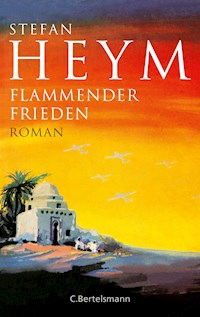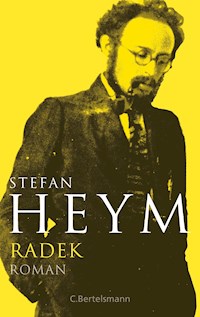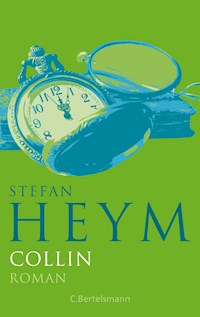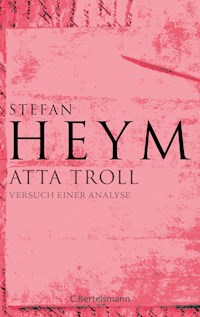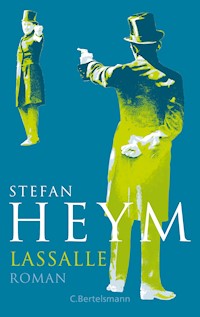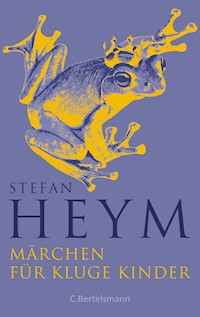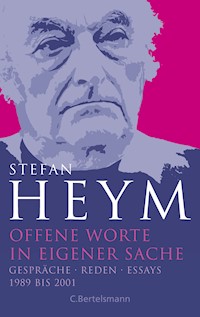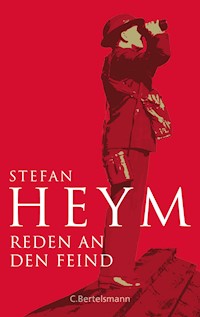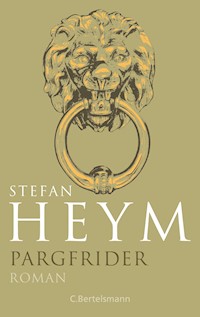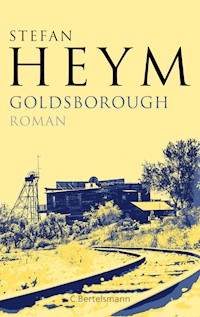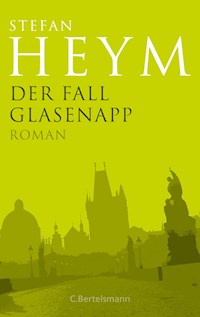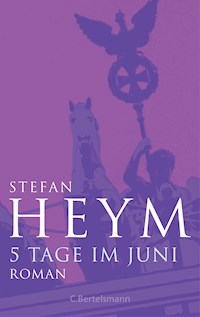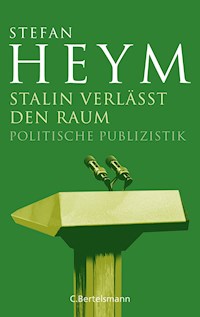
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Stefan-Heym-Werkausgabe, Autobiografisches, Gespräche, Reden, Essays, Publizistik
- Sprache: Deutsch
Der seit 1957 erste Publizistik-Band von Stefan Heym für die DDR-Leserschaft aus dem Jahr 1990.
Neben den Romanen und Erzählungen des Schriftstellers Stefan Heym steht das umfangreiche publizistische Werk. Die Themen der Texte, Gespräche, Interviews spiegeln sein Leben: Emigration, Zeitung in New York, Reden an den Feind im zweiten Weltkrieg, die Auseinandersetzung mit der Diktatur in der DDR, Nachdenken über Demokratie und Sozialismus. Eine seiner klassischen Polemiken über den sowjetisch geprägten Dogmatismus gab diesem Auswahlband den Titel: »Stalin verlässt den Raum.« Heym hatte sich auf einem internationalen Kolloquium im Dezember 1964 Rederecht erkämpft und das überraschte Publikum mit seinen kritischen Thesen konfrontiert. Offene Worte, Zivilcourage – das war eine prägende Charaktereigenschaft des Autors.
Seit 1957 erstmalig wieder für die DDR zusammengestellte Publizistik. In hoher Auflage gedruckt sollte diese, zusammen mit Tausenden anderer Bücher aus DDR- Verlagen, auf einer Mülldeponie bei Leipzig vernichtet werden. Der Pfarrer Weskott aus Katlenburg rettete eine große Anzahl von Büchern und eröffnete eine Bücherscheune in der alten Ritterburg aus dem 12. Jahrhundert.
Stefan Heyms Publizistik ist Ermunterung zum aufrechten Gang, Aufforderung zur Zivilcourage und oft verblüffendes Vorausdenken. Sie hat ihre visionäre Strahlkraft bis heute erhalten. Bei Reclam Leipzig erstmals 1990 erschienen, endlich wieder lieferbar in der digitalen Werkausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch:
Neben den Romanen und Erzählungen des Schriftstellers Stefan Heym steht das umfangreiche publizistische Werk. Die Themen der Texte, Gespräche, Interviews spiegeln sein Leben: Emigration, Zeitung in New York, Reden an den Feind im zweiten Weltkrieg, die Auseinandersetzung mit der Diktatur in der DDR, Nachdenken über Demokratie und Sozialismus. Eine seiner klassischen Polemiken über den sowjetisch geprägten Dogmatismus gab diesem Auswahlband den Titel: »Stalin verlässt den Raum.« Heym hatte sich auf einem internationalen Kolloquium im Dezember 1964 Rederecht erkämpft und das überraschte Publikum mit seinen kritischen Thesen konfrontiert. Offene Worte, Zivilcourage – das war eine prägende Charaktereigenschaft des Autors.
Seit 1957 erstmalig wieder für die DDR zusammengestellte Publizistik. In hoher Auflage gedruckt sollte diese, zusammen mit Tausenden anderer Bücher aus DDR- Verlagen, auf einer Mülldeponie bei Leipzig vernichtet werden. Der Pfarrer Weskott aus Katlenburg rettete eine große Anzahl von Büchern und eröffnete eine Bücherscheune in der alten Ritterburg aus dem 12. Jahrhundert.
Stefan Heyms Publizistik ist Ermunterung zum aufrechten Gang, Aufforderung zur Zivilcourage und oft verblüffendes Vorausdenken. Sie hat ihre visionäre Strahlkraft bis heute erhalten. Bei Reclam Leipzig erstmals 1990 erschienen, ist dieser Band nun Teil der digitalen Werkausgabe.
»Heym ist einer der großen Autoren des 20. Jahrhunderts, der zwischen den Welten wanderte, der immer zwischen den Stühlen saß und der diesen unbequemen Platz als den ihm gemäßen letztlich schätzen gelernt hat.« Westfälische Rundschau
»Heyms Lebensleistung: Er ist ein Zeuge des Jahrhunderts, der sich nie auf die Zuschauerrolle beschränkt hat.« Hamburger Abendblatt
Zum Autor:
Stefan Heym, 1913 in Chemnitz geboren, emigrierte, als Hitler an die Macht kam. In seiner Exilheimat New York schrieb er seine ersten Romane. In der McCarthy-Ära kehrte er nach Europa zurück und fand 1952 Zuflucht, aber auch neue Schwierigkeiten in der DDR. Als Romancier und streitbarer Publizist wurde er vielfach ausgezeichnet und international bekannt. Er gilt als Symbolfigur des aufrechten Gangs und ist einer der maßgeblichen Autoren der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Er starb 2001 in Israel.
Besuchen Sie uns auf www.cbertelsmann.de und Facebook.
Stefan Heym
STALIN VERLÄSST DEN RAUM
Politische Publizistik
1990
Herausgegeben von Heinfried Henniger
Die Originalausgabe erschien 1990 bei Reclam Verlag, Leipzig.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 1990 by Inge Heym
Copyright © der Originalausgabe 1990 by Reclam Verlag, Leipzig
Copyright © dieser Ausgabe 2021 by C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlagkonzeption und -gestaltung: Sabine Kwauka, München
Umschlagmotiv: © Devek Brumby / Shutterstock.com
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN978-3-641-27846-5V001
www.cbertelsmann.de
Wenn mich einer fragte …
3. Juni 1966
Wenn mich einer fragte: In welcher Zeit hättest du gerne gelebt? – würde ich ihm antworten: In unserer. Denn noch nie, glaube ich, gab es eine Zeit mit so raschen, so tief einschneidenden Veränderungen, mit so enormen Widersprüchen, so fürchterlichen Verstrickungen und Verteufelungen des Menschen; nie aber auch eine Zeit, in der der Mensch so sehr über sich hinauswächst und mit solcher Kühnheit eine neue, kaum erahnte Welt schafft: eine Zeit also, wie ein Schriftsteller für seine Zwecke sie sich nicht schöner wünschen könnte, selbst auf die Gefahr hin, daß er in ihre Strudel gerät.
In meinen Romanen und Erzählungen habe ich versucht, einige Aspekte dieser Zeit und ihrer Menschen zu erfassen. Selbst da, wo ich in die Geschichte griff, tat ich es, um dort die Wurzeln unserer Zeit und unserer Konflikte zu finden und vielleicht auch Antworten auf Fragen von heute. Durch die Darstellung von Gefühlen und Schicksalen habe ich mich bemüht, den Menschen etwas zu geben, ihnen vielleicht auch ein wenig vorwärtszuhelfen und so zur Veränderung unserer Welt beizutragen. Dabei war mir natürlich klar, daß der Einfluß des Wortes beschränkt ist, daß er sich oft auch nur indirekt auswirkt, und daß der einzelne überhaupt nur wirken kann in Wechselbeziehung zur Gruppe, zum Kollektiv, zum Ganzen. Der Rufer in der Wüste wirkt immer leicht komisch; er muß sich schon dorthin bemühen, wo die anderen sind; aber manchmal ist es auch notwendig zu rufen, wenn es scheint, als ob nichts als Wüste um einen herum ist.
Wie weit es mir gelungen ist, mitzuwirken, mitzuhelfen an der Neugestaltung unserer Zeit, läßt sich schwer sagen. Man könnte da Ziffern anführen, in einzelnen Fällen sogar hohe – Titel, Auflagen, Anzahl von Übersetzungen. Aber das besagt noch nicht viel. Eher wäre hier zu erwähnen, daß es kaum ein Buch von mir gibt, das nicht vor oder nach seinem Erscheinen zu Kontroversen Anlaß gegeben hat. Wenn ich all die Epitheta aneinanderreihte, die mir dabei verliehen worden sind – die Skala reicht von Stalin-Agent bis Konterrevolutionär, von ein neuer Thomas Mann bis schwarz-rot-goldener Ganghofer –, so ergäbe sich ein ganz hübscher Waschzettel.
Habent sua fata libelli – die Schicksale meiner Bücher sind auch das meine, im Westen, im Osten, in unserer Zeit.
Redaktion Jungbuchhandel,
Düsseldorf
Ich aber ging über die Grenze …
1935
Ich aber ging über die Grenze.
Über die Berge, da noch der Schnee lag,
auf den die Sonne brannte durch die dünne Luft.
Und der Schnee drang ein in meine Schuhe.
Nichts nahm ich mit mir
als meinen Haß.
Den pflege ich nun.
Täglich begieße ich ihn
mit kleinen Zeitungsnotizen
von kleinen Morden,
nebensächlichen Mißhandlungen
und harmlosen Quälereien.
So bin ich nun einmal.
Und ich vergesse nicht.
Und ich komme wieder
über die Berge, ob Schnee liegt,
oder das Grün des Frühlings die Höhen bedeckt,
oder das Gelb des Sommers, oder das dunkle Grau
des Herbstes, der den Winter erwartet.
Dann steh ich im Lande, das sich befreien will,
mit einer Stirn, die zu Eis geworden
in den Jahren, da ich wartete.
Dann sind meine Augen hart, meine Stirn zerfurcht,
aber mein Wort ist noch da, die Kraft meiner Sprache
und meine Hand, die des Revolvers
eiserne Mündung zu führen versteht.
Über die Straßen geh ich der Heimatstadt,
über die Felder, die mir verloren gingen,
auf und ab, auf und ab.
Deutsches Volksecho stellt sich vor
20. Februar 1937
Zweierlei Aufgaben hat eine Zeitung zu erfüllen: Nachrichten zu bringen und Meinungen zu bilden. Aber man sehe sich an, was heute aus der Rotationsmaschine kommt! Der Zweck der Presse hat sich in sein Gegenteil verkehrt: Nachrichten werden gefälscht, Meinungen unterdrückt. Und das nicht nur in faschistischen Staaten, wo die Praxis des organisierten Volksbetrugs eine Selbstverständlichkeit ist, sondern auch in den Ländern, wo das Volk durch seinen Widerstand ein Restchen Freiheit für sich gerettet hat.
Die deutsche Presse in Amerika – reden wir nicht von den Naziblättern, die dafür bezahlt werden, daß sie das hysterische Gelalle des Propaganda-Goebbels nachbeten. Aber auch die nicht-nationalsozialistischen deutschamerikanischen Tages- und Wochenblätter, verstreut über das Land, sind eingeschüchtert und erpreßt durch den wirtschaftlichen und politischen Druck der Nazis. Sie wagen nicht mehr so zu schreiben, wie es ihre vornehmste Aufgabe wäre, sie wagen nicht, die Stimmführer des deutschen Volkes zu sein, da dem deutschen Volke innerhalb des Machtbereiches des Führers und seiner Unterführer die freie Sprache geraubt wurde. Und die wenigen deutschamerikanischen antifaschistischen Zeitungen sind nicht imstande, im Kampf für die Wahrheit die großen Massen der deutschamerikanischen Bevölkerung zu erreichen, da sie durch ihre Tradition als Parteizeitungen eingeengt sind.
Darum ist die Zeitung, die mit diesem Aufruf zum erstenmal vor die Öffentlichkeit tritt, notwendig. Darum wurde sie gegründet.
Jean Jaurès, der, weil er für Frieden und Freiheit kämpfte, an jenem verhängnisvollen Vorabend des Weltkrieges ermordet wurde, sagte einmal: »Dem Volk kann man immer die Wahrheit sagen, es hat kein Bedürfnis nach Lügen.« – Diese Zeitung, die den Namen Volksecho tragen wird, weil sie als Echo des Volkes sprechen soll, wird die Wahrheit sagen. Die Wahrheit über Deutschland, unsere in Ketten gelegte Heimat, die Wahrheit über Amerika, unser neues Land, die Wahrheit über die Welt, deren Bürger wir alle sind.
Die Wahrheit zu sagen, aber bedeutet Kampf. Nicht nur, weil die am Volksbetrug Interessierten die Wahrheit als ihren schrecklichsten Feind bekämpfen – sondern weil die Erkenntnis der Wahrheit an sich in jedem anständigen, fühlenden, denkenden Menschen den Willen zum Kampf, zu Verbesserungen und Veränderung wachruft.
Hier steht das Volksecho nicht allein. Der große Verbündete jeder Zeitung für das Volk ist das Volk selber, das sich heute in einer großen Front zusammenfindet im Kampf um seine Rechte, seine Freiheiten.
Jeder Tag bringt neue Angriffe auf diese Rechte und Freiheiten. Da werden die Menschen in den Zuchthäusern gefoltert, auf den Straßen friedlicher Städte bombardiert; da werden sie von den Arbeitsplätzen gerissen und zu langsamem Hungertod verurteilt; da werden die Kulturgüter des Volkes verbrannt und zerschossen; da werden die Greise zu Bettlern und die Kinder zu Lohnsklaven gemacht; die Bauern von den Feldern gejagt; die Soldaten verkauft und verraten; da zerfallen die Krankenhäuser, damit Panzerkreuzer entstehen; da werden ein paar Gewissenlose steinreich und die Armen immer ärmer – das ist die Wahrheit. Und das Volk beginnt, die Wahrheit zu sehen, in einer Volksfront beginnt es sich zusammenzuschließen!
Diese Zeitung stellt sich in den Dienst der Volksfront. Das bedeutet: Sie nimmt Partei auf der Seite des Volkes. Sie will das Echo und der Ruf des Volkes sein. Sie will alle aufrufen, alle um sich scharen: Arbeiter, Bauern, Handwerker, Mittelständler, Intellektuelle – Deutsche in aller Welt, Deutsche in Amerika.
Denn die Geschichte der letzten Jahre hat dem deutschen Volke eine Mission zugewiesen. Diese Mission ist nicht die der Hitler und Göring, die unser Volk dadurch entehren, daß sie es zum Brandstifter eines neuen Weltbrandes machen wollen.
Die Aufgabe der Deutschen ist es, ihre Freiheit wiederzugewinnen, um gleichberechtigt in der Welt an der Seite der fortschrittlichen Demokratien für soziale Befreiung und für den Frieden zu kämpfen.
Kam nicht ein Steuben nach Amerika, um hier die Demokratie erkämpfen zu helfen? Trat nicht hier Karl Schurz selbstlos für die Freiheit einer versklavten Rasse ein?
In dieser Zeit, wo die Schicksale von kommenden Generationen geformt werden – in Fabriken und Schützengräben, in Warenhäusern und Wohlfahrtsämtern, auf den Straßen der Städte und den Feldern der Farmer –, in dieser Zeit müssen wir Deutsche unserer Tradition und Aufgabe uns voll bewußt werden:
Einig, einig für Freiheit und Fortschritt, für Frieden, und das Recht auf unser Leben zu kämpfen – eine große Volksfront, in Deutschland, in Amerika – überall!
Aus finsteren Jahren
Sinn und Form, Sonderheft Thomas Mann
1965
Noch heute träume ich mitunter, daß ich die neue Nummer des Deutschen Volksecho umbrechen muß und nichts – aber auch nichts! – von dem, was geschrieben werden müßte, ist geschrieben, nicht die Vereinsnachricht und nicht die Glosse, nicht der Leitartikel und nicht der politische Bericht, und nicht eine Zeile der englischen Seite. Der Setzer wartet, der Metteur. Die Presse – wir druckten in einer winzigen armenischen Druckerei, deren Meister kein Wort Deutsch und kaum Englisch verstand – war nur auf Stunden zu haben; war die kostbare Zeit verstrichen, konnte überhaupt nicht gedruckt werden. Ein Aufschrei … Und statt in New York, um zwei Uhr morgens, neben der klappernden Setzmaschine, wache ich in meinem Berliner Bett auf, achtundzwanzig Jahre nach meinen Ängsten.
Nur wer selbst Redakteur war, wird solche Alpträume verstehen. Und selbst in diesem Falle – die Arbeit an einer antifaschistischen deutschsprachigen Wochenzeitung in New York in den Jahren 1937 bis 1939, ohne ständigen Redaktionsstab, ohne Pressedienst, Archiv, Bilderdienst, Honorarfonds, wird normalen Journalisten an normalen Blättern zu normalen Zeiten unvorstellbar bleiben. Unvorstellbar wird ihnen bleiben der Dr. Geismayr, der ohne einen Cent zu erhalten als Redaktionsvolontär mitarbeitete und den ich mit Gewalt nach Hause expedieren mußte, nachdem ich in einer Umbruchnacht eine Blutlache auf seinem Korrekturschemel fand. Unvorstellbar die Redaktionssekretärin Hilde Schott, von der ich heute noch nicht weiß, wie sie damals ihre beiden Kinder ernährte; unvorstellbar die Arbeitslosen, die jeden Mittwoch kamen, die Zeitungen adressierten und verpackten, bis die Postsäcke fertig waren – für ein Dankeschön und einen Kaffee in einer Papptasse. Da konnte man nur Chefredakteur sein, wenn man vierundzwanzig war, elastisch, ans Hungern gewöhnt, und keine Ahnung hatte von journalistischen und politischen Gefahren. Chefredakteur – welch schöner Titel für zwölf Dollar die Woche (sofern die vorhanden waren), und wenn man soeben den Anzeigentext einer Möbeltransportfirma in Yorkville (Anzeige einspaltig, ein Zoll hoch) geschrieben hatte und sich nun eine Analyse der englischen Außenpolitik unter Chamberlain vornahm oder etwa loszog, um Thomas Mann zu interviewen.
Zu den Gründern des Deutschen Volksecho gehörten der Nationalökonom Professor Alfons Goldschmidt, der Anwalt und ehemalige preußische Justizminister Dr. Kurt Rosenfeld, der Arzt Dr. Joseph Ausländer. Emigranten oder »alteingesessene« Deutschamerikaner, waren sie alle an einer Zusammenfassung der deutschsprachigen antifaschistischen Kräfte in den USA und an einem energisch geführten Kampf gegen die örtlichen Hitleristen interessiert, gegen den »Amerikadeutschen Bund« in New York, New Jersey, Chicago, Los Angeles, San Franzisko, Texas. Die zahlenmäßig geringe organisatorische Basis des Volksecho fand sich in linken Gruppierungen der Arbeiter-Gesangsvereine und der Arbeiter-Kranken- und -Sterbekasse (es gab damals keine staatliche Sozial- oder Krankenversicherung in den Vereinigten Staaten; die Krankenkasse, wie man sie kurz nannte, war eine freiwillige Versicherungsorganisation). Ich sehe diese deutschamerikanischen Arbeiter noch vor mir – Männer wie den Stukkateur Eric Sanger aus Brooklyn, die Metallarbeiter Gustav Merkel und Max Schiffbauer aus New Jersey, den Krankenkassenfunktionär Blohm –, wenn sie in die Redaktion kamen und ein paar Dollar ablieferten, die sie auf Veranstaltungen der Arbeiterorganisation gesammelt hatten. Es lag etwas Rührendes und doch auch Großartiges in ihrer Vereinsmeierei; hier hatte sich noch etwas vom Geist der Achtundvierziger Emigration und des Kampfes gegen das Sozialistengesetz gehalten, gerade weil man vom Hauptstrom der deutschen Entwicklung abgekapselt als Gruppen und Grüppchen in amerikanischer Umgebung lebte; es läuft eine nicht unwichtige Nebenlinie von Marx und Engels über Weydemeyer und Schurz zu den Opfern des Haymarket, zum internationalen 1. Mai, zur modernen amerikanischen Gewerkschaftsbewegung.
Wir übernahmen die Abonnentenliste der kleinen kommunistischen Wochenzeitung Der Arbeiter und hofften auf einen Zusammenschluß mit der sozialdemokratischen New Yorker Volkszeitung, die gleichfalls wöchentlich erschien. Die deutschen Sozialdemokraten in den USA, gestützt von noch weiter rechts stehenden Gewerkschaftsgruppen besonders der Bekleidungsindustrie, waren jedoch finanziell mehr als gesund und sahen auch politisch keinen Grund für eine Vereinigung mit Leuten, die so idealistisch waren, daß sie gegen alle Ströme gleichzeitig schwammen. Wenn wir uns auf Kritik an den Nazis beschränkt hätten – gut und schön. Aber wir bestanden darauf, auch die Dinge in den USA von links zu sezieren und die sowjetische Politik, wo immer wir konnten, zu verteidigen. So ergab sich eine Einheitsfront auf einem Bein – auf die Dauer keine bequeme Position.
Um so höher ist es Thomas Mann anzurechnen, daß er von Anbeginn der Existenz des Volksecho uns seine moralische und tätige Unterstützung gab. Das kann nicht der Effekt der wenigen Briefe gewesen sein, die wir ihm schrieben; wer die Artikel liest, die er im Volksecho veröffentlichte, die Reden, die er in jener Zeit hielt und die wir abdrucken durften, der wird erkennen, daß der Autor der Betrachtungen eines Unpolitischen aus politischer Maxime handelte; wie denn der Thomas Mann jener Jahre überhaupt ein verblüffend politischer Mensch war mit Einsichten, von denen wir heute noch lernen können.
Ich bin dankbar, daß mir drei fast vollständige Jahrgänge des Volksecho durch meine Abenteuer und Wanderungen hindurch erhalten blieben. Meines Wissens existiert nur noch ein anderes Exemplar: in der New Yorker Public Library. Aus den vergilbten Blättern spricht eine ganze Zeit – eine Zeit der Kämpfe und der Niederlagen, aber auch der Zähigkeit und der Hoffnung, die sich schließlich erfüllen sollte. Und wenn es nur wegen der sonst verschollenen Worte Thomas Manns wäre, die so erhalten blieben – es hätte sich gelohnt.
1939, zwei Wochen nach Abschluß des Nazi-Sowjet-Paktes, stellte das Volksecho sein Erscheinen ein. So verständlich der Pakt im Rückblick auch erscheint, so sehr die Ursache seines Zustandekommens auch in Paris und London gelegen haben mag – es wirkte lähmend auf die gesamte antifaschistische Bewegung im Westen.
Dieser Lähmung erlag das Deutsche Volksecho in New York. Die an ihm mitarbeiteten, kämpften jedoch weiter gegen den Faschismus, zum Teil mit der Waffe in der Hand. Die Vernichtung Hitlers, der Sieg der Demokratie und des Sozialismus auf einem beträchtlichen Teil des Globus ist auch der Sieg dieser Handvoll von Menschen, die in einer dunklen Zeit ein kleines Licht leuchten ließen.
In meinem Elternhaus war der Künstler eine Respektsperson, der Dichter gar, dessen Wort gedruckt, dessen Name auf einem Buchrücken eingeprägt war, eine Art Hohepriester. Thomas Mann galt unter den Hohepriestern als der höchste; in der Rangordnung, die sich im Kopf des Knaben gebildet hatte, saß er an der Spitze der Tafel; weit unter ihm Wassermann und Werfel, Stefan Zweig und Schnitzler, von solch weltlichen Typen wie Vicki Baum und Remarque gar nicht zu reden. Thomas Mann war Distanz, unerreichbar; Olympier zu Lebzeiten; schon die Art seines Schreibens, seine Sätze, die man verfolgen mußte wie Ariadne-Fäden, schlossen jede ordinäre Annäherung aus, obwohl da auch Freundliches sprühte, ein Augenzwinkern, Ironie, aber doch die Ironie eines ganz Großen.
Das Bild des Unnahbaren ist mir geblieben, auch heute, nachdem mein Beruf es mit sich brachte, daß ich eine Anzahl der anderen Hohepriester in Hemdsärmeln, und manchmal noch stärker déshabillé, kennenlernte. Auch heute, lebte er noch, würde ich Thomas Mann gegenüber die Scheu empfinden, die ich bei den kurzen Begegnungen in New York fühlte. Dabei war er eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, gar nicht stuffy, gar nicht der Aristokrat, zu welcher Rolle ihn Abkunft und Leistung berechtigten. Er war vielmehr sachlich und durchaus nahbar und, oh, Überraschung, fast leidenschaftlich, wenn er von Dingen sprach, die ihm ans Herz rührten.
Er war ein überzeugender Sprecher. Grundlos war die Befürchtung, daß er zu dem Arbeiterpublikum, das wir ihm bieten konnten, die Brücke nicht würde schlagen können. Dabei machte er keine Konzessionen, vereinfachte er weder Satzkonstruktionen noch Gedanken, und nichts war ihm ferner als Theatralik. Der dunkle, markante Kopf hielt den ganzen Saal in schweigendem Bann. Und die Wärme des Beifalls zeigte, daß man in ihm mehr sah als den großen Schriftsteller, den Schicksal und wohl auch Einsicht in eine verrauchte Arbeiterhalle geführt hatten – man sah den Mitkämpfer.
Die Jahre, in denen Thomas Mann seine Reden und Aufsätze dem Volksecho zum Abdruck überließ, gehören zu den finstersten der europäischen Geschichte. Es sind die Jahre, da Hitler »von einem Siege über das Nichts, über die vollendete Widerstandslosigkeit, zum anderen getragen wird«, da in Spanien sich ein Krieg abspielt, der »gar zu empörend, verbrecherisch und widerwärtig« ist, da Österreich und die Tschechoslowakei dem Aggressor zum Fraß vorgeworfen werden, so daß »das freie deutsche Wort heute in Europa nur noch in der Schweiz laut werden kann, und wer weiß, wie lange auch nur dort noch« und »es nachgerade fast allein in der Hand des Deutschamerikanertums liegt, der erschreckenden Gefahr eines wirklichen Abhandenkommens deutschen Geisteslebens zu steuern«.
In diesen Jahren und in diesen Aufrufen und Betrachtungen legt Thomas Mann die Verpflichtung des Schriftstellers zur Aktion in geradezu exemplarischer Weise dar. Im New Yorker Mecca Temple spricht er von der »Selbstüberwindung, die für seinesgleichen dazu gehört, »aus der Stille seiner Arbeitsstätte herauszutreten vor die Menschen, um persönlich und mit eigener Stimme für die bedrohten Werte zu zeugen«. Und er zitiert Hamlet: »Die Welt ist aus den Fugen, Schmach und Scham! Daß ich zur Welt sie einzurenken kam«, hinzufügend: »Ein Widerstreit besteht ohne Zweifel zwischen der angeborenen Weltscheu und Skepsis des Dichters und Träumers und der kämpfenden Aufgabe, welche die Zeit ihm aufdrängt, zu der sie ihn beruft. Aber diese Berufung, diese Forderung ist heutzutage unüberhörbar für mich und meinesgleichen.« Nach seiner neuerlichen Ankunft in den USA, wo er von da an lange Zeit bleiben wird, geht er wieder auf diese Gedanken ein und wird genauer: »Ich habe natürlich nicht die Absicht, den demokratischen Ländern politische Lektionen zu erteilen, und am wenigsten den Vereinigten Staaten. Ich gebe nur meiner Überzeugung Ausdruck, das ist alles, was ich tun kann, aber ich fühle, es ist meine Pflicht, alles in meiner Kraft zu tun, um zur Klärung der Weltsituation von heute beizutragen.« In der Rede zum Deutschen Tag in New York, im Dezember 1938, greift er die Frage noch einmal vom Grundsätzlichen her auf: »Es wäre durchaus falsch und bedeutete eine schöngeistig schwächliche Haltung, Macht und Geist, Kultur und Politik in einen notwendigen Gegensatz zu bringen und von der Höhe des Spirituellen und Künstlerischen hochmütig auf die politische und soziale Sphäre hinabzublicken … Es war ein Irrtum deutscher Bürgerlichkeit, zu glauben, man müsse ein unpolitischer Kulturmensch sein. Wohin die Kultur gerät, wenn es ihr am politischen Instinkt mangelt, das können wir heute sehen.«
Rückschauend, meine ich, sollten wir ihm danken für diese Worte, die auch in unseren Tagen noch gelten. Und wir sollten ihm danken, daß er sich nicht einmischte in die unseligen Kleinkämpfe der Emigranten, die die Tragödie der Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung auf winziger Bühne als Possenspiel wiederholten. Thomas Mann sprach, wo er konnte, für die Einheit aller Gegner des Faschismus, aller Freunde der Demokratie und des Friedens. Freiheit, sagte er, sei das Ziel, auf das sich alle einigen müßten. »… eine Freiheit aber, die aus schweren Erlebnissen gelernt hat und die nicht noch einmal dulden wird, daß ihre Feinde sie überrumpeln … die sich nicht durch den Geist zum schwächlichen Zweifel an ihrem Erdenrechte verführen läßt und sich zu wehren weiß …«
Ich freue mich, daß die im New-Yorker Deutschen Volksecho veröffentlichten Reden und Betrachtungen Thomas Manns nun einer neuen Generation vorgelegt werden. Sie wird zu urteilen haben, ob und wie weit es gelungen ist, die Forderungen des Dichters zu erfüllen; sie wird ihr Teil dazu beitragen müssen, das noch Unerfüllte zu verwirklichen.
Rede in Camp Ritchie
23. Oktober 1943
Meine Damen und Herren,
es ist mir eine Ehre und eine Freude, heute abend zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich werde nicht allzu viel über den Film Hostages reden, weil das Buch nämlich, nachdem die Filmrechte einmal nach Hollywood verkauft worden waren, kaum noch in meiner Hand war. Unter normalen Umständen wäre ich wahrscheinlich nach Kalifornien gefahren, um wenigstens bei der Abfassung des Filmskripts mitzuwirken; aber wir befinden uns mitten im Kriege, das wissen Sie ja, und auch ich empfing die bekannten Grüße des Präsidenten der USA und mußte die Schreibmaschine mit dem Gewehr vertauschen. Also machen Sie bitte nicht mich verantwortlich, wenn dies oder jenes in dem Film, der nun vorgeführt werden wird, Ihnen mißfallen sollte. Dort draußen in Hollywood haben die Filmemacher ihre eigenen Auffassungen darüber, was das Publikum begeistert – und sie haben einiges von dem, was ich gern auf der Leinwand gesehen hätte, ausgelassen und manches hinzugefügt, von dem sie annehmen, daß es publikumswirksam sei.
Lieber will ich Ihnen ein bißchen davon erzählen, was mich veranlaßt hat, den Roman Hostages zu schreiben.
Viele von Ihnen hier in Ritchie sind aus Europa gekommen. Sie wissen daher, daß der Krieg nicht an dem Tag begann, an dem die Japaner Pearl Harbor überfielen, und auch nicht an dem Tag, als Hitler in Polen einmarschierte. Der berühmte preußische Stratege Clausewitz hat einmal erklärt, der Krieg sei die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. In Wirklichkeit begann dieser Krieg, als die deutschen Monopolherren entschieden, daß sie höhere Gewinne machen könnten, wenn sie nicht nur die Deutschen, sondern auch andere Völker ausbeuteten, und als sie demzufolge die Organisierung einer illegalen Armee zu finanzieren begannen, bei der Hitlers Sturmtruppen anfänglich nur eine untergeordnete Rolle spielten.
Den Rest der Geschichte kennen Sie. Sie führt von dem Münchener Bierhallenputsch über das Münchener Abkommen der Herren Chamberlain, Daladier, Mussolini und Hitler zu den Konzentrationslagern und Galgen und Ruinen, mit denen Europa und Asien heute übersät sind. Aber sie führt auch zu einer Wiedererweckung des Freiheitswillens unter den Völkern, zu einem neuen demokratischen Bewußtsein, das gesäubert ist von dem Bodensatz der alten politischen Bräuche – und zu einer neuen, zu großen Hoffnungen Anlaß gebenden Einheit aller anständigen, gerechtdenkenden Menschen auf Erden. Die Zusammenkunft der Außenminister, die in diesen Tagen in Moskau stattfindet, ist ebenso symbolisch für diese neue, hoffnungsvolle Entwicklung wie die Zusammensetzung der Truppen in diesem einzigartigen Camp, Ritchie, wo Männer aus allen Gegenden des Globus – Franzosen, Deutsche, Tschechen, Polen, Russen, Griechen, Italiener, Spanier und was Sie wollen, aber alle von jetzt an Amerikaner – zu einem einzigen Zweck zusammen ausgebildet werden: zur Niederschlagung des Faschismus.
Was mich betrifft, so habe ich in diesem Kampf gestanden, solange ich politisch denken kann. Ich bin dafür verprügelt worden, mein Vater wurde von den Nazis als Geisel verhaftet, ich habe dafür gehungert und geschrieben und gesprochen – und ich nehme an, daß ich dafür auch bald mit dem Gewehr in der Hand im Einsatz stehen werde.
Mein Roman Hostages ist aus diesem Kampf hervorgegangen. Ich sehe auch nicht, wie ein Schriftsteller, der es ehrlich meint, heute etwas anderes tun kann, als über diesen Kampf zu schreiben, der ja alle Menschen in Amerika und in der ganzen Welt angeht. Hostages wurde mit zweierlei Absicht geschrieben: Einsicht zu geben in das Denken der Nazis und in die große Furcht, die diesem Denken zugrunde liegt; und den Kampf der Menschen gegen die Nazis darzustellen.
Der scheinbare Wahnsinn der Nazis, ihre Grausamkeiten, ihr Wüten und ihre Prahlerei, ihre Verlogenheit sind ganz klar Manifestationen dieser Furcht. Der Nazismus ist nicht, wie Hitler so gerne behauptet, eine »Neue Ordnung«. Im Gegenteil, er repräsentiert und verteidigt die älteste und verrottetste aller sozialen Ordnungen: die Herrschaft der Wenigen über die Vielen. Diese Ordnung ist am Zusammenbrechen, aber in ihrem Todeskampf möchte sie noch die ganze Welt in ihren Untergang hineinziehen. Vor kurzem erst hat Goebbels verkündet, die Nazis würden, wenn sie denn schon untergehen müßten, in einem Blutbad untergehen, wie es die Welt noch nicht gesehen hätte. Die Tortur, mit der die Nazis die Menschen quälen, die Verbrechen, die sie verüben, die willkürliche Zerstörung, die sie anrichten, sind nichts anderes als die vorweggenommene Rache für die eigene Niederlage, die sie kommen sehen. Und wir werden ihnen diese Niederlage beibringen, wir, die Vereinten Nationen. Unsere Verbündeten sind die Völker. Die meisten von Ihnen hier in Ritchie werden Berichte über die Untergrundbewegung in Europa gelesen haben; aber einige von Ihnen werden gedacht haben: all right, das sind Propaganda-Artikel und Augenauswischerei und Wunschträume. Lassen Sie mich Ihnen versichern, daß dem nicht so ist.
Wir können in diesem Kampf drei Stadien erkennen. Das erste: der eigentliche Kampf im Untergrund – Agitation, Organisierung, Sabotage, Hilfe für Soldaten der Verbündeten, die in das von den Nazis besetzte Gebiet verschlagen wurden, politische Attentate, und so weiter. Das gibt es in Frankreich, Holland, der Tschechoslowakei und sogar innerhalb Deutschlands. Das zweite Stadium: Guerilla-Kämpfe. Kleine Trupps von mutigen Männern und Frauen, ausgestattet mit allen möglichen Waffen, die die Einheiten des faschistischen Unterdrückers angreifen, schädigen, seine Verbindungslinien unterbrechen, seine Vorräte vernichten, seine Etappe durcheinanderbringen. Dieses Stadium wurde in Teilen Polens, im besetzten Rußland, in Norditalien, Norwegen, Bulgarien erreicht. Und als drittes: Die Guerilla-Trupps vereinen sich zu richtiggehenden kämpfenden Armeen, so ausgebildet und organisiert und bewaffnet, daß sie größere Gefechte aufnehmen und sich uns anschließen können, sobald wir an ihren Ufern landen. Dieses Stadium finden wir bereits vor in Jugoslawien, Griechenland und China.
Auf alle Fälle aber sind die Menschen im Untergrund unsere besten und zuverlässigsten Verbündeten. Aus ihren Reihen werden die Kräfte kommen für eine neue, verjüngte Demokratie in Europa und Asien – Volksregierungen, die bereit sind, unsere Freunde zu sein und sich mit uns zusammenzutun, um wiederaufzubauen, was zerstört wurde, und zu wirtschaftlichen und kulturellen Erfolgen zu gelangen, die in der Vergangenheit unvorstellbar waren. Zusammen mit ihnen und mit den Bürgern des Vereinigten Königreichs und der Union der Sowjetrepubliken müssen und werden wir einen dauernden Frieden schaffen.
Uns, den Soldaten und Bürgern Amerikas, obliegt es, die Fehler von 1918 zu vermeiden. Von dieser Pflicht kann uns keiner entbinden. Und wir können das den Politikern allein nicht überlassen. Die Demokratie erhält ihre Kraft von einem wachen, bewußten, kämpferischen Volk. Wir Soldaten haben gelernt, für den militärischen Sieg zu kämpfen. Ich bin überzeugt, daß wir auch den Aufgaben gewachsen sein werden, die der kommende Friede uns bringt.
Und noch ein Wort – ein persönliches. Ich habe die besten, freundschaftlichsten Beziehungen zu den Männern meiner Kompanie, der Kompanie H, und zu ihren Offizieren, und hatte sie auch zuvor, als ich in den Kompanien E und F diente. Ich war einfach der Soldat Heym und erfüllte meine Pflicht, so gut es ging, und drückte mich von unangenehmen Arbeiten, so wie wir alle es zu tun suchen. Ich habe sogar meinen Küchendienst gemacht. Ich möchte auch weiter nur der Soldat Heym sein, ein Soldat unter vielen anderen. Ich bitte Sie also, nach dem heutigen Abend zu vergessen, daß ich je auf diesem Podium stand – denn in einer Armee gibt es nichts Unangenehmeres, als eine Sonderperson zu sein und eine Sonderrolle zu spielen. Solche Sonderpersonen enden meistens als besonders traurige Fälle.
Und jetzt – zeigen Sie den Film!
Was ist ein Leben wert?
8. Juli 1944
Für deine Mutter, die dich unter Schmerzen in die Welt setzte, die sich vielleicht das Brot vom Munde absparte, um dich großzuziehen …
ALLES
Für deine Frau, die mit ihrem ganzen Herzen an dir hängt, die auf dich wartet, die bangt und hofft, daß du zurückkommst …
ALLES
Für dein Kind, das dich als Erzieher und Ernährer braucht, das zu dir als seinem Führer auf dem Weg in die Welt aufschaut …
ALLES
Für deine Führung, die weiß, daß dieser Krieg verloren ist, und dich trotzdem gegen eine überlegene Macht immer wieder rücksichtslos einsetzt …
NICHTS
Wer schätzt den Wert deines Lebens richtig ein?
Wenn du deiner Frau, deiner Mutter, deinem Kinde glaubst, gibt es nur einen Ausweg:
SCHLUSSMACHEN!
Flugblatt
Mein Name ist Joe Jones
September 1944
Ich bin ein amerikanischer Soldat. Ich komme aus Steubenville im Staate Ohio.
Meine Kameraden und ich haben eine weite Reise gemacht, um hierherzukommen. Unser Volk hat uns das beste und das wirkungsvollste Kriegsmaterial aller Armeen der Welt zur Verfügung gestellt.
Wir glauben nicht an Wunder. Wir glauben an Flugzeuge, Kanonen, Granaten, Panzer und Maschinen.
In wenigen Monaten haben wir die deutschen Armeen des Westens überrannt und vernichtet. Was wir uns vornehmen, das führen wir durch.
Wir wollen Frieden, Ruhe und Ordnung. Und nicht nur für 25 Jahre.
Ich bin Joe Jones, ein amerikanischer Soldat. Ich verlange persönlich nichts von den Deutschen und bin daran gewöhnt, die Rechte meiner Mitmenschen zu achten. Ich führe Krieg als Soldat.
Ich lebe gern und achte auch das Leben anderer. Aber wer mich angreift, der muß wissen, daß Joe Jones auch anders kann.
Wer mein Feind sein will, der wird schnell erfahren, daß ich auch ein harter und unerbittlicher Feind sein kann. So hart und unerbittlich, daß meine Feinde mich nie vergessen.
Welchen Joe Jones willst Du kennenlernen?
JOEJONESERWARTETEINEANTWORT!
Flugblatt
Ich bin doch nur ein kleiner Mann
10. September 1944
Ein grauer Morgen irgendwo in Nordfrankreich.
Der staubbedeckte Jeep fährt vor dem Kriegsgefangenenlager vor. Das Lager – ein Feld, umzäunt von halb entrolltem Stacheldraht – ist wiederum mit Stacheldraht unterteilt in mehrere kleinere Lager: eines für Offiziere, eines für Unteroffiziere, ein drittes für Mannschaften; im vierten Karree stehen die Zelte für die Interrogators, die Gefangenenbefrager.
Das Tor zum Lager ist denkbar einfach gebaut: zwei hölzerne Pfosten, ein Holzrahmen, quer darüber Stacheldraht genagelt. Vor dem Tor ein gelangweilter Militärpolizist, der dem Interrogator die Waffe abnimmt. Keiner betritt das Lager bewaffnet; offenbar befürchtet man, einer der Gefangenen könnte auf den Gedanken kommen, sich der Pistole des Interrogators zu bemächtigen.
Aber die Gefangenen sehen nicht aus, als hätten sie solche Streiche im Sinn. Sie haben sich ins Gras geworfen, liegen in kleinen Gruppen, unterhalten sich in gedämpften Tönen. Eine Vielfalt von Uniformen – das gewöhnliche Graugrün der Infanterie, das Blaugrau der Luftwaffe-Divisionen und Grün mit SS-Kragenspiegeln. Die gesamte Truppenaufstellung des Gegners läßt sich an den Uniformen ablesen.
Aber der Zustand der Armee ist am Schuhwerk zu erkennen. Die genagelten Schaftstiefel, die siegreich quer durch Europa marschierten, sind selten geworden; man trägt jetzt bescheidene Schnürschuhe, heruntergetreten, geflickt, mit kurzen Gamaschen, ähnlich denen der Engländer; das sieht weniger bedrohlich aus und spart Leder. Die Uniformen sind aus billigem Zeug – auch die der Offiziere. Mützen aller Stile, mit Schild und ohne. Die Embleme sind nicht mehr gestickt, nur noch gedruckt.
Und wie sie reden – wer hat die Gefangenen eigentlich in diese Gruppen aufgeteilt? Es stellt sich heraus, daß sich das ganz natürlich ergeben hat; die eine gemeinsame Sprache sprechen, haben sich zusammengefunden. Da gibt es Polen und Wallonen, Georgier und Turkmenen, Tschechen und Elsässer, Franzosen und Italiener – und schließlich auch Deutsche.
Die Wehrmacht wurde auf den Schlachtfeldern Rußlands ausgeblutet. Um die Lücken zu füllen, warb man in den unterworfenen Ländern Europas Freiwillige an, indem man versprach, sie an den Segnungen der Neuen Ordnung teilhaben zu lassen. Doch es kamen nicht genug Freiwillige, und so wendete man Zwang an. Rekrutiert aus allen möglichen Völkern, wurden sie zuerst in Arbeitsbataillone gesteckt und später dann an die Front geschickt. Heute finden sich Ausländer sogar in den Elitedivisionen der SS.
Das ergibt Probleme nicht nur für die deutsche Heeresleitung. Soll zum Beispiel die amerikanische Armee Polen, die ihre Nazi-Offiziere beseitigten und dann überliefen, als gewöhnliche Kriegsgefangene behandeln? Und was tun mit dem armen Muschik aus Astrachan, der von den deutschen Truppen schon 1941 bei Bialystok gefangengenommen wurde und den man hungern ließ und mit Schlägen traktierte, bis er sich bereitfand, als Verteidiger besagter Neuer Ordnung in einem der deutschen Ostbataillone zu dienen? Und diese Probleme beginnen erst. Je tiefer die amerikanischen Einheiten in Europa eindringen, desto häufiger werden sie mit den Millionen entwurzelter, heimatloser Arbeits- und Militärsklaven in Berührung kommen, die den Humus bildeten, auf dem die deutsche Oberherrschaft wuchs.
Ein deutscher Unteroffizier wurde befragt, wie er von den Mongolen in seinem Zug denke – die von den amerikanischen Soldaten zuerst für Japaner gehalten worden waren. »Na ja«, sagte er, »so schlecht sind sie gar nicht.«
Es klingt, als redete er von Pferden.
»Unter welcher Bezeichnung wurden sie in der Stammliste geführt?«
»Volksdeutsche«, sagt er.
Es gibt da deutsche Einheiten, bei denen der Kommandeur seine Befehle durch Übersetzer erteilt.
Die nächste Frage an den Unteroffizier: »Wie lange, glauben Sie, wird der Krieg noch dauern?«
Er zuckt die Achseln. Er weiß nicht. Er ist seit zwei Tagen in Gefangenschaft, hat sich anscheinend in sein Schicksal gefügt.
»Wer wird Ihrer Meinung nach den Krieg gewinnen?«
»Die Alliierten«, sagt er gleichgültig.
»Seit wann wissen Sie das?«
»Seit ich gefangengenommen wurde.«
»Also vorher sahen Sie’s anders. Was hat Sie veranlaßt, Ihre ursprüngliche Meinung zu ändern?«
»Ich habe Ihre Waffen gesehen und Ihr Material.«
»Und vorher glaubten Sie, Deutschland wird gewinnen?«
»Selbstverständlich.«
»Wieso selbstverständlich?«
»Als deutscher Soldat mußte ich doch an den Sieg der Wehrmacht glauben. Oder?«
Der Interrogator schweigt.
»Darf ich Sie mal was fragen?« sagt der Unteroffizier.
Der Interrogator nickt.
»Warum führen Sie eigentlich Krieg gegen uns? Warum sind Sie über einen ganzen Ozean hierhergekommen? Die Amerikaner sind doch reich. Wir haben nichts von Ihnen gefordert. Außerdem gehören Sie zu unserer Rasse und unserer Kultur. Von Rechts wegen müßten Sie doch zusammen mit uns kämpfen – gegen die Bolschewisten.«
»Ich dachte«, sagt der Interrogator, »Sie führen Krieg gegen die Plutokratien!«
»Ja, gegen die Plutokratien und gegen den Bolschewismus. Das ist doch ein und dasselbe. Sind alles die Juden. Sehen Sie mal, was die in der Weimarer Republik gemacht haben. Die haben sämtliche Warenhäuser gehabt. Und wir hatten Millionen Arbeitslose.«
Der Interrogator hört sich das an. Die Gedanken des Gefangenen sind merkwürdig zusammenhanglos, er reiht Losung an Losung, es fehlt jede Logik, es ist, als könne der Mann überhaupt nicht folgerichtig denken. Aber als Soldat besaß er doch genügend Denkfähigkeit; als er gefangengenommen wurde, befehligte er einen Zug Infanterie, verhielt sich tadellos, und im Zivilleben – er war Mechaniker, sagt er, verdiente gut – mußte er gleichfalls denken gekonnt haben.
Verlorengegangen ist seine Fähigkeit zu abstraktem Denken.
Völker haben ein Gewissen.
Die Deutschen haben ein schlechtes, schon seit Jahren, aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Gewissens, solange sie in einer so starken und festgefügten Organisation wie der Wehrmacht integriert waren. Im Augenblick der Gefangennahme änderte sich das. Die Gefangennahme erzeugt im Soldaten nicht nur einen physischen und nervlichen, sondern auch einen psychischen Schock.
Plötzlich wird dieser Soldat nicht mehr von zahlreichen eigenen Leuten gestützt, die die gleiche Uniform tragen wie er und den gleichen Befehlen gehorchen; jetzt steht er allein und unbewaffnet ebenso zahlreichen anderen gegenüber, die eine ihm fremde Uniform tragen, eine fremde Sprache sprechen und fremde Befehle befolgen – und die ihre Überlegenheit ihm gegenüber bewiesen haben, indem sie seine Stellung überrannten und ihn selbst überwältigten.
Der Kriegsgefangene ist strikt ein Individualist. Nachdem ihm das eigene Leben auf eine ihm wunderbare Weise erhalten blieb, ist er mehr an seinem persönlichen Schicksal interessiert als an dem Kollektivschicksal seines Volkes. Er ist wenig besorgt über die Möglichkeit, daß Deutschland in mehrere kleine Vasallenstaaten aufgeteilt werden könnte, sehr besorgt dagegen, wenn er hört, daß er mitverantwortlich gemacht werden könnte für das, was während des Kriegs von Wehrmacht und SS und Polizei begangen wurde. Er widerspricht sofort: »Ich habe Grausamkeiten immer abgelehnt!« – »So etwas ist nie passiert, wo meine Einheit gestanden hat!« – »Damit hat die Wehrmacht doch nichts zu tun, das war alles die SS!«
Der Interrogator unterbricht ihn. »Aber gewußt haben Sie doch von den Sachen!«
»Gewußt – schon. Teilweise.«
»Und was haben Sie dagegen unternommen?«
Der Gefangene wird erregt, gestikuliert: »Was konnte ich denn tun? Ich bin doch nur ein kleiner Mann!«
Nur ein kleiner Mann. Das ist die Standardantwort, die Standardausflucht vor jeglicher Verantwortung. Sobald der Krieg sich gegen sie wendet, sobald die Furcht vor der Vergeltung sich einstellt, der Vergeltung für all das Unglück, das sie angerichtet haben, halten sie diese Entschuldigung parat. Sie mußten ja ihre Befehle befolgen.
Es liegt eine gewisse, uns unwirklich erscheinende Logik in dieser Entschuldigung. Wenn es wahr ist, daß im totalen Krieg das ganze Volk mobilisiert ist, dann steht das ganze Volk unter militärischer Disziplin und muß Befehlen von oben gehorchen. Dann sind sie allesamt nur kleine Leute, die sich nach der Devise »Führer befiehl, wir folgen« verhalten, und alle Verantwortung fällt auf den Wahnsinnigen, der die Befehle erteilt.
Sie ahnen irgendwie, fürchten aber, es zu erkennen, daß die Welt außerhalb des Hitler-Reiches nach anderen Gesetzen lebt – nach Moralgesetzen, die von einem Menschen ein unabhängiges Urteil und sogar Widerstand fordern, wenn das, was ihm anbefohlen wird, sich gegen das primitivste sittliche Gefühl richtet.
In vielen Fällen sind sie mutige Soldaten. Aber der moralische Mut ist ihnen genommen worden, schon seit 1933. Wenn der Tag der Abrechnung kommt, werden unter ihnen nur wenige sein, die zugeben, daß sie zur Nazi-Partei gehörten, daß sie hilflose Menschen beraubt und ermordet haben, daß sie bewußte Helfer eines absolut gewissenlosen Machtapparats waren und daß sie dabei sogar Genugtuung empfanden. An dem Tag wird es nur Millionen kleine Leute geben. Und wenn man dennoch versuchte, sie verantwortlich zu machen, würde ein Aufschrei verletzter Unschuld ertönen.
Ein junger Fallschirmjägeroffizier wird ins Zelt geführt. Vierundzwanzig Jahre alt, sieht er aus wie ein jugendlicher Filmheld. Auf der Brust trägt er Orden und Ordensbänder, am Ärmel das gestickte, weiß-goldene Kreta-Band. Er hat an allen wichtigeren Unternehmen der deutschen Fallschirmjäger teilgenommen – Polen, Holland, Griechenland, Kreta, Norwegen, Rußland. Er sagt, ihn lockte das Abenteuer.
Das Abenteuer lockte ihn. Daß diese Art Reiz, den ihm seine Führung verschaffte, mit dem Töten von Menschen, dem Bombenangriff auf Rotterdam – den er miterlebte – verbunden war, das gehörte eben dazu, war Teil des Soldatenlebens. Daß der Bombenangriff auf seine Heimatstadt irgendwie mit dem Bombenangriff auf Rotterdam zusammenhängen könnte, gibt er zu; darum protestiert er auch nicht dagegen.
»Also warum haben Sie sich dann ergeben, Leutnant?«
»Nun ja«, sagt er, »die Lage war hoffnungslos.« Ein Schatten huscht über sein Gesicht.
»Was halten Sie vom Putsch Ihrer Generale? Von dem Attentat auf Hitler?«
»Oh, das war eine üble Sache.«
»Wieso?«
»Wenn Generale sich gegen den Führer stellen, das kann man nicht billigen.«
»Meinen Sie nicht, es wäre möglich, daß diese Generale, so wie Sie es in Ihrem kleinen Abschnitt taten, die Lage für hoffnungslos hielten?«
Wieder eine Pause. Dann sagt er heiser: »An wen sollen wir uns denn halten? Wir müssen doch an den Führer glauben, verstehen Sie das denn nicht?«
Natürlich müssen sie glauben. Im Innersten, fast unbewußt, spüren sie, daß der ganze Krieg nicht gerechtfertigt ist. Aber sie können das nicht zugeben – besonders die Sensibleren können es nicht. Wie denn auch? Rotterdam vernichtet, ganze Völker dezimiert, die Besten der eigenen Jugend geopfert – sie müssen an den Führer glauben, der das Kreuz der Verantwortung für sie trägt, der für sie denkt, der für sie alle mit Gott ringt. Sie müssen glauben, daß den Rückzügen in Ost und West und Süd ein Plan zugrunde liegt, des Führers Intuition.
Wenn sie aufhören würden zu glauben, müßten sie innerlich zusammenbrechen.
Was eigentlich fand hinter dem Vorhang statt, der sich 1933 über Deutschland senkte?
Erstens wurden die besten und bewußtesten Kader der deutschen Arbeiterbewegung ausgerottet.
Zweitens, und wichtiger noch, wurde die deutsche Arbeiterklasse insgesamt bestochen, und zwar in einer sehr einfachen Währung: Arbeit. Die Arbeitslosen wurden zum Teil in die Armee, zum Teil in die Rüstungsindustrie gesteckt. Die riesigen Investitionen, die notwendig waren, um eine so große Zahl von Menschen unproduktiv zu beschäftigen, sie für Zerstörung auszubilden und für nichts als Zerstörung arbeiten zu lassen, sollten durch einen siegreichen Krieg amortisiert werden.
Wären nicht die Schlacht um England und die Schlacht um Stalingrad gewesen, das Projekt hätte Erfolg gehabt. Mehrere Jahre hindurch, zwischen 1939 und 1942, genoß die deutsche Bevölkerung bereits die Früchte des Sieges; sie lebten besser als die anderen Völker Europas, Hunderttausende gut bezahlter Verwaltungsposten entstanden, das Geld floß reichlich.
Daß seit Stalingrad ausländische Arbeiter allmählich an die Stelle ihrer deutschen Kollegen traten, die nun in den Krieg ziehen mußten, daß die Frauen in den Betrieben endlos lange Stunden zu arbeiten hatten, wurde als Notstandsmaßnahme dargestellt. Immer noch aber gaukelt man der Masse der deutschen Arbeiter und Kleinbürger die Illusion von dem Herrenvolk vor, dem die Früchte des Sieges zufallen würden, und dies Bild erscheint um so realistischer, als die Leute ja bereits einen Vorgeschmack dieser Früchte gehabt haben.
Besonders eindrucksvoll war ein korpulenter deutscher Stabshauptmann. Er war für die Besoldung und Verpflegung seines Regiments zuständig und wurde gefangengenommen, als er an die Front fuhr, um zu erkunden, wieso das Essen nicht bis in die Hauptkampflinie kam – und um dann festzustellen, daß das Gulasch nicht in der Linie eintraf, weil es keine Linie mehr gab. Dieser Stabshauptmann, der aus seiner knapp sitzenden Uniform fast herauszuplatzen schien, lehnte sich über den improvisierten Tisch bis dicht zu dem Interrogator hinüber und vertraute ihm flüsternd an: »Lassen Sie uns das lieber machen. Denn wenn wir besiegt werden, haben Sie das Problem mit den Russen. Und wenn wir nicht imstande sind, die Russen zu schlagen, dann schaffen Sie’s erst recht nicht.«
Besagter Hauptmann machte sich keine Sorgen um Deutschlands Zukunft nach einer Niederlage. Er versicherte dem Interrogator jovial, daß man Deutschland schon intakt lassen müsse, damit es als Barriere gegen die Russen dienen könne, und daß Amerika zweifellos in kurzer Frist gezwungen sein würde, Deutschland wieder zu bewaffnen.
»Und wären Sie denn auch bereit, solche Landsknechtsdienste zu leisten?«
»Klar«, sagte der Hauptmann. »Machen Sie uns nur ein annehmbares Angebot.«
Auch er, ein kleiner Mann.
Nach 1918 beeilte sich der deutsche Generalstab, die Dolchstoßlegende zu erfinden. So konnten die Generale dem Volk einreden, sie hätten eigentlich den Krieg gewonnen – wenn nur der Feind im eigenen Land nicht gewesen wäre.
Diesmal kann man’s den Juden nicht in die Schuhe schieben, weil man die Juden bereits vernichtet hat. Auch eine Arbeiterbewegung besteht nicht mehr, der man die Schuld geben könnte. Und es ist noch fraglich, ob die Goebbels-Lüge, daß es die putschenden Generale waren, die die Schlachten im Osten verloren, wirklich Glauben finden wird.
Trotzdem ist die neue Entschuldigung für die kommende Niederlage bereits parat und wird auch von deutschen Soldaten benutzt. Sie ist sehr einfach und lautet Materialüberlegenheit.
Doch ist diese Entschuldigung eine zweischneidige Sache. Auf kurze Sicht wirkt sie sich günstig für die Alliierten aus, denn immer wieder verschafft sie dem deutschen Soldaten die innere Berechtigung aufzugeben, auch ohne die letzte Kugel gefeuert und bis zum letzten Blutstropfen gekämpft zu haben.
Aber auf lange Sicht wird es diese Materialüberlegenheit sein, die späterhin als das große Mittel zur Wahrung des Gesichts der Wehrmacht dienen wird. Kein deutscher Gefangener, der für das deutsche Heer nicht die bessere Moral in Anspruch genommen und der die Amerikaner nicht beinahe der Unfairneß geziehen hätte, weil sie mehr Flugzeuge und mehr Artillerie und mehr Panzer und mehr Truppen einsetzen konnten. »Ja, wenn es ein Kampf Mann gegen Mann gewesen wäre …!«
Die deutschen Soldaten vergessen dabei, daß sie ihre Siege auf die gleiche Weise gewonnen haben und daß die Polen und Franzosen, die Griechen und Norweger, die Engländer bei Dünkirchen und die Russen bis hin nach Stalingrad immer wieder geschlagen wurden, weil sie nicht die Panzer und Flugzeuge hatten, die sie denen der Wehrmacht hätten entgegenstellen können.
Aber gerade das darf man den Deutschen nicht gestatten zu vergessen. Sie müssen erkennen, daß sie geschlagen wurden, weil sie es unternahmen, eine Welt von freien Völkern herauszufordern, denen sie nichts zu bringen hatten als Unterdrückung und Sklaverei.
Kann man hoffen, daß das deutsche Volk seine Niederlage als eine geschichtliche Lehre hinnehmen wird, daß man die Deutschen umerziehen kann und daß sie vor allem es fertigbringen werden, sich selber umzuerziehen?
Es war in dem Lager auch ein Soldat aus Sachsen, ein Textilarbeiter, der den Interrogator bei seinem Gang zum Zelt ansprach mit den Worten: »Darf ich Ihnen etwas sagen?«
»Ja, natürlich.«
»Ich möchte Ihnen sagen …« Und dann brach es aus ihm heraus: »Das ist doch eine Schande für die Wehrmacht, daß ein Deutscher erst ins Gefangenenlager kommen muß, um wieder frei atmen zu können und sich wie ein Mensch zu fühlen!«
Und da war ein junger Fallschirmjäger aus dem Rheinland, der nach einem längeren Verhör dem Interrogator anvertraute, daß er als geheimer Kurier für Pastor Niemöllers Bekenntniskirche gearbeitet hatte.
Es gibt unter den Deutschen viele wie die beiden – jeder Interrogator ist ihnen schon begegnet. Sie geben Anlaß zu Hoffnung. Aber diese besseren Deutschen haben bisher weder ein gemeinsames Programm noch eine gemeinsame Organisation, die stark genug wäre, um wirklich wirksam werden zu können. Zweifellos werden sie bei dem Prozeß der Umerziehung mithelfen können, der durchgeführt werden muß, wenn nicht im Herzen Europas eine frustrierte Nation bleiben soll – eine Nation, die nur allzu bereit sein würde, sich dem nächstbesten Hitler, der daherkommt, in die Arme zu werfen.
New York Times Magazine
Wir alle starben in Auschwitz
Korrespondentenberichte vom ersten KZ-Prozeß in Lüneburg
September/Oktober 1945
Alles erhebt sich, als der Gerichtshof eintritt. Generaladvokat Stirling, würdig in der traditionellen weißen Perücke britischer Gerichtsbarkeit, vereidigt Richter, Dolmetscher und Stenographen und schwört dann selbst den Eid, gerecht und fair Recht zu sprechen. Dann verliest er die Anklageschrift. Jeder Satz wird genau übersetzt. Die Angeklagte Herta Ehlers, eine Führerin der Frauen-SS in Auschwitz und Belsen, fällt in Ohnmacht. Irma Grese und die Angeklagte Elisabeth Volkenrath, eine Kollegin der Ehlers, halten sie aufrecht, und sie erholt sich rasch.
Die Angeklagten sind bleich, aber mit dieser einzigen Ausnahme gefaßt. Als sie dann vom Präsidenten des Gerichtshofs gefragt werden: »Bekennen Sie sich schuldig – ja oder nein?«, antwortet jeder einzeln, klar und deutlich: »Nein!« Die Verteidigung unternimmt bereits, bevor der Prozeß eigentlich in Gang gekommen ist, den Versuch, ihn in mehrere kleine Einzelprozesse aufzuspalten. Der Verteidiger Major Cranfield, unterstützt von Captain Philipps, erklärt, daß man die angeblichen Verbrechen von Belsen und die von Auschwitz nicht gemeinsam behandeln kann und daß die Verteidigung sich bemühen wird, für einzelne Angeklagte den Beweis zu führen, daß sie überhaupt nicht an den angeblichen Verbrechen teilgenommen haben können.
Der Antrag der Verteidigung wird nach längerer Beratung des Gerichtes abgelehnt.
Der Anklagevertreter, Oberst Backhouse, spricht.
Vor einem britischen Gericht ist es üblich, daß der Anklagevertreter in seiner Eröffnungsrede kurz ausführt, was die gesetzliche Grundlage ist, auf der seine Anklage beruht, und wie er seine Beweisführung zu gestalten gedenkt.
Er schildert die Methode der Vernichtung in Auschwitz – die Gaskammern, in denen, wie er sagt, vier Millionen Menschen umgebracht wurden. Und er sagt: »Dieser Dr. Klein war einer der Männer, die die Opfer für die Gaskammer auswählten. Ebenso Johanna Bormann. Ebenso die junge Irma Grese. Wer zu schwach, zu alt oder zu jung war, für die Nazis Sklavenarbeit zu verrichten, wanderte in die Gaskammern … Kinder, Greise, schwangere Frauen … so viele Menschen wurden vergast, daß zeitweilig die Riesenkrematorien nicht ausreichten, um die Leichen zu verbrennen.«
Im Gerichtssaal könnte man eine Nadel fallen hören. Die Journalisten schreiben fieberhaft mit, Soldaten holen die Manuskripte ab, in wenigen Minuten werden die Worte des Staatsanwalts in der ganzen Welt zu hören sein.
Brigadier Hughes, der erste Zeuge, machte den Eindruck eines harten, erfahrenen Soldaten – eines Soldaten, der aber auch Arzt ist. Und so war vielleicht der erschütterndste Moment seiner Aussage ihr Ende, als der ordensgeschmückte Brigadier einfach sagte: »Ich bin dreißig Jahre lang Arzt gewesen. Ich habe alle Schrecken des Krieges gesehen. Aber was ich in Belsen sehen mußte, übertraf alles an Schrecklichkeit.«
Brigadier Hughes berichtete, wie in der zweiten Woche des April deutsche Offiziere ins britische Hauptquartier gekommen waren, um einen örtlichen Waffenstillstand abzuschließen, da in Belsen eine Flecktyphusepidemie herrschte. Der Waffenstillstand kam zustande. Bedingung des Waffenstillstandes war, daß die SS-Truppen sich bis zum 12. April um 13.00 Uhr aus Belsen zurückziehen, und daß nur solches Personal im Lager zurückbleiben sollte, das zur Übergabe der Verwaltungsgeschäfte notwendig sei. Diese zurückbleibenden SS-Leute sollten unbewaffnet sein.
Brigadier Hughes traf am Nachmittag des 15. April in Belsen ein, wo bereits der britische Oberst Taylor im Begriff war, die Verwaltung des Lagers zu übernehmen. Die Zustände, erklärte Brigadier Hughes, waren unbeschreiblich. In dem Lager, das ein Zehntel dieser Zahl hätte aufnehmen können, befanden sich über 28 000 Frauen und 12 000 Männer – alle in verschiedenen Stadien des Verhungerns. Außerhalb und innerhalb des Lagers, vor den Baracken, in den Baracken, lagen Haufen von Leichen. Während der letzten vierzehn Tage vor dem Anmarsch der Alliierten hatte es kein Brot gegeben, während der letzten sechs Tage kein Trinkwasser.
In mehreren Abteilungen des Lagers wütete die Flecktyphusepidemie, gefördert durch die Verlausung und den Schmutz. Kot und Exkremente waren überall.
Brigadier Hughes fand ein noch offenes Massengrab, in dem Tausende von teils nackten, teils in Fetzen gehüllten Leichen lagen. Andere Massengräber waren bereits zugeschaufelt. Über 10 000 Tote lagen herum. Brigadier Hughes nahm den Kommandanten des Lagers, den Hauptangeklagten Josef Kramer, zu einer Inspektion des Massengrabes mit und berichtet: »Kramer war völlig abgebrüht. Er blieb unberührt von dem, was wir sahen.« In den Baracken selbst lagen die Sterbenden und die Leichen durcheinander.
Der Zustand der Überlebenden war so, daß nach der Befreiung noch über 10 000 an den Folgen von Flecktyphus, Unterernährung und Tuberkulose starben. Am Abend des 15. April kam es zu schrecklichen Szenen. Einige Häftlinge, die jetzt nicht mehr von der SS in den Baracken eingesperrt waren, hatten zwischen zwei Lagerabteilungen einen Haufen Kartoffeln entdeckt und stürzten sich darauf.
Die SS, die das Waffenstillstandsabkommen gebrochen und ihre Gewehre behalten hatte, begann auf die Ausgehungerten zu schießen, angeblich, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Da Kramer sich weigerte, dem Schießen Einhalt zu gebieten, gab Brigadier Hughes schließlich den Befehl, daß jeder SS-Mann, der noch einen Schuß abgibt, an die Wand gestellt werden würde. Trotzdem dauerte das Schießen während der Nacht noch an. Erst als stärkere britische Einheiten in das Lager einrückten, konnte die SS entwaffnet werden. Brigadier Hughes erklärte, daß die Schießerei keineswegs zur Aufrechterhaltung der Ordnung im Lager notwendig war.
Die Aussage des Brigadiers Hughes, die hier im Zusammenhang wiedergegeben wurde, bestand in Wirklichkeit aus Antworten, die er auf die Fragen des Staatsanwalts Oberst Backhouse gab und die Satz für Satz übersetzt wurden. Kaum hatte der Staatsanwalt seine Fragen beendet, als der Zeuge von den zwölf Verteidigern ins Kreuzverhör genommen wurde. Die Verteidiger bemühten sich, die schwer belastenden Aussagen des Brigadiers zu entkräften.
Major Winwood, der Verteidiger von Kramer und Klein, sucht den Zeugen zu veranlassen, zuzugestehen, daß Kramer beim besten Willen nicht genügend Nahrung für die Insassen des Lagers beschaffen konnte und daß Dr. Klein nicht genug Personal zur Verfügung hatte, um die Flecktyphusepidemie zu bekämpfen und für hygienische Verhältnisse im Lager zu sorgen.
Der Zeuge erwiderte darauf, daß die britische Armee mit weniger Personal, als Kramer und Klein zur Verfügung gestanden hatte, die Epidemie innerhalb von zwei Wochen zum Erlöschen brachte und daß in Belsen selbst sowie in der nah gelegenen Panzergrenadierkaserne große Lebensmittelvorräte vorhanden waren, die zur Ernährung aller Insassen ausgereicht hätten.
Major Munro, der Verteidiger des Angeklagten Hesseler, fragte den Zeugen, ob die Verhältnisse in der Lagerabteilung 2, deren Kommandant Hesseler war, nicht besser waren als in den anderen Abteilungen von Belsen.
Brigadier Hughes gab zu, daß in Abteilung 2 die Insassen wenigstens nach Nationalitäten organisiert waren und daß sich dort auch weniger Tote befanden als in anderen Abteilungen des Lagers.
Andere Verteidiger wieder stellten Fragen, die den Zeugen veranlassen sollten, zuzugeben, daß es der SS unmöglich war, unter den durch Hunger apathisch gewordenen Insassen Ordnung zu halten. Leutnant Boye, der Verteidiger der Gertrud Fiest, fragte den Zeugen, ob er ihm sagen könne, ob die SS in Belsen während der letzten zwei Wochen vor der Befreiung des Lagers Brot gehabt habe – da er doch ausgesagt hätte, es habe in diesen zwei Wochen in Belsen kein Brot gegeben.
Brigadier Hughes erwiderte darauf, er wisse nicht, was die SS-Leute gegessen hätten, aber sie hätten alle recht wohlgenährt ausgesehen, als er nach Belsen kam …
Der nächste Zeuge betrat den Zeugenstand. Es war dies Captain Singlow, ein Angehöriger des britischen Geheimdienstes, der das Lager mit den ersten englischen Truppen erreichte. Captain Singlow äußerte sich besonders zu den in der Voruntersuchung gemachten Angaben Kramers, nach denen es der SS unmöglich gewesen sein sollte, ohne Gewaltanwendung im Lager Ordnung zu halten. Captain Singlow erklärte, daß es für die Engländer ganz einfach gewesen war, mit Hilfe eines mitgeführten Lautsprecherwagens Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Captain Singlow stellte fest, daß viele Lagerinsassen die Spuren schwerer Schläge aufwiesen, die sie noch kurz vor dem Eintreffen der Engländer empfangen hatten.
Captain Singlow schilderte das Trinkwasser, das den Lagerinsassen zur Verfügung stand. Es war faules, brackiges Wasser, das in Betonbehältern stand, in denen mehrere Leichen gefunden wurden. Ebenso wie Brigadier Hughes bestätigte Captain Singlow, daß der Lagerkommandant Kramer seelisch völlig unberührt von den grauenhaften Zuständen war.
Auch an diesem Tage unterzog die aus britischen Offizieren und einem polnischen Offizier bestehende Verteidigung den Zeugen einem oftmals überaus scharfen Kreuzverhör, um seine Aussage zu entkräften.
Der nächste Verhandlungstag brachte die Vorführung des Belsenfilms. Dieser war von britischen Kameraleuten in der Zeit zwischen dem 6. und dem 26. April 1945, das heißt in der Periode während und kurz nach der Übernahme des Lagers durch die Engländer aufgenommen worden. Der Film hatte eine unerhörte Wirkung besonders auf die deutschen Zuschauer auf den Galerien, die ihr Entsetzen über die auf der Leinwand erscheinenden halbverhungerten Menschen, über die in den verschmutzten Baracken zusammengepferchten Toten und Sterbenden nicht verhehlen konnten. Die achtundvierzig Angeklagten, die im Film die Dokumente ihres Wirkens, die beredten Zeugnisse ihrer Tätigkeit, sehen mußten, saßen stumm. Nachdem das Licht im Gerichtssaal wieder eingeschaltet worden war, waren sie bleich.
Noch war die Wirkung des Films nicht abgeklungen, als der erste Überlebende von Belsen, der britische Staatsbürger Harold Le Druillenec, als Zeuge aufgerufen wurde. Er schilderte, wie er und andere Häftlinge, dem Zusammenbruch nahe, fünf Tage lang vor dem Eintreffen der Alliierten Leichen zu einem Massengrab schleppen mußten. Bei dieser Arbeit starben viele der Leichenträger selbst und wurden dann in dieselbe Grube geworfen, zu der sie die Leichen ihrer Mitgefangenen hatten tragen helfen.
Le Druillenec bestätigte, was der Staatsanwalt in seiner Einführungsrede gesagt hatte – daß infolge des von den Nationalsozialisten herbeigeführten Hungers Häftlinge zu Menschenfressern geworden wären. Der Zeuge berichtete, er habe mit eigenen Augen gesehen, wie ein vor Hunger halb wahnsinniger Häftling in der Leichenhalle des Lagers ein Messer aus der Tasche zog, ein Stück Fleisch aus dem Bein einer verwesenden Leiche schnitt und es auf der Stelle aß.
Mitgefangene hatten Le Druillenec gesagt, daß dies keineswegs ein Ausnahmefall war. Nach Ansicht des Zeugen hatte die Lagerleitung beim Herannahen der Engländer zunächst den Versuch unternommen, die Massen der Leichen in Belsen beiseite schaffen zu lassen, hatte diesen Versuch aber aufgeben müssen, da die Arbeit einfach nicht bewältigt werden konnte.
Der nächste Zeuge war der britische Verbindungsoffizier Major Berney, der bestätigte, daß sich in der Nähe von Belsen nicht nur ausreichende Lebensmittelvorräte befanden, sondern ebenso Riesenlager von Medikamenten. Er selbst habe in einem nur drei Kilometer von Belsen entfernten Vorratslager 600 Tonnen Kartoffeln, 150 Tonnen Fleisch, 30 Tonnen Zucker, 20 Tonnen Milchpulver und größere Mengen Schokolade vorgefunden. Die Vorräte an Medikamenten, welche die Alliierten dort fanden, waren so groß, daß sie heute noch nicht aufgebraucht sind.
Nachdem Major Berney seine Aussagen beendet hatte, führte die von dem Staatsanwalt, Oberst Backhouse, aufgerufene nächste Zeugin den Gerichtshof, die Angeklagten und die deutschen Zuschauer nach Auschwitz. 14 der auf der Anklagebank Sitzenden sind ja beschuldigt, ihre Verbrechen nicht nur in Belsen, sondern auch vorher schon in Auschwitz begangen zu haben.
Die Zeugin, die polnische Ärztin Dr. Ada Bimko, beschrieb, wie sie mit ihrer Familie – ihrem Vater, ihrer Mutter, ihrem Bruder und ihrem sechsjährigen Söhnchen – nach Auschwitz verschleppt und wie ihre Angehörigen sofort am Tage der Ankunft im Lager vergast worden waren. Man konnte der Zeugin ansehen, wie schwer es ihr fiel, von diesem grausamen Schicksal zu berichten, man konnte hören, wie stellenweise ihre Stimme zu versagen drohte.
Tiefes Schweigen herrschte im Gerichtssaal, als die Zeugin in einfachen Worten berichtete, wie am Versöhnungstag, dem höchsten Feiertag der Juden, 25 000 jüdische Insassen des Lagers Auschwitz in die Gaskammern geschickt wurden.
Die Zeugin erkannte unter den Angeklagten den Lagerarzt von Auschwitz und Belsen, Dr. Fritz Klein, sowie Irma Grese als die Personen wieder, die die Opfer für die Gaskammern persönlich ausgewählt hatten.
Über das Wochenende vertagte sich der Gerichtshof, um zusammen mit den Verteidigern das Konzentrationslager Belsen zu besichtigen. Belsen, der Tatort der Verbrechen, liegt etwa 125 Kilometer von Lüneburg entfernt.