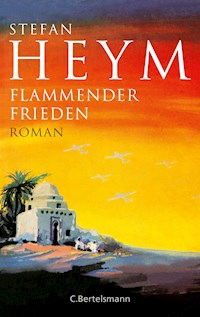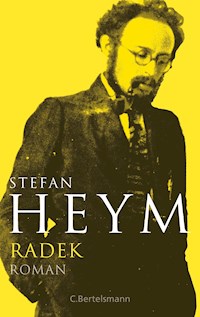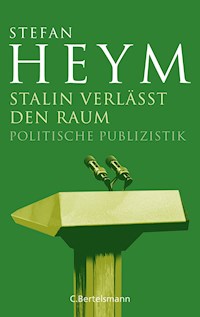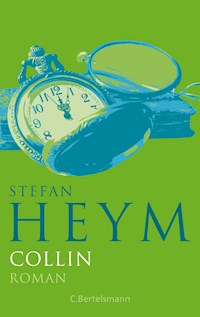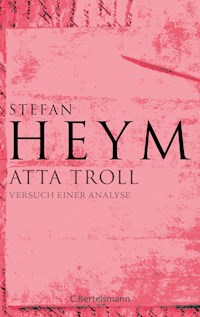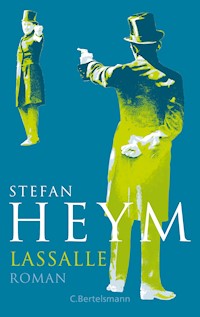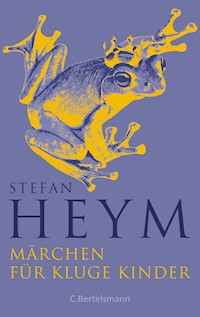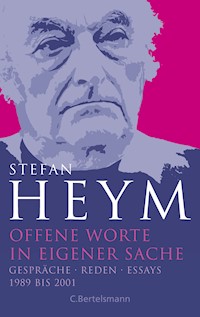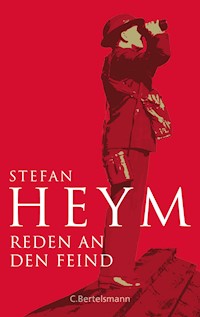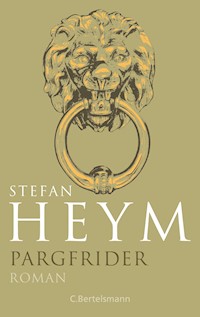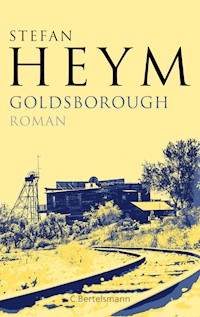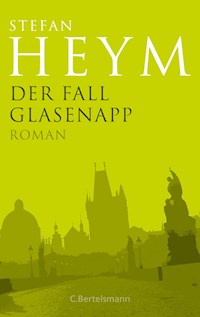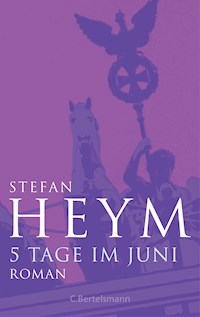12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Stefan-Heym-Werkausgabe, Autobiografisches, Gespräche, Reden, Essays, Publizistik
- Sprache: Deutsch
Ein brisantes politisches Lehrstück und ein Beispiel für Mut und Zivilcourage in einer Diktatur
»OV Diversant« war der Deckname, unter dem die Stasi Stefan Heym in ihren Akten führte. Zum Zeitpunkt der Biermann-Ausbürgerung spitzte sich die innere Situation der DDR dramatisch zu, Stefan Heym verfasste in diesen Monaten Tagebuchaufzeichnungen, in denen er Politisches und Persönliches gleichermaßen festhielt. Aber auch die Stasi führte genau Protokoll über alle Bewegungen, Kontakte, Zusammenkünfte Stefan Heyms. Beides ist in diesem Buch enthalten. Es zeigt beklemmend die Mechanismen von Bespitzelung, Psychoterror und Einschüchterung, ist aber zugleich auch ein eindrucksvolles Beispiel für den Widerstand von DDR-Intellerktuellen – lange vor der Wende.
Ein beklemmendes, sehr persönliches Zeitbild der DDR nach der Biermann-Ausbürgerung, bei btb erstmals erschienen 1996, endlich wieder lieferbar als Teil der digitalen Werkausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch:
»OV Diversant« war der Deckname, unter dem die Stasi Stefan Heym in ihren Akten führte. Zum Zeitpunkt der Biermann-Ausbürgerung spitzte sich die innere Situation der DDR dramatisch zu, Stefan Heym verfasste in diesen Monaten Tagebuchaufzeichnungen, in denen er Politisches und Persönliches gleichermaßen festhielt. Aber auch die Stasi führte genau Protokoll über alle Bewegungen, Kontakte, Zusammenkünfte Stefan Heyms. Beides ist in diesem Buch enthalten. Es zeigt beklemmend die Mechanismen von Bespitzelung, Psychoterror und Einschüchterung, ist aber zugleich auch ein eindrucksvolles Beispiel für den Widerstand von DDR-Intellektuellen – lange vor der Wende.
Ein beklemmendes, sehr persönliches Zeitbild der DDR nach der Biermann-Ausbürgerung jetzt in der digitalen Werkausgabe.
»Wir hatten gelebt wie unter Glas, aufgespießten Käfern gleich, und jedes Zappeln der Beinchen war mit Interesse bemerkt und ausführlich kommentiert worden.« Stefan Heym
»Heyms Lebensleistung: Er ist ein Zeuge des Jahrhunderts, der sich nie auf die Zuschauerrolle beschränkt hat.« Hamburger Abendblatt
Zum Autor:
Stefan Heym, 1913 in Chemnitz geboren, emigrierte, als Hitler an die Macht kam. In seiner Exilheimat New York schrieb er seine ersten Romane. In der McCarthy-Ära kehrte er nach Europa zurück und fand 1952 Zuflucht, aber auch neue Schwierigkeiten in der DDR. Als Romancier und streitbarer Publizist wurde er vielfach ausgezeichnet und international bekannt. Er gilt als Symbolfigur des aufrechten Gangs und ist einer der maßgeblichen Autoren der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Er starb 2001 in Israel.
Besuchen Sie uns auf www.cbertelsmann.de und Facebook.
Stefan Heym
Der Winter unsers Mißvergnügens
Aus den Aufzeichnungen des OV Diversant
Die Originalausgabe erschien 1996 bei btb in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
E-Book-Ausgabe 2021
Copyright © 1996 by Inge Heym
Copyright © 1996 by btb in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München
Copyright © dieser Ausgabe 2021 by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlagkonzeption und -gestaltung: Sabine Kwauka, München nach einem Entwurf von Hafen Werbeagentur, Hamburg
Umschlagmotiv: © grisdee / Shutterstock.com
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN978-3-641-27831-1V002
www.cbertelsmann.de
Ohne die Loyalität und Hilfe meiner Frau Inge zu jener Zeit und ohne ihren Rat, ihre Kritik und ihre Mitarbeit heute wäre dieses Buch wohl kaum zustande gekommen. Ihr gilt mein ganzer Dank.
Stefan Heym
EINLEITUNG
Die Republik in der Mitte Europas, die einst DDR hieß, ist im Begriff, zu einer Art Atlantis zu werden, einem Mythos, um den Gegner wie Freunde des verschwundenen Landes sich mühen, ob sie nun Kenner der Materie sind oder nicht, auf eine objektive Darstellung bedacht oder eher von Vorurteilen besessen.
Die Beschäftigung mit der Geschichte der DDR ist jedoch von mehr als akademischem Interesse; ihre Einflüsse reichen bis in die Gegenwart der nunmehr vereinten, aber immer noch von ihrer jeweiligen Vergangenheit geprägten Ost- und Westdeutschen; die Zeugnisse dieser Vergangenheit mögen den Heutigen helfen, die Zeit damals besser zu verstehen, aber auch die Courage zu erkennen, mit der einzelne DDR-Bürger es unternahmen, öffentlich zu vertreten, was sie für gut und richtig hielten.
Mein Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag hieß auch, daß ich die Gastrolle aufgeben mußte, die man mir in dessen Enquêtekommission zur Untersuchung der Geschichte der DDR angetragen. Vielleicht kann »Der Winter unsers Mißvergnügens«, neben andern Zwecken, auch als nachträglicher Beitrag zur Arbeit dieser Kommission dienen.
*
Nach der Biermann-Affäre im November 1976 setzte ein Exodus von DDR-Künstlern ein. Ich hatte Verständnis für sie, obwohl ich es für richtiger hielt, wenn irgend möglich im Lande zu bleiben und zu versuchen, ein jeder auf seine Weise, die Zustände zu verändern.
Unter denen, die da gingen, war einer der Prominentesten der Schauspieler Manfred Krug, selber Mitunterzeichner der Petition gegen die Ausbürgerung Biermanns. Auf ihn war ich seit seiner Übersiedlung ins westdeutsche Exil schlecht zu sprechen, weil er sein Tagebuch über Interna der Vorgänge dem Genossen Werner Lamberz, Mitglied des Politbüros, hatte zukommen lassen. Für mich bedeutete die Auslieferung an offizielle Stellen, von Informationen, wie sie in solchen Aufzeichnungen enthalten sein mußten, Verrat an Freunden und Gleichgesinnten, mit entsprechenden Folgen für diese.
Ich selber hatte an einem Projekt ganz ähnlicher Natur gearbeitet: einer täglichen Niederschrift meiner Gedanken, Erlebnisse und Begegnungen in den anderthalb Monaten zwischen der Biermann-Ausweisung und Weihnachten 1976 –, nur daß ich mein Manuskript, da ich es für zu riskant hielt, um es alsbald zu veröffentlichen, an vermeintlich sicherer Stelle aufbewahrte.
Narr ich, der ich nicht ahnte, daß IM Frieda, kaum daß ein paar Seiten aus meiner Maschine in den Papierkorb flogen, diese oder entsprechende Schnipsel in die konspirative Wohnung »Kurt« zu Oberleutnant Scholz von der Hauptabteilung XX des Ministeriums für Staatssicherheit trug; wenig später dann beschafften sich die Genossen mit Hilfe eines Nachschlüssels, für dessen Herstellung unsre Frieda den Wachsabdruck geliefert hatte, das ganze Skript und kopierten es; mit dieser Kopie arbeiten meine Frau und ich jetzt.
Krug, das gestehe ich ihm zu, hatte nur bewußt und aus gutem persönlichen Grunde der Behörde abgeliefert, was mir dank meiner Sorglosigkeit wegeskamotiert worden war; und heute, etwa zwanzig Jahre nach dem Geschehen, geben wir nun beide unsre Manuskripte in Druck.
*
Und nun zu IM Frieda.
Sie hieß tatsächlich Frieda; die Stasi bemühte sich gar nicht erst, nach einem phantasievollen IM-Pseudonym für die neue Haushaltshilfe bei Heyms zu suchen. In den Akten findet sich, säuberlich aufgeklebt, als erstes die Kleinanzeige aus der Berliner Zeitung, auf die hin sie sich im Hause Heym vorstellte; nur Tage später begann man im Ministerium, sich für ihre Person zu interessieren; und nachdem sie die annoncierte Stelle tatsächlich antrat, wurde beschlossen, die Frau anzuwerben.
Die Leutnants Tischendorf und Scholz, die sich bei ihr als harmlose Volkspolizisten auf der Suche nach Kleinkriminellen in Köpenick einführten, verstanden einiges von Psychologie: sie spielten auf unsrer Frieda proletarischen Instinkten.
Am 27. April 1971 berichteten sie:
Bei den Aussprachen wurde das Gespräch so gelenkt; daß der Kandidatin klar aufgezeigt werden konnte, wie in unserem Staat alles mit den Arbeitern und alles für die Arbeiter getan wird. Der Kandidatin wurde auch dargelegt, daß es bei uns immer noch Schmarotzer gibt, die sich auf Grund ihrer Persönlichkeit einbilden, etwas Besonderes zu sein und Sonderrechte haben zu müssen. Hierbei wurde indirekt auf Erscheinungen bei einzelnen Kulturschaffenden hingewiesen, die versuchen, auf Kosten besonders der Arbeiterklasse zu leben, ohne selber an der Gestaltung unserer sozialistischen Gesellschaft teilzunehmen. Im Verlaufe der Gespräche kam die Kandidatin von sich aus auf Heym zu sprechen und brachte zum Ausdruck, daß dieser ihrer Meinung nach einer von der beschriebenen Kategorie von Kulturschaffenden sei. Daraufhin wurde die Kandidatin immer mehr zur Bearbeitung des Heym herangezogen …
Sie gab eine Selbstverpflichtung ab, handschriftlich, lernte ein paar geheimdienstliche Tricks und erhielt vom Ministerium ein Monatsgeld in Höhe von 100 Mark, plus Prämien und kleinen persönlichen Geschenken.
Ihr Aufgabenbereich wurde folgendermaßen umrissen:
Durch gute Arbeit und unauffälliges Verhalten das Vertrauen des Heym und seiner Lebensgefährtin Inge Wüste voll gewinnen und das sich anbahnende Vertrauensverhältnis weiter ausbauen.
Feststellung politischer Auffassungen und Meinungen aller im Hause des Heym befindlichen Personen.
Feststellungen des Verbindungskreises des Heym, von Besuchen und Feierlichkeiten sowie Einschätzung der Charaktere derselben.
Feststellung der eingehenden operativ interessanten Postsendungen, Literatur, ausländische Zeitungen, Zeitschriften usw. Ermittlung von literarischen Arbeiten, die Heym vorbereitet. Insbesondere solche Arbeiten, die er in Westberlin, Westdeutschland oder dem kap. Ausland veröffentlichen will.
Beschaffung von Hinweisen über Verbindungen, Kontakte und andere operativ interessante Momente durch konspirative Durchsuchung des Schreibtisches, des Papierkorbs, der Bücherablage u. a. in der Wohnung des Heym.
Schaffung von Voraussetzungen zur Einleitung andrer politisch-operativer Maßnahmen, die der Aufdeckung und Dokumentierung schädlicher und strafrechtlich relevanter Handlungen des Heym dienen.
Frieda bewährte sich offenbar zur vollen Zufriedenheit ihrer Führungsoffiziere, denn am 26. Juni 1974 bestätigte Oberstleutnant Müller einen kühnen Vorschlag von Leutnant Scholz.
Im Kampfprogramm der Abteilung zum 25. Jahrestag der DDR ist die Verpflichtung enthalten, in der Bearbeitung des OV »Diversant« weitere schriftliche Aufzeichnungen und Dokumente des Schriftstellers Stefan Heym konspirativ zu beschaffen und zu dokumentieren. Zur Realisierung dieser Verpflichtung wird vorgeschlagen, durch den IMV »Frieda« während des Urlaubs des Heym, den dieser mit seiner Familie ab 8. Juli 1974 in Frankreich verbringt, die Tagebuchaufzeichnungen des Heym konspirativ beschaffen zu lassen und diese fototechnisch zu dokumentieren.
Bei der Auftragserteilung wird der IMV besonders auf die bei der Realisierung des Auftrags notwendigen Vorsichtsmaßnahmen hingewiesen. Die Organisierung erfolgt so, daß die Unterlagen nur für kurze Zeit aus dem Hause des Heym entfernt werden und der IMV sie noch am gleichen Tag wieder am Aufbewahrungsort ablegt.
Die fototechnische Dokumentierung erfolgt in der Bildstelle des MfS, um jedes technische Risiko auszuschließen. Mit der Bildstelle wird vorher der genaue Termin vereinbart. Der IMV wird beauftragt, nach der Rückkehr des Heym aus dem Urlaub zu kontrollieren, ob Heym etwas von der kurzzeitigen Entfernung der Unterlagen bemerkt hat oder anderweitig Verdacht schöpfte.
Um Bestätigung dieses Vorschlags wird gebeten.
Scholz, Leutnant
Nein, ich habe nichts bemerkt und auch anderweitig keinen Verdacht geschöpft. Die Anerkennung der Arbeit von IM Frieda folgte auf dem Fuße.
Berlin, 7. Oktober 1974
Auszug aus dem
Befehl Nr. K. 3283/74
Für besondere Leistungen, verantwortungsbewußte Tätigkeit, Initiative und hohe persönliche Einsatzbereitschaft bei der Erfüllung übertragener Aufgaben zur Stärkung und Sicherung unserer Arbeiter-und-Bauernmacht
zeichne ich
anläßlich des 25. Jahrestages der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik aus:
Frieda Schmitz
mit der
Verdienstmedaille der NVA in Bronze.
Die Medaille, Urkunde und 250.– M wurden dem IMV »Frieda« am 2.10.1974 durch Ltn. Scholz überreicht.
gez. Mielke
Generaloberst
Friedas wahrhaft große Zeit, mit den großen Geschenken, kam jedoch später erst, 1976, mit der Vertreibung des Wolf Biermann aus der Deutschen Demokratischen Republik.
Mit der Begründung, Durch den IM konnten in der operativen Bearbeitung des Operativ-Vorgangs »Diversant«eine Reihe operativ bedeutsamer Hinweise zur bearbeiteten Person und eine Vielzahl operativ wertvoller Informationen erarbeitet sowie wichtige Unterlagen konspirativ gesichert und dokumentiert werden, schlug ihr nun zum Oberleutnant beförderter Führungsoffizier Scholz am 28.2. 1977 vor,
Vorschlag
Den IMV »Frieda«,
46 fahre, parteilos
anläßlich des Internationalen Frauentags 1977 mit einem Sachgeschenk in Form eines Fernsehgerätes im Wert von
2000,– Mark (zweitausend)
auszuzeichnen.
Gez. Scholz
Oberleutnant
Gegengez. Leiter der Operativ-Gruppe
Müller, Oberstleutnant
*
In der Normannenstraße in Berlin-Lichtenberg, über den weiten, gepflasterten Hof hinweg und die Treppen hinauf, gelangten wir in die schmutzfarbenen Korridore, durch welche die mit uns befaßten Kameraden von der unsichtbaren Front schon gewandelt, und saßen in den schmutzfarbenen Räumen, in denen auch sie gehockt, und ihre Aktenstöße häuften sich vor uns. Ich hieß OV Diversant, erfuhr ich – OV ist Operativer Vorgang –, meine Frau OPK Film – OPK gleich Operative Personenkontrolle. Und da lag tatsächlich auf dem zerkratzten Pult das Manuskript, dem die Stasi den Arbeitstitel 16. November 1976 gegeben und welches ich dann Der Winter unsers Mißvergnügens nannte, nach Shakespeare, Richard III, Act One, Scene One. Daneben fanden sich weitere Akten, eine ganze Kollektion von Feststellungen und Vermutungen über den Schriftsteller Heym und dessen Familie, beginnend in den frühen Fünfzigern und endend mit dem Kollaps der Republik; nur nach 1980 fehlten Teile: In den letzten Monaten des alten Staates hatte mir einer, der es wissen mußte, noch gesagt, »Sie werden sowieso nur lesen, was Sie lesen sollen.«
Aber selbst diese Auswahl genügte, um einen das Gruseln zu lehren. Wir hatten gelebt wie unter Glas, aufgespießten Käfern gleich, und jedes Zappeln der Beinchen war mit Interesse bemerkt und ausführlich kommentiert worden.
Und doch – in jenem Winter unsers Mißvergnügens war etwas Neues entstanden. Ein Bruch hatte sich gezeigt in dem scheinbar so fest gefügten System, ein Bruch, der nicht mehr verdeckt werden konnte, ein innerer Widerstand, kollektiv dazu noch, der nicht mehr zu verschweigen war. Zurückblickend möchte ich sagen, daß hier ein Menetekel erschienen war, ankündigend das Ende des real existierenden Sozialismus – nicht ohne Grund hatte man ihn so präzisiert –, das Ende dieser mißratenen Revolution, dieser Republik ohne eigne Legitimierung.
Von den Akteuren selber erkannte das seinerzeit kaum einer; erst heute wird klar, was da ausgegangen war von dem kleinen Kreis einiger Schriftsteller: ein Funke war übergesprungen zu Menschen im ganzen Land, die plötzlich darauf bestanden, sich zu Wort zu melden – eine Art Wende, die Keim und Vorgängerin war jener späteren, großen. Darum auch, denke ich, soll dieses Buch jetzt an sein Publikum kommen, denn das Publikum von heute gehört großenteils schon einer Generation an, welche jene Zeit nicht mehr bewußt miterlebt hat – deren gutes Recht es jedoch ist, Näheres über eine der folgenreichsten Episoden in der Geschichte der DDR zu erfahren. Gewiß, es gibt auch Dokumentarbände dazu. Aber den Dokumenten, so klug zusammengestellt sie auch sein mögen, fehlt die Atmosphäre, der Atem.
Ich hoffe, der Leser wird, im nachhinein, noch einen Hauch davon verspüren.
DIENSTAG, 16. NOVEMBER 1976
[1] Zweiter Städtischer Friedhof Berlin-Pankow, Begräbniskapelle, Inneres. Wasserflecke an den Wänden, abbröckelnde Farbe. Vorn Mitte eine hölzerne Säule, etwa einen Meter hoch, darauf die Urne; auf der Urne ein Gebinde von Nelken. Weiter vorn kleine Schar von Trauergästen, meist ältere Leute; ein jüngerer Mann in Nylonkutte, er ist der Vertreter der Gewerkschaft des Betriebs, in dem der Verstorbene einst gearbeitet hat.
Hinter der Säule der Pfarrer; gelegentlich aus seiner Bibel zitierend, er hat das schon Hunderte Male gesagt, predigt er von der Vergänglichkeit des Menschen, alles in Gottes Hand, von der Hölle, von Auferstehung und himmlischem Trost, auch vom Sohne Gottes, der gekommen ist, die Sünden der Menschen auf sich zu nehmen. Mir ist, als blicke er mich dabei strafend an, vielleicht wegen meines Buchs über den König David, aus dessen Haus auch der Jesus von Nazareth gestammt haben soll, vielleicht überhaupt. Kaum ein Wort über den Toten, dessen sicher sündiges Leben und langes Leiden, acht Jahre Prostatakrebs.
[2] Ratskeller im Rathaus Pankow, Totenschmaus. Mir gegenüber die alte Frau, die Augen verweint. Hat sie ihn geliebt, hat sie ihn nicht geliebt, es waren viele Jahre ihres Lebens.
Das Licht geht aus, anscheinend ist irgendwo ein Defekt in der Leitung – im Rathaus? In ganz Pankow? In ganz Berlin? Die Kellnerin bringt Kerzen. Man ißt weiter, den Nachtisch.
Inge, die neben der alten Frau sitzt, blickt mich an. Eigentlich wollte ich diesem Essen fernbleiben, ich bin dem Tod oft genug begegnet, aber Familie ist schließlich Familie, der Verstorbene war Inges Vater, sie hat die ganzen letzten Wochen mitleidend durchgemacht, so auch dieses noch, aber nun will ich nach Hause, während sie bei der Mutter bleiben wird.
Ich treibe zum Aufbruch. Mein Sohn kommt mit mir.
[3] Die Lichter in Pankow sind ausgegangen. Im Tor des Ratskellers weist der Geschäftsführer ankommende Gäste ab. Die Läden sind geschlossen. Die S-Bahn funktioniert aber.
Inneres des S-Bahn-Waggons. Mein Sohn sitzt neben mir, er ist einen Kopf größer als ich, trägt graue Kutte, das Haar lang. Wir schweigen. Er neigt nicht dazu, seinen Emotionen Ausdruck zu geben, wie denn diese ganze junge Generation ihren Überschwang nur in der Musik zeigt und in ihrer Haltung zur Musik, sonst aber sich distanziert verhält, Eltern, Erzieher und Behörden frustrierend.
Ich versuche zu lesen, stecke die Zeitung wieder in die Manteltasche, blicke aus dem Fenster. Trübes Wetter, die Berliner Industrielandschaft. Ich möchte noch etwas arbeiten zu Hause, viel wird es nicht werden, für den Spätnachmittag hat sich Herr Henniger angesagt, der Sekretär des Schriftstellerverbandes; er möchte, sagt er, mit mir wegen meiner für Freitag angesetzten Lesung in Westberlin sprechen.
Ich denke nach: Es wird wohl um den Ausschluß des Reiner Kunze aus dem Verband gehen, Henniger wird wissen wollen, was ich zu sagen plane, wenn ich in Westberlin deswegen befragt werde; davon wird das Visum abhängen. Unverständlich ist mir nur: einerseits Ausschluß Kunzes aus dem Verband wegen seiner »Wunderbaren Jahre«, andererseits darf Biermann nach dem Westen reisen und dort auftreten, ist in der Tat schon abgereist. Seit September, seit meiner Talk-Show in Köln, haben wir einander nicht gesehen, auch vorher selten genug; wie ich erfahren habe, hat er sich abfällig über mein Auftreten dort geäußert.
Nach der Talk-Show war ich bei Böll gewesen.
[4] Oktober 1976
Stube in einem Bauernhaus in der Eifel, bescheiden möbliert. Am Tisch Heinrich Böll, seine Frau, ich. Wir reden über die Gegend, die ich kenne, vom Krieg her, Monschau, Aachen, hier war die Schlacht im Hürtgen-Wald, Böll erzählt, daß die Bauern jetzt noch auf den Feldern Schrapnelle finden, Helme, Knochen, was so bleibt von einer Schlacht.
Dann schiebt Böll mir das Kunze-Buch zu, über das er gerade für die Hamburger »Zeit« eine Besprechung geschrieben hat. Ich kenne von dem Buch nur ein paar Auszüge; heute morgen in der Zeitung las ich sie.
Da kommt etwas auf euch zu, meint Böll. Ich widerspreche. Die maßgebenden Genossen, sage ich, haben hinzugelernt in der Zeit seit dem 11. Plenum, das ist nun auch schon elf Jahre her, doch hat man oft das Gefühl, als wäre es erst gestern gewesen, so einschneidend war das Erlebnis. Die Angriffe auf Havemann, Biermann und mich auf dem Plenum und die stupide Kampagne, die darauf folgte, haben Biermann nur populär werden lassen; er hat das sogar in einem Lied ironisch bedichtet. Jetzt reden sie nicht mehr über Biermann, obwohl der sie sicher auch heute noch ärgert; also werden sie auch still sein über Kunze, und in vier Wochen spätestens wird niemand mehr von seinem Buch sprechen.
Täuschen Sie sich nur nicht, sagt Böll.
Wir leben jetzt in einer anderen Zeit, sage ich.
[5] Es ist still im Haus. Inge ist, nach dem Totenschmaus, noch bei ihrer Mutter, der Junge ist irgendwohin gegangen. Endlich komme ich zur Arbeit, ich kann mich konzentrieren, ich sitze an einem psychologisch schwierigen Kapitel des »Collin«, ich schreibe es schon zum dritten Mal, diesmal scheint es zu werden, eine Seite Text habe ich schon. Aber was wird, wenn ich das ganze Buch fertig habe? Mit dieser Thematik wird es hier nie erscheinen.
Das Telephon. Die Verständigung ist schlecht, das Gespräch kommt aus Westberlin, vom Büro der New York Times. Ellen Lentz sagt, wissen Sie schon, daß Wolf Biermann ausgebürgert worden ist und nicht zurückdarf in die DDR? Ich sage, unmöglich, das gibt es doch gar nicht, Biermann hat ein gültiges Visum, Aus- und Wiedereinreise, sonst wäre er doch gar nicht gefahren. Woher haben Sie das?
Von ADN, eben über den Ticker gekommen. Sie liest vor:
[6] Dokument
Die zuständigen Behörden der DDR haben Wolf Biermann, der 1953 aus Hamburg in die DDR übersiedelte, das Recht auf weiteren Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik entzogen.
Diese Entscheidung wurde auf Grund des »Gesetzes über die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik – Staatsbürgerschaftsgesetz – vom 20. Februar 1967«, Paragraph 13, nach dem Bürgern wegen grober Verletzung der staatsbürgerlichen Pflichten die Staatsbürgerschaft der DDR aberkannt werden kann, gefaßt.
Biermann befindet sich gegenwärtig in der Bundesrepublik Deutschland. Mit seinem feindseligen Auftreten gegenüber der Deutschen Demokratischen Republik hat er sich selbst den Boden für die weitere Gewährung der Staatsbürgerschaft der DDR entzogen. Sein persönliches Eigentum wird ihm – soweit es sich in der DDR befindet – zugestellt.
[7] Danke, sage ich, das genügt.
Was meinen Sie denn nun dazu? fragt Ellen Lentz.
No comment, sage ich, ich muß das erst mal verdauen.
Ich lege meine Papiere zur Seite, schließe die Schreibmaschine, froh, daß ich etwas Mechanisches tun kann. Die Sache erscheint mir immer noch nicht glaubhaft – aber der Ton und die Sprache sind unverkennbar: die Meldung ist echt.
Die diese Entscheidung getroffen haben, wissen sie denn nicht, welchen Sturm sie ernten werden – und nicht nur außerhalb der Grenzen der Republik? Jeder Schriftsteller hier, der das Salz auf seinem Stück Brot wert ist, wird sich auflehnen gegen diesen Beschluß, denn er muß sich selbst getroffen fühlen: heute Biermann, morgen er. Jede wirkliche Kritik würde verstummen müssen, jede realistische Darstellung unseres Lebens gestrichen werden aus Büchern und Stücken, das Ausbürgern würde sich einbürgern, wenn jetzt nicht gesprochen wird.
Sind diese Leute so töricht, so blind? Oder haben sie Angst? Angst wovor? Angst vor dem kleinen Biermann mit seiner Gitarre? Nun erst wird er doch groß werden, nun erst werden auch die in unsrer Republik, die ihn noch nicht kannten, von ihm hören, ihn am Fernsehschirm sehen, und Biermann mit seinem Talent, den Finger auf das Schlimme zu legen, wird unwiderlegbar werden.
Ich rufe bei Hermlin an. Er weiß noch nichts, ist schockiert. Hermlin ist kein Freund Biermanns, das ist mir bekannt; Biermann hat freche Verse über ihn und freche Briefe an ihn geschrieben, obwohl Hermlin den Dichter Biermann mit aus der Taufe gehoben und ihn auch später oft verteidigt hat; Hermlin ist ein Homme des Lettres, für ihn ist wichtig: die Begabung.
Ich sage, vielleicht sollten wir uns über die Sache unterhalten. Er schlägt vor, Samstagnachmittag, zum Kaffee. Heute ist Dienstag – das wäre in vier Tagen.
Meinetwegen, sage ich.
Wieder das Telephon, irgendein Mensch vom Westdeutschen Rundfunk, sagt er. Ob ich über Biermann wisse.
Ich gestehe, daß ich weiß und sehr überrascht bin.
Weiter hätte ich nichts dazu zu sagen?
Nein, sage ich, und ich gäbe prinzipiell keine Telephon-Interviews.
Er hängt auf. Da kann ja jeder kommen und sagen, er sei vom Westdeutschen Rundfunk. Ich habe monatelang anonyme Anrufe bekommen, offensichtlich provokatorischer Natur, einmal wurde ich zur Staatssicherheit bestellt, ein andermal gab der Anrufer sich als Mitarbeiter des Staatsrats aus und wollte mir eine geheime Telephonnummer verschaffen; der phantasievollste Anruf kam angeblich aus Stuttgart, von den Mercedes-Werken, die Regierung der DDR habe mehrere Mercedes-Wagen zu Geschenkzwecken bestellt, einer davon sei für mich bestimmt, welche Farbe ich denn haben möchte und welchen Typ. Ich bestellte einen kanariengelben. Irgendwelche Aufregungen gibt es in diesem Lande immer.
Jetzt klingelt es an der Haustür. Es wird wohl der Herr Henniger sein, verspätet zwar, aber doch.
[8] Wohnzimmer. Auf dem dunkelroten Zweisitzer, gebaut für Damenhintern aus der Zeit der Queen Victoria, der Sekretär des Schriftstellerverbandes, ein mittelgroßer Mann mit wenig markanten Gesichtszügen; er ist sichtlich verlegen.
Worum es denn gehe, verlange ich zu wissen, was mir denn die Ehre seines Besuchs verschaffe.
Ja, meine Reise nach West-Berlin.
Reise ist gut, sage ich, das ist eine Viertelstunde Fahrt nach Kreuzberg.
Na ja, sagt er, und zieht aus der Aktentasche die Photokopie eines Plakats, das die Lesungsreihe der Berliner Handpresse im Künstlerhaus Bethanien ankündigt. Als erster lesender Dichter war angekündigt Reiner Kunze, der ist durchgestrichen, als nächster komme ich, an diesem Freitag, zwei Wochen später Günter Kunert; weitere Autorenlesungen, Namen kleingedruckt, sind geplant. Ob ich denn wisse, daß es sich um eine Serie handle.
Ich versuche, ihm etwas über die Veranstalter zu erklären, die Berliner Handpresse, zwei Graphiker, sie drucken, mit der Hand, dreihundert Exemplare, jede Zeile handgesetzt, jede Illustration drei- oder viermal durch die Maschine gezogen, dann die Bücher handnumeriert, handsigniert von Graphikern und Autoren; in anderen Worten, zwei Idealisten, die keineswegs politische Absichten hatten, als sie Reiner Kunze an die Spitze ihrer Lesungsreihe setzten.
Aber Jurek Becker, sagt er, stünde auch auf dem Plakat, allerdings nur kleingedruckt, und Jurek Becker wisse von nichts. Und im übrigen, was werde ich sagen, wenn bei meiner Lesung die Rede auf Kunze kommt?
Meine Meinung, sage ich, die ich ja auch sehr klar in meinem Brief an das Präsidium des Verbandes zum Ausdruck gebracht habe.
Er tut erstaunt, vielleicht ist er wirklich erstaunt. Er kenne keinen solchen Brief von mir. Ich sage, der Brief ist vor einer Woche, per Einschreiben, an das Präsidium geschickt worden, länger als 48 Stunden könne er kaum gelaufen sein.
Und was steht in dem Brief?
Ich zitiere kurz, aus dem Gedächtnis.
[9] Dokument
An das Präsidium des
Schriftstellerverbandes der DDR
Friedrichstr. 169
108 Berlin
8. November 1976
Werte Kollegen,
Das »Neue Deutschland« hat bestätigt, daß Reiner Kunze mit Billigung des Präsidiums aus dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen worden ist.
Aufgabe unseres Verbandes ist es, seine Mitglieder zu schützen und ihre Interessen zu vertreten, nicht aber, Schriftsteller zu bestrafen oder gar aus den Reihen des Verbandes auszustoßen, wenn sie ein kritisches Buch schreiben.
Ich protestiere daher gegen den Beschluß des Präsidiums und distanziere mich davon.
Stefan Heym
[10] Henniger protestiert seinerseits: Kunze sei nicht wegen seines Buchs aus dem Verband ausgeschlossen worden, sondern weil er gegen das Statut verstoßen habe.
Hat er das? frage ich und wundere mich laut, wieso der Ausschluß dann erst nach der Veröffentlichung seines Buchs erfolgt sei. Doch gebe ich Henniger zu verstehen, mir liege nichts an einer Kontroverse: Ich würde tunlichst vermeiden, die Angelegenheit Kunze in Westberlin aufs Tapet zu bringen; allerdings könnte ich Fragen nicht ausweichen, die man mir bei der Lesung eventuell stellen würde – schon deshalb nicht, weil Kunze vor mir an der Reihe gewesen sei.
Kunze habe gar keinen Antrag auf Ausreise nach West-Berlin gestellt, versichert Henniger.
Ich nähme das zur Kenntnis, sage ich, und würde das den Leuten, die sich dieserhalb erkundigten, auch mitteilen.
Verlegenheitspause.
[11] Dialog
Henniger: Als ich jetzt im Auto herausfuhr, kam gerade die Nachricht, daß Biermann die Staatsbürgerschaft entzogen worden ist.
Heym: Ach nein. Das ist ja eine Überraschung.
Henniger: Das wurde begründet – Verletzung seiner staatsbürgerlichen Treue. Und ich nehme an, das habe ich nun nicht am Radio gehört, aber ich habe gelesen, die Kölner Veranstaltung, siebentausend Menschen, ich habe es nicht gesehen, aber was ich der Westpresse entnehme, daß er da wieder, schon was die Proportionen betrifft, in der Hauptstoßrichtung gegen die DDR gegangen ist.
Heym: Ich habe nur ein Lied gehört, am Fernsehen, das Lied vom abgehackten Fuß, und das richtet sich nicht gegen die DDR. Aber was halten Sie denn nun davon?
Henniger: Das, was ich – also ich habe nichts bei der Hand, aber was ich gelesen habe – und auch gehört – also ich …
Heym: Ist es denn üblich, daß Schriftsteller bei uns ausgebürgert werden? Das ist doch ein Brauch, der in eine Zeit zurückreicht, wo – in die Nazizeit also.
Henniger: Das handelt sich doch nicht speziell um Schriftsteller oder Nicht-Schriftsteller. Soweit ich weiß, geht es, sagen wir mal um die Loyalität des Bürgers gegenüber dem Staat, statt sich einzureihen in eine Kampagne, die gegen uns im Gange ist.
Heym: Nein, das hätte ich nicht erwartet, diesen Schritt. Das sieht nämlich so aus, als ob man Biermann herausgeschickt hätte, um ihn durch diese Regelung bequem loszuwerden.
Henniger: Das würde ich nun nicht sagen. Das ist ja nach seinem Auftreten geschehen.
Heym: Der Beschluß sollte so rasch gefaßt worden sein? Biermann tritt einmal auf, und da ist der Beschluß? Das kann ich mir doch gar nicht denken.
Henniger: Was da drüben im einzelnen geschehen ist, was in den Kommentaren zu lesen war, ist doch – nun, recht böse. Weil da immer verallgemeinernde Äußerungen kamen gegen – gegen …
Heym: Ich weiß aber aus einem Bericht von Herrn Zehm in der »Welt«, daß die da drüben sehr unzufrieden waren mit dem Auftreten Biermanns. Zehm hat sich sogar beschwert, daß Biermann so sehr für die DDR eingetreten sei. Biermann hat sich ja sogar von Kunze distanziert, hat gesagt, der Ausschluß ist falsch, aber Kunze ist kein Sozialist, während er, Biermann, einer sei.
Henniger: Das habe ich auch gelesen. Aber Biermann hat sich doch in hohem Maße gegen Kunzes Ausschluß gewandt … (Henniger öffnet seine Aktentasche und zieht ein Bündel Zeitungsausschnitte heraus. Liest vor) »alle Schriftsteller der DDR seien empört über den Ausschluß Kunzes aus dem Schriftstellerverband, sie fühlten sich selbst bedroht. Jurek Becker habe ihn beauftragt, bei jeder Gelegenheit öffentlich mitzuteilen, daß auch er, wie andere, leidenschaftlich dagegen protestiere. Jurek Becker und andere erklärten das auch bei ihren Lesungen in der DDR.« (Henniger wendet sich mir zu) Jurek Becker sagte mir gestern, er habe Biermann vor dessen Abreise zwar seine Meinung gesagt, aber ihn in keiner Weise beauftragt.
Heym: Aber schauen Sie –
Henniger: Das ist auch sicher nicht der eigentliche Grund.
Heym: Aber die Bürger ausschließen aus einem Lande, sie ausbürgern, je nach dem, was eine Westzeitung schreibt …
Henniger: Nein, das sicher nicht, das sicher nicht. Ich habe nur Teile des Programms gesehen, aber …
Heym: Wir werden’s ja jetzt zu sehen kriegen –
Henniger: Jetzt –
Heym: Jetzt werden wir wahrscheinlich jede Minute des Biermannschen Auftritts zu sehen bekommen.
Henniger: Ich habe ja nicht die ganze Sendung gesehen …
Heym: Na ja, gut. Dann werden wir ja in Westberlin einige Fragen bekommen.
Henniger: Ja, ja.
Heym: Wenn ich da rübergehe. Das wird lustig werden. Haben wir sonst noch etwas zu bereden? Ich möchte Sie nur bitten, mir den Paß schon am Donnerstag zuzustellen.
Henniger: Ja, ja. Donnerstag läßt sich machen. Donnerstag nachmittag.
Heym: Wir telephonieren noch mal miteinander.
[12] Allein, an meinem Schreibtisch. Nachdenken über die Sache, über das, was der Mann gesagt hat, was er durchblicken ließ. Ist da überhaupt noch etwas zu retten? Kann die Regierung ihren Schritt korrigieren, ohne ihr Gesicht total zu verlieren? Andererseits kann man diese Ausbürgerung doch nicht schweigend hinnehmen, ich wenigstens nicht. Zu allem haben wir in der Öffentlichkeit geschwiegen, zu allen Dummheiten, Angriffen, Verfälschungen, Verdrehungen, zu den Reden auf dem 11. Plenum, 1965, zum 14. Plenum zehn Jahre später, zu der Rede von Hager – einen Brief habe ich ihm geschrieben, der nicht einmal beantwortet wurde – und habe zuletzt noch geschwiegen zu der Sache Kunze.
Was hat Böll gesagt? Da kommt etwas auf euch zu.
Es ist auf uns zugekommen und weiß der Teufel, wie es ausgehen wird.
[13] Herbst 1956
Charité, II. Medizinische Klinik, Privatstation des Professor Krautwald in der vierten Etage. Ich liege mit Herzgeschichten, die ich nach Brechts plötzlichem Tod prompt entwickelt habe.
Im Nebenzimmer befindet sich, schwer zuckerkrank, der Genosse Johnny Löhr, alter KP-Funktionär, jetzt spielt er irgendeine Rolle in einer der sogenannten Blockparteien. Löhr, literarisch interessiert, hat mir von einem jungen Dichter erzählt, Biermann heißt er; er, Löhr, sei eine Art Ziehvater des Jungen, der leibliche Vater ist im KZ umgekommen. Wenn der Junge nächstes Mal käme, ihn zu besuchen, werde er ihn zu mir hinüberschicken.
Jetzt also: Biermann. Ein untersetztes Kerlchen, große lebendige Augen. Er ist sehr erregt, ich muß unbedingt sofort etwas unternehmen, aufstehen, hinübergehen zur Volkskammer, die die Studenten der Veterinärmedizin zu stürmen beabsichtigen, warum, ja, weil das mal die Mensa der Veterinärmediziner war, ich, Autor der Kolumne »Offen gesagt« in der Berliner Zeitung, könne vielleicht noch verhindern, ich wisse ja, was in der Welt vor sich gehe, er sieht mich an mit hoffnungsvollem Blick, der Junge sucht eine Vaterfigur, geht mir durch den Kopf, aber was ist das mit den Veterinärmedizinern, ein neuer 17. Juni, diesmal von den Studenten her und wegen ihrer konfiszierten Mensa?
Ich werde etwas unternehmen, sage ich, aber aufstehen und zu den Studenten gehen könne ich nicht, ich läge im Krankenhaus, das sehe er wohl.
Dann rufe ich bei Erich Wendt an, damals Chefredakteur der großen Lenin-Ausgabe; Wendt war auch ein Opfer Stalins, Jahre in Sibirien, wie er es überlebt hat, weiß ich nicht.
Wendt ruft später zurück: Ich könne mich beruhigen, die Sache mit den Veterinärmedizinern sei beigelegt.
Da ist ein Junge, denke ich mir, der sich Sorgen macht um seinen Staat; wenn es doch noch viele mehr gäbe wie ihn.
[14] Ich versuche mich zu konzentrieren.
Am besten konzentriere ich mich an der Schreibmaschine. Ich lege Kohlepapier zwischen zwei Bogen, spanne ein. Ich beginne zu schreiben, streiche durch, korrigiere. Nur keine langen Seelenergüsse, kurz muß so etwas sein, lange Erklärungen druckt keiner.
[15] Dokument
Ich protestiere gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann.