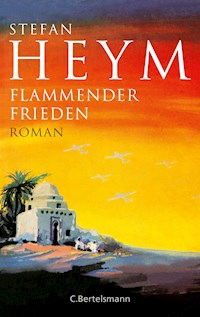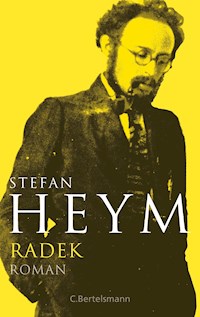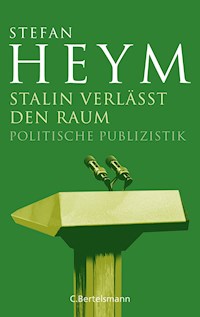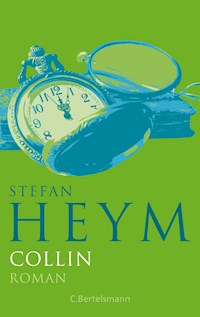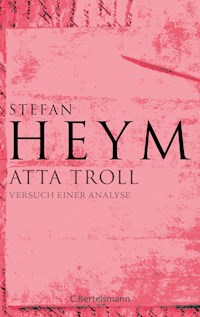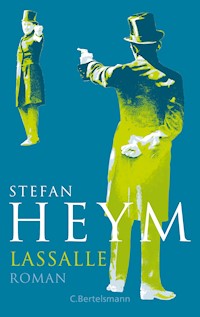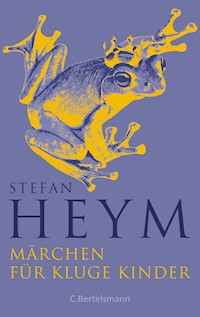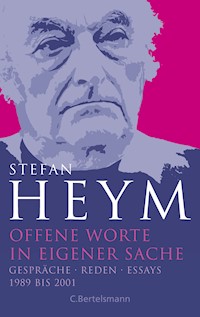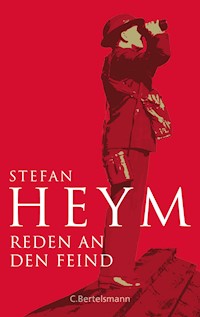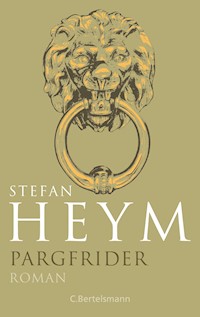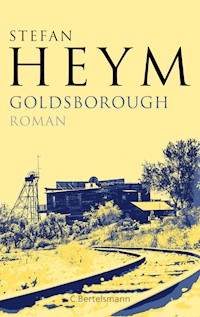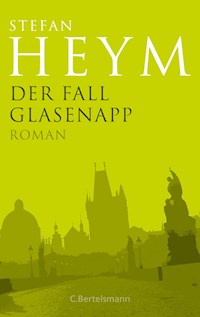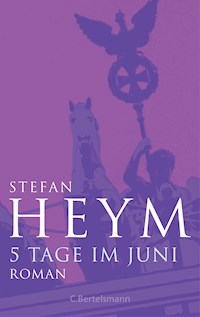15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Stefan-Heym-Werkausgabe, Romane
- Sprache: Deutsch
Ein packender Nachkriegsroman, der die tragische Zerrissenheit dieser Zeit eindrucksvoll spiegelt.
Drei einst unzertrennliche Brüder kehren nach dem Zweiten Weltkrieg nach Prag zurück: Joseph Benda, Besitzer der elterlichen Glashütte und während des Krieges englischer Offizier, der Arzt Karel Benda, der das Konzentrationslager überlebte, und Thomas Benda, sensibler Dichter und Essayist, der in den USA im Exil war. Nun müssen sie erfahren, wie anders alles in der Tschechoslowakei geworden ist. Die drei Brüder gehen angesichts der Wirren im Land sehr verschiedene Wege. In ihren Auseinandersetzungen und Konflikten spiegelt sich die tragische Zerrissenheit jener Zeit.
Stefan Heyms aufrüttelnder Roman über die Nachkriegszeit, bei List Leipzig erstmals 1955 erschienen, endlich wieder lieferbar als Teil der digitalen Werkausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1090
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch:
Drei einst unzertrennliche Brüder kehren nach dem Zweiten Weltkrieg nach Prag zurück: Joseph Benda, Besitzer der elterlichen Glashütte und während des Krieges englischer Offizier, der Arzt Karel Benda, der das Konzentrationslager überlebte, und Thomas Benda, sensibler Dichter und Essayist, der in den USA im Exil war. Nun müssen sie erfahren, wie anders alles in der Tschechoslowakei geworden ist. Die drei Brüder gehen angesichts der Wirren im Land sehr verschiedene Wege. In ihren Auseinandersetzungen und Konflikten spiegelt sich die tragische Zerrissenheit jener Zeit.
Stefan Heyms aufrüttelnder Roman über die Nachkriegszeit, bei List Leipzig erstmals 1955 erschienen, nun Teil der digitalen Werkausgabe.
»Stefan Heym ist neben Franz Fühmann so etwas wie ein Maßstab für unsere vater- und vaterlandslose Generation geworden.« Klaus Schlesinger
Zum Autor:
Stefan Heym, 1913 in Chemnitz geboren, emigrierte, als Hitler an die Macht kam. In seiner Exilheimat New York schrieb er seine ersten Romane. In der McCarthy-Ära kehrte er nach Europa zurück und fand 1953 Zuflucht, aber auch neue Schwierigkeiten in der DDR. Als Romancier und streitbarer Publizist wurde er vielfach ausgezeichnet und international bekannt. Er gilt als Symbolfigur des aufrechten Gangs und ist einer der maßgeblichen Autoren der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Er starb 2001 in Israel.
Besuchen Sie uns auf www.cbertelsmann.de und Facebook.
Stefan Heym
Die Augen der Vernunft
Roman
Die englische Originalausgabe erschien 1951 unter dem Titel The Eys of Reason bei Little, Brown, Boston.
Vom Autor revidierte Übersetzung aus dem Englischen von Ellen Zunk, erstmals erschienen 1955 unter dem Titel Die Augen der Vernunft beim Paul List Verlag, Leipzig
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
E-Book-Ausgabe 2021
Copyright © 1951 Inge Heym
Copyright © dieser Ausgabe 2021 C. Bertelsmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlagkonzeption und -gestaltung: Sabine Kwauka, München
Umschlagmotiv: © photomaster / Shutterstock.com
Satz: Buchwerkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN978-3-641-27842-7V001
www.cbertelsmann.de
Inhalt
Erstes Buch Glas
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Zweites Buch Freiheit
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Nachwort
Valerie Stone
für ihre selbstlose Hilfe, ihre geduldige und ermutigende Kritik in Dankbarkeit und Liebe zugeeignet
Die Freiheit des Menschen unterscheidet sich von jeder anderen Kraft dadurch, daß sich der Mensch dieser Kraft bewußt ist; aber vor den Augen der Vernunft unterscheidet sie sich durch nichts von jeder anderen Kraft. Und die Kräfte der Anziehung, der Elektrizität oder der chemischen Verbindung unterscheiden sich nur dadurch voneinander, daß diese Kräfte von der Vernunft verschieden bestimmt werden. Ganz ebenso unterscheidet sich für die Vernunft die Kraft der Freiheit des Menschen von den anderen Naturkräften nur durch die Definition, welche ihr die Vernunft gibt. Freiheit ohne Notwendigkeit aber, das heißt ohne die Gesetze der Vernunft, welche sie bestimmen, unterscheidet sich durch nichts von der Schwerkraft oder der Wärme oder den Kräften des Wachstums – für die Vernunft ist sie nur eine flüchtige, unbestimmbare Erscheinung des Lebens.
Leo Tolstoi: Zweiter Epilog zu »Krieg und Frieden«
Erstes BuchGlas
Erstes Kapitel
Die Familie würde also wieder vereinigt sein.
Alles war in diesem Krieg in die Brüche gegangen – Wirtschaft, Land, Gesellschaft, Regierung. Aber solange die Familie noch bestand, war eine Grundlage vorhanden, auf der man wieder aufbauen konnte.
Das war ein gesunder und beglückender Gedanke. Aber auch erschreckend – gab es doch in der ganzen Tschechoslowakei kaum eine Familie, die nicht in den Konzentrationslagern oder Gefängnissen, bei Dünkirchen oder am Dukla-Paß oder auf den Barrikaden von Prag einen Angehörigen verloren hatte. Joseph Benda wußte es sehr wohl: er war einer von den fünfhundert Mann, die das tschechische Kontingent in der Royal Air Force gebildet hatten, und er war einer von den ungefähr achtzig Überlebenden. Senkt die Fahnen, dämpft die Trommeln, Schweigen!
Aber die Toten hatten kein Recht, diesen Tag heute zu stören. Karel lebte, Karel kam heim – der Bruder, den man längst als verloren, tot, in irgendeinem Massengrab verscharrt aufgegeben hatte. Und dennoch stand die Familie jetzt hier, als wären sie trauernde Hinterbliebene: Lida mit maskenhaft starrem Gesicht gegen ihre Müdigkeit ankämpfend; sein Bruder Thomas abgespannt und verhärmt; Kitty, die sich zur Selbstbeherrschung zwang. Petra war die einzige, die ihre Lebhaftigkeit bewahrt hatte. Sie konnte nicht still stehen, und selbst wenn sie einen Moment lang auf einer Stelle blieb, wippte sie auf ihren dünnen Beinen auf und ab.
Liegt wohl an der Hitze, dachte Joseph, drei Stunden in dieser Glut. Die Augustsonne wurde in der Bahnhofshalle kompakt und zähflüssig und ranzig. Die Menschen stießen und drängten einander in die Staubstreifen der gelben Strahlen, die schräg durch die großen, schmutzigen Fenster fielen. Sie stießen und drängten ihn und seine Familie.
Lida hatte vielleicht recht gehabt; man hatte sich ins Restaurant im Wartesaal setzen sollen. Aber Kaffee gab es ebensowenig wie Bier, nur trübes, lauwarmes Mineralwasser mit einem ekelhaften Schwefelgeruch. Und außerdem hätte man dort die Ansage überhören können, die den Sonderzug ankündigen sollte.
Irgend etwas mußte aber unternommen werden. Seine Frau und sein Kind und sein Bruder und die Frau seines Bruders erwarteten es von ihm; er war das Familienoberhaupt, und die Uniform, die er trug, verlieh ihm gleichfalls Autorität.
Joseph straffte sich, und sofort fühlte er, wie unbequem ihm die Jacke war. Sie kniff ihn in den Achselhöhlen. Er hätte sich noch in England eine neue kaufen sollen; aber damals ging der Krieg schon seinem Ende zu, und er hatte das Geld nicht ausgeben wollen. Es wäre besser gewesen, heute Zivil zu tragen.
Er ließ die Schultern wieder sinken und sagte: »Das ist doch wirklich wunderbar! Daß wir alle wieder zusammen sein werden – nach so einer langen Zeit!«
»Glaubst du, daß dieser Zug überhaupt jemals ankommt?« fragte Lida. »Könnte nicht jemand gehen und irgendwo nachfragen?«
Joseph erkannte, daß seine wohlgemeinte Bemerkung ihre Wirkung verfehlt hatte, und seufzte verärgert. Lida machte eine Bewegung, als ob sie selbst gehen wollte, aber er hielt sie zurück. »Ich bin schon bei der Auskunft gewesen – zweimal sogar; aber da weiß auch keiner was.«
»Ich versteh das nicht!« Lida tupfte ihr Taschentuch gegen ihre hohe und jetzt verschwitzte Stirn. »In seinem Telegramm steht doch: acht Uhr früh!«
Joseph betrachtete seine Frau. Er hatte einen jener Anfälle von Hellsichtigkeit, wie sie bei ihm häufig vorkamen, seit er vor drei Monaten aus dem Krieg zurückgekehrt war. Damals in England hatte er ihren Mund nicht als so klein und dünnlippig, ihr Lächeln als so gezwungen, ihre Augen als so mißtrauisch in Erinnerung gehabt. Ich kenne sie ja gar nicht mehr, dachte er deprimiert; vielleicht habe ich sie niemals richtig gekannt.
»Immerhin war es nett von ihm, das Telegramm mit ›herzlichst‹ zu unterschreiben«, bemerkte Lida.
Joseph sagte: »Thomas und ich haben sechs Jahre darauf gewartet, Karel wiederzusehen. Wir werden auch noch ein paar Minuten mehr warten können.« Aber seine Worte taten ihm sofort leid. Er war nicht gern unfreundlich, besonders nicht zu seiner Frau, und besonders nicht an einem Tag wie heute.
Thomas griff ein: »Es ist doch kein fahrplanmäßiger Zug, Lida! Und du weißt doch, wie der Krieg den Eisenbahnen hier mitgespielt hat …«
»Ja, ich weiß«, sagte Lida spitz. »Ich war ja hier und hab’s miterlebt.«
Thomas’ voller, sinnlicher Mund preßte sich zusammen. Kitty kannte diesen Ausdruck. Beruhigend legte sie die Hand auf den Arm ihres Mannes und sagte zu Lida: »Wir sind doch nicht gern von hier fortgegangen.«
»Aber fortgegangen seid ihr«, erwiderte Lida.
Thomas fuhr auf. »Es war nicht gerade eine Vergnügungsreise! Was hätte ich nach deiner Meinung denn tun sollen?«
»Karel ist hiergeblieben!« sagte Lida.
»Karel war keine bekannte Persönlichkeit!« Joseph sah, daß die Leute sich umwandten und zu ihm und seiner Familie hinblickten. Er senkte seine Stimme. »Ich mag diese Zankereien nicht. Nicht heute! Und nicht auf dem Wilson-Bahnhof!«
»Du könntest hinzusetzen: Und nicht vor meinem Kind«, schlug Lida trocken vor.
Joseph warf einen raschen Blick auf Petra. Sie hörte mit weit geöffneten Augen zu. Er suchte nach ein paar harmlosen und freundlichen Worten, die er ihr sagen könnte.
»Wie sieht er eigentlich aus?« fragte Petra.
»Wer?«
»Onkel Karel. Wie sieht er aus?«
Joseph fühlte sich erleichtert. Offenbar hatte das Kind die Tragweite des Streites nicht begriffen. »Dein Onkel Karel – ja, weißt du …« Er stockte. Thomas müßte imstande sein, Karel zu beschreiben. Thomas konnte einen Menschen so darstellen, daß er aus den Seiten seiner Bücher geradezu auf einen zuzukommen schien. Aber Thomas stand mit verkniffenem Gesicht da, seine Lippen bewegten sich noch immer, als wollte er etwas sagen, um sich gegen Lida zu verteidigen.
Kitty hatte ihren Arm durch den seinen geschoben und hielt ihre Handtasche wie einen Schild vor sie beide. »Du kannst Karel nicht als Argument gegen Thomas benutzen!« wandte sie sich gegen Lida.
»Karel war ein Idealist«, antwortete Lida. Ihr Lächeln entblößte den Silberzahn in ihrem Munde. Schlechte Dentistenarbeit, Kriegsware. Sie hatte schon seit Wochen die Absicht gehabt, von Rodnik nach Prag zu fahren und sich eine Porzellankrone anfertigen zu lassen, aber immer hatte es an der Zeit gefehlt. Sie bemerkte, daß Kittys Augen sich auf diesen Zahn hefteten, und es ärgerte sie. »Ein großer Idealist, möchte ich betonen!«
Einen Augenblick lang war Kitty verdutzt: Seit wann fand Lida Idealismus so lobenswert, und Karels schon gar! Dann sagte sie: »Er hatte kein Verantwortungsgefühl – er war radikal – er verkehrte mit den falschen Leuten – er brachte es dahin, daß er verhaftet wurde, und er war schuld, daß du die Benda-Werke verlorst – das hast du doch immer behauptet, Lida, oder?«
»Ich kann mich nicht erinnern, daß ich so etwas je gesagt hätte«, erwiderte Lida und starrte ihre Schwägerin an – die schöne Kitty mit den rosigen Wangen, die noch gerundet waren vom Fett Amerikas, mit blanken Augen, die unberührt waren von dem, was andere Leute hatten durchmachen müssen, mit ihren amerikanischen Strümpfen, die die Form ihrer hübschen Beine zur Geltung brachten, und mit den Lippen, die bemalt waren wie die einer Dirne. »Aber ich kann mich wohl erinnern, daß er ein Idealist war!« fügte sie hinzu, und dann, ohne besonderen Nachdruck: »Der einzige Benda, der im Lande blieb!«
»Ich will wissen, wie er aussieht!« Petra war den Tränen nahe. »Ich habe ihn so lange nicht gesehen. Ich versuche immer, die Augen zuzumachen und mir sein Gesicht vorzustellen …«
Lida wandte sich ihrem Kinde zu; der Ausdruck um ihren Mund herum wurde weich. Dieser fragende Klang schnitt ihr immer noch ins Herz. Zuweilen schien es ihr, daß ihr der aggressive Ton, den Petra zur gleichen Zeit entwickelt hatte, lieber war. Das Kind wechselte unmittelbar von einem zum anderen über; beide waren Überbleibsel aus dem Kriege, aus den Jahren, wo Petra Essen verlangt hatte, das nicht zu beschaffen war, oder Fragen gestellt hatte, die sich nicht beantworten ließen; war man doch selber halb verrückt vor Angst: der einzige Polizeibeamte, dachte Lida, der von ihr bestochen war und von dem sie und Petra deshalb Schutz erwarten durften, hätte abgelöst oder sie und Petra hätten festgenommen oder ungeduldig werden können wie Karel und ins Pankrac-Gefängnis geschickt oder nach Deutschland, in ein Lager.
»Du hast doch sein Bild, Petra …«, sagte sie.
»Aber an seine Hände erinnere ich mich noch.« Petra zog die Stirn in Falten und wurde plötzlich ganz still.
Joseph fühlte sich auf sonderbare Art verlegen. »Arzthände«, sagte er.
Lida drang in das Kind. »Dann mußt du dich doch auch an sein Gesicht erinnern!«
»Eben nicht!« sagte Petra unglücklich.
Lidas und Josephs Blicke begegneten einander. »Sie trug Karels Bild immer bei sich, wohin wir auch fahren mußten. Ich hatte ihr auch eins von dir gegeben, aber das ging verloren.«
Joseph zwang sich zu lächeln. »Dein Onkel Karel war ein sehr gut aussehender Mann«, sagte er schließlich.
Lida stimmte zu. »Alle Bendas sind gut aussehende Männer.« Sie berührte die Ordensbänder auf Josephs Brust. »Du kannst sehr stolz auf deinen Vater sein, Petra.«
Joseph zuckte zurück. Aber Lida redete weiter, wies auf die Bändchen und erklärte die Bedeutung eines jeden. Petra hörte höflich zu. Joseph nahm seine Mütze ab und wischte über das feucht gewordene Schweißband.
Warum habe ich den verdammten Affenfrack nur angezogen? dachte er. Muß eine Art Reflexhandlung gewesen sein, wie im Kriege. Als das Telegramm kam, gestern um Mitternacht, griff ich einfach nach der Uniform im Schrank. Ganz automatisch.
Andererseits war das Telegramm gar keine so große Erschütterung für ihn gewesen. Er hatte schon zweimal eine Art Nachricht erhalten – zu unbestimmt für wirkliche Hoffnung, zu indirekt, als daß er darüber zu Lida oder Thomas hätte sprechen können. Ein Arbeiter hatte von einem Mann berichtet, der vor mehr als einem Jahr in Buchenwald gewesen war. Dieser Mann hatte angeblich einen Dr. Karel Benda aus Rodnik gekannt, der irgendwelche untergeordnete Arbeit im Lagerhospital verrichtete. Es war nicht möglich gewesen, Nachforschungen über diese Geschichte anzustellen. Und dann war da ein Brief von einem Geschäftsfreund in Prag gewesen, der schrieb, daß ein Freund von ihm zufällig gehört hätte, wie ein amerikanischer Offizier von der Befreiung von Buchenwald erzählte und von Ärzten, die sich unter den Häftlingen befunden hatten, und besonders von einem Dr. Benda, wenn der Freund dieses Geschäftsfreundes richtig gehört hatte.
Es war alles zu unbestimmt gewesen. Und nun erwies es sich als wahr. Der Krieg war zu Ende; Mai, Juni, Juli waren vorübergegangen. Joseph kniff die Augen zusammen. Warum hatte Karel keine Verbindung mit ihm aufgenommen?
Wieder spürte er das unangenehme Drücken unter den Achseln. Nein, es war kein Reflex gewesen. Er hatte sich so herausgeputzt, weil die Uniform erst es ihm möglich machte, dem Bruder gegenüberzutreten, dessen Gesichtszüge – wie ihm jetzt bewußt wurde – auch er sich nicht mehr ins Gedächtnis rufen konnte.
Die schnarrende Stimme, die aus dem Lautsprecher drang und die Abfahrt und Ankunft der Züge ankündigte, ging Thomas durch und durch, so als kratzte jemand mit dem Fingernagel auf einer Schiefertafel. Eine Wolke von Knoblauchgeruch traf ihn; sie ging von einem alten Gepäckträger aus, der auf einem Sack saß und abwechselnd an einem Stück Brot und einer Knoblauchzwiebel nagte. Die altersfleckige Mauer hinter dem alten Mann war gescheckt durch große Vierecke; hier waren erst vor wenigen Monaten die deutschen Aufschriften übermalt worden. Draußen wurde das nervenzermürbende Geratter der Preßluftbohrer von den Hammerschlägen der Bauarbeiter begleitet. Sie räumten die Umgegend auf, den Schutt von den Luftbombardierungen und Artilleriebeschießungen und von den schweren Kämpfen in den Straßen Prags im Mai. Das Pfeifen der Lokomotiven, das Poltern von Waggons, die auf den Geleisen rangierten, das beständige Summen der Gespräche ringsum vereinigten sich in Thomas’ Ohren zu einem mißtönenden Dröhnen.
Und doch wußte er, daß er es nicht hätte aushalten können, wäre Stille um ihn gewesen.
Er liebte Karel, obgleich er sich nicht gestattet hatte, seinem Kummer freien Lauf zu lassen, als man begann, mit Karels Tod als mit einer Tatsache zu rechnen. Es war das erste Thema gewesen, das Joseph mit ihm bei seiner Heimkehr besprochen hatte. »Ich erfuhr es selber erst, als ich zurückkam«, hatte Joseph gesagt. Thomas hatte das Empfinden gehabt, als ob er Karel schon bei seiner Abreise nach Amerika verloren hätte. Darüber hinaus hatte er nicht den Wunsch gehabt, seine Gefühle zu untersuchen; er hielt sich fern von Joseph, der sich seiner Trauer so intensiv hingab wie jedem Geschäft, das er unternahm. Für Thomas war der große Schock vergangene Nacht gekommen, als Joseph anrief und sagte: »Zieht euch an, du und Kitty. Wir fahren nach Prag, um Karel abzuholen. Er lebt! Ja, Karel lebt! Und er kommt nach Haus!«
Kitty hatte ihm den Schlips binden und die Manschetten zuknöpfen müssen. Er war zu allem unfähig gewesen. Er hatte sich völlig wirr benommen, hatte gelacht und in kurzen, unvollständigen, zusammenhanglosen Sätzen gesprochen. Er hatte sich mehrere Schnäpse eingegossen, und als Joseph vorfuhr, war er angetrunken gewesen, und Kitty hatte ihm in den Wagen helfen müssen. Den größten Teil des Weges von Rodnik nach Prag hatte er mit Unterbrechungen geschlafen, und jetzt drang durch das Getöse des Bahnhofs wie Grillengezirp das ständige feine Klingen seines Kopfschmerzes.
Thomas versuchte, seine Gedanken wieder auf Karel zu lenken. Er hoffte, seines Bruders Heimkehr würde glücklicher sein als seine eigene. Karel würde wahrscheinlich gut mit allem fertig werden.
Besser als er selbst. Besser als Joseph. Er sah, wie unbehaglich Joseph sich in seiner Uniform fühlte. Was für einen Grund hatte Joseph, sich unbehaglich zu fühlen? Joseph konnte für die Kriegsjahre etwas aufweisen – Ordensbänder, ehrenvolle Erwähnungen, einen konkreten Anteil am Sieg und an der Befreiung des Landes. Was aber ihn selbst anbetraf – trotz aller offiziellen Anerkennung, die ihm bei seiner Rückkehr zuteil geworden war, trotz all der schönen Worte über den großen Schriftsteller, über den Wortführer des tschechoslowakischen Volkes wußte Thomas, daß er nichts in die Waagschale zu werfen hatte als die quälenden Stunden an seiner Schreibmaschine und die Vorträge, die er in den Damenklubs von Omaha oder Poughkeepsie gehalten hatte. Und wenn er sich die Seele aus dem Leib geredet hatte, dann kamen die Damen zu seinem Rednerpult und schüttelten ihm die Hand und sagten: »Sie waren ja so wunderbar, Mister Benda!«
Vielleicht würde er eines Tages mit Karel darüber sprechen können. Er hatte es mit Joseph versucht; aber Joseph hatte ihn enttäuscht, Joseph hatte es zweckdienlich gefunden, seine schönen Briefe aus England zu vergessen. Wie oft hatte Joseph ihm von seiner Sehnsucht nach einem Leben von der Art geschrieben, wie sie es vor dem Kriege und vor ihrem Exil geführt hatten – die Abende, die dahingingen in Diskussionen über die Welt und das Land und ihr Volk, über Jan Hus und Comenius und Thomas Masaryk, und über die mystischen Geschichten, die die einsamen Köhler in der Abgeschiedenheit der böhmischen Wälder erdacht hatten. Nur daß jetzt, wo er zurück war, diese Abende nicht Wirklichkeit geworden waren.
Er und Joseph waren sich fremd geworden. Sie hatten so lange mit einem Ozean zwischen sich gelebt. Nein, das war es nicht – selbst der Ozean konnte überbrückt werden. Joseph war zu sehr damit beschäftigt, sein Geschäft wieder aufzubauen. Er machte eine Religion daraus, eine plumpe und dumme Religion. Irgendwann mußte es zu einer großen Auseinandersetzung zwischen ihnen kommen.
Etwas in ihm erstarrte. Plötzlich hatte er Kittys Besorgnis gespürt, ihre Nähe, ihr sanftes Drängen. Er wurde sich ihres Körpers bewußt, dessen jede Linie er kannte, wo es keine Stelle gab, auf der sein Kopf nicht schon geruht hatte. Ja, wenn er zu ihr sprechen könnte! Sie war bereit zuzuhören, immer bereit, zuzuhören und sich hilfreich zu zeigen, so bereit und so ergeben, daß ihm bei dem Gedanken daran die Haut kribbelte. Er wußte, was sie ihm sagen würde, und er wußte, wie sie sich anfühlte – ihr Körper war immer kühl unter der Berührung seiner Hände, angenehm kühl und Schutz verheißend und leicht antiseptisch riechend und unfähig, seine Gespanntheit zu lösen.
»Petra«, sagte er plötzlich, »wenn du wissen willst, wie dein Onkel Karel war … Wie er aussah, ist nicht so wichtig. Aber ich will dir sagen, was wirklich wichtig war: Er war der einzige von uns drei Brüdern, der es wagte, gegen deinen Großvater Benda zu opponieren.«
Joseph wollte Einspruch erheben, aber Thomas fuhr, mit einem steifen Lächeln zu Petra hin, unbeirrt fort: »Karel war noch nicht so alt wie du jetzt, als er deinem Großvater den Gehrock zerschnitt.«
In Petras Augen glänzte es auf. »Warum?«
»Warum?« wiederholte Thomas. »Damit dein Großvater nicht in dem üblichen würdigen Aufputz zu einem Begräbnis gehen konnte – zum Begräbnis des alten Matjej.«
»Ich finde es durchaus nicht großartig, wenn einer ein vollkommen gutes Kleidungsstück zerschneidet!« sagte Lida. »Du solltest dem Kind nicht …«
»Ich bin kein solches Kind mehr!« sagte Petra. »Wer war der alte Matjej?«
»Ach, niemand weiter«, sagte Joseph zögernd. »Ein Arbeiter, der in der Fabrik bei einem Unfall ums Leben kam. Karel war starrköpfig, das stimmt, aber was er mit dem Gehrock tat, war einfach Bosheit. Ich möchte nicht, daß du dich jemals boshaft verhältst, Petra!«
Petra blieb hartnäckig. »Und warum hat er denn dem Großvater den Gehrock zerschnitten?«
Thomas nahm ihre Hand. »Ich glaube, weil er den alten Matjej gern hatte. Karel war so ein Mensch, der sich gern um Leute kümmerte, die sich nicht selber zu helfen wußten.«
Die Familie schien darüber nachzudenken. Kitty brach das Schweigen. »Da an der Schranke stellen sich Leute auf. Meint ihr nicht, wir sollten mit dem Stationsvorsteher sprechen?«
Die Menschenschlange mochte einen Vorortzug erwarten; trotzdem wandten sich sowohl Joseph wie Thomas gleichsam erleichtert um, als wollten sie gehen, blieben dann aber doch wieder stehen.
»So geht schon!« pflichtete Lida Kitty bei. Die Männer gingen gehorsam; Petra folgte ihnen. Lida zog ihre Puderdose heraus und bearbeitete ihre Nase. »Langt es dir auch?« fragte sie ihre Schwägerin.
Kitty hörte das leise Schnappen, mit dem die Puderdose sich schloß. Es hatten sich noch mehr Leute an der Schranke angesammelt, und sie sahen aufgeregt aus.
Obgleich Lidas Lippen leicht ironisch verzogen waren, zeigte ihr Ton keine Spur von Sarkasmus, als sie sagte: »Du weißt, daß ich nichts dagegen habe, wenn er in eurem Hause wohnt. Wir haben zwar mehr Platz für ihn, aber …«
»Aber …?« Kitty wartete. Wie Thomas, so setzten sie alle bei ihr voraus, daß sie Nerven wie Stricke hatte.
»Nun«, sagte Lida leichthin, »du bist doch schließlich Krankenschwester gewesen – da wirst du viel besser als ich verstehen, wie man für ihn sorgen muß …«
Kitty brauste auf. »Es war einfach schrecklich, wie wir über ihn gesprochen haben!«
»Aber wieso denn?« Lida zog ihre dünnen Augenbrauen hoch. »Was meinst du denn, um Gottes willen?«
»Wir haben über ihn gesprochen, als ob er tot wäre.«
Lida blickte ihre Schwägerin an. Kitty hatte recht, und es lag etwas Schreckliches in dem Gedanken. »Es war eben eine große Überraschung«, sagte sie, und ihre Stimme klang weniger bestimmt als sonst. »Und er hätte uns eher wissen lassen sollen …!«
»Er lebt!« sagte Kitty. »Er kommt nach Haus! Warum kann sich diese Familie denn nicht mit dem Gedanken abfinden?«
»Erzähl mir doch nicht, du hättest geglaubt, er würde jemals zurückkommen!«
»Ich habe nie geglaubt, daß er tot ist!« Kittys Stimme schwankte, und sie ärgerte sich, daß sie überhaupt etwas gesagt hatte.
Thomas und Petra kamen eilig vom Büro des Bahnhofsvorstehers zurück.
»Er kommt!« rief Petra. »Der Zug kommt!«
»Muß jede Minute hier sein!« Thomas’ Stimme war heiser vor unterdrückter Erregung.
Joseph ging zu einem der Fahrkartenschalter, um die kleinen Pappkärtchen zu kaufen, die der Familie das Recht gaben, die Sperre zum Bahnsteig zu passieren. An der Straßenseite des Bahnhofs fuhren eine Anzahl von Autobussen und mehrere Krankenwagen vor.
Joseph kam in sein Element. Mit den Ellbogen bahnte er seiner Familie den Weg durch die Menge, die den Durchgang zum Bahnsteig versperrte. Er schob die Handvoll Bahnsteigkarten dem an der Sperre sitzenden Beamten in die Hand und wartete ungeduldig, bis der systematische Mann jedes Pappkärtchen einzeln geknipst hatte. Dann trieb er Frau und Tochter, Schwager und Schwägerin die Stufen hinunter, die Unterführung entlang und wieder treppauf zu dem Bahnsteig, auf dem der Zug einlaufen sollte.
Der Bahnsteig begann sich zu füllen. Am einen Ende sammelten sich Männer und Frauen mit Rote-Kreuz-Armbinden; von irgendwoher tauchten Menschen mit Fahnen auf; eine Gruppe von Herren, die wie Regierungsvertreter aussahen, schritt mit wichtigen Mienen auf und ab. Joseph fühlte sich versucht, einen von ihnen anzusprechen, aber er ließ den Gedanken sofort wieder fallen – alles, was mit dem Empfang des Zuges zusammenhing, war so offensichtlich improvisiert, so im Einklang mit den hölzernen Behelfsschuppen, in denen die Werkzeuge und Signale aufbewahrt wurden, mit den altersschwachen Waggons, die auf den anderen Geleisen standen, mit dem schäbigen Anblick, den das Glasdach mit seinen fehlenden Scheiben bot.
Petra fragte wieder: »Wie wird er aussehen?«, und Lida war gerade im Begriff, sie zur Ruhe zu weisen, als das langgezogene Pfeifen einer Lokomotive hohl aus dem Tunnel klang, durch den die Züge in den Bahnhof einliefen. Die Scheinwerfer der Lokomotive leuchteten aus dem Dunkel heraus und verblaßten, sobald das helle Tageslicht sie traf. Die Lokomotive fuhr klappernd ein, langsam schob sie sich den Bahnsteig entlang. Zwei kleine Flaggen, die eine gänzlich rot, die andere mit dem Weiß-Rot-Blau der Tschechoslowakei, flatterten im spitzen Winkel zu ihrem Schornstein. Der Lokomotivführer lehnte sich aus seinem Stand heraus und winkte. Und dann kamen die Waggons, hinter ihren Fenstern die übereinandergedrängten Köpfe wie bleiche Trauben. Der Zug fuhr noch immer zu schnell, um die Gesichtszüge der einzelnen Passagiere erkennen zu lassen. Menschen liefen neben den Waggons her, winkten und riefen.
Petra zerrte Lida am Arm. »Ich habe ihn gesehen!« schrie sie. »Welcher ist es denn? Wo ist er?«
Joseph nahm seine Mütze ab, strich sich über das Haar, setzte die Mütze wieder auf. Thomas stützte sich schwer auf Kitty.
Mit einem letzten Quietschen und Klirren hielt der Zug an. Die Leute mit den Rote-Kreuz-Armbinden verteilten sich längs der Waggons – eine dünne, unpersönliche Kette der Bewillkommnung.
Am Ende des Zuges öffnete sich eine Tür.
Die Bendas standen wie festgewurzelt.
Der Mann, der da herausgeklettert kam, war hager, sein Haar ein weißliches Grau. Er trug eine amerikanische Militärjacke, die nicht zugeknöpft war und in Falten unansehnlich von seinen Schultern hing. Er ging schleppenden Schritts den Bahnsteig entlang und blickte suchend in die Gesichter der Wartenden. Er nickte den Männern und Frauen mit den Rote-Kreuz-Binden zu, er nickte den Vertretern der Behörden zu. Wenn er am Fenster eines Abteils vorbeikam, preßten sich die Gesichter dahinter enger an die Scheiben.
Jetzt verlangsamte er seinen Schritt noch.
Er sah sie: Joseph, Thomas, Lida, Kitty und Petra – denn das mußte wohl Petra sein. Wie wenig sich seine Brüder verändert hatten! Er war sich der grauen Stoppeln auf seinen eingefallenen Wangen bewußt, er war sich bewußt, daß seine Oberlippe über der großen Zahnlücke vorn eingesunken war. Er merkte, daß er nach dem Schweiß und Staub der langen Reise roch und nach dem Dunst der Kranken, der an ihm haftete. Er wollte seiner Familie rufen: Gott sei Dank, daß ihr alle da seid, Gott sei Dank, daß ich hier bin – aber seine Lippen waren trocken und heiß, seine Kehle wie ausgedörrt, und seine Stimme fand nicht den Weg an dem Schluchzen vorbei, das er unterdrückte.
Er blieb stehen. Erschöpfung übermannte ihn auf einmal. Er sah, wie Kitty sich plötzlich von der versteinerten Gruppe löste. Sie stürzte an Lida vorbei, stieß Joseph beiseite – und dann spürte er sie in seinen Armen.
»Karel!«
Er hielt sie fest an sich gepreßt, aber nur eine oder zwei Sekunden lang. Dann sanken ihm die Arme herab. Über ihren Kopf hinweg sah er seine Brüder auf sich zukommen; Petra lief ihnen voraus. Sie begrüßten ihn lärmend mit »Willkommen zu Haus!« und »Wie geht es dir?« und all den bekannten Sätzen, die die Menschen gemeinhin sagen, um bei solchen Gelegenheiten ihre innere Erregung zu verbergen, und Petra hing sich an ihn und rief einmal ums andere: »Onkel Karel! Onkel Karel …!«
Das Bild war so scharf, daß er sich selbst darin erkennen zu können meinte; und doch war es unglaubhaft, war flach wie eine Photographie. All die Jahre im Lager – zuerst im Steinbruch, dann in dem Gestank des Laboratoriums und schließlich im Hospital – hatte er die unklare, illusorische Hoffnung auf diesen Augenblick in sich getragen. Aber so wie sein Magen unfähig gewesen war, die erste kräftige Nahrung bei sich zu behalten, die die Amerikaner ihm gegeben hatten, so konnte sein Hirn jetzt die Wärme und das Glück der Wirklichkeit nicht erfassen.
Viel realer war der Menschenstrom, der die von ihm und seiner Familie gebildete Insel umspülte, waren die Leute vom Roten Kreuz, die die Türen der Abteile öffneten, waren die Kranken, die er begleitet hatte und die jetzt langsam aus dem Zug kamen. Viel realer war der Wirbel von Freunden und Verwandten, die umherrannten, um ihre Angehörigen zu finden, und von Aussteigenden, die auf der Suche nach bekannten Gesichtern sich nach allen Seiten verliefen. Und obgleich er die räumliche Nähe seiner Familie fühlte, hatte er doch fast die Empfindung, daß er viel enger mit jenen seiner Patienten verbunden war, die niemand erwartet hatte und die jetzt, isoliert von den lachenden, einander umarmenden, lärmenden Glücklichen, wie verloren und in sich zusammengekrochen dastanden und zwecklos warteten.
»Doktor Benda! Doktor Benda!«
Vielleicht war der Ruf von einem der behördlichen Herren gekommen, denen er die ihm Anvertrauten zu übergeben hatte; vielleicht suchte ihn einer der befreiten Häftlinge, der sich in den Tagen der Reise daran gewöhnt hatte, von ihm geführt und betreut zu werden.
»Ich muß fort«, sagte er und war sich bewußt, daß er es ein wenig zu eifrig gesagt hatte. Er bemerkte Josephs verletzte Miene. »Wohin?« wollte Joseph wissen. »Kommst du denn nicht mit uns mit? Wir haben alles vorbereitet. Mein Wagen steht draußen …«
Kitty sagte: »Bist du denn noch nicht frei?«
Ja, er war frei. Er war seiner Fesseln ledig und, abgesehen von einigen Formalitäten, entlassen – es gab keinen Stacheldraht, keine Baracken, Arbeitskommandos, Wachen, Verpflichtungen und Bindungen mehr – und doch schnurrten irgendwelche Räder in ihm weiter, wie bei einem Aufziehspielzeug, auch wenn die Feder schon abgelaufen ist.
Er mußte seinen Angehörigen das Gefühl geben, daß er sie liebte, daß es ihn froh machte, wieder zu Hause zu sein, und wie dankbar er ihnen dafür war, daß sie hier waren und ihm ihre Arme öffneten. Aber man kann nicht so schnell vom Konzentrationslager zur Familie finden. Er war ja nicht auf einem Wochenendausflug gewesen.
»Du mußt schon wieder fort?« Thomas fuhr mit dem Finger seinen zerdrückten Kragen entlang. »Warum denn nur?«
Sie verstanden nicht. Sie brauchten Zeit. Auch er brauchte Zeit. »Habt ihr meine Briefe nicht bekommen?« Er knöpfte seine Jacke zu, die von seinem hageren Körper abstand wie die Glocke von ihrem Klöppel. »Ich habe euch dreimal geschrieben. Es wurden Ärzte gebraucht für die schlimmsten Fälle, für Leute, die man nicht nach Hause schicken konnte. Wir brachten sie in ein Sanatorium in Thüringen. Dort habe ich seit Mai gearbeitet.«
»Wir haben keine Briefe erhalten«, sagte Lida.
Er nickte langsam, mit gequälten Augen, seine Zunge stieß gegen die eingesunkene Lippe. »Das tut mir leid. Ich habe euch sicherlich Sorge gemacht …«
»Immer noch der alte Karel! Läßt sich immer noch von jedem Hilfsbedürftigen ausnutzen!« Mit einem gezwungenen Lachen wies Joseph zu Karels Schützlingen hinüber, die auf dem Bahnsteig zu einer Kolonne formiert wurden. »Hast du noch nicht genug für sie getan?«
»Es wird nicht allzu lange dauern …« Im Geiste zählte Karel die Stunden, die ihm und seiner Vergangenheit blieben, bevor er sich der Familie und der Zukunft zuwenden mußte. »Es gibt hier eine Art Aufnahmezentrale. Dorthin muß ich die Leute noch bringen und mich um ihre letzte Überprüfung kümmern – wer nach Hause fährt, vorausgesetzt, daß er noch ein Zuhause hat, wer in ein Krankenhaus kommt …«
»Dann richten wir uns besser darauf ein, über Nacht in Prag zu bleiben.« Lida ging von der praktischen Seite her an die Situation heran, und Karel war ihr dankbar dafür. »Du wirst wohl todmüde sein, wenn du fertig bist. Wir hatten natürlich darauf gehofft, dich heute abend wieder in Rodnik zu haben. Kitty hat in ihrem Haus ein Zimmer für dich bereit …«
»Es ist das Zimmer im Obergeschoß«, sagte Kitty leise. »Du erinnerst dich doch. Du hast immer gesagt, wenn du da den Arm aus dem Fenster streckst, kannst du die Berge berühren. Es ist ruhig in dem Zimmer – und du kannst dort allein sein, wenn du willst.«
»Ja, ich glaube, ich entsinne mich …« Er blickte Kitty voll ins Gesicht. Sie schien aus dem merkwürdigen Familienphoto herauszuwachsen, dreidimensional zu werden. »Natürlich erinnere ich mich!«
»Onkel Karel«, sagte Petra, »ich hab dich lieb.«
Er wandte sich dem Kind zu, die tiefen Linien um seinen Mund zuckten. Er legte seine langen, abgemagerten Finger auf ihren Kopf; seine Hand sah fast weiß aus gegen ihre weichen dunkelbraunen Locken.
»Ich muß jetzt gehen«, sagte er.
Joseph rief hinter ihm her: »Wir erwarten dich im Esplanade. Ich nehme ein Zimmer mit Bad für dich!«
Karel antwortete nicht. Es war ihm, als lebte er außerhalb der Zeit – das Gestern war vorüber, das Heute hatte noch nicht begonnen. Dann hörte er hastige Schritte neben sich, und Thomas fragte atemlos: »Ich dachte, ich könnte vielleicht mit dir mitkommen. Du hast doch nichts dagegen?«
»Nein …«, sagte Karel zögernd.
»Bestimmt nicht?« fragte Thomas und ließ alle anderen Fragen unausgesprochen.
»Du kannst mir bei der Schreiberei helfen.« Karel warf einen Blick zurück und sah, daß die anderen noch immer an derselben Stelle standen, wo sie ihn getroffen hatten. »Vielleicht hätte ich das Telegramm nicht schicken sollen«, sagte er.
Zweites Kapitel
Joseph nahm vier Zimmer im Hotel Esplanade. Das Esplanade war nicht so protzig wie das Alcron; es war ruhiger, würdiger und entsprach mehr seiner Vorstellung von einem Hotel, in dem man mit seiner Familie abstieg. Die Zimmer gingen auf den Park hinaus. Jenseits des grünen Gevierts konnte er die Türme des Wilson-Bahnhofs sehen, die ihn immer an die Aufbauten auf Butterkremtorten erinnerten, und die klassische Fassade des ehemaligen Deutschen Theaters, das man eilig in »Theater des fünften Mai« umgetauft hatte, zu Ehren des Tages, an dem die Prager zu den Waffen gegriffen und gegen SS und Wehrmacht gekämpft hatten. Er konnte den eisengrauen Block der Börse sehen, in der keine Aktien mehr gehandelt werden würden, weder über noch unter dem Tisch – es hieß, daß die Provisorische Nationalversammlung dort einziehen würde.
Joseph hatte nicht um den Preis für die Zimmer gefeilscht. Nicht, daß er mit Geld um sich zu werfen pflegte – aber als Geschäftsmann wußte er, daß die Protektoratskrone, die noch immer in Umlauf war, einen zweifelhaften Wert hatte; je schneller er die bunten Scheine in greifbare Besitztümer oder geleistete Dienste umsetzen konnte, um so lieber war es ihm.
Alles in allem war es mit ihm in den letzten zwei Monaten seit Juni, seit er sich wieder in Rodnik niedergelassen hatte, sehr gut vorangegangen. Es war ein schwerer Kampf gewesen, die Benda-Werke wieder in Gang zu bringen, aber jetzt war der Schmelzofen wieder aufgebaut, Arbeiter waren eingestellt worden, der Gasgenerator war geflickt, mit Bitten und Bestechungen und Ausfüllen zahlloser Formulare hatte man Kohle und Glassand und Sodaasche und Pottasche und gebrannten Kalk und Bleiglätte aufgetrieben.
Er war bereit, wieder Glas zu machen.
Er war bereit, die Arbeit war wieder aufgenommen, Kontakte mit alten Kunden wurden wieder hergestellt – und doch war er nicht einmal sicher, daß er der Besitzer der Fabrik war, die sein Großvater Zdenek Benda erbaut, sein Vater Peter Benda zu einem großen Unternehmen gemacht und die er selbst übernommen und für immer zu sichern versucht hatte. Da waren die Gerichte, Gerichte erster und zweiter Instanz; und nicht einmal die Gerichte wußten genau, ob sie die endgültige Rechtsprechung hatten oder ob irgendein lächerliches Bezirks-Nationalkomitee oder der neue Verband der Glasfabriken oder ein Minister in Prag das entscheidende Wort zu sprechen hatte.
Zum Teufel, es war doch nicht seine Schuld, daß die Nazis eingerückt waren und Lida gezwungen hatten, zu einem Preis zu verkaufen, der zu demütigend war, um ihn überhaupt zu erwähnen! Und alles das, während er seine guten tschechischen Mannschaften über London einsetzte, um den Luft-Blitzkrieg der Nazis abzuwehren. Er war verantwortlich gewesen für die technischen Einzelheiten jedes Einsatzes; er war es gewesen, der auf dem Flugplatz stand und auf das dumpfzornige Brummen der heimkehrenden Flugzeuge wartete und jeden anfliegenden Apparat ängstlich zählte und tief in seinem Herzen fühlte, wie das letzte Fünkchen Hoffnung, eine längst überfällige Maschine könnte noch nachgehinkt kommen, allmählich erlosch; er war es gewesen, der täglich die Dienstrolle unterzeichnete und die Kreuzchen hinter die Namen der Verlorenen setzte. Was verlangten sie denn noch von einem Menschen, bevor sie ihm zurückgaben, was ihm gehörte?
»Was starrst du eigentlich so?« rief Lida von der Chaiselongue her, auf der sie sich ausgestreckt hatte.
Joseph fuhr herum. »Ich habe nachgedacht.«
Er trat zu dem Nachttischchen, auf dem das lachsrosa Telephon stand, setzte sich auf sein Bett und zog das kleine rotlederne Notizbuch, in das er wichtige Adressen eintrug, aus der Tasche. Dann nahm er den Hörer ab und verlangte eine Nummer.
»Wen rufst du an?« fragte Lida. »Du hast die ganze Nacht durch chauffiert. Leg dich lieber etwas hin.«
Die Hälfte ihres Körpers wurde seinem Blick durch das Fußende des Doppelbettes entzogen. Die andere Hälfte bekam durch das Licht, das von ihrem Satinunterkleid reflektiert wurde, einen rosigen Schein. Ihre Schultern waren nackt, und der Schatten zwischen ihren Brüsten irritierte ihn.
»Ich muß den Minister anrufen«, sagte er und lauschte, wie es im Telephon leise knackte, wenn der Strom sich bemühte, durch die in den Kriegsjahren lädierten Drähte zu dringen.
Lida drehte sich halb um und stützte das Kinn auf ihr Handgelenk. »Und du glaubst, er sitzt da und wartet auf deinen Anruf? Du hättest ihn von Rodnik aus antelephonieren sollen. Aber du warst so von dem Gedanken an Karel in Anspruch genommen …«
Noch immer war das Knacken das einzige Geräusch, das aus dem Telephon drang. Joseph war versucht, den Hörer wieder auf die Gabel zu legen. Schließlich war er nach Prag gekommen, um seinen von den Toten zurückgekehrten Bruder abzuholen; man sollte Geschäftliches nicht mit derartigen Dingen vermengen.
»Ich konnte schließlich Minister Dolezhal nicht gut um Mitternacht anrufen«, sagte er scharf.
»Du wirst ihn nicht einmal an den Apparat bekommen.« Sie räkelte sich. »Nichts funktioniert hier.«
Er legte den Hörer auf, kam zur Chaiselongue, setzte sich neben Lida und begann, ihre Schultern zu streicheln.
»Hoffentlich kommt Petra nicht herein«, sagte sie. »Sie hat die Gewohnheit angenommen, hereinzukommen, ohne zu klopfen.«
Joseph streifte ihr die Achselbänder herunter. »Sie ist bei Kitty. Wahrscheinlich schläft sie fest – armes Kind.«
Das Telephon klingelte. Er sprang auf; Lida streifte die Achselbänder wieder über ihre Schultern und zog die Decke hoch.
Die Stimme der Telephonistin des Hotels sagte: »Haben Sie versucht, Minister Dolezhals Kanzlei zu erreichen? Sein Sekretär ist am Apparat.«
Mit halbgeschlossenen Augen hörte Lida der Unterhaltung zu, soweit sie von Joseph geführt wurde: Ja, er war der ehemalige Major Benda vom tschechischen Kontingent der Royal Air Force … Ja, er war in London mit Minister Dolezhal recht häufig zusammengetroffen, bei Lord Sitterton, in Kinborough House und an anderen Orten … Nein, er blieb nur bis heute nachmittag in Prag, aber er hätte den Minister gern in einer dringenden Angelegenheit gesprochen …
Dann trat eine lange Pause ein.
Endlich sprach Joseph wieder. »Drei Uhr paßt sehr gut. Vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen.«
Lida stand auf und griff nach ihrem Kleid.
»Ich dachte, du bist müde«, sagte er zu ihr. Er lächelte nicht, aber sein Gesicht hatte jenen breiten Ausdruck von Bauernschlauheit angenommen, der ein Erbteil von Peter und Zdenek Benda und den Bendas vor ihnen war.
»Ich möchte Mittag essen, bevor wir zum Minister gehen«, sagte Lida unter ihrem blumenbemusterten Kleid hervor, das sie sich gerade über den Kopf zog.
»Du kannst da nicht einfach mitkommen!« Er lachte verlegen. »Das ist eine offizielle Angelegenheit, nur zwischen Dolezhal und mir.«
Sie puderte ihre flache, gerade Nase und trug sorgfältig ihren Lippenstift auf. Nachdem sie damit fertig war, sagte sie: »Ihr seid doch gut befreundet, der Minister und du, nicht wahr? Warum sollte das also so schwierig sein?«
»Es ist nicht schwierig.« Er suchte nach einer Zigarette, hantierte mit ihr herum und steckte sie schließlich an. »Es gehört sich einfach nicht.«
»Du vergißt, daß man mir die Fabrik fortgenommen hat. Du brauchst die Unterstützung des Ministers. Da müßte es dir doch eigentlich angenehm sein, wenn er die Geschichte direkt von mir erfährt.«
Das mochte etwas für sich haben. Aber es war undenkbar.
»Sieh mal, ich bin doch jetzt zurück«, sagte er.
Sie betrachtete sich prüfend im Spiegel, zog ihren Gürtel zurecht und trat dicht an Joseph heran. Sie gab ihm einen leichten Kuß auf die tiefe Falte, die sein Kinn spaltete, und streichelte ihn hinterm Ohr.
»Und ich bin froh, daß du zurück bist«, sagte sie.
Er wich ein wenig zurück, ungewiß, worauf sie abzielte.
»Und ich bin froh, daß du wieder arbeitest und wieder im Geschäft bist.« Sie nahm ihren Hut aus dem Schrank. »Aber du darfst nicht vergessen, daß die Firma Vesely dir dazu verholfen hat.«
Er setzte sich. Es gelang ihm, seiner Stimme einen autoritativen Ton zu geben. »Gut – wollen wir das jetzt klarstellen, ein für allemal.«
»Also?«
Er suchte nach den richtigen Worten. Er hatte nicht viel Geld gebraucht – eine halbe Million Kronen, um den Schmelzofen wieder aufzubauen, eine weitere halbe Million für das Rohmaterial und für kleinere Reparaturen und um das Ganze in Gang zu setzen – nichts, was nicht in drei bis sechs Monaten zurückgezahlt sein konnte, wenn die Geschäfte nur einigermaßen gingen; aber ohne Veselys Glasschleiferei, die in Betrieb war und produzierte und den größten Teil des Krieges über produziert hatte, würde die Bank ihm das Darlehn kaum gegeben haben. Und Veselys Glasschleiferei – das war Lida.
»Du tust, als wenn es dein Verdienst wäre, daß dein Vater starb und dir die Schleiferei hinterließ.«
Das war so offensichtlich unfair, daß Lida überhaupt nicht darauf einging.
»Entschuldige bitte«, sagte Joseph. »Der Alte war ein anständiger Mensch. Und du kannst davon überzeugt sein, daß ich ihm dankbar bin.«
»Solltest du auch sein. Ohne ihn hätte dein Kind deine Rückkehr nicht mehr erlebt.«
»Ich weiß«, sagte er mit pflichtschuldiger Geduld. »Ich weiß, woher das Geld kam, um die Polizei zu bestechen. Du hast es mir mehr als einmal erzählt.«
Lida bemerkte schneidend: »Meinem Vater hat niemand etwas vererbt. Er hat sein ganzes Leben damit zugebracht, die Firma Vesely zu dem zu machen, was sie heute ist. Als er im letzten März starb, starb er allein, und ich wußte nicht einmal davon. Vesely gehörte auf einmal mir, und ich wußte es nicht. Ich lebte halb verhungert in dem einen kahlen Zimmer in Prag und zog dein Kind auf!«
Er empfand schmerzhaft, wie spitz sie war und wie plump er. Hatte sie ihm jemals geglaubt, als er ihr sagte, daß er sie liebe? Und er hatte sie geliebt, damals, als er sie heiratete; sie war in ihrer Art sogar attraktiv gewesen – intelligent, schlagfertig, elegant und stolz. Da waren natürlich die unausgesprochenen Dinge. Lida war das einzige Kind gewesen. Wenn jemand in Rodnik aufgewachsen war und Glas machte, wußte er selbstverständlich, daß Lidas zukünftiger Mann eines Tages Veselys Glasschleiferei beherrschen würde. Peter Benda, der die Heirat zustande brachte, hatte diese Seite der Angelegenheit niemals mit Jaroslav Vesely oder, was das angeht, mit seinem eigenen Sohn besprochen. Es wäre besser gewesen, wenn er es getan hätte, dachte Joseph mit Bitterkeit. Vielleicht wäre seinem Vater dann eingefallen, daß die Herrschaft auch andersherum ausgeübt werden konnte.
»Also bitte?« sagte Lida wieder.
Er wand sich, um das beengende Gefühl unter den Achseln loszuwerden. »Ich weiß wirklich nicht. Es gibt da gewisse Formalitäten …«
»Ich glaube, ich bin ganz präsentabel«, stellte Lida fest und strich sich das Kleid über den schlanken Hüften glatt.
»Lida – Dolezhal und ich werden keine Erinnerungen an London austauschen. Wir werden über das Geschäft sprechen, wir werden über Glas sprechen, wir werden über Benda sprechen.«
»Ich weiß Bescheid im Geschäft«, antwortete sie, »ich weiß Bescheid über Glas, ich weiß Bescheid über Benda.«
Der Knopf, dachte er – wenn man den Knopf versetzte, säße die Uniform vielleicht etwas bequemer.
Dann sagte er: »Ich werde Dolezhals Sekretär anrufen und mit ihm darüber reden. Vielleicht geht es in Ordnung.«
Petra war trotz der schlechten Ernährung in den Kriegsjahren für ihr Alter zu schnell gewachsen. Sie hatte die sanften großen Augen ihrer Großmutter Anna Benda, die, wie die bösen Zungen von Rodnik behaupteten, vor ihrer Zeit ins Grab gebracht worden war. Petra war schon beinahe so groß wie Kitty; in diesem Augenblick saß sie auf dem Fensterbrett, baumelte mit den Beinen und verglich neidvoll ihren eigenen Körper mit dem Kittys.
Sie wünschte, daß ihre Brüste groß und rund wären wie die Kittys und ihre Hüften solche sanft geschwungenen Linien hätten, die sich beim Gehen ständig veränderten. Sie hatte auch schon Brüste, aber nur andeutungsweise, nicht mehr als kleine Schwellungen mit Spitzen dran; sonst war sie am ganzen Leibe flach, und ihre Hüftknochen standen heraus wie große Schöpfkellen. Sie wünschte, sie hätte Kittys tiefe, warme Stimme und Lippen wie Kitty, die so hübsch aussahen, wenn sie halb geöffnet waren. Sie wünschte, sie hätte jemanden, der sie liebte. Sie wünschte, sie wäre irgend jemand anderes, nur nicht sie selbst.
Lida steckte ihren Kopf durch die Tür und kündigte an, daß sie und Joseph ausgingen; Kitty und Petra müßten also im Hotel auf Karel und Thomas warten. Dann trat sie, als sei es ihr plötzlich noch eingefallen, eilig ins Zimmer, nickte Kitty zu und küßte Petra auf die Stirn. »Wir sind gegen fünf zurück«, sagte sie und eilte wieder hinaus.
Petra zeigte keinerlei Reaktion. Sie lauschte auf den kurzen schwächlichen Ton der Straßenbahnklingeln und auf das Kreischen der Räder, wenn die Wagen den Hügel vom Museum zum Wilson-Bahnhof herunterkamen. Sie liebte Prag. Ihre Mutter haßte Prag und hatte das oft deutlich gesagt; sie aber liebte Prag und konnte Rodnik nicht ausstehen, wo sie fast immer allein war: ihre Mutter war meistens im Büro von Vesely oder mit dem Haushalt beschäftigt, und ihr Vater kam spät nach Hause, müde von der Arbeit.
Ihre Beine bewegten sich plötzlich nicht mehr. »Was glaubst du, was Onkel Karel machen wird, wenn er wieder in Rodnik ist?«
Kitty, die sich mit derselben Frage beschäftigte, war überrascht, daß das Kind danach fragte, und sie fühlte sich schuldbewußt, weil sie sich eigentlich Gedanken über Thomas’ nächste Zukunft machen sollte.
»Ich denke, er wird sich zunächst ausruhen«, sagte sie, »und wir werden ihn ordentlich herausfüttern.«
Thomas ißt schlecht, seit wir wieder zu Hause sind, dachte sie. Thomas arbeitete auch nicht, obgleich er voller Pläne gewesen war und von einem neuen Roman gesprochen hatte, während sie ihre täglichen obligatorischen zehn Runden um das Deck des Schiffes spazierten. Es sollte ein großer Roman werden, etwas in der Art von »Krieg und Frieden«. Selbst wenn es ein Werk von mehreren Bänden werden würde, sagte Thomas, werde er es unbedingt schreiben. Aber er hatte noch nicht damit begonnen, nicht einmal mit dem Entwurf eines Planes; und in dem Monat, den sie wieder in ihrem Haus auf dem Sankt-Nepomuk-Berg hoch über Rodnik wohnten, war das Projekt überhaupt nicht mehr erwähnt worden, obwohl er ideale Arbeitsbedingungen hatte.
»Onkel Karel hat mich immer auf herrliche Spaziergänge mitgenommen«, sagte Petra. »Ich glaube, er kannte jeden Weg im Gebirge. Und er kannte alle Geschichten, die das Volk erzählt. Über die Geister der Bäume – das ist natürlich ein Märchen; Bäume haben doch keinen Geist, nicht wahr? – und daß für jeden Menschen ein Baum wächst und kleine Bäume für die Kinder, und wenn wir sterben, gehen wir heim zu unserem Baum … Meinst du, er nimmt mich wieder mit?«
Es war falsch, dachte Kitty, dem Kind vom Tod und vom Sterben zu erzählen, auch wenn man es noch so hübsch darstellte.
»Ich denke schon«, sagte sie. »Wenn du ihn darum bittest.«
»Aber er hat sich so verändert. Und ich bin auch anders geworden. Ich bin kein Kind mehr.«
Kitty ging zum Fenster und strich mit ihren Fingern über Petras knochiges Knie. »Man ist ein Kind, bis man siebzehn oder achtzehn ist, mindestens aber sechzehn, weißt du!«
»Das stimmt nicht«, sagte Petra ernst. »Vielleicht war es früher so. Aber als ich acht Jahre alt war, wußte ich über Onkel Karels Arbeit Bescheid. Und ich wußte, daß Vater in England flog und die Deutschen bombardierte. Und ich hörte zu, wenn nachts Onkel Thomas’ Stimme aus Amerika kam. Und ich wollte den deutschen Kommandanten in unserm Haus umbringen, aber Onkel Karel sagte, das würde nichts helfen …« Ihre Hände waren damit beschäftigt, Knoten in die lange Schnur der Vorhänge zu knüpfen und sie wieder zu entwirren. »Jetzt, wo wir Frieden haben, sagst du, ich bin ein Kind.«
Kitty wußte nichts zu antworten. Alles hatte sich hier verändert, und in dem Augenblick, da man das Land betrat, mußte man sich selbst ebenfalls ändern. Ob auch Thomas das fühlte? Aber Thomas verschloß sich in sich selbst und erzählte ihr nichts von dem, was ihn bewegte.
Petra richtete sich plötzlich auf. »Ich werde neue Kleider bekommen«, sagte sie. »Mutter denkt, meine Röcke müßten länger sein. Wir werden natürlich auf dem schwarzen Markt kaufen. Ich finde es aufregend, schwarz zu kaufen. Das Ganze spielt sich in Hinterzimmern ab, und die Leute tun sehr geheimnisvoll, und über alles, was wichtig ist, sprechen sie nur im Flüsterton. Willst du mitkommen und mir beim Aussuchen helfen, Kitty? Ich möchte so angezogen sein wie du.« Begutachtend betrachtete sie Kittys Kostüm, die auf Taille gearbeitete Jacke, den breiten Kragen, den Schnitt des Rockes. »Hast du das auf dem schwarzen Markt gekauft?«
»Nein. Es ist von Bloomingdale in New York.«
»Bloomingdale …«, sagte Petra und dehnte jede Silbe.
»Das ist ein Warenhaus. Die gibt’s in Amerika, ganz große. Da kannst du alles kaufen.«
»Wie herrlich! Vielleicht fahren wir auch mal nach Amerika, und ich kann bei Bloomingdale kaufen. Gibt’s in Amerika keinen schwarzen Markt?«
Kitty lächelte. »Doch – für Butter und für Automobile.«
»Genau wie hier«, stellte Petra mit Befriedigung fest. »Vater hat unsern Wagen auch schwarz bekommen, und es ist ein sehr guter Wagen. Er hat früher dem Kreisleiter in Usti gehört; der Kreisleiter konnte ihn nicht mit nach Deutschland nehmen, weil er kein Benzin mehr hatte. Wie teuer war dein Kostüm?«
Kitty rechnete schnell. Das Kostüm hatte achtzig Dollar gekostet, wert war es fünfundvierzig. Achtzig Dollar in Kronen umgerechnet waren – aber das war falsch; man konnte nicht den offiziellen Wechselkurs nehmen, man mußte, wollte man ehrlich sein, den Wert nach dem Kurs des schwarzen Marktes berechnen.
»Etwa sechstausend Kronen«, sagte sie zögernd.
Petra befühlte den Stoff mit sachverständigem Finger. »Genau wie ich dachte«, sagte sie schließlich. »Du hast es in der Schwarzmarktabteilung von Bloomingdale gekauft.«
Kitty runzelte die Stirn. Die Umstände und die Menschen hatten sich verändert, und man konnte nicht mal mehr eine so einfache Transaktion wie den Kauf eines Kleides bei Bloomingdale erklären.
Bohumil Dolezhal, Minister im Kabinett der wiedererstandenen Tschechoslowakischen Republik, war ein imponierender Mann. Ein breites Gesicht mit gesunder Hautfarbe und gutgeformten Flächen stand über abfallenden Schultern; ein buschiger grauer Schnurrbart verbarg mit Erfolg seinen Mund. Seine Hände waren erstaunlich klein und weiß, fast weiblich. Er benutzte sie gern für kurze, scharfe Gesten, als ob er einen mit seinen Argumenten physisch in die Enge treiben wollte. Die Hände faszinierten Lida; verglichen mit ihnen waren Josephs Hände wie die eines Bauern.
Der Minister war herzlich. Aber Lida erschien die Liebenswürdigkeit in seinen zwinkernden Augen ebenso berechnet wie seine Anekdote von den tausend Kronen, die er dem Vorsitzenden des Parlamentsklubs der kommunistischen Abgeordneten im Poker abgewonnen hatte. Die Banknote mit Autograph hing eingerahmt an der Wand des Büros neben einem Bild von Benesch. Lidas Augen schweiften zwischen dem Bild des bescheiden und sorgenvoll aussehenden kleinen Präsidenten und Dolezhals Händen hin und her; sie hätte gern gewußt, wieviel von des Ministers Herzlichkeit fingiert und wieviel echt war. Joseph hatte mit der Freundschaft zwischen ihm und Dolezhal geprahlt. Er hatte mit Genugtuung betont, Dolezhal hätte ihn, sooft sie in London zusammentrafen, vor den anderen Emigranten, vor Engländern, Amerikanern und sogar ein paar Russen, herausgestrichen. »Was konnte er schon durch mich gewinnen?« hatte Joseph gefragt. »Ich war doch völlig unwichtig für ihn und diese Leute …«
So viel wußte Lida – und wenig mehr. Sie wußte, daß Dolezhal als ein verhältnismäßig kleiner Funktionär seiner Partei nach London geflohen und als Minister zurückgekehrt war. Sie hatte gelesen, daß er in der Debatte ein gefürchteter Gegner war. Er erhob niemals die Stimme, sondern erledigte seinen Opponenten mit ein paar sarkastischen Bemerkungen, die in seltsamem Gegensatz zu seinem freundlichen, gewinnenden Ton standen.
»Soweit es in meiner Macht liegt, lieber Benda, will ich Ihnen helfen«, sagte der Minister, und Lida nahm die einschränkende Floskel zur Kenntnis. »Aber geben Sie mir die Tatsachen!«
Dann wandte er sich ihr zu. Sie hielt seinem Blick stand und lächelte. Dolezhal lächelte zurück.
»Das ist eine lange Geschichte, Herr Minister …« Joseph saß steif da und wartete. »Macht es Ihnen nichts aus?«
»Ich habe eine Besprechung mit meinen Abteilungschefs verlegt. Ich habe Zeit.«
»Die Sache geht noch auf die Zeit vor München zurück …« Joseph zögerte wieder.
Dolezhal sagte philosophisch: »Leider geht alles in diesem Lande auf die Zeit vor München zurück.« Diese Bemerkung schien ihm sehr treffend; er machte sich im Geiste einen Vermerk davon – er würde sie so nebenbei in eine seiner nächsten Reden einflechten; man konnte so einer Feststellung entweder einen bedauernden oder einen anklagenden oder einfach einen sachlichen Ton geben.
Sein Gedankengang wurde durch Joseph unterbrochen. Joseph sagte plötzlich: »Ich verlange Gerechtigkeit!«
Dolezhal neigte den Kopf.
»Drei Generationen lang hat meine Familie die Benda-Werke in Rodnik besessen. Wir sind so tschechisch wie die Hügel, auf denen Prag steht. Wir beschäftigten tschechische Arbeiter. Wir machten tschechisches Glas. Aber etwa fünf Kilometer von uns entfernt liegt das Sudetenland mit einer anderen Glasstadt, die Martinice heißt. Und da sind die Hammer-Werke …«
Kommt dieser Benda einmal ins Reden, so spricht er gar nicht schlecht, dachte Dolezhal. Auch das müßte man sich merken. Dolezhal konnte mitempfinden, wie diese Kleinbürgergeschichte sich mit der Logik eines griechischen Dramas entwickelte – wie die alte Handelskonkurrenz zwischen den Deutschen in den Hammer-Werken und den Bendas politisch wurde; wie Martinice nach München an das Deutsche Reich fiel; wie die Hammer-Leute der Firma Benda die Zufuhr von Rohmaterial abschnitten und ihr die Kunden wegnahmen; wie, kurz bevor die Wehrmacht die ganze Tschechoslowakei besetzte, Herr Aloysius Hammer in Rodnik erschien und das Angebot machte, alles, was von den Benda-Werken übrig war, für eine viertel Million Kronen zu kaufen.
Joseph zitierte Herrn Hammer, wobei er genau die nasalen breiten Töne des Sudetendialekts nachahmte: »Sie müssen verstehen, Benda, daß dies ein einmaliger Vorschlag ist. Wenn wir wiederkommen, werden wir uns nicht damit aufhalten, Ihnen Angebote zu machen. Aber ich bin durchaus damit einverstanden, daß Sie als Geschäftsführer mit einem anständigen Gehalt hierbleiben …«
»Diese Deutschen!« Der Minister führte einen Dolchstoß in die Luft. »Immer so zartfühlend!«
Joseph schaltete wieder auf Tschechisch um. »Ich warf ihn aus meinem Büro hinaus. Es war komisch zu sehen, wie er sich aus dem Schnee aufrappelte, sein Tiroler Hütchen aufsetzte und die Faust schüttelte.«
»Es war weniger komisch, als er zurückkam und ich ihm allein gegenüberstand«, erwähnte Lida.
»Unsere Frauen waren großartig«, sagte der Minister. Der Ton seiner Worte ließ sie als an Lida persönlich gerichtet erscheinen.
»Mein Mann war fort«, bemerkte sie nüchtern.
Ein Schatten von Verdruß flog über Josephs Gesicht. »Ich flüchtete im März 1939, unmittelbar bevor die Deutschen alles nahmen. Wir wohnten sehr nahe an der Münchener Grenze; wir sahen, was drüben vorbereitet wurde.«
»Und warum sind Sie geflüchtet?«
»Weil ich die Freiheit liebe«, sagte Joseph. Das war nicht gespielt, es war einfach die Feststellung einer Tatsache. »Und weil jedermann in Rodnik wußte, wo ich stand. Und die Deutschen wußten es auch.«
Ein anständiger Mann, dachte Dolezhal, ein Mann mit Prinzipien. Das war es, was man in einem Lande brauchte, das seinen Kurs noch nicht wiedergefunden hatte. Der Minister fühlte ein leises Prickeln der Befriedigung; er hatte einen Instinkt, und es war richtig gewesen, diesen Major Benda damals in London zu begünstigen.
Lida sagte: »Mein Mann hatte sich exponiert, und sein Bruder hatte all diese Aufrufe geschrieben.«
»Die Liberator-Aufrufe«, erklärte Joseph. »Mein Bruder Thomas schrieb sie; wir Unterzeichneten sie mit ›Liberator‹. Ich ließ sie drucken, und sie wurden überall im Land verbreitet.«
»Natürlich!« Dolezhal wußte von diesen scharfen Angriffen gegen München und gegen alle, die bereit gewesen waren, einen Kompromiß mit München zu schließen. Die Flugblätter hatten seinerzeit einen richtigen Sturm hervorgerufen, und die Regierung des Rumpfstaats hatte lahme Versuche gemacht, ihre Urheber zu finden. Dieser Joseph Benda also war der Bruder von Thomas Benda, dem Schriftsteller … »Ich habe einen Roman Ihres Bruders gelesen. Sehr interessantes Buch. Er ist auch wieder im Lande?«
Joseph sagte: »Jawohl, Herr Minister«; aber seine Gedanken richteten sich plötzlich auf den gleichfalls wieder heimgekehrten Karel, und eine nervöse Hitze stieg ihm in die Stirn.
Lida war besorgt, das Gespräch könnte ins Literarische abschweifen und da steckenbleiben. Sie schlug die Beine übereinander. »Die Bendas haben nie an ihr eigenes Wohlergehen gedacht. Mein anderer Schwager, Karel, der Arzt, war in der illegalen Widerstandsbewegung. Er wurde verhaftet und in ein Konzentrationslager geschickt. So kam die ganze Schwierigkeit mit unserer Glashütte.«
Die Röte in Josephs Gesicht vertiefte sich; sein Mund war hart zusammengepreßt.
Lida fuhr ungerührt fort: »In der Nacht, in der mein Mann uns verließ, übergab er mir die Benda-Werke und sagte: Versuche, das Geschäft zu halten … Ich habe es fast zwei Jahre lang versucht. Vielleicht ist das eine unwichtige Angelegenheit, und wir sollten Sie nicht damit behelligen – es sind so viele kleine Dinge hineinverwickelt …«
»Durchaus nicht; bitte, berichten Sie weiter, gnädige Frau!«
»Der deutsche Kommandant von Rodnik nahm sein Quartier in unserm Haus. Das half mir, die Werke in der Hand zu behalten. Übrigens bin ich natürlich auf allen Gebieten, die mit Glas zusammenhängen, Fachmann.«
Wenn sie doch endlich aufhörte, dachte Joseph – oder ihren Bericht doch wenigstens so gäbe, daß weder Karel noch Petra hineingezogen wurden. Sie hatte ihm die Geschichte seit dem Tage, an dem er wieder in Prag eintraf, mindestens ein dutzendmal wiederholt. Er wußte, sie würde mit dem Verwundeten beginnen, der mitten in der Nacht zu Karel gebracht worden war. Karel hatte ihn behandelt. Dann würde sie erzählen, wie die SS gekommen war und Karel geholt hatte. Dann würde sie sich weiter in die Sache hineinsteigern und Petra beschreiben, die wie von Sinnen gewesen war vor Angst und Aufregung.
»Kinder wissen immer zuviel«, sagte Lida. »Petra ging hinein in das Zimmer des deutschen Kommandanten. Der saß an seinem Schreibtisch, und sie krallte sich an seinen Ärmeln fest und schrie, wenn er ihren Onkel Karel nicht gehen ließe, würde ihr Vater von London geflogen kommen und mit seinen Bomben alle Deutschen in Rodnik umbringen und alle Deutschen überall sonst. Ich stürzte ins Zimmer, aber es war zu spät.«
Danach war es für Herrn Aloysius Hammer aus Martinice ein Kinderspiel gewesen. Trotz all seines Geldes und seines Einflusses konnte der alte Vesely nicht mehr tun, als Lida und Petra vor dem Gefängnis zu bewahren.
Joseph mußte zugeben, daß Lida ihre Geschichte geschickt erzählte. Sie vermied das Melodramatische und trug ihre Farben eher bescheiden auf. Sie wußte, welche Einzelheiten sie ausschmücken mußte und wann es besser war, die Tatsachen für sich selbst sprechen zu lassen. Wenn er an Dolezhals Stelle säße und den Bericht zum erstenmal hörte, dachte er, würde auch er beeindruckt sein. Nur war er bei allen Proben dabeigewesen; er kannte Lidas Inszenierung, und das störte ihn.
Nein, er war wirklich undankbar. Niemals im Leben hätte er es fertiggebracht, den Ausdruck von lebendigem Gefühl in Dolezhals Augen zu erzeugen; Lida kämpfte für etwas, das ihr ebenso am Herzen lag wie ihm selbst.
»Und dann kehrte ich zurück«, sagte Joseph, »kehrte aus dem Kriege zurück, heim nach Rodnik. Nur das Gerippe der Werke stand noch und der tote Schmelzofen. Nichts könnte toter sein als ein toter Schmelzofen. Man stößt ein Arbeitsloch auf; drinnen ist Schlacke, zerbrochene Schamottepfannen, ein bißchen hart gewordenes, sprödes Glas, seltsam geformt und staubbedeckt …«
Dolezhal sah sehr ernst aus.
Joseph holte tief Atem. »So begann ich wieder von vorn. Ich verpfändete meine Seele und den gesamten Besitz meiner Frau, und ich arbeitete, bis ich glaubte, ich würde umkippen.«
»Und Sie wollen behaupten«, fragte Dolezhal ärgerlich, »daß nach alledem noch Zweifel bestehen, ob man Ihnen Ihre Glashütte zurückgibt?«
»Ja«, antwortete Lida einfach.
Dolezhal kritzelte eine Zeile auf den Schreibblock, der vor ihm lag.
»Da sind alle möglichen Behörden«, warf Joseph ein, »und keine von ihnen scheint genau zu wissen, wie weit ihre Kompetenz eigentlich geht.«
Dolezhal zuckte die Schultern. »Wir haben eine neue Regierung. Mit der Zeit wird das in Ordnung kommen.«
Er nahm den Hörer von einem der drei Telephonapparate, die wie dicke schwarze Soldaten auf der linken Seite seines Schreibtischs standen.
»Wollen Sie bitte einen Augenblick hereinkommen, Jan?« sagte er wie nebenher in den Apparat. »Ich glaube, ich habe eine kleine Sache für Sie.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: