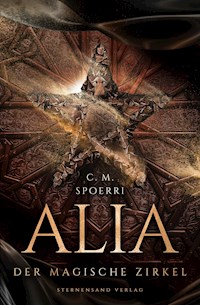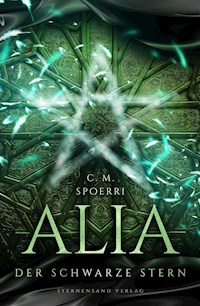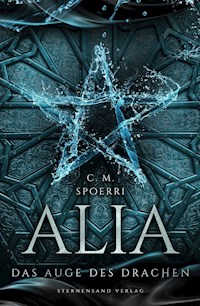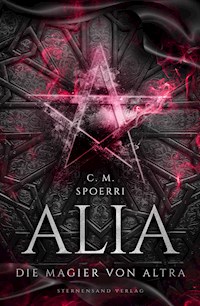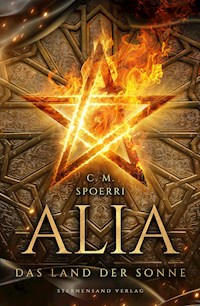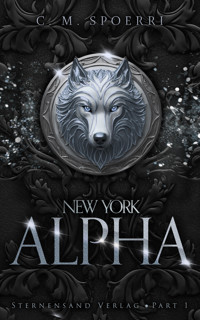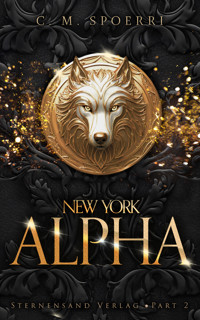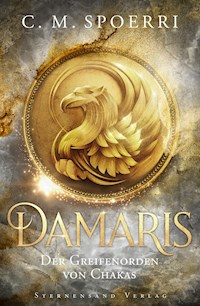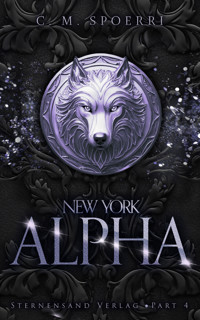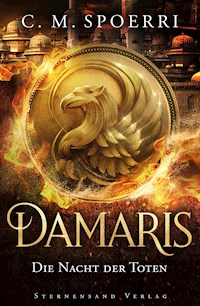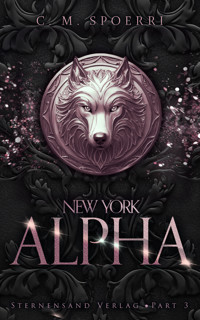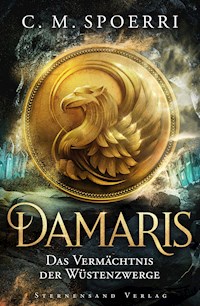Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sternensand Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Conversion
- Sprache: Deutsch
"Ich bin Skya und lebe auf der Insel Diés. Mein Volk ist äußerst intelligent und wir beten die Göttin Solaris an, die uns tagsüber ihre Gabe leiht. Dann gibt es noch diese gehirnlosen Muskelpakete, die auf der Nachbarsinsel Nox leben und deren Kräfte von ihrem Gott Lunos nachts verstärkt werden ..." Zero: "Was willst du damit sagen, Prinzessin?" Skya: "Unterbrich mich nicht. Ich versuche gerade, den Lesern zu erklären, wie unsere Welt funktioniert." Zero: "Du meinst wohl eher: Unsere beiden Inseln." Skya: "Dieser Besserwisser hier ist übrigens Zero, der selbstverliebte Anführer der Nox. Aber immerhin hilft er mir, meine Freundin Mona vor den Diés zu verstecken." Zero: "Mhm. Aber nur, weil mein dämlicher Bruder sich mit deiner Freundin eingelassen und sie geschwängert hat!" Skya: "Wir müssen jetzt zusammenarbeiten und versuchen, die Schwangerschaft vor den Ältesten geheim zu halten. Ansonsten droht uns allen die Todesstrafe – wir dürfen untereinander keinen Kontakt haben. Und schon gar keine Kinder zeugen, weil Mona ... sie wird bei der Geburt wahrscheinlich sterben ..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Impressum
Widmung
Zeichnung
Prolog
Kapitel 1 – Skya
Kapitel 2 – Skya
Kapitel 3 – Zero
Kapitel 4 – Zero
Kapitel 5 – Skya
Kapitel 6 – Skya
Kapitel 7 – Zero
Kapitel 8 – Zero
Kapitel 9 – Skya
Kapitel 10 – Zero
Kapitel 11 – Skya
Kapitel 12 – Zero
Kapitel 13 – Zero
Kapitel 14 – Zero
Kapitel 15 – Skya
Kapitel 16 – Skya
Kapitel 17 – Zero
Kapitel 18 – Zero
Kapitel 19 – Skya
Kapitel 20 – Skya
Kapitel 21 – Skya
Kapitel 22 – Zero
Kapitel 23 – Zero
Kapitel 24 – Zero
Kapitel 25 – Skya
Kapitel 26 – Skya
Kapitel 27 – Zero
Kapitel 28 – Skya
Kapitel 29 – Zero
Kapitel 30 – Skya
Epilog - Skya
Dank
Über die Autorinnen
C.M. Spoerri
Jasmin Romana Welsch
C. M. Spoerri & Jasmin Romana Welsch
Conversion
Zwischen Tag und Nacht
Band 1
Dystopie
www.cmspoerri.ch | [email protected]
www.jasminromanawelsch.com | [email protected]
1. Auflage, August 2016
© Sternensand-Verlag GmbH, Zürich 2016
Umschlaggestaltung: Alexander Kopainski | alexanderkopainski.de
Lektorat / Korrektorat: Wolma Krefting | bueropia.de
Satz: Sternensand Verlag GmbH | sternensand-verlag.ch
ISBN (Taschenbuch): 978-3-906829-23-4
ISBN (epub): 978-3-906829-24-1
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Freundschaft
ist eine Seele
in zwei Köpfen.
Viel Freude mit unserer Geschichte
Corinne & Jasmin ♥
Bei einem unserer Treffen entstanden diese Skizzen von Nox und Diés, die wir Euch nicht vorenthalten wollten. ;-)
(Keine von uns behauptet übrigens von sich, der nächste Picasso zu werden … )
Prolog
Die Dunkelheit machte ihm zu schaffen – seine Augen waren es nicht gewohnt, bei Nacht zu sehen. Er war ein Diés, seine Kräfte verschwanden mit Anbruch der Abenddämmerung und normalerweise war er um diese Tageszeit auch nicht mehr unterwegs – es war streng verboten und er hielt sich eigentlich immer an Regeln und Gesetze.
Der einzige Grund, der ihn hierher an die Grenze trieb, war die Tatsache, dass das Mädchen, das ihm so viel bedeutete, in Schwierigkeiten steckte – in massiven Schwierigkeiten. Wenn er ihr nicht helfen konnte, würde sie vom Ältestenrat zum Tode verurteilt … ebenso wie ihre Freundin, für deren Vergehen sie gerade ihr Leben aufs Spiel setzte.
Er tastete sich durch das Dickicht, das sich vor ihm wie ein Wall aufbaute.
Seine Kleidung war nass, da er durch das Wasser gewatet war, das die beiden Inseln Diés und Nox voneinander trennte. Die Hose klebte an seiner Haut und verursachte bei jedem Schritt leise quietschende Geräusche.
Es war eine sternenklare Nacht und der Mond schien hell über ihm am Himmel, sodass seinen Augen zumindest ein wenig Licht geschenkt wurde, das ihm erlaubte, Hindernissen auszuweichen und seine Schritte zu beschleunigen.
Vorhin musste er zwei Soldatenpatrouillen ausweichen, die das Gebiet durchkämmten, und wäre beinahe entdeckt worden. Sein Herz hämmerte immer noch wie verrückt, sein ganzer Körper war angespannt und er bewegte sich so lautlos wie nur irgend möglich.
Seine Mission war gefährlich. Ein falscher Laut, eine Unachtsamkeit – und er wäre so gut wie tot.
Wie war es nur so weit gekommen? Wie war er nur da hineingeraten?
Er war nur ihretwegen hier. Weil sie ihn gebeten hatte zu helfen und er ihr nichts abschlagen konnte. Sie war besonders: besonders schön, besonders klug und besonders stur. Stur genug, um sich allen Regeln und sogar ihren Ängsten zu widersetzen, um ihrer besten Freundin zu helfen.
Jetzt musste er ihr helfen.
Er hatte sich dazu bereit erklärt, sich mit diesem Nox zu treffen. Dem Feind. Hier an der Grenze – und er hoffte inständig, dass es keine Falle war, in die er gerade lief.
Nox waren weder vertrauenswürdig noch hilfsbereit, auch wenn sie keine andere Wahl hatten, als dem Feind zu vertrauen. Es war ein Spiel mit dem Feuer.
Doch wenn dieser Nox ihr etwas antäte, würde er ihn umbringen. Normalerweise hätte er keiner Fliege etwas zuleide getan, aber sie zu beschützen, war ein Drang, der ihn sogar dumm und verzweifelt genug machte, um sich mit dem Feind anzulegen. Diesem arroganten Bastard mit den Eisaugen, der ein Geheimnis hütete, von dem sie unbedingt erfahren musste …
Kapitel 1 – Skya
Drei Tage zuvor ...
Ich wurde von einem Hämmern, das nicht aufhören wollte, aus dem Schlaf gerissen. Während ich auf dem Sofa gelesen hatte, war ich eingenickt und schreckte jetzt hoch.
Wer mochte das zu solch später Stunde noch sein? Meine Ziehmutter Praeda war noch bei der Ratsversammlung und würde bestimmt erst in ein paar Stunden zurückkommen. Ich war alleine zu Hause und hatte keinen Besuch erwartet.
Rasch ging ich zur Tür, blieb davor jedoch unschlüssig stehen. Es war Abend, die Dämmerung bereits lange hereingebrochen … was, wenn es ein Nox war?
Schwachsinn! Diese Bastarde würden nicht anklopfen, sondern durch das Fenster einsteigen – oder die Tür in Fetzen reißen.
»Wer ist da?«, fragte ich dennoch vorsichtshalber.
Zur Antwort erhielt ich erst ein leises Wimmern. Dann eine Stimme, die mir vertrauter war als alle anderen. »Ich! Bitte mach auf! Bitte …«
»Mona!«, rief ich verblüfft und riss die Tür auf.
Meine Freundin ließ sich gegen mich sinken und ein Schluchzen entfloh ihrer Kehle, baute sich zu einem regelrechten Heulkrampf auf, der sich an meiner Schulter entlud, während sie die Arme um mich schlang.
»Was tust du hier?«, fragte ich und zog sie mit mir ins Haus. »Es ist bereits nach Einbruch der Dunkelheit … du solltest jetzt nicht mehr alleine unterwegs sein.«
Ich schloss vollkommen überrumpelt die Tür mit der freien Hand, während ich ihr mit der anderen beruhigend über das dunkle Haar fuhr.
Sie war ebenso dunkelhaarig wie ich – schwarzhaarig, um genau zu sein. Wie wir alle. Wie alle, die zu den Kindern des Tages gehörten. Wir waren Kinder der Sonne … der Insel Diés, über die unsere Göttin Solaris wachte.
Mona wollte gar nicht mehr aufhören mit ihrem Schluchzen und ihre braungebrannten Arme schlossen sich so fest um meinen Nacken, dass ich vor Schmerzen leise aufstöhnte.
»Mona!«, wiederholte ich ihren Namen und versuchte, sie ein wenig von mir wegzustemmen. »Was ist denn los? Was ist passiert? Warum bist du um diese Zeit noch draußen?!«
Meine Freundin dachte gar nicht daran, sich zu beruhigen, sondern ließ ihren Tränen freien Lauf. Ihr ganzer Körper zitterte unkontrolliert.
Ich hatte keine Ahnung, warum sie so aufgelöst war. Mona war zwar schon immer eine junge Frau gewesen, die näher am Wasser gebaut war als andere, mehr ihren Gefühlen folgte als ihrem Verstand, aber derart neben der Spur hatte ich sie noch nie erlebt.
Behutsam versuchte ich, ihre Arme, die fester als ein Schraubstock zupackten, von meinem Hals zu lösen. Die Verzweiflung verlieh ihr Kraft, die normalerweise in der Nacht allen Diés genommen wurde. Beim dritten Anlauf gelang es mir zumindest, sie so weit von mir zu stemmen, dass ich wieder einigermaßen Luft holen konnte – und sie auch.
»Mona!« Zum dritten Mal rief ich ihren Namen und endlich – endlich! – schien sie mich zu hören.
Zumindest konnte ich in ihren dunklen Augen, die wir Diés-Kinder alle gemeinsam hatten, etwas anderes als nackte Verzweiflung erkennen. Ich schob sie noch weiter von mir weg und legte ihr beide Hände an die Wangen, um ihren Blick festzuhalten.
»Mona. Bitte. Erzähl mir, was passiert ist. Du bist ja vollkommen außer dir. Wurdest du angegriffen?«
Mein Blick glitt suchend über ihren Körper. Abwegig war die letzte Frage nicht. Wir lebten hier auf der Insel Diés nicht ohne Gefahren – und die Nox-Bastarde standen ganz oben auf der Feindesliste.
Immer wieder gab es Banden, die unsere Insel nachts überfielen. Wir besaßen zwar einen gewissen Reichtum, den sie ihrerseits vermissten, aber selten hatten sie uns diesen entwendet. Meist ging es nur darum, uns zu verängstigen und dafür zu sorgen, dass wir ihrer eigenen Insel, der sie den Namen Nox gegeben hatten, fernblieben.
Natürlich fanden die Überfälle nur in der Nacht statt, wenn ihre Kräfte stärker waren als unsere. Diese verdammten, feigen Schweine! Von denen Zero das größte war. Ich hatte den Anführer der Nox-Banden zwar noch nie gesehen, aber ich verachtete ihn aus vollstem Herzen. Mir war bekannt, wozu er fähig war und wofür er sich hielt, vor allem, seit er eben zum Anführer seiner Generation ernannt worden war. Er war arrogant und kaltblütig – und ich hasste ihn, seit ich seinen Namen zum ersten Mal gehört hatte.
Mein Hass war vor allem auch darin begründet, dass uns von klein auf eingetrichtert wurde, dass die Nox schlecht waren und wir uns von ihnen fernhalten sollten. Seit ich im Alter von drei Jahren auf die Insel gekommen war, hatte man mich das gelehrt. Wieder und wieder.
Ich konnte mich nicht genau daran erinnern, was ich vor meinem dritten Geburtstag erlebt hatte. Die bruchstückhaften Erinnerungen handelten vor allem davon, dass ich etwas verloren hatte. Etwas Wichtiges. Ich wusste noch, dass ich geweint hatte. Und ich glaubte mich an Häuser zu erinnern. Hohe Häuser. Weiße Fassaden, helle Lichter … Bilder, die ich nur selten, und wenn, dann nur kurz, aufflackern ließ. Zu viel Schmerz war damit verbunden und zu viele Fragen wurden aufgeworfen. Fragen nach dem Warum …
Nach meiner Ankunft auf der Insel war mir wie bei allen anderen Diés eine Familie zugeteilt worden, in der ich seither lebte. Es gab keine Blutsverwandtschaft unter uns Diés, da wir miteinander keine Kinder zeugen konnten. Die Kinder kamen vom Meer. So war es immer schon gewesen. Meine Familie bestand aus der Ratsältesten Praeda, meiner Ziehmutter, sowie Mona, die gleichzeitig meine beste Freundin war.
Sie war zwar zwei Jahre älter als ich, aber doch um so vieles naiver. Gut, ich hatte schon immer eine stärkere Gabe besessen als die anderen Diés. Wir alle hatten die Fähigkeit, strategisch zu denken und waren allgemein künstlerisch begabt. Aber ich hatte immer schon Menschen rascher durchschauen und Dinge noch schneller auffassen und analysieren können als die anderen. Eine Gabe, die oft zum Fluch werden konnte. Vor allem, wenn man wusste, wer einen täuschen wollte – und wer dafür sorgte, dass man seine Erinnerungen ruhen ließ.
Dabei erinnerte ich mich an so manches, was vor meinem Leben auf dieser Insel gewesen war. Verschwommene Bilder, die ich nicht verstand oder einordnen konnte. Doch ich wusste, dass mein Gedächtnis auch Dinge beinhaltete, die weder Praeda noch sonst jemand vom Rat der Diés hören wollten. Niemand wollte darüber sprechen und so hatte ich es mit den Jahren aufgegeben, Antworten auf meine Fragen zu erhalten.
Es hätte so vieles gegeben, was ich hätte fragen wollen. Aber solange die Räte schwiegen, würde ich wohl vergebens darauf warten, mehr über mich und mein früheres Leben zu erfahren. So blieb mir nur, mich in der Bibliothek unserer Siedlung zu verkriechen und in den alten Büchern, die es dort zuhauf gab, nach Antworten zu suchen. Bisher leider ohne Erfolg.
Mona schien sich wieder ein bisschen gefangen zu haben. Sie schluchzte zwar immer noch und ihr Blick war verschleiert vor Tränen, aber immerhin sprach sie mit mir.
»Nein …« Sie schniefte und sah mich mit geröteten Augen an. »Ich wurde nicht angegriffen … ich … hach, Skya, es ist so schrecklich!«
Ich sah sie verstört an und begriff nicht, was sie mir sagen wollte. »Was ist schrecklich?«, fragte ich verwirrt.
»Alles«, war die aussagekräftige Antwort.
»Mona!« Jetzt rief ich ihren Namen regelrecht. »Hör bitte auf, so rumzuheulen und erzähl mir, was los ist!«
Mona schniefte und wischte sich mit der Hand über die Oberlippe. Ich reichte ihr seufzend ein Taschentuch, das ich aus einer Kommode neben der Eingangstür holte.
Praeda bewahrte dort immer Taschentücher auf – womöglich wegen Momenten wie diesem. Jedenfalls kamen sie mir jetzt gelegen.
Meine Freundin nickte dankbar und putzte sich geräuschvoll die Nase, während sie ihre Augen zusammenkniff, als könne sie sie vor der Wahrheit verschließen.
»Komm, setz dich aufs Sofa und erzähl, warum du so aufgelöst bist«, sagte ich ein wenig ruhiger und zog sie am Ellbogen ins Wohnzimmer.
Unser Haus war hübsch eingerichtet, Praeda legte viel Wert darauf, dass unser Wohlstand unübersehbar blieb. So zierten selbst gemalte Gemälde die Wände über dem Kamin, den wir so gut wie nie benutzten, da die Temperaturen hier auf Diés über das ganze Jahr sehr warm – und sehr stabil – waren. Dennoch hatte Praeda darauf bestanden, einen Kamin in ihrem Haus zu haben. Warum, war mir immer ein Rätsel geblieben.
Mona ließ sich neben mir in die Polster sinken und schnäuzte sich nochmals ausgiebig, ehe sie dankend das Wasserglas nahm, das ich ihr reichte.
Es handelte sich dabei eigentlich um meine abendliche Ration. Wir hatten auf der Insel derzeit wenig Trinkwasser und jeder durfte nur so viel zu sich nehmen, wie die Räte uns erlaubten. Momentan waren das vier Gläser pro Tag.
Grund für die Wasserknappheit war die Tatsache, dass die Nox bei ihrem letzten Überfall – der Teufel soll sie holen! – in unserer Wasseraufbereitungsanlage die Rohre zerschnitten hatten. Die Leitungen führten von der Quelle, die sich im Inneren des Berges auf ihrer Insel befand, bis zu uns hinüber. Anscheinend war ihnen dies ein Dorn im Auge gewesen und sie hatten bei ihrem letzten Anschlag dafür gesorgt, dass nur noch drei Rohre heil geblieben waren. Drei Leitungen für fast zweihundert Menschen. Das war zu wenig. Viel zu wenig.
Die Arbeiter versuchten mit Hochdruck, die Rohre wiederherzustellen, aber es würde wohl noch mindestens einen Monat dauern, bis wir alle wieder genügend Wasser zur Verfügung hatten.
Ich hatte eigentlich mein Wasserglas heute Abend vor dem Zubettgehen trinken wollen, aber jetzt sah ich stirnrunzelnd dabei zu, wie Mona daran nippte. Auch sie litt unter der Wasserknappheit – wie wir alle.
Meine Kehle fühlte sich trocken an und ich schluckte schwer, während ich mir ausmalte, wie sich das kühle Nass in meinem eigenen Hals anfühlen würde.
Monas Blick traf auf meinen und sie reichte mir rasch das Glas. »Trink du auch etwas«, murmelte sie.
Ich schüttelte den Kopf, aber als sie das Glas nicht sinken ließ, nahm ich es dennoch wieder und stellte es auf den Glastisch zurück, der vor dem Sofa stand.
»Geht es dir besser?«, fragte ich mit einem forschenden Blick auf ihr verheultes, aufgequollenes Gesicht.
Sie nickte tapfer. »Ja, danke.« Dann atmete sie tief durch und schlug die Augen nieder. Sie nestelte am Saum ihres Kleides, das sie immer trug.
Wir Diés besaßen eine Art Uniform, die uns als Einheit auszeichnen sollte. Gegen wen war klar: gegen die Nox. Wir trugen alle braune Kleidung, deren Farbe sich mit dem Schwarz unserer Haare biss. Aber das schien dem Rat, der dies beauftragt hatte, nicht aufgefallen oder egal zu sein. Ziemlich sicher hatte einer der männlichen Räte die Hände dabei im Spiel gehabt, eine Frau hätte solch eine Farbenkombination niemals abgesegnet.
Die männlichen Diés hatten immerhin die Möglichkeit, Hosen anzuziehen, während wir Frauen meist in Kleidern unterwegs sein mussten. Es sei denn, wir hatten solch gute Freunde wie ich. Wie Teias zum Beispiel, einer meiner engsten Freunde neben Mona. Er hatte mir ein paar Hosen besorgt, als ich zehn Jahre alt war. Damals waren sie mir viel zu groß gewesen, aber seit ich sechzehn geworden war, passten sie wie angegossen.
Ich genoss es, sie zu Hause zu tragen. Natürlich durfte ich das nur, wenn Praeda nicht hier war … sie hätte die Hosen auf der Stelle verbrannt. So was geziemte sich nicht für ein Mädchen – sie war sehr streng. Aber bisher hatte sie meine Beinkleider zum Glück noch nie gesehen. Im Verstecken war ich ziemlich gut.
Jetzt schlug ich die Beine unter und musterte meine Freundin mit schmalen Augen. »Also, wenn es dir besser geht, dann kannst du mir ja jetzt erzählen, was dich derart aufgewühlt hat.«
Mona schien es schwerzufallen, die richtigen Worte zu finden. Schließlich blickte sie mich voller Verzweiflung an und ich konnte in ihren schwarzen Augen Angst erkennen. Aber wovor?
»Skya, ich … was ich dir jetzt erzähle, muss unbedingt unter uns bleiben.« Ihre Stimme war kaum ein Flüstern, vielmehr ein Krächzen.
Ich nickte mit Nachdruck und wartete mit zunehmender Ruhelosigkeit. Geduld war noch nie meine Stärke gewesen – erst recht nicht, wenn ich meine Freundin so aufgelöst vor mir sah.
Sie blickte mich nicht an, während sie fortfuhr. »Du weißt doch, dass ich vor etwa drei Monaten an der Grenze war …«
Abermals nickte ich. Ich wusste nicht, worauf sie hinaus wollte.
Dass sie in der Nähe der Grenze verhaftet worden war, war ein offenes Geheimnis. Jeder wusste es auf der Insel. Nur Praeda war es damals zu verdanken gewesen, dass Mona nicht ertränkt worden war. Im Grunde stand nämlich die Todesstrafe darauf, wenn man sich an der Grenze ohne Erlaubnis herumtrieb. Es war strengstens verboten, sich mit den Nox anzulegen. Das war schon immer so gewesen und keiner war dumm genug, es dennoch zu tun.
Nun ja, hatte ich schon erwähnt, dass Mona nicht gerade mit Weisheit gesegnet war?
»Damals«, sprach sie weiter, »habe ich einen Jungen gesehen. Einen sehr … gut aussehenden Jungen.«
Ich zog die Augenbrauen zusammen und mein Blick verfinsterte sich. »Du hast jemanden gesehen? Einen Nox?«
Sie bestätigte meine Befürchtung mit einem Nicken. »Ja. Er heißt Calem. Und er ist wirklich nett.«
Ich wollte ihr etwas entgegnen. Sie maßregeln. Ihr an den Kopf werfen, wie strohdumm sie war. Dass man sich nicht von der Dunkelheit blenden lassen durfte …
Doch sie hob beide Hände und erstickte meine Predigt damit im Keim. »Es ist nicht so, wie du denkst oder wie uns die Räte glauben machen wollen. Die Nox sind Menschen wie wir, keine hirnlosen Muskelpakete, die nur kämpfen wollen. Sie haben Gefühle, sind nett. Und Calem, er … ich habe ihn seither mehrmals getroffen.«
»Du hast …« Mir blieb die Luft weg und ich sog sie scharf wieder ein. »Mona!«, fuhr ich eindringlich fort. »Bist du von allen guten Geistern verlassen?! Du kannst nicht einfach einen Nox treffen und das Gefühl haben, es sei in Ordnung! Das geht nicht! Du bist eine Diés! Es ist verboten! Verdammt, lass dich nicht von der Dunkelheit blenden!« Die letzten Worte schrie ich ihr förmlich ins Gesicht, sodass sie zusammenzuckte und den Blick senkte.
»Ich weiß«, flüsterte sie. »Ja, ich weiß, dass es … verboten ist … aber … ich mag ihn. Ich glaube sogar, ich liebe ihn.«
Ich holte abermals tief Luft und versuchte, das gerade Gehörte zu verdauen.
Hatte mir Mona tatsächlich soeben eröffnet, dass sie in einen Nox verliebt war? Einen unserer Erzfeinde?! Allen Diés war von Kindesbeinen an eingetrichtert geworden, uns von ihrer Insel – und vor allem von ihnen selbst! – fernzuhalten.
Wir hatten auf den Rat gehört … das hatte ich zumindest angenommen. Bis eben.
Verständnislos starrte ich meine Freundin an und wusste nicht, was ich auf ihre Offenbarung erwidern sollte. Gab es überhaupt Worte, die in dieser Situation angemessen waren? Wenn ja, dann wollten sie mir gerade partout nicht einfallen …
Mein Gesicht musste Bände sprechen, denn Mona zog den Kopf zwischen den Schultern ein und brachte es kaum zustande, mir in die Augen zu schauen.
»Was?!«, rief ich aufgebracht. »Gibt es da etwa noch mehr, was du mir sagen willst?!«
Ich kannte diesen Ausdruck in ihren Augen. Ich kannte sie so gut. Und ich wusste, dass das, was sie mir gleich sagen wollte, ganz und gar nicht gut war … überhaupt nicht gut!
Sie nickte zögerlich und nestelte dann mit noch mehr Eifer an ihrem Saum. »Ich … ich glaube, ich erwarte ein Kind von ihm …« Ihre Stimme war kaum ein Hauch, doch mich traf es wie ein Blitzschlag.
»Wie bitte?!«, schrie ich und sprang auf. Ich hielt es keine Sekunde länger auf dem Sofa aus.
Meine beste Freundin – meine Schwester! – saß vor mir und erzählte mir, dass sie ein Kind erwartete. Von einem Nox! EINEM NOX!
Das war ihr Todesurteil! Jeder wusste das! JEDER!
Das war einer der Gründe, warum wir uns von den Nox fernhalten sollten – und sie sich von uns: Wenn eine Diés von einem Nox ein Kind erwartete, starb sie unter Qualen bei der Geburt. Ebenso, wenn eine Nox schwanger von einem Diés wurde.
Deswegen gab es keine Schwangeren hier und Schwangerschaften wurden uns in der Schule als gleichbedeutend mit einem Todesurteil gepredigt!
Deswegen brachten uns die Inducer die Kinder über das Meer!
Deswegen durften wir uns nicht mit den Nox einlassen!
Genau DESWEGEN!
Ich griff mir mit beiden Händen ins Haar und fuhr hindurch, bis es nach allen Seiten abstand, um dann über mein Gesicht zu wischen. Doch so fest ich es auch wünschte, die Schuld und Scham wollten nicht aus Monas Blick weichen.
Sie meinte es tatsächlich ernst. Es war kein übler Scherz!
Verflucht noch mal!
Ich begann, im Zimmer auf und ab zu laufen und war mir nur zu bewusst, dass ihre Augen mir folgten, während ich meine Schläfen massierte, um die Kopfschmerzen fortzuscheuchen, die mit der aufkommenden Nacht mein Denken verlangsamten. So war es immer. In der Nacht verloren wir Diés unsere Fähigkeiten, klar zu denken und wenn wir es versuchten, waren hämmernde Kopfschmerzen die Folge. Etwas, das ich gerade in diesem Moment nicht gebrauchen konnte!
Ich musste klar denken!
Mona hatte gegen die Regeln verstoßen … und würde bestraft werden, wenn das ans Licht kam! Entweder tötete der Rat der Diés sie oder die Geburt des Kindes, in dessen Erwartung sie war.
Es war eine ausweglose Situation!
Schließlich blieb ich stehen und starrte sie fassungslos an. »Sag mir, dass das nicht wahr ist …« Meine Stimme war so leise, dass Mona sich etwas nach vorne beugen musste, um mich zu verstehen. »Sag mir, dass du kein Kind von einem dieser Bastarde erwartest! Sag es mir!« Da ich die letzten Worte schrie, konnte sie mit dem Kopf wieder zurückweichen, was sie auch tat.
Ihre Augen waren geweitet, während sie eine verneinende Bewegung machte. Zu mehr war sie offenbar nicht imstande.
Verflucht! Verflucht!
Ich hatte eine Menge Verwünschungen auf den Lippen, die mir auch entwichen wären, wenn sie mich nicht mit einem erneuten Schluchzen unterbrochen hätte.
Entnervt sah ich zu ihr und mein Herz rutschte in die Hose, als ich Panik in ihrem Blick las.
Verdammt, sie war noch nicht fertig mit ihrer Beichte!
Ich trat zu meiner Freundin und schüttelte sie an den Schultern. »Mona! Sag mir die ganze Wahrheit! Ich sehe, dass du mir noch etwas vorenthältst!«
Sie brachte es nicht zustande, mich anzusehen, als sie weitersprach. »Praeda … sie weiß es«, presste sie schließlich hervor.
Kaltes Grauen ergriff mein Herz, ließ es auf der Stelle langsamer schlagen. Ich löste meine Hände von Monas Schultern und sank wieder neben ihr aufs Sofa.
Was mir meine beste Freundin gerade eröffnet hatte, bedeutete … nein, nein, nein … das konnte – durfte! – nicht sein.
»Bist du sicher?«, flüsterte ich, ohne sie anzusehen.
Aus dem Augenwinkel konnte ich ihr Nicken dennoch erkennen.
»Verdammt«, entfuhr es mir.
Zur Antwort erhielt ich nur ein weiteres Schluchzen.
Kapitel 2 – Skya
Ich hatte keine Ahnung, was ich jetzt tun sollte. Und Mona offenbar auch nicht. Eine Weile lang starrten wir schweigend auf den kleinen Salontisch, als würde dort nächstens die Lösung für unser Problem auftauchen.
Natürlich passierte das nicht …
Alles, was auftauchte, war mein Kater, der auf den Namen Dämon hörte und uns mit großen, gelben Augen ansah. Sein graues Fell leuchtete stets, da ich es täglich bürstete. Er schien zu merken, dass wir angespannt waren und maunzte leise, während sein Schwanz unruhig hin und her zuckte. Nach ein paar Sekunden tapste er beleidigt weg, weil ich ihn nicht beachtete. Aber ich war nicht in der Lage, ihm jetzt die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Ich hatte ein Problem zu lösen.
Ja, es war unser Problem. Ich liebte Mona. Wir kannten uns schon so lange, waren zusammen aufgewachsen. Und der Gedanke, dass sie bald sterben könnte – hingerichtet würde! –, bildete in meinem Magen schmerzhafte Knoten, während mein Herz am liebsten stillstehen wollte.
Wenn Praeda es wusste, war es nur eine Frage der Zeit, bis Mona festgenommen wurde. Die Räte würden sie zum Tode verurteilen, weil sie gegen unsere heiligste Regel verstoßen hatte.
Das durfte einfach nicht passieren, wir mussten irgendetwas dagegen unternehmen. Mussten sie verstecken, bis wir eine bessere Lösung gefunden hätten. Bis wir das Kind los waren. Bis wir …
»Meinst du …«, unterbrach Mona meine herumwirbelnden Gedanken, die mir mit jeder Sekunde stärkere Kopfschmerzen bereiteten. »Meinst du, es stimmt, was uns der Rat immer erzählt hat? Dass ich sterben werde bei der Geburt?«
Ich wandte ihr langsam den Kopf zu, meine Stirn in tiefe Falten gelegt, und fuhr mir mit der Hand durch das Haar. Einige Sekunden lang musterte ich sie nachdenklich.
Ich hatte noch nie hinterfragt, ob es stimmte, was die Ältesten uns über Schwangerschaften erzählten. Aber ich war auch nicht gewillt, es drauf ankommen zu lassen.
»Ich … weiß es nicht …«, gestand ich leise.
Sie nickte und starrte wieder niedergeschlagen auf den Salontisch.
Ich hatte noch nie eine Schwangere gesehen, hatte mich mit diesem Thema nicht einmal im Ansatz befasst, da es so absurd und weit weg von meinem Alltag war.
Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass jemals eine Diés schwanger gewesen war, weil die Inducer uns stets die Kinder gebracht hatten. Diese geheimnisvollen Gestalten, die Diener unserer Göttin Solaris und des Nox-Gottes Lunos. Sie brachten in ihren Booten regelmäßig Babys und Kleinkinder über das Meer, welche in feierlichen Zeremonien an die Räte der Nox und Diés überreicht wurden, je nachdem, zu welchem Volk sie gehörten. Auch Mona und ich waren in solch einem Boot hierhergekommen.
Die Inducer kamen durch die unsichtbare Barriere, die unsere Inseln umgab und die sonst keiner überwinden konnte. Dahinter befand sich das Land der Götter. So war es immer schon gewesen und würde es immer sein. Keiner stellte das infrage und keiner wusste, woher die Kinder kamen. Keiner … außer mir. Oder zumindest vermutete ich, dass die Bilder, an die ich mich erinnerte, etwas damit zu tun haben mussten. Doch meine Fragen wollte ja ohnehin niemand beantworten.
»Vielleicht …«, murmelte Mona und unterbrach damit ein weiteres Mal meine Gedankenflut. »Womöglich stimmt es ja nicht und ich überlebe die Geburt.«
Ich schnaubte unwirsch durch die Nase. »Willst du wirklich wegen eines ungeborenen Kindes dein Leben riskieren? Ganz zu schweigen davon, dass Praeda dieses Mal deinen Kopf nicht aus der Schlinge ziehen kann. Sie wird das Gesetz befolgen müssen und das Gesetz besagt, dass jeder, der im Verdacht steht, mit einem Angehörigen der Nox intim geworden zu sein, hingerichtet wird … und dass du eindeutig mit einem Nox intim geworden bist, das werden alle sehen, sobald deine Schwangerschaft weiter fortgeschritten ist …« Ich brach ab und schauderte bei dem Gedanken.
Verdammt, wir brauchten dringend eine Lösung!
»Wie konnte sie es überhaupt erfahren?«, fragte ich, um auszuloten, wie groß unsere Chancen standen, dass es noch nicht die halbe Insel wusste und wir damit rechnen mussten, dass jeden Moment unser Haus von Soldaten gestürmt würde.
Mona zitterte unwillkürlich, als sei ihr kalt. Dann sah sie mich verzweifelt an. »Ich habe in der Krankenstation nach einem Schwangerschaftstest gesucht, da ich seit zwei Monaten meine Periode nicht mehr bekommen habe.«
Ich runzelte die Stirn. »Einen … was?«
»Einen Schwangerschaftstest«, wiederholte Mona. »Die Ältesten haben uns ihre Existenz zwar verschwiegen, aber während meiner Ausbildung habe ich mal einen gesehen. Irgendwo bei den alten Unterlagen, die Praeda in ihrem Arbeitszimmer der Krankenstation verbirgt. Ich bin dort hineingeschlichen … und ich habe einen gefunden. Die Anwendung war nicht schwer zu verstehen. Als ich gerade das Ergebnis in den Händen hielt, hat Praeda mich erwischt und mich ausgefragt. Ich … ich konnte sie nicht anlügen. Das konnte ich noch nie …«
Oje, die anständige, naive Mona. Sie war wirklich viel zu gut und rechtschaffen für diese Insel …
Abermals verfluchte ich insgeheim die Nox aufs Übelste – jetzt war Zero als mein Feindbild Nummer eins von diesem Calem abgelöst worden –, doch das würde Mona leider nichts helfen.
Sie schluchzte erneut herzzerreißend. »Praeda ist danach direkt zur Versammlung gegangen, und ich bin mir sicher, dass sie dort meinen Fall besprechen wird. Das muss sie, das hat sie mir gesagt.« Ihr Schluchzen wurde zu einem Schluckauf. »Skya … hicks … was … mache … hicks … bloß? Bald … bald ist … hicks … Praeda … wieder … hicks … hier und dann … dann …« Ihre sonstigen Befürchtungen gingen in einem weiteren Heulkrampf unter.
Ich legte den Arm um sie und streichelte ihr mit der Hand beruhigend über den Kopf.
»Schhh, wir finden eine Lösung. Wir müssen es einfach«, flüsterte ich ihr zu. »Als Erstes bringen wir dich hier weg. Ich werde Praeda sagen, dass ich dich nicht gesehen habe, wenn sie zurückkommt. Das verschafft uns Zeit, denn dann muss der Rat erst Suchtrupps ausschicken.«
Mona schniefte und sah mich aus ihren verquollenen Augen geknickt an. Es dauerte eine Weile, bis sie ihren Schluckauf einigermaßen unter Kontrolle hatte und wieder normaler sprechen konnte. »Und wohin soll ich … gehen?«, schluchzte sie. »Praeda kennt die … Insel wie niemand … sonst. Sie wird mich … finden.«
»Sie hat dich nicht gefunden, als du die letzten Male bei der Grenze warst, oder?«, erwiderte ich energisch. »Dort wirst du auf mich warten. Ich werde morgen vor Anbruch der Dämmerung dorthin kommen und bringe dir etwas zu essen mit. Außerdem will ich mit diesem Calem sprechen und ihm an den Kopf werfen, was ich von ihm halte!«
»Nein!« Mona legte mir beide Hände auf die Schultern und sah mich mit panisch geweiteten Augen an. »Bitte, tu das nicht!«
»Warum nicht?« Mein Blick war misstrauisch. Ich wusste, wie durchdringend meine dunklen Augen blicken konnten.
»Weil … weil …«, stotterte Mona. Dann schluchzte sie abermals und senkte den Blick. »Ich habe ihm nichts von meinem Verdacht erzählt …«
Ich runzelte die Stirn. »Was für ein Verdacht?«
Sie wagte nicht, mir in die Augen zu sehen. »Na, dass ich … ein Kind von ihm erwarte.«
»Mona!« Ich sog scharf die Luft ein und versuchte, meine Moralpredigt, die mir auf den Lippen brannte, zu unterdrücken. Ein paar Mal atmete ich tief ein und aus, bis ich mich beruhigt hatte. Dann fuhr ich gefasster fort: »Du musst es ihm sagen. Er ist der VATER.«
»Ja, ich weiß …«, nickte sie hilflos. »Aber ich habe Angst davor, wie er reagieren wird. Was, wenn er … wenn er mich tötet?«
Ich schnaubte leise. »Was hätte er davon? Zudem hast du gesagt, dass er nett sei. Ein netter Kerl tötet nicht einfach so eine Frau, mit der er geschlafen hat.«
Monas Gesicht glich einem einzigen Trauerspiel, als sie mir in die Augen sah. »Vielleicht hast du recht … aber kannst … kannst du es ihm sagen?«
»Ich?!« Ich sah sie fassungslos an.
Ich wollte diesem Calem vieles an den Kopf werfen, aber bestimmt nicht die frohe Botschaft, dass er zeugungsfähig war. Das sollte Mona mal schön selbst ausbaden.
Schließlich war sie es gewesen, die jegliche Vernunft in den Wind geschossen und diesen Armleuchter zwischen ihre Beine gelassen hatte.
»Bitte …« Monas flehender Blick hätte wohl einen Fisch dazu überreden können, einen Tag als Lemur zu verbringen.
»Wir werden sehen«, antwortete ich ausweichend. »Wann trefft ihr euch denn normalerweise?«
»Meist alle drei Tage in der Dämmerung bei der Grenze.«
»Mhm.« Ich runzelte die Stirn, während ich mir in Gedanken versuchte, einen Plan zurechtzulegen. »Und wann ist das nächste Mal?«
»Morgen Abend.«
Mist. Das bedeutete, ich würde Mona einen Tag lang vor Praeda verstecken müssen. Denn in mir reifte gerade der Plan heran, dass dieser Calem sie nach Nox mitnehmen könnte. Dort wäre sie zumindest vor Praeda und den anderen Ratsmitgliedern der Diés sicher. Immerhin so lange, bis uns etwas Besseres einfiel.
Meine Gedanken überschlugen sich und mir wurde fast schwindlig, als ich versuchte, meinen provisorischen Plan auf Schwachstellen zu analysieren.
Diese verdammte Nacht verlangsamte immer stärker meine Denkfähigkeit und meine Kopfschmerzen wurden schier unerträglich. Aber ich musste weiter am Plan feilen! Von Kopfschmerzen konnte man nicht sterben, von einer Schwangerschaft aber schon!
Vielleicht konnte ich unbemerkt ein Mittel für einen Schwangerschaftsabbruch besorgen. Wenn es in der Krankenstation Schwangerschaftstests gab, dann sicher auch Abtreibungsmittel. Etwas anderes würde Mona nämlich nicht übrig bleiben. Sie musste das Kind loswerden. Womöglich, wenn sie nicht mehr schwanger war, würde die Strafe nicht allzu hart ausfallen. Vielleicht könnte Praeda dann ein Wort für Mona einlegen und ihr das Todesurteil ersparen.
Ja, das wäre ein guter Plan.
Nur würde es äußerst schwierig werden, ein solches Abtreibungsmittel zu besorgen. Da niemand auf unserer Insel jemals schwanger gewesen war, wären diese wohl genauso schwer zugänglich wie die Schwangerschaftstests. Ich selbst kannte die Existenz solcher Mittel überhaupt nur, weil ich mal zufällig etwas davon in einem der hundert Bücher gelesen hatte, die ich in der Bibliothek täglich wälzte. Ich musste das Buch wiederfinden. Vielleicht fände sich darin eine Anleitung, wie man so ein Mittel selbst herstellen konnte? Einen Versuch wäre es wert, auch wenn mir die Zeit davonlief.
Aber erst musste ich dafür sorgen, dass Mona in Sicherheit war. Eins nach dem anderen.
»Ich werde dich zur Grenze begleiten«, sagte ich entschieden und stand auf. »Die Versammlung dauert noch mindestens zwei Stunden, da Praeda mit den Räten unter anderem auch besprechen will, wie sie den Fischfang noch ertragreicher machen können. Zudem ist da ja noch das Wasserproblem. Und wenn sie auch noch über dich beratschlagen, wird es noch länger dauern. Nur könnte es sein, dass sie dann bereits Wachen schicken, um dich festzunehmen. Denen müssen wir entkommen, was bedeutet, dass wir auf der Stelle aufbrechen.«
Mona nickte stumm.
Die Tatsache, dass Praeda sie nicht augenblicklich verhaftet hatte, verriet mir, dass es meiner Ziehmutter widerstrebte, eine ihrer Töchter zum Tode zu verurteilen. Praeda war eine der leidenschaftlichsten Verfechterinnen unserer Gesetze und Regeln, doch sie hatte Mona einfach so gehen lassen. Das passte nicht zu ihr.
Vielleicht hatte Praeda Mona eine Flucht ermöglichen wollen? Wahrscheinlich hatte sie sogar geahnt, dass Mona zu mir kommen würde. Konnte das sein? Selbst wenn, wir durften nicht noch mehr Zeit verlieren!
»Komm.« Ich zog Mona auf die Beine. »Pack ein paar Kleider von mir ein. Das meiste sollte dir ja passen. Zudem die Wolldecke, die ich unter dem Bett aufbewahre. Ich suche in der Zwischenzeit in der Küche nach etwas Essbarem. In fünf Minuten gehen wir los. Beeil dich!«
Ich schubste meine Freundin in Richtung Schlafzimmer, während ich selbst den Weg zur Küche einschlug. Sie stolperte zur Tür und riss sie auf, um in meinem Zimmer zu verschwinden.
Ich ergriff meinen Rucksack, den ich ansonsten immer für den Sportunterricht benutzte, und stopfte ihn mit einem Laib Brot und einigen Äpfeln voll.
Mein Kater war mir in die Küche gefolgt und sah mir neugierig dabei zu, während er wieder leise maunzte, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber für ihn hatte ich jetzt gerade keine Zeit. Mona war wichtiger als alles andere.
Einen Moment lang zögerte ich, dann packte ich eine Flasche meines Wasservorrates mit ein. Mona würde ihn dringender benötigen als ich, wenn sie bei der Grenze war.
Die ›Grenze‹ wurde eine langgezogene, breite Insel genannt, die dicht mit Sträuchern und hohen Bäumen bewachsen war und wie ein Wall gegen die Nox anmutete. Man musste durch kniehohes Meerwasser waten, um sie von unserer Insel aus zu erreichen.
Auf der Grenze selbst gab es kaum Leben, geschweige denn Trinkwasser. Zudem patrouillierten Soldaten am Strand, aber es war der einzige Platz, der mir auf die Schnelle eingefallen war. Mona würde nur einen Tag dort bleiben müssen und in dieser Zeit würde sie sich vor den Soldaten verbergen können. Das hoffte ich zumindest.
»Kommst du?«, rief ich, als ich alles fertig gepackt hatte.
Mona trat aus meinem Zimmer, über der Schulter ebenfalls einen Rucksack, der zum Bersten gefüllt schien.
»Danke«, flüsterte sie.
Sie hatte sich wieder etwas gefangen und ihr Blick wirkte ein wenig klarer. Immerhin. Eine hysterische Mona könnte ich auf unserer Flucht nicht gebrauchen.
»Danken kannst du mir, wenn du in Sicherheit bist«, antwortete ich ausweichend. »Komm jetzt. Bis zur Grenze ist es ein ganzes Stück Fußmarsch und ich muss wieder hier sein, wenn Praeda zurückkommt.«
Mona nickte und folgte mir in die Dunkelheit hinaus.
Wie ich sie hasste, diese Tageszeit. Das lag nicht nur daran, dass ich mich schwächer fühlte und schlechter denken konnte, sondern auch daran, dass ich kaum etwas erkennen konnte, weil die Augen von uns Diés nicht für die Nacht geschaffen waren. Nicht umsonst war unser Kredo: Lass dich nicht von der Dunkelheit blenden. Wir waren im Dunkeln fast so blind wie ein Maulwurf.
Auf eine Lampe hatte ich verzichtet. Wir durften keinesfalls auffallen. So blieb uns nur das spärliche Sternenlicht, denn der Mond zeigte sich heute nicht am Himmel. Was mir ebenfalls recht war. Neben der Tatsache, dass ich den Mond nicht ausstehen konnte, war es somit dunkel genug, um uns vor den Augen der Patrouillen zu verbergen.
Während der Nacht gab es überall Soldaten, die dafür sorgten, dass kein Diés ohne Erlaubnis das Haus verließ. Zwischen acht Uhr abends und sechs Uhr morgens war Sperrstunde. Dann durften nur diejenigen, die in dringenden Angelegenheiten unterwegs waren und dementsprechende Papiere bei sich hatten, auf den Straßen sein.
Mona war ein großes Risiko eingegangen, als sie so spät in der Nacht zu mir gekommen war. Sie lebte ebenso wie mein Jugendfreund Teias seit einem Jahr ein paar Häuser weiter in der Krankenstation, wo sie als Pflegerin arbeitete. Die meisten Pfleger und Ärzte wohnten dort, um direkt vor Ort sein zu können, sollte ein Notfall eintreten. Dann mussten sie nicht mitten in der Nacht ihre Häuser verlassen.
Nun ja, außer man hieß Mona.
Auch Praeda arbeitete in der Krankenstation, allerdings genoss sie als Ratsmitglied das Privileg, auch nachts unterwegs sein zu dürfen, sodass sie auch nicht in dem Krankenhaus schlafen musste.
So leise und unauffällig wie möglich verließen wir die Siedlung und schlugen den Weg in Richtung Grenze ein. Hinter unserem Haus breitete sich ein weitläufiges Maisfeld aus, dessen Pflanzen uns zusätzlichen Sichtschutz boten.
Es war gespenstisch ruhig und ich fühlte mich alles andere als wohl in meiner Haut. Doch es widerstrebte mir, Mona alleine zur Grenze zu schicken. Ich musste wissen, dass sie dort gut ankam, sonst würde ich die ganze Nacht kein Auge zutun können.
Unser Weg führte uns durch einen dunklen Wald, vorbei an Wiesen und über zwei Hügel. Ein paar Mal mussten wir uns vor Patrouillen verstecken, doch glücklicherweise entdeckte uns niemand.
Endlich, fast eine Stunde später, erreichten wir den Strand bei der Grenze. Das Rauschen der Wellen wirkte irgendwie beruhigend, auch wenn mein Herz bis zum Hals schlug.
Dunkel glänzte das Wasser vor uns, aus dem die Grenz-Insel wie ein schwarzer Hügel emporragte. Dahinter konnte ich den Berg der Nox-Insel erkennen, der sich von dem Sternenhimmel abhob. Er hieß Lunamontem und wirkte so bedrohlich und kalt wie seine Bewohner. Ich schauderte bei seinem Anblick. Selten war ich so nervös gewesen wie in diesem Moment.
»Das letzte Stück musst du alleine gehen«, flüsterte ich. »Wenn ich triefendnass nach Hause komme und Praeda bereits da ist, wird sie wissen, wo du dich verbirgst.«
»In Ordnung«, nickte Mona. »Kommst du auch wirklich morgen vor Einbruch der Dämmerung vorbei?«
»Versprochen.« Ich zwang mich zu einem aufmunternden Lächeln, auch wenn ich wusste, dass sie mein Gesicht im Halbdunkeln kaum erkennen konnte. »Ich werde dreimal wie eine Elfenbeinmöwe rufen. Dann weißt du, dass ich es bin.«
»Gut.« Sie fiel mir mit einem leisen Schluchzen um den Hals und drückte mich an sich. »Danke. Danke für alles.«
Ich erwiderte ihre Umarmung und hielt sie ein paar Sekunden lang fest. Mein Herz wurde schwer, als ich sie losließ. Rasch hauchte ich ihr einen Kuss auf die Wange und drängte sie dann, auf die kleine Insel hinüberzuwaten, ehe eine weitere Patrouille vorbeikommen konnte.
Wieder nickte sie und wandte sich leise seufzend ab. Ich sah ihr hinterher, wie sie im Sternenlicht zum Wasser ging und wartete, bis sie auf der Insel angekommen und ihre Silhouette nicht mehr von der Dunkelheit der Bäume zu unterscheiden war.
Dann drehte ich mich um und rannte so rasch ich konnte den Weg zurück. Wenn ich Glück hatte, hätte Praeda noch nichts von meinem Verschwinden bemerkt.
Kapitel 3 – Zero
Der Schein des lodernden Feuers tauchte das Innere der Kuppel in orangefarbenes Licht. Das gut tausend Quadratmeter große Glaskonstrukt war unser ganzer Stolz.
Die Bauarbeiten hatten viele Jahre in Anspruch genommen, aber die Mühe hatte sich definitiv gelohnt. Die schwarzen, glänzenden Steinplatten schienen das nächtliche Himmelszelt zu spiegeln – in Wirklichkeit hatten wir in mühevollster Kleinarbeit Bergkristalle in den Boden gearbeitet. Hier konnten wir der Schönheit der Nacht frönen, ohne Wind und Wetter ausgesetzt zu sein – und wir frönten ihr äußerst gerne, so wie heute.
Ich liebte diese Atmosphäre, die Hitze des Feuers, das wir mitten im Raum entzündet hatten und dessen Rauch durch eine Öffnung an der Decke abzog. Die Musik, die durch unsere Körper dröhnte, sie zum Tanzen brachte … aber das ging allen hier so.
Wir vergaßen beim Feiern für ein paar Stunden den Alltag, die Pflichten, die vielen Verbote, die unsere Gemeinschaft am Leben hielten, und, dass wir seit Tagen kaum etwas gegessen hatten. Seit diese verfluchten Diés – die Haie sollen sie fressen! – ihre Netze gespannt hatten, verirrten sich fast keine Fische mehr auf unsere Seite des Meeres. Es würde noch lange dauern, bis die Arbeiter die Folgen der Sabotage durch diese Sonnenanbeter beseitigt hatten, aber das verschwieg ich der jüngeren Generation natürlich. Sie kämpften zur Genüge mit den starren, strengen Regeln und dem eintönigen Alltag, das wusste ich, weil ich einer von ihnen war.
Seit drei Jahren versuchte ich, den Balanceakt zwischen Ratsmitglied und Generation B – wie uns die alten Säcke gerne nannten – zu meistern. Ich war der Erste aus unseren Reihen, der in den Rat aufgestiegen war, was mich ganz automatisch zum Anführer der Gen B gemacht hatte. Die Gen A bestand nur aus den Ratsmitgliedern. Die Gen B aus allen anderen, die im Verlaufe der vergangenen Zeit hier auf die Insel gekommen waren.
Mit meinen neunzehn Jahren war ich zwar noch jung, aber alle hier in der Kuppel mussten wohl oder übel auf mich hören. Das taten sie jedoch bestimmt gerne, weil sie zu mir aufschauten und mich bewunderten. Ich war der Einzige, der seine körperlichen Kräfte während des Tages nicht einbüßte so wie die übrigen Nox. Außerdem richtete ich ekstatische Feste für sie aus – kurz: Ich war durch und durch fantastisch!
»Zero! Du brennst!«, erklang eine Stimme hinter mir.
Ich wirbelte auf dem Absatz herum und schaute nach unten auf mein Hosenbein. Dort loderte tatsächlich eine Flamme, weil ich zu nahe am großen Feuer gestanden hatte, um die Übersicht über mein rauschendes Fest zu haben.
Mein Knöchel fing in der nächsten Sekunde an, höllisch zu schmerzen, aber ich würde jetzt nicht wie ein kleines Mädchen hektisch nach der Flamme schlagen – das ziemte sich für einen Anführer nicht.
Zähne zusammenbeißen! Cool aussehen!
Ich schenkte Fero, dem jungen Nox, der mich auf meine unangenehme Situation aufmerksam gemacht hatte, einen gelangweilten Blick und streifte dann mit meinem rechten Fuß – der zum Glück noch nicht in Flammen stand – über die brennende Stelle. Das kleine Feuer ging aus und ich konnte Fero mit einem dankenden Nicken abspeisen und erhobenen Hauptes in Richtung Thron davonstolzieren. Dass mir auf dem Weg kurz die Gesichtsmuskulatur entglitt, weil ich dem intensiven Schmerz von vorhin Luft machen musste, fiel niemandem auf.
Der steinerne Thron zwischen den zwei hohen Palmen gehörte normalerweise Neurus, unserem Ratsoberhaupt. Eigentlich diente die Kuppel den Versammlungen der Ältesten und nicht unserem Vergnügen. Da ich die Musik, den Tanz und den Spaß heute hierher gebracht hatte, gehörte der unbequeme Thron aber für den Moment mir.
Ich nahm Platz und wunderte mich, wie Neurus sein knochiges Hinterteil immer so lange hier positionieren konnte. Wahrscheinlich war der Alte immun gegen Schmerzen – er war auch immun gegen Humor und Stilgefühl. Würde es noch immer nur nach ihm gehen, würden wir alle nach wie vor in diesen hässlichen, dunkelgrauen Kutten herumlaufen, die er so liebte, weil sie versteckten, dass er so unansehnlich wie ein Anglerfisch war.
Eine meiner ersten Errungenschaften als Ratsmitglied war das Abschaffen der Kleiderordnung für meine Generation gewesen. Jetzt durften wir tragen, was wir wollten, und das war gut so, denn ich sah in diesen schwarzen Hosen, die eine der Schneiderinnen extra für mich angefertigt hatte, wirklich umwerfend aus!
»Suchst du Gesellschaft, mein Anführer?«
Ihre Stimme drang problemlos durch die lauten Bässe, weil sie schrecklich schrill war. Sie stützte sich mit der linken Hand am oberen Rand des Throns ab und beugte sich leicht nach vorne. So präsentierte sie mir ihren Ausschnitt, als würde sie mir zwei Zuckermelonen anbieten.
Teana wusste ihre Vorzüge in Szene zu setzen, aber diese offensichtliche Laszivität hatte irgendwann angefangen, mich zu langweilen – zumindest ein ganz klein wenig.
»Gefällt dir das Fest?«, wollte ich wissen, um ein paar Lobgesänge auf meine Anführerqualitäten zu hören – die langweilten mich nie!
Sie nickte hastig und verriet mir mit ihrem Grinsen, dass sie ein wenig zu oft am Zitruswein genippt hatte. Eigentlich durften wir nur an den höchsten Feiertagen Alkohol trinken, aber ich hatte die Kiste mit den seltenen Flaschen in Neurus’ Zelt gefunden und kurzerhand mitgenommen. Wenn mich der Alte schon ständig mit Einzelunterricht quälte, dann wollte ich auch ein wenig davon profitieren. Seine Predigten und Lektionen brachten mir wenig, weil ich sie mittlerweile auswendig im Schlaf mitsingen konnte. Er trichterte mir seit meinen Kindertagen dasselbe ein.
Erstens: Das Wohl von Nox steht über allem! Zweitens: Diés sind Idioten! Und drittens: Halte dich immer penibelst an die Vorschriften der älteren Ratsmitglieder, sonst muss ich dich leider wieder auspeitschen, was ich großartig finde, weil ich ein sadistischer Sack bin!
Das waren natürlich nicht ganz Neurus’ Worte, aber meine persönliche Zusammenfassung.
»Du bist das Beste, das uns Nox passieren konnte! Irgendwann übernimmst du den Ratsvorsitz und dann muss selbst die Gen A auf dich hören!«, flötete Teana mir Lobgesänge vor. Ihre Augen glänzten beeindruckt und sie stolperte einen Schritt näher, um sich auf meinen Schoß zu setzen.
Das durfte sie natürlich. Auf mir war immer Platz für junge, hübsche Mädchen, die in den kurzen Röcken und den engen Oberteilen, die sie dank mir tragen durften, zum Anbeißen aussahen. Die Schneiderinnen übertrafen sich manchmal selbst mit ihren Kreationen.
»Das dauert aber wohl noch etwas, bis Neurus seinen Thron räumt«, brummte ich.
Sie kicherte und legte ihre Arme um meinen Nacken. »Neurus zerfällt doch sowieso bald zu Staub. Wie alt ist er? Achtzig? Neunzig?«
»Er ist fünfundfünfzig …« Er sieht nur aus wie neunzig, ergänzte ich in Gedanken. »… und du solltest etwas mehr Respekt vor unserem Rat zeigen!«
Meine hellblauen Augen konnten sehr, sehr kalt blicken und meine versteinerte Miene hatte schon viele das Fürchten gelehrt. Selbst mein älterer Bruder Calem konnte Angst vor mir bekommen, wenn ich ihn so ansah.
»Entschuldige!«, rief Teana, geläutert von der Erkenntnis, dass ich nicht nur großzügige, amüsante Seiten hatte. Sie wusste das zwar bereits, aber ich hatte manchmal den Verdacht, dass ihr Gedächtnis ein Sieb war, das nur die schönen, spaßigen Dinge auffing und den Rest wie Sand hindurchrieseln ließ.
Eigentlich hatte es sich mittlerweile herumgesprochen, dass ich mich zwar für gewisse Bedürfnisse der Gen B stark machte, aber mich auch konsequent und unabdingbar für das Einhalten der wichtigsten und ältesten Statuten einsetzte. Mein Vater hatte mir unmissverständlich klargemacht, dass unser aller Leben auf dem Spiel stehen würde, wenn wir die Regeln und Gesetze unserer Insel missachteten. Nach seinem Tod und vor allem seit meinem Eintritt in den Rat hielt ich umso stoischer an dieser Anweisung fest.
»Ich sollte dich auspeitschen lassen«, drohte ich ihr mit kalter Stimme, was Teana dazu veranlasste, von meinem Schoß zu rutschen und vor mir auf die Knie zu fallen. Im ›Einschüchternde-Drohungen-Aussprechen‹ war ich unschlagbar.
»Verzeih mir, Zero! Ich wollte nicht respektlos klingen. Ich …«
»Steh auf! Du sollst nicht vor mir auf dem Boden herumrutschen, du sollst dir bewusst machen, dass es der Rat ist, dem wir es zu verdanken haben, dass wir Essen, ein Dach über dem Kopf und ein strukturiertes Leben haben.«
Mein Satz wurde von einer hoheitsvollen Geste begleitet.
Sie nickte wieder hastig, diesmal mit Angst in den Augen. Wenn ich sie an Neurus verraten hätte, hätte ich sie wirklich auspeitschen müssen – öffentlich. Diese Strafe stand auf Rufmord, aber ich hatte keine Lust auf dieses Spektakel. Ich war vielleicht ein klein wenig narzisstisch, aber kein Sadist.
Es gab eine große Vielzahl an Strafen und Sanktionen auf Nox, die zwar notwendig waren, um unsere Regeln und Gebote durchzusetzen, aber wirklich angefreundet hatte ich mich mit der ganzen Quälerei noch nie.
Ausgesprochen hätte ich diese Abneigung natürlich nicht. Es gab einen Unterschied zwischen dem, was ich dachte und dem, was ich sagte. In meinen Gedanken konnte ich Neurus einen alten, knochigen Sack ohne Stilgefühl nennen, aber das wirklich kundzutun, hätte der Gemeinschaft geschadet und nichts stand für mich über dem Wohl der Nox. Regel Nummer eins!
Wenn es zum Wohl aller war, würde ich mich sogar selbst am Versammlungsplatz auspeitschen lassen – das nannte man wohl bedingungslosen Patriotismus.
Meine Aufopferung kannte kaum Grenzen. Richtig, ich war ein hervorragender Anführer!
Teana stand wieder auf und schenkte mir einen Blick, der mir versichern sollte, dass sie nur ein vollbusiges Unschuldslamm war. »Ich werde nie wieder ein schlechtes Wort über unsere Regeln und unsere Anführer verlieren.« Sie neigte demütig den Kopf, nur um mir im nächsten Moment einen lasziven Blick zuzuwerfen. »Darf ich mich vielleicht bei dir … entschuldigen?«
»Ja. Schreib ihm einen Brief! Falls du überhaupt schreiben kannst.«
Die Stimme, die plötzlich durch die Bässe an mein Ohr gedrungen war, ließ mich die Augen verdrehen, noch bevor ich sein dämliches Gesicht erblickt hatte.
»Kannst du mich kurz mit unserem großen Anführer alleine lassen?«, fragte er Teana und trieb das vollbusige Unschuldslamm damit wieder zu den anderen.
»Was willst du, Calem?« Meine Stimme klang so genervt, wie ich mich fühlte, weil sein Auftauchen hier nichts Gutes zu bedeuten hatte.
Er hielt wenig von meinen Festen, nannte sie heuchlerisch und idiotisch, aber das entsprach in etwa meiner Charakterisierung meines Bruders Calem, also war es irgendwie in Ordnung.
Als ich ihm einen überdrüssigen Blick schenken wollte, fiel mir auf, dass er weder dämlich grinste noch diese ›Ich bin ein Freigeist und kann mich nicht an Regeln halten‹-Attitüde, die ich auf den Tod nicht ausstehen konnte, an den Tag legte. Ich hätte schwören können, dass er sogar traurig aussah.
»Kannst du dein dummes Fest für ein paar Minuten verlassen? Ich muss mit dir reden«, brummte er, senkte dabei aber den Kopf, was irgendwie niedergeschlagen anmutete.
Ich betrachtete betont gelangweilt meine Fingernägel, ehe ich ihm einen knappen Blick zuwarf. »Hat das nicht bis morgen Zeit? Oder heulst du gleich? Das sieht nämlich so aus … Brauchst du ein Taschentuch?«
Sein Blick wurde finster und er ballte die Hände zu Fäusten. Er hätte aber damit rechnen müssen, blöde Sprüche von mir zu kassieren, wenn er hier mit glänzenden Augen vor mir auftauchte – wer war ich? Seine beste Freundin?
»Für dich ist alles immer ein Witz!«, fauchte er mit unbeherrschter Stimme.
Er fuhr selten so aus der Haut, aber ich war gerade zu sehr in Fahrt, um nachzuhaken, warum er so emotional war.
»Ein Witz?«, wiederholte ich seine Worte mit hochgezogener Augenbraue und setzte mich aufrechter in den steinernen Thron. »Ich bin für vieles bekannt, aber sicher nicht für meinen Humor!«
Obwohl ich es mochte, wenn die Leute über meine Witze lachten. Ja, ich konnte definitiv unterhaltsam sein, zumindest mir selbst bereitete ich meistens große Freude mit meinen Kommentaren und das war schließlich das Wichtigste. Narzissten Modus an.
Calem knurrte abermals. Dieses Geräusch aus seiner Kehle hätte für jeden anderen wahrscheinlich bedrohlich geklungen, weil mein Bruder groß und breitschultrig war, aber ich wusste, dass in diesem Löwenkörper ein Kätzchen wohnte. Da konnten einem seine markanten Züge und der unterkühlte Blick noch so sehr etwas anderes weismachen wollen.
Seine Stimme klang vorwurfsvoll und seine blauen Augen blitzten. »Für was du bekannt bist, interessiert mich nicht, Zero! Niemand hier kennt dich richtig. Niemand außer mir! Und du versteckst dich immer hinter Sarkasmus und Witzchen, wenn es um ernste Gefühle geht!«
Ich schnaubte verächtlich. »Ernste Gefühle? Ach, zieh dir ein Kleid an und schreib ein Gedicht!«
Jetzt war es um seine Beherrschung vollends geschehen. »Du kannst es nicht sein lassen, oder? Du Idiot!«
Niemand sonst hätte mich ungestraft anschreien oder gar Idiot nennen dürfen. Calem hatte dieses Privileg leider schon immer gehabt und ich konnte es ihm nicht absprechen, schließlich war er mein Bruder.
Er fuhr sich verzweifelt seufzend durch die kinnlangen Haare, ehe er sich auf dem Absatz umdrehte und an all den tanzenden, lachenden Nox vorbei nach draußen rannte.
Ich seufzte ebenfalls, während ich ihm nachsah.
Wieso konnte er nicht so wie die anderen Nox sein? Wieso konnte er verdammt noch mal nicht tanzen, Zitruswein in sich reinschütten und auf mich hören?! Nein, er musste dieser verfluchte Freigeist sein, dessen dummen Kopf ICH ständig aus der Schlinge ziehen musste. Damit ihn, für all den Mist den er baute, niemand an den Galgen brachte oder im Meer ertränkte!
Ich sprang entnervt von dem unbequemen Thron auf und wollte der emotionalen Prinzessin hinterherlaufen, aber die Musik ging plötzlich aus und ein Raunen durch die Menge.
»Schluss jetzt, ihr habt genug mit dem Exzess geliebäugelt! Der Morgen bricht bald an!«
Diese Stimme löste augenblicklich den Ratsmitglied-Modus in mir aus. Ich erstarrte mitten in der Bewegung, stellte mich gerader hin und ließ meine Miene sofort gefrieren.
Neurus hatte meine Feier gesprengt. Der Orangeton des Feuers, das in der Mitte der Kuppel brannte, ließ sein faltiges, raues Gesicht noch vergrämter aussehen als sonst. Er war alt und hässlich – und er trug wie immer seine dunkle Robe, die er wohl noch mehr liebte als sein dunkelblaues Amulett, das ihn als Ratsältesten auszeichnete und um seinen knochigen Hals baumelte. Sein einst blondes Haar war beinahe weiß und strähnig.
»Räumt auf und geht in eure Zelte! Zur Dämmerung gehen wir wieder dem Alltag nach! Wenn einer von euch den Unterricht oder die Arbeit verschläft, hat er mit harten Strafen zu rechnen!«
Diese ruppigen, drohenden Worte waren nicht aus dem Mund unseres Ratsoberhaupts gekommen, sondern aus meinem.
Ich musste Neurus immer wieder beweisen, dass ich auf der Seite des Rates stand und meiner Generation nur Zuckerwürfel vor die Füße warf. Dass ich unsere Gesetze und Regeln verinnerlicht hatte und sie niemals infrage stellen würde, waren Dinge, an denen ich keine Zweifel aufkommen lassen durfte.
Während meine Partygäste begannen, aufzuräumen und die Kuppel wieder zum Versammlungsraum machten, ging ich auf Neurus zu.
Wir hatten alle hellblaue Iriden, aber hinter seinen tobte ein Schneesturm – ich war irgendwie neidisch auf diesen eiskalten Blick.
»Es gab keine Zwischenfälle, sie haben sich nur amüsiert«, sagte ich in sachlichem Tonfall, als würde ich einen erfolgreichen Beutezug rapportieren. »Es hat ihnen gutgetan.«
Man hatte bei Neurus immer das Gefühl, dass er absolut kein Interesse an dem hatte, was man ihm sagte. Er nickte trotzdem, weil er mich anhören musste – schließlich gehörte ich auch zum Rat.
»Na gut«, brummte er. »Mach dir aber bewusst, dass wir deine Kinkerlitzchen nur dulden, weil du sie vom Hunger ablenkst. Glaub nicht, dass so etwas auf Nox zur Routine wird. Struktur und Pflichtbewusstsein – wenn wir davon ablassen, bricht unsere Welt zusammen.«
Am liebsten hätte ich ihm gesagt, dass er alt, hässlich und kopfschmerzerregend war, aber ich war kein trotziges Kind mehr, sondern ein Anführer.
»Ich weiß. Ich werde es sie nie vergessen lassen, das habe ich meinem Vater versprochen, wie du weißt«, betete ich herunter.