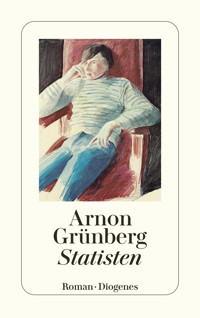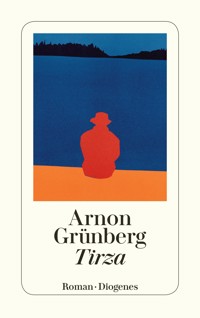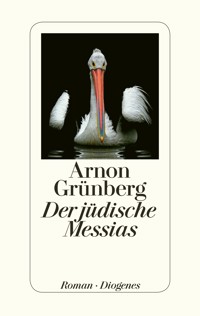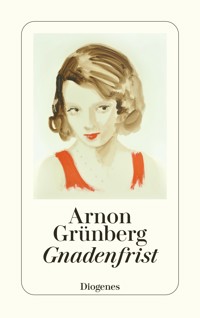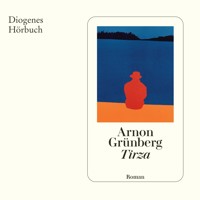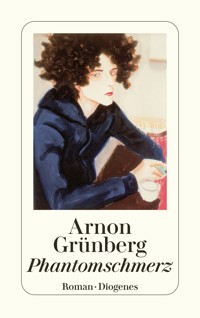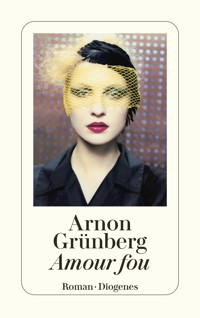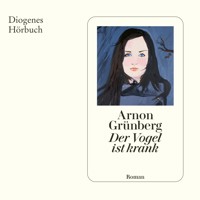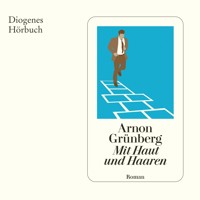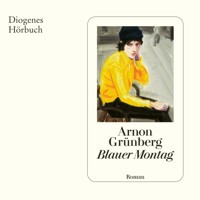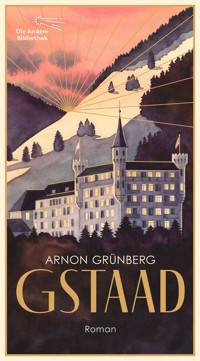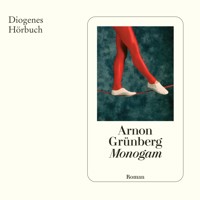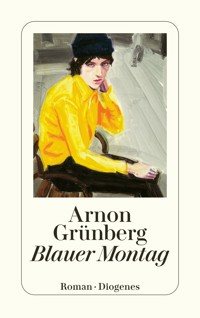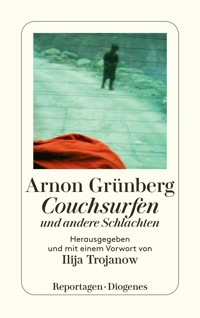
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine abenteuerliche Reise durch die Gegenwart: Ob auf fremden Sofas beim Couchsurfing, auf Brautschau in der Ukraine, in Guantánamo oder Afghanistan – diese Reportagen führen dorthin, wo wir alleine nie hingekommen wären. Arnon Grünbergs Blick für das absurde Detail stimmt ebenso nachdenklich, wie er erheitert. Die besten Reportagen, ausgewählt von Ilija Trojanow.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 609
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Arnon Grünberg
Couchsurfen und andere Schlachten
Reportagen
Aus dem Niederländischen von Rainer Kersten
Herausgegeben und mit einem Vorwort von Ilija Trojanow
Diogenes
Wenn ich ihn fragen könnte …
Arnon Grünberg bei Ilija Trojanow auf der Couch
Ilija Trojanow: Was unternimmt ein Autor, um die Welt kennenzulernen? Schaut er aus seinem Fenster auf einen Baum, der sich dem Frühling zuneigt? Schließt er die Augen, um sich die Kindheit zu vergegenwärtigen? Betrachtet er von einem Hochsitz aus das Wild, das aus dem Wald der Ereignisse tritt? Zieht er eine Latzschürze an oder einen Overall oder irgendeine andere Uniform des Alltags, um zu erfahren, wie es ist, ein anderer zu sein? Wagt er ein anderes Leben für eine gewisse Auszeit? Setzt er sich wie ein Pilger dem Unbekannten aus?
Viele Autoren sind scheu, introvertiert, gedankenverloren, selbstzentriert. Gelegentlich gelingen ihnen Gedichte, die Schüler späterer Generationen auswendig lernen und interpretieren müssen. Als Dexter Gordon von einem jungen, technisch brillanten Saxophonisten nach dem Geheimnis seines Spielens gefragt wurde, antwortete er: »Leben.« Womit er die vielen Höhen und Tiefen seiner Leidenschaft und Sucht meinte. Jahrzehnte früher hat ein junger jüdisch-russischer Autor namens Isaak Babel den damals weltberühmten Maxim Gorki um Rat gebeten, wie er ein besserer Schriftsteller werden könne. »Gehe unter die Menschen!«, soll der ältere Autor ausgerufen haben. Babel befolgte diesen Rat gewissenhaft: »Als sich herausstellte, dass zwei oder drei meiner leidlich geratenen jünglingshaften Versuche nur zufällig geglückt waren, dass ich in der Literatur gar nichts würde ausrichten können, dass ich erstaunlich schlecht schrieb – da schickte Alexej Maximowitsch [Gorki] mich zu den Menschen. Und sieben Jahre – von 1917 bis 1924 – trieb ich mich unter den Leuten herum.«1 Babel meldete sich sogar freiwillig zum Dienst in der Roten Armee. Selten wurde Recherche unter existentielleren Bedingungen betrieben.
2006 beschloss Arnon Grünberg, damals alles andere als ein Jüngling oder ein Anfänger, sich diesen Rat zur Maxime zu nehmen und gleichfalls unter die Menschen zu gehen, »nicht als Spion, sondern als Beobachter«. Ein ungewöhnlicher, ein mutiger Schritt. Könnte ich ihn fragen, würde mich vor allem interessieren, was der Antrieb für diese Entscheidung war. Unzufriedenheit mit seinem Schreiben? Fernweh im übertragenen Sinne, ein gebrochenes Herz oder Entdeckerlust?
Arnon Grünberg: 1994 erschien in den Niederlanden mein Debütroman Blauer Montag. Fast unmittelbar danach begann ich, für eine Zeitschrift Kolumnen zu schreiben und kurz darauf auch längere Beiträge für eine Zeitung. Beides tue ich noch immer, doch nach ungefähr zehn Jahren mit diversen Romanen und anderen Büchern erschien meine Welt mir mehr und mehr steril und nur noch von der Beschäftigung mit bloßen Derivaten des Literarischen geprägt, das heißt in meinem Fall vor allem: sehr klein, von Lesungen in Buchhandlungen zu literarischen Festivals zu wieder einer anderen Lesung. Gut, zwischendurch schrieb ich auch noch und lebte, doch so vieles blieb unentdeckt: Welten, von denen ich nichts wusste oder nur das, was mir die Zeitungen präsentierten. Und das genügte mir nicht. Daneben begann meine Berührungsangst vor dem, was ich hier einfachheitshalber »die Wirklichkeit« nennen möchte, mir zunehmend auf die Nerven zu gehen. Die Furcht des Romanautors, sich auf das »Niveau des Journalismus herabzubegeben« oder durch zu ausgiebige Recherche literarisch verbrämte Soziologie zu betreiben – das alles erschien mir immer weniger als Versuch, die wahre Literatur gegen Instrumentalisierung von außen zu schützen, denn als plumpe Furcht vor der schmutzigen, unberechenbaren Realität, »Berührungsangst« eben. 2006 sagte ich bei einer Unterredung mit dem damaligen Feuilletonchef der niederländischen Zeitung NRC Handelsblad: »Seit fast zehn Jahren schreibe ich jetzt Kolumnen über meine Reisen und mein Leben – ich finde, das reicht: Ich möchte auch über andere Menschen und Welten schreiben.« Keine Fragen mehr beantworten, sondern sie stellen. Ich wollte der Rolle entkommen, die ich für mich irgendwann akzeptiert, doch die man mir eigentlich aufgedrängt hatte.
Zudem war ich moralisch, auch wenn sich das vielleicht etwas pathetisch anhört, davon überzeugt, dass der Romancier die gesellschaftliche Wirklichkeit keinesfalls ignorieren darf, und diese Pose wollte ich auch nicht mehr vortäuschen. Ich wollte keinen harmlosen Zeitvertreib liefern, ich wollte meine eigene Rolle – die des Autors in einer Gesellschaft – besser begreifen. Im Februar 2006 hatte das niederländische Parlament für eine neue, vieldiskutierte Mission unserer Truppen in Afghanistans Süden gestimmt, und so erschien es mir logisch, dass meine erste Reise mich dorthin führen müsste. Ich hatte nie Militärdienst geleistet, die Armee kannte ich nur aus den Nachrichten und aufgrund von dem, was ich mir selber zusammenreimte, sagen wir ruhig: meinen Vorurteilen. Außerdem wollte ich wissen, was erklärter Pazifismus in einer Demokratie bedeutet, wenn diese Demokratie beschließt, auf den Kriegspfad zu gehen. Kurzum: Alles sprach für Afghanistan als Ziel meiner ersten journalistischen Reise.
Die Chefredaktion der genannten Zeitung sträubte sich zunächst gegen mein Vorhaben: War das nicht zu gefährlich, womöglich würde es Leser befremden – bei einer Lesung in Deutschland fiel während einer Fragerunde später einmal das Wort »Kriegstourismus« –, und ich glaube, dass das Projekt auch die niederländische Armee nicht unmittelbar begeisterte. Im Juli 2006 jedoch machte ich mich mit einer Einheit der niederländischen Truppen auf den Weg, und diese Erfahrung gab den Anstoß zu vielen weiteren journalistischen Projekten.
Schließlich gibt es kein größeres Glück als das Befriedigen der eigenen Neugier. Die Rolle des Schriftstellers als reiner Ästhet – soweit es diese Spezies überhaupt noch gibt – war jedenfalls keine, die ich je für mich angestrebt hatte. In einer schmutzigen Welt kann auch der Schriftsteller nicht mit sauberen Händen herumlaufen.
Ilija Trojanow: Über die Jahre hinweg hat Arnon Grünberg fremde Identitäten angenommen, Erniedrigungen ertragen, Rollen gespielt, Missverständnisse ausgehalten und dabei stets seinen aufmerksamen Blick auf das Unvermutete gerichtet, sein geneigtes Ohr jenen geliehen, die einen Alltag bewohnen, der ihm zunächst befremdlich, exotisch oder grotesk erschien. Er war unter anderem Couchsurfer, Zimmerjunge, Brautshopper, Kellner, Masseur, Investor, er hat sich die Hände schmutzig gemacht und manches Mal in Situationen begeben, die ihn gewiss beschämt haben, ohne dass er seine Verlegenheit zeigen durfte. Doch allmählich, und das macht den besonderen Reiz dieser Reportagen aus, vertraut sich Arnon Grünberg dem Unbekannten an, so wie er es sich auf einem Sofa in der fremden Wohnung bequem macht. Nicht dass es dort heimelig wäre, aber die scharfen Kanten der Fremde, das Verstörende am Unverständlichen schleifen sich ab, und er beginnt hinter die Fassade des Offensichtlichen zu blicken.
Wie wählt er die unbekannten Berufe und Lebensentwürfe aus? Nähert er sich ihnen mit der Naivität des Unbedarften? Oder bereitet er sich darauf vor wie ein Schauspieler des method acting auf seine nächste Rolle? Führt er Notizbuch von Tag eins an, oder lässt er sich zunächst treiben beziehungsweise antreiben, bis er eine kritische Dichte der Erfahrung gesammelt hat, die ihn zum Stift greifen lässt? All das würde ich ihn gerne fragen.
Arnon Grünberg: Eine Reportageidee bringt immer wieder die nächste hervor: Nachdem ich einmal in Afghanistan gewesen war, wollte ich nochmals dorthin. Nachdem ich mich mit diesen Reportagen dem Genre genähert hatte, dachte ich: Warum mich auf Afghanistan beschränken? Es gibt doch auch einen Krieg im Irak, ich könnte die us Army begleiten. Was machen die Amerikaner dort, was sind die Unterschiede, was die Übereinstimmungen der Situation in den Ländern? Treten die Niederlande am Hindukusch anders auf, was machen wir dort und warum? Und wer sind die Leute, die dort den Kopf für uns hinhalten?
Außerdem: Warum mich auf Soldaten beschränken? Es gibt andere Berufe und andere Welten, die ich erkunden könnte. Ich las über Reisen für amerikanische Männer, die im Ausland eine Braut suchen, zum Beispiel in der Ukraine, und ich dachte: Da muss ich hin! Und so kam ich auf das Thema Menschenhandel. So führt ein Thema immer wieder zum nächsten.
Nach einer gewissen Zeit gab es allerdings auch Themenvorschläge und Anregungen von außen. So ging die Reportage über das Neubauviertel bei Utrecht auf eine Anfrage zurück, ob ich nicht etwas über die Kunstprojekte in jenem Viertel schreiben wolle. Ich antwortete, dass die Kunstprojekte mich weniger interessierten, aber dass ich gern etwas über das Viertel und seine Bewohner schreiben wollte, was dann in die genannte Reportage mündete.
Ich gehe vorbereitet, aber mit offenen Sinnen auf Reisen. Eine gewisse Naivität ist unerlässlich, wenn man wirklich beobachten will. Dabei benutze ich ein Notizbuch, denn alles muss stimmen – die Reportagen sind keine »Literatur«. Ich darf mir nichts ausdenken, alles muss dem Faktencheck standhalten.
Und ich passe mich an, lebe mich ein. Nach ein paar Tagen ist man auf dem Stützpunkt im Irak genauso zu Hause wie in einem Hotel in Bayern. Uniformen können helfen, in eine andere Rolle zu schlüpfen.
Es geht mir nicht darum, Missstände an den Pranger zu stellen: Wo ich sie sehe, beschreibe ich sie, ich will aber niemanden zwingen, sich zu empören, das wäre unhöflich und bringt wenig. Ich möchte beschreiben, was ich sehe, höre und rieche. Wenn irgend möglich, stelle ich mich vor.
Ich bin Spion oder Amateuranthropologe, aber auch ein Performancekünstler und letztlich doch immer wieder der Autor – mit großem Respekt vor den Menschen, über die ich schreibe. Dabei bin ich mir des Machtgefälles zwischen Autor und Beschriebenen durchaus bewusst: Wer andere beschreibt, übt Macht über sie aus. Dies ist fast immer der Fall, vor allem, wenn das Geschriebene von vielen gelesen wird.
Vom Naturell her bin ich eher Melancholiker als Aktivist, Melancholie scheint mir für einen journalistischen Schriftsteller die intelligentere Form des Aktivismus. Meine Absichten gehen eher dahin, zu analysieren, als zu verändern.
In einer idealen Welt wäre ich länger am jeweiligen Ort des Geschehens geblieben, aber ich bin kein Soldat, kein Zimmerjunge, meine Anwesenheit ist per definitionem vorübergehend. Hätte ich mehr erfahren, wenn ich länger geblieben wäre, nicht einen Monat, sondern ein Jahr? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht.
Alles ist ein Kompromiss, auch die Menge der Zeit, die ich an einem bestimmten Ort verbringen kann.
Rückblickend betrachtet, sind diese Reisen Erkundungen des Tragischen. Letzteres liegt in der Konfrontation mit der Faktizität und im Akzeptieren des Schicksals. Die Komik ist dabei nie weit entfernt. Wie sonst könnte man dem Tragischen begegnen, ohne in Zynismus zu verfallen?
Es gibt kaum etwas Schöneres, als sich selbst zu vergessen. Letztendlich sind diese Reisen auch Versuche, den anderen kennenzulernen, doch nicht als den Fremden, sondern als jemanden, der man selbst hätte sein können.
Ilija Trojanow: Ich fürchte, Arnon Grünberg ist ein Idealist und Moralist wider Willen. Immer wieder scheucht er seine eigenen skeptischen Pferde auf, so sehr misstraut er festen Überzeugungen und dogmatischen Gesetzen, aber in seiner literarischen Weitstirnigkeit offenbart sich ein Suchender, der die Abschottung bekämpft. Differenz ist für ihn eine zufällige Distanz, die überwunden werden kann (ob als Spion oder als Amateuranthropologe), Empathie ist für ihn integraler Bestandteil seines literarischen Verfahrens. Die Grenzen seines Verständnisses, vermute ich, sind die Schlagbäume des bitteren Ernstes; wer Ironie nicht akzeptieren kann, wird selbst schwerlich Akzeptanz finden. Arnon Grünberg hinterfragt die vorgegebenen Verwerfungslinien, weswegen seine Reportagen nicht nur spannend, unterhaltsam und lehrreich sind, sondern zum Nachdenken anregen, über die eigene Position, die eigene Wahrnehmung, die eigene Gewissheit. Arnon Grünbergs Texte sind Karten aus aller Welt, mit eigenwilliger Projektion und Proportion, gezeichnet von einem provokanten Geist.
Alkoholismus mit Rollkoffer
Couchsurfen in Mittel- und Osteuropa
(April 2008)
Im Winter 2007 hörte ich zum ersten Mal etwas von Couchsurfen2. Es bedeutet, kurz gefasst, dass man umsonst bei Fremden übernachtet. Die Website bringt Leute, die ein Bett suchen, mit solchen zusammen, die ein Bett anzubieten haben.
Ich komme gern in die Wohnungen anderer Leute, es macht mir Spaß, unter fremden Duschen zu stehen. Doch achtundvierzig Stunden später möchte ich am liebsten wieder weg sein. Ein Bett mit Zukunft gleicht einem Sarg.
Darum habe ich mich bei couchsurfing.com angemeldet.
Was ich tue, dient meinem Zweck, leben zu lernen. Lernen, das heißt: sehen, wie andere es machen. Und auch: in den Sachen anderer Leute herumschnüffeln.
Sicherheitshalber unternehme ich diese Reise mit meinem Freund Sander. Für den Fall, dass Gastgeber oder andere Couchsurfer aggressiv werden.
Der Gratisaspekt erweist sich dabei als ein eher untergeordnetes Detail. Der eigentliche Reiz des Couchsurfens liegt im Kontakt. Wobei ich hinzufügen muss, dass ›Kontakt‹ für die meisten Beteiligten nicht unbedingt erotisch besetzt ist.
Das erste Bett steht in Berlin, in der Wohnung von Guy und Marianne in der Manfred-von-Richthofen-Straße. Guy ist Francokanadier und laut Couchsurfing-Profil Liebhaber von dunklem Bier. Wer Marianne ist, muss sich noch herausstellen.
In der Wohnung empfängt uns eine 21-jährige, schlicht gekleidete junge Frau, auch sie aus dem französischsprachigen Teil Kanadas. Sie ist in Berlin, um Deutsch zu lernen.
Weit und breit allerdings leider kein Guy. Dafür fünfzig leere Bierflaschen in der Küche.
Auf die Frage, wann Guy nach Hause kommt, antwortet Marianne: »Das kann spät werden.« Wie sie mir sagt, logiert in der Wohnung vorübergehend auch noch eine zweite Marianne, die Marianne deux genannt wird.
Ich sage: »Ich muss noch mal los, bin gleich zurück, ich kauf schnell noch ein Handtuch.«
Mehr als ein Bett darf man nicht erwarten.
Um sieben Uhr erscheint Marianne deux. Ebenfalls Francokanadierin. Marianne deux sagt, sie sei glücklich.
Von Guy nach wie vor keine Spur.
Gegen Mitternacht bieten Sander und ich an, im Wohnzimmer auf einer Matte zu schlafen, damit Marianne deux das Bett haben kann.
An der Wand hängen Fotos der blonden Krankenschwester, der eigentlich diese Wohnung gehört. Erst war sie in Indien, jetzt arbeitet sie in der Schweiz.
Brüderlich liegen wir schließlich zu dritt nebeneinander. Wir sprechen noch etwas Französisch, aber ich kann mich nicht mehr auf den richtigen Zeitengebrauch konzentrieren.
Lektion eins des Couchsurfens: Mach das Beste aus allem, was dir begegnet. Stell keine Fragen. Fragen sind kein Beitrag zum Glück.
Das zweite Bett steht in der Wohnung von Martina in Prag 7. Sie wohnt im dritten Stock. Ab acht Uhr abends sind wir willkommen.
Sander und ich wuchten meinen Schrankkoffer die Treppe hinauf. Innerlich bin ich von Kopf bis Fuß auf die zu erwartende Hippiekolonie eingestellt, mein Reisegepäck dagegen stammt aus Großvaters Zeiten.
Im Wohnzimmer liegen zwei Matratzen mit drei Couchsurfern. Es riecht nach Aschenbecher, Schweißfuß und Bananen.
Martina hat rotes Haar und ist ziemlich dick. Sie ist fünfundzwanzig, sieht aber älter aus. In ihrem Couchsurfing-Profil steht, dass sie raucht wie ein Schlot. Was sie verschwiegen hat, ist, dass sie von Bananensaft-Cocktails mit Rum lebt.
Ich komme mit einem jungen Australier ins Gespräch, der fünf Tage auf dem Flughafen von Prag übernachtet hat, bevor er Unterschlupf bei Martina fand. Mitten auf seiner Weltreise ging ihm das Geld aus. Der moderne Obdachlose ist eine dekadente Spezies.
Neben dem Australier liegt ein Pärchen. Er aus Frankreich, sie aus Spanien. Der Unterschied zwischen Liegen und Sitzen ist fließend. So wie auch unklar ist, wo der Pyjama beginnt und die Jeanshose endet. Ich würde sagen: Die Jeanshose ist der Pyjama.
»Warum hast du dich zum Couchsurfen angemeldet?«, frage ich Martina.
»Früher musste ich in eine Bar, um Leute zu treffen«, sagt sie. »Jetzt kommen sie zu mir. Ich kam zu Verabredungen auch immer zu spät. Jetzt komme ich nie mehr zu spät.«
»Habt ihr Hunger?«, frage ich. »Kann ich euch zu einem Essen in einem guten Restaurant einladen?«
Diese Matratzengruft ist ja schön und gut, aber bevor ich mich dazulege, möchte ich doch noch was Leckeres essen.
»Ich geh nicht mehr aus dem Haus«, sagt Martina. »Ich will mich betrinken und high werden, außerdem habe ich schon gegessen.«
Obwohl man es nach dieser Äußerung nicht vermuten sollte, hat Martina eine feste Stelle in einer Werbeagentur. Sie selbst nennt sich ›Sklavin des Kapitalismus‹. Ihr wäre es lieber gewesen, fährt sie fort, die Revolution von 1989 hätte erst 1990 stattgefunden, dann hätte sie wenigstens noch eine Auszeichnung der sozialistischen Kinder- und Jugendorganisation bekommen.
»Und du?«, fragt sie. »Bist du Geheimagent oder so was?«
Ich nicke.
»Und wenn du mir verrätst, was du genau machst, musst du mich ermorden, was?«
»Welches Datum wäre genehm?«, frage ich. »Lass es mich wissen, wann es dir passt.«
Die Kombination von Bananensaft und Rum macht auch mir langsam zu schaffen.
Martina lacht kurz und leicht gruselig auf. »Überrasch mich«, sagt sie.
Mich beschleicht das ungemütliche Gefühl, dass sie es ernst meint.
Der Unterschied zwischen Vertrauen in die Menschheit und Nihilismus ist oft minimal. Martina hat uns ihre Hausschlüssel gegeben. Wir müssen in ein anderes Zimmer umziehen, dürfen aber noch eine Nacht bleiben. Heute Morgen hat sich herausgestellt, dass wir im Bett von Martinas Mitbewohner geschlafen haben. Beim Aufwachen entdeckte ich einen Pyjama, auf dem ich gelegen hatte. Ich roch alten Schweiß.
Schmutzphobie ist der kleine Bruder des Todes. Vergiss jede Schmutzphobie. Das Leben ist schmutzig.
Bevor Martina von der Arbeit zurückkommt, machen wir uns an den Abwasch. Es sind vor allem Aschenbecher und Gläser.
Die anderen Couchsurfer sind am Morgen gegangen.
Um acht Uhr betritt Martina die Wohnung. Sie wirft ihre Tasche in die Ecke, reißt den Kühlschrank auf und beginnt leise zu weinen.
Da steht man dann da mit seinem Geschirrtuch über der Schulter.
»Was du brauchst, ist ein richtiges Steak«, sage ich.
»Ich will nach China«, sagt Martina schluchzend. »Ich bin in meiner asiatischen Phase.«
Wir nehmen sie mit in die Bar des Hotels Josef. Alle sieben Minuten trinkt Martina ein Glas Rum. Sie will sich betrinken, wird aber nur immer nüchterner. Sie sagt: »Ich trinke nur tschechischen Rum. Tschechischer Rum ist der Rum des Arbeiters.«
Das bleibt von Solidarität übrig. Besser als nichts.
Nach neun Rum geht Martina zu Piña Colada über. Ich ertappe mich bei Erstaunen und sogar einer gewissen Ehrfurcht. Ein moralisches Dilemma tut sich auf: Martina gewährt uns ein Bett für die Nacht, müssten wir sie nicht vor dem Absturz bewahren? Allein schon aus Eigeninteresse. Wer trägt sie nach Hause?
Im Restaurant Chez Marcel stößt eine Bekannte zu uns. Sie hat ein Kind aus einer früheren Beziehung und ist jetzt verheiratet mit einem schnauzbärtigen Mann, der zwanzig Jahre älter ist als sie. Sie sagt: »Ich bin in keiner asiatischen Phase, ich bin in meiner konservativen Phase. Mein Mann ist mein Held.«
Sie zeigt uns die Hochzeitsfotos.
Mit jedem Glas Wein nimmt ihr Konservatismus andere, überraschende Formen an. Sie murmelt: »Ich liebe euch, bedingungslos.«
Wie viele Menschen kann man bedingungslos lieben? Dutzende. Mindestens.
Martina selbst scheint die Prinzipien des Couchsurfens überall zu verwirklichen. In ihrer Wohnung. In ihrem ganzen Leben. Couchsurfen bis zum bitteren Schluss. Nenne es praktischen Idealismus.
Die Bekannte begleitet uns zu Martinas Wohnung. Ihr Kind und ihr schnauzbärtiger Mann sind verreist. Heute Abend ist sie die vierte Couchsurferin.
M. ist Logopädin, und W., eigentlich Wilhelm, ist Arzt. Sie haben angeboten, uns vom Bahnhof im österreichischen Stainach-Irdning in der Steiermark abzuholen.
W. hat etwas von einem ergrauten Skilehrer.
Im Vorraum ihrer Villa in Stainach werden uns Pantoffeln gereicht. Fünf Minuten später sitzen wir bei Kir Royal zusammen im Wohnzimmer. »Die Crème de Cassis ist selbstgemacht«, sagt M.
»Sie machen selbst Johannisbeerlikör?«, frage ich. Nicht umsonst habe ich mich folgendermaßen beschrieben: »Reinlich, harmlos und höflich.«
»Nein, er ist von der Nachbarin«, sagt M. »Außerdem sagen wir unter Couchsurfern ›Du‹.«
Ich nehme einen Schluck Kir Royal. »Und warum empfangt ihr wildfremde Leute zu Hause?«
M. lacht allerliebst. »Unser Sohn war couchsurfen in Mexiko«, sagt sie. »Und ich bin eine besorgte Mutter. Da hab ich mir ein Profil auf couchsurfing.com zugelegt. So konnte ich sehen, wo er war, denn er hat überall Bemerkungen hinterlassen. Nach einiger Zeit dachte ich: Warum empfangen wir selbst eigentlich niemanden? Unser Sohn findet das komisch, aber natürlich verbietet er es uns nicht. Und wir haben so nette Couchsurfer kennengelernt. Ein Amerikaner auf Weltreise, zwei Ungarn mit einem Cello. Nur Raucher mag ich nicht.«
Ich erzähle, dass wir gerade von einer Kettenraucherin kommen.
»Ja«, sagt M., »was mir an deinem Profil gefallen hat, war, dass du dich als reinlich beschrieben hast. Ich mag keine Dreckspatzen.«
Nach meinem Tod keine Ansprachen. Nur sechs Worte: Der Mann, der kein Dreckspatz war.
»Esst ihr Rindfleisch?«
»Ja, gern«, sage ich.
Wir setzen uns zu Tisch. »Das Gericht hier heißt Tafelspitz«, erklärt W. »Dazu trinke ich gern ein Glas Bier.«
Sander, mein Reisebegleiter, greift tüchtig zu. Was unseren Gastgebern sichtlich gefällt.
»Unser Simon studiert in Graz«, sagt M. »Er will Arzt werden. Der Älteste auch, aber jetzt couchsurft er mit seiner Freundin durch Laos.«
Ich merke es: eine Familie von Couchsurfern.
Auch eine Schokoladentorte haben M. und W. gebacken. Alles gleich appetitlich und lecker.
Zu guter Letzt bekomme ich das Kinderzimmer, Sander das Gästezimmer. Das Bett sieht herrlich aus. Die Kissen sind dick aufgeschüttelt wie im besten Hotel. Ich ziehe die Pantoffeln aus.
»Brauchst du noch irgendetwas?«, ruft M.
»Nein, danke«, rufe ich zurück.
Ich bin das reisende Kind für Eltern im Herbst ihres Lebens, die sich ohne größere Umstände noch einmal um jemanden kümmern möchten.
Für Strobl am Wolfgangsee zeigt die Couchsurfing-Website keine Einträge. Bis in diesen Winkel Österreichs ist das Phänomen noch nicht vorgedrungen.
So hoffe ich, nach meiner Gratislesung vor jungen Buchhändlern, bei einem von ihnen unterschlüpfen zu können. Die jungen Buchhändler haben sich zu einer Tagung nach Strobl zurückgezogen, um über ihren Berufsstand zu diskutieren.
Mein Reisebegleiter ist optimistisch. »Sie werden sich um dich schlagen«, sagt er. Ich bin eher skeptisch. Seit 1998 hat sich niemand mehr um mich geschlagen, und ich sehe nicht ein, warum das in Strobl auf einmal anders sein sollte.
Mein Vorschlag am Ende der Lesung sorgt unter den Buchhändlern für Verwirrung, eine Verwirrung, die sich von Argwohn kaum unterscheiden lässt. »Haben Sie kein Geld fürs Hotel?«, fragt ein junger Mann.
»Das ist es nicht«, sage ich. »Aber ich muss nun mal eine Woche bei Fremden übernachten.«
Ich habe für mein Leben Spielregeln aufgestellt, die ich nicht übertreten möchte.
»Wir werden uns aufdrängen müssen«, sagt mein Freund Sander.
Wir setzen uns zu Buchhändlern an den Tisch und lassen Schnaps auffahren. Zwei Buchhändler verabschieden sich schnell, doch beim Rest siegt die Neugier über den Argwohn.
»Wenn ihr einen Autor persönlich kennt, könnt ihr seine Bücher dann besser verkaufen?«, frage ich.
»Ja, klar«, sagen die Buchhändler.
»Und wenn der Autor neben euch im Bett gelegen hat?«
Der Verkauf erweist sich auch hier, wie so oft, als entscheidendes Argument.
»Du kannst zu mir aufs Zimmer«, sagt J. »Ich hab fünf Brüder, ich bin das gewöhnt.«
J. verkauft nicht nur Bücher, sie ist auch fanatische Turnerin.
Als ich mir die Zähne putze, schlüpft sie schnell in ihre Nachtwäsche: ein schwarzes T-Shirt und eine Radlerhose.
Dann fängt sie an zu erzählen. Auch ihre Mutter ist begeisterte Turnerin. Bei der Fußball-EM2008 in Wien wird J. im Stadion vor jedem Spiel gymnastische Darbietungen bringen, die leider nicht im Fernsehen übertragen werden. Ihr Freund und sie wollen nächstes Jahr heiraten, aber ihre Eltern sind nicht glücklich darüber, weil er nichts mit Turnen am Hut hat.
»Warum machst du das hier eigentlich?«, fragt sie plötzlich.
»Um einen Titel von Ian McEwan zu paraphrasieren«, antworte ich, »Der Trost von Fremden ist besserer Trost.«3 Und füge hastig hinzu: »Jetzt müssen wir aber schlafen.«
Über Turnen darf man nicht bis zum frühen Morgen reden.
»Bahnhof Keleti, stehe unter der großen Uhr«, teilt Violka uns per SMS mit. »Trage Sonnenbrille, roten Mantel und bin groß.«
Der Mantel ist nicht rot, doch der Rest stimmt.
Violka hat zwei Mitbewohnerinnen, und aus unerfindlichen Gründen können wir noch nicht in die Wohnung. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren wir in ein Café gegenüber der größten Synagoge der Stadt. »Das ist das Judenviertel«, sagt Violka und schaut mich vielsagend an.
Sie hat Deutsch auf Lehramt studiert, doch der Beruf war die Hölle. Jetzt arbeitet sie in einem Reisebüro.
Wir warten auf Orsolya. Von ihr stammt die Idee, Fremde zu beherbergen: das Leben ein nicht enden wollender Logierbesuch. Die Euphorie von 1989 ist verflogen und hat der großen Flucht aus der Realität Platz gemacht. »Ich lese nie Zeitungen«, hat J. in Strobl gesagt. »Nur Bücher. Ich will in meiner eigenen, heilen Welt bleiben.« Was viel über Bücher sagt. Und über die Art, wie sie gelesen werden. Wer sich enttäuscht von der Welt abwendet, macht irgendwann nur noch für Pyjamapartys die Tür auf.
Orsolya lässt auf sich warten, und inzwischen reißen Sander und ich Witze, die wir schon die ganze Woche über erzählen. Für Violka jedoch sind sie neu. Sie lacht herzlich.
Orsolya, die schließlich doch noch dazukommt, nennt sich Orsy. Sie arbeitet für eine japanische Firma der Autozulieferindustrie.
Die Wohnung in einem Außenbezirk von Buda strahlt eine freundliche, osteuropäische Melancholie aus. Auf der Toilette prangt eine Liste mit fünfzig Gründen, das Leben zu lieben. Orsy sagt: »Wenn euch noch einer einfällt, schreibt ihn unbedingt dazu.« Die dritte Mitbewohnerin heißt Marta. Marta hat Zahnschmerzen.
Mit Violka und Orsy gehen wir in ein traditionelles ungarisches Restaurant, wo natürlich die örtliche Schnapsspezialität probiert werden muss. Im Grunde ist Couchsurfen Alkoholismus mit Rollkoffer.
Beim Hauptgang wird Orsy auf einmal ernst. »Was ist euer süßester Traum?«, will sie wissen.
Was könnte sie meinen?
In einem Versuch, freundlich und zugleich witzig zu sein, antworte ich: »In sieben Städten mit sieben Frauen sieben verschiedene Kinder zu zeugen.«
Mein Misstrauen der Menschheit gegenüber hat sich noch nicht verflüchtigt, aber ich bin bereit, das vorübergehend zu vergessen.
Neben der Zeit als Zimmerjunge in Bayern und meinen Reisen nach Afghanistan waren dies hier die glücklichsten Tage meines Lebens.
Vielleicht ist das mein süßester Traum: Couchsurfen bis an mein seliges Ende.
Auch in Bagdad scheint es Couchsurfer zu geben. Adnan Salih zum Beispiel, der sich auf der Website folgendermaßen vorstellt: »I wish to explore the western world I love to meet the good and funny people and I wish to make a real friendship with the people that I enjoy.«
Orsy schläft in Violkas Zimmer, so dass mein Reisebegleiter und ich in ihr Bett kriechen können.
»Komm lebend aus dem Irak zurück«, sagt Orsy.4
Auf der Toilette trage ich Grund Nummer 51 ein: »Der Geruch der Schweißfüße von Fremden.«
Saubere Laken
Undercover als Zimmerjunge in einem bayrischen Hotel
(Juli–August 2007)
An einem warmen Samstagabend im Juli 2007 stand ich in einem Apartment in Brooklyn einem Mann gegenüber, der fest entschlossen war, mir mit einem Baseballschläger den Schädel einzuschlagen. Er dachte, ich hätte mit seiner Freundin geschlafen, und war keinerlei Vernunftgründen zugänglich.
Um seine Aggressionen einigermaßen zu beruhigen, kroch ich wie ein Hund über den Boden und versicherte: »Ich kann alles erklären.« Dabei konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass seine Freundin, eine Bekannte von mir, dies alles arrangiert oder das Missverständnis zumindest in Kauf genommen hatte – ob aus einem unbezwingbaren Bedürfnis nach Spannung oder aus anderen Motiven, wagte ich zu dem Zeitpunkt nicht zu entscheiden.
Ich hatte immer geglaubt, dass das Spiel aufhört, wo physische Gewalt beginnt, doch an jenem Samstagabend im Sommer 2007 erkannte ich, dass das nicht stimmt – nur der Einsatz wird erhöht: Was dann auf dem Spiel steht, ist das nackte Leben.
Der Mann rief die Eltern seiner Freundin an, während er mich mit seinem Baseballschläger in Schach hielt, und brüllte: »Holt euch die Hure zurück, ich will sie nicht mehr sehen!«
Schließlich kamen nicht die Eltern, sondern der Bruder, der mir ein paar Faustschläge verpasste. Der Bruder erwies sich jedoch als rettender Engel, denn er hatte die Wohnungstür offen stehen lassen. Der Wunsch, mich zu schlagen, war so riesig gewesen, dass er ans Schließen der Tür nicht gedacht hatte.
Während er mich verprügelte, kam die Nachbarin nach Hause. Ich schrie: »Darf ich mich in Ihrer Wohnung verstecken?«
Sie antwortete: »Nein, dann vergewaltigen Sie mich.«
Immerhin war sie bereit, die Polizei zu rufen, und bevor die kam, konnte ich entkommen. – Der Nachbarin sei Dank!
Zehn Tage darauf arbeite ich als Zimmerjunge im Hotel B., zirka siebzig Kilometer südlich von München. Das Hotel hat eine eigene Brauerei, ein Restaurant, einen Biergarten und siebzig Betten.
Meine linke Wange tut noch etwas weh, doch man muss sehr genau hinsehen, um die Spuren der Faustschläge zu erkennen.
Ein Mann mit Baseballschläger kann einem eine Rolle aufzwingen, zum Beispiel die eines kuschenden Hundes. Die Besessenheit, mit der die Öffentlichkeit dies bei mehr oder weniger prominenten Personen tut, bei Schriftstellern zum Beispiel, ist kaum weniger brutal. Darum wähle ich mir meine Rollen lieber selbst: jetzt die eines Zimmerjungen. Damit stehe ich in einer langen Tradition – der der Künstlerin Sophie Calle zum Beispiel, die 1983 als Zimmermädchen in einem venezianischen Hotel arbeitete, die persönlichen Gegenstände der Gäste fotografierte und für ihre künstlerische Arbeit benutzte. Auch der niederländische Schriftsteller Jan Arends5 ist hier zu nennen. Er dichtete: »Ich/gehe durchs Zimmer und/staube ab. Ich/krieche. Ich/bin ein Tausendfüßler.«6
Eine gewisse kultivierte Wollust verbirgt sich in Selbsterniedrigung.
Warum Bayern? Man ist dort zu Hause, wo die eigene Abwesenheit registriert wird. In Deutschland fällt meine und die Abwesenheit so vieler anderer überall auf, am meisten in Bayern, rede ich mir ein. Darum bin ich hier zu Hause. Wäre die Geschichte anders verlaufen, würde ich jetzt vielleicht ganz selbstverständlich als Einheimischer übers Oktoberfest stapfen.
Sicherheitshalber arbeite ich im Hotel unter falschem Namen: Anton Morsink. Auch in diesem Namen fühle ich mich zu Hause.
Die Wirtin ist eine sympathische Frau, mein Zimmer ist klein, aber nicht unfreundlich.
Zum Saubermachen brauche ich keine Uniform. Bequeme Kleidung genügt.
Ich schreibe, weil ich wissen will, wie die Leute das machen: leben. Zweifellos aus dem Gefühl heraus, dass mir das selbst nicht gelingt oder ich es nicht wage. In diesem Sinn ist der Schriftsteller ein Doppelagent: Wem er seine Informationen verkauft, bleibt im Dunkeln, seine Loyalität wechselt je nach Auftrag, für Liebe tut er alles.
Morgen früh um halb sieben beginnt meine Arbeit. Unbemerkt werde ich meine Nase in benutzte Handtücher pressen und es riechen: das nackte Leben.
Ich werde Haare aus dem Duschabfluss fischen und sie studieren, das nackte Leben ganz aus der Nähe betrachten. Viel mehr noch als nach meiner ersten Reise nach Afghanistan habe ich das Gefühl, in Brooklyn dem blanken Tod entronnen zu sein und darum das Leben in Bayern umso besser erforschen zu können.
Morgens um Viertel vor sechs hat das Personal im Hotel noch kein warmes Wasser. Notgedrungen dusche ich kalt; eigentlich sehr erfrischend.
Die Schwiegermutter der Wirtin wird mich unter ihre Fittiche nehmen. Sie ist eine quirlige Frau um die sechzig.
Anders als erwartet, soll ich heute nicht im Zimmerdienst arbeiten. Stattdessen soll ich zunächst das Frühstücksbüfett vorbereiten. Aus großen Kühlschränken werden Schinken und Käse geholt; das meiste ist vakuumverpackt und vorgeschnitten.
Meine Aufgabe besteht darin, den Schwarzwälder Schinken auf dem Tablett anzurichten. Jede Scheibe wird von mir oder der Schwiegermutter in die Hand genommen, manche auch von uns beiden. Wir arbeiten ohne Handschuhe.
Die Scheiben dürfen nicht einfach flach auf den Platten liegen, sie müssen sich wölben, damit der Gast leicht mit der Gabel hineinpiken und sie sich auf den Teller legen kann. Manchmal wölben meine Scheiben sich nicht genug, dann hilft die Schwiegermutter mit einem friemelnden Zeigefinger ein bisschen nach.
Wer sich in einer neuen Umgebung befindet, muss alles daransetzen, die dort geltenden Regeln und Gesetze so schnell wie möglich zu lernen und sich Privilegien zu erwerben. Wer oder was man gewesen ist, spielt keine Rolle mehr. Sich halsstarrig auf alte Privilegien zu berufen bringt nur Scherereien.
Um ein einfaches Beispiel zu nennen: Bevor er ein verfolgter Kriegsverbrecher wurde, war Saddam Hussein ein befreundeter Staatschef.
Kurz nach halb acht lerne ich, wie man die Schneidemaschine bedient. Der rohe Schinken ist nicht vorgeschnitten. »Stell sie auf anderthalb«, sagt die Schwiegermutter, »die Leute hier mögen dicke Scheiben.«
Zuerst drücke ich den Schinken nicht fest genug an, doch nach einigen Versuchen sehen meine Scheiben aus wie von einem erfahrenen Metzger. Meine Kollegin im Service trägt eine Brille mit schwarzem Rahmen, weiße Socken in Sandalen und ein Dirndl. Sie flüstert: »Die macht mich noch verrückt.« Sie zeigt auf die Chefin.
Ich betrachte das Leben als ein Trainingslager; ich weiß zwar noch nicht, wofür, aber ich habe eine Vermutung: Wir trainieren, um uns hervorzutun. Privilegien gibt es nur für die Besten.
In unserem Hotel gibt es drei Sorten Abfall: Papier, Verpackung und Schweinefutter. Auch benutzte Kaffeefilter verschwinden im Schweineeimer. Die Schweine fressen alles.
Meine Chefin fischt eine Semmel aus dem Eimer. Ein Gast hat sie auf dem Teller gelassen. Ich hielt es für Abfall. »Was ist das?«, fragt sie und hält die Semmel hoch.
»Schweinefutter«, antworte ich heiser.
»So was werfen wir nicht weg.« Sie kratzt etwas Kaffeesatz von der Semmel und legt sie zurück in den Brotkorb auf dem Büfett. Sie ist nicht böse, aber doch indigniert.
Als Zimmerjunge bin ich eine Katastrophe. Bettlaken abziehen gelingt mir gerade noch, genauso wie Kopfkissen. Aber Bettdecken wieder ordentlich zu beziehen kriege ich einfach nicht hin. Ich enttäusche. Das will ich nicht.
Erstes Dienstmädchen im Hotel ist die Türkin Esmeralda. Offiziell zumindest. In Wirklichkeit ist sie das einzige. Sie hat niemanden unter sich. Bis ich kam. Seit 1971 lebt sie in Deutschland, doch ihr Deutsch ist noch immer gebrochen. »Du«, sagt sie, »machst Mülleimer leer.«
Ich gehe von Zimmer zu Zimmer und nehme den Abfall der Gäste mit. Viel Aufregendes gibt es dabei nicht zu entdecken. Zeitungen, Faltblätter, leere Flaschen, Arzneiverpackungen, Windeln, selbst in Zimmern, wo gar keine Kinder logieren.
Im Bügelraum wird der Müll sortiert. Auf den Knien trenne ich Papier und Verpackung, auch das ohne Handschuhe. Die Geschäftsleitung mag keine Verschwendung, doch irgendwie finde ich es erregend, im Abfall von Fremden zu stöbern.
Existentielle Probleme tun sich auf. Ein Röhrchen Tabletten: Das Röhrchen ist eindeutig Verpackung – aber die Tabletten?
Ich frage Esmeralda. Sie zögert. Sie hält die Tabletten gegen das Licht. »Schweinefutter«, sagt sie.
Für Zimmermädchen gibt es zwei Sorten Gäste: diejenigen, die abreisen, und die, die dableiben. In den Zimmern der bleibenden Gäste wird mit einem alten Geschirrtuch eilig über Tisch, Bettrand und Fernseher gewischt, die Toilette wird flüchtig geschrubbt, die Handtücher werden geradegerückt, die Badematte verschoben und die Dusche kurz mit dem Putzlappen berührt.
In den Zimmern der Abgereisten jedoch muss das Bettzeug gewechselt werden.
Esmeralda ist das Zimmermädchen, ich bin ihr Assistent. Die Rollenverteilung gefällt mir.
»Gehst du noch Schule?«, fragt Esmeralda.
»Nein«, antworte ich.
Das genügt ihr.
Ich folge ihr mit dem Putzwagen und gehe mit ebengenanntem Geschirrtuch symbolisch über Schränke und Türklinken.
In Zimmer zwei sehe ich Esmeralda am Bettlaken schnüffeln. Offiziell müssten wir das Laken jetzt wechseln. Der Gast ist abgereist. Ein neuer wird das Zimmer beziehen.
»Laken nicht dreckig«, sagt Esmeralda. Sie liest ein Haar herunter und zieht das Betttuch gerade.
Ich helfe Esmeralda, die Haare vom Laken zu lesen, der Gast hier hat eine Menge hinterlassen. Ob Scham- oder Kopfhaar, ist schwer zu sagen.
»Viel Haare«, sagt Esmeralda, »aber nicht dreckig.«
Als wir fertig sind, haben wir beide ein Häufchen Haare in der Hand.
Jetzt stellt sich das alte Problem: Sind die Haare Papier- oder Verpackungsmüll, oder gehören sie in den Schweineeimer?
Offenbar fressen Schweine auch Menschenhaar.
»Nicht weitersagen«, sagt Esmeralda. »Aber Gäste, wenn nur ein Nacht bleiben, machen Laken nicht dreckig.«
Ich verspreche zu schweigen.
»Hol große Handtuch, kleine Handtuch, und saug Flur, aber nicht so langsam.«
Bestimmte und unbestimmte Artikel mag Esmeralda nicht besonders. Ich sauge den Flur, aber nicht so langsam.
Dies ist ein vollkommener Tag.
Heute Morgen um zehn ist es mir zum ersten Mal gelungen, ein Bett zu machen, ohne dass Esmeralda daran etwas zu korrigieren hatte.
Esmeralda strahlte und sagte: »Super!«
Das ist ein Triumph. Vielleicht sogar Glück.
Seitdem darf ich auch die Toiletten und Duschen schrubben, offenbar steht diese Tätigkeit höher im Ansehen als Bettenmachen. Und ich darf die Zimmer alleine betreten. Esmeralda geht hinterher nur noch durch, um alles zu kontrollieren.
Jedes Zimmer ist eine Überraschung, jede Tür eine neue Hoffnung. Jedes Detail verrät ein Geheimnis.
Ein Gast, der ohne Zahnbürste reist, er (ich gehe von einem Mann aus) hat überhaupt kein Waschzeug dabei. Sein Zimmer wirkt unbewohnt, nur im Schrank ein kleiner schwarzer Rollkoffer. Ich bin versucht, den Koffer zu öffnen, aber ich traue mich nicht.
Ich will alles sehen.
Auf Zimmer elf wohnt eine junge Österreicherin, Ende zwanzig. Früh am Morgen habe ich sie beim Frühstück gesehen. Ich nehme an, sie ist Vertreterin.
Neben einem Bügeleisen liegt ein Buch mit dem Titel: Die Geheimnisse des Unterbewussten.
Ein Terminkalender und Zettel mit Namen und Telefonnummern. Eine fahrige Handschrift.
Auf dem Bett eine Strickjacke und eine graue Hose. Ich lege die Kleidungsstücke zusammen.
Auf dem Nachtschränkchen ein Glas, eine offene Flasche Orangensaft, noch halbvoll, der Verschluss auf dem Boden, eine Dose Nüsse.
Warum hat sie bloß den Verschluss nicht wieder auf die Flasche gedreht?
Ich befühle meine linke Wange, mittlerweile fühlt sie sich beinah normal an. Mit Leuten zu ihnen nach Hause zu gehen ist gefährlich, das weiß ich jetzt – erst in ihren Wohnungen offenbart sich ihr Wahnsinn oder der ihrer Anverwandten. Hier hingegen besteht kaum eine Gefahr. Für seinen Aufenthalt auf fremden Zimmern hat der Hotelboy fast immer eine gute Entschuldigung.
Ich spüle das Glas und trockne es mit dem Tuch ab, das ich auch zum Abstauben nehme, denn das ist so üblich hier. Das Tuch, mit dem Toilette und Waschbecken gereinigt werden, wird später auch für Fernseher und Fernbedienung genommen. Für ein Zimmermädchen gibt es keinen wesentlichen Unterschied zwischen Toilette und Fernseher: Beide müssen geputzt werden.
In einem Hotel in Bayern kann man viel Bier erwarten. Und in der Tat, alles hier dreht sich um Bier.
Nicht nur im Zimmerdienst – der mir inzwischen leicht von der Hand geht – sowie zum Auf- und Abbauen des Frühstücksbüfetts werde ich eingesetzt, nein: auch zum Zapfen.
Heute arbeite ich mit Diana. Sie denkt, ich möchte mich auf Dauer im Gaststättengewerbe etablieren. In einem ruhigen Moment nimmt sie mich beiseite. »Anton«, sagt sie, »ich bin gelernte Sekretärin, aber die Gastronomie macht süchtig. Meine Ehe ist daran kaputtgegangen, jetzt steh ich allein mit einem Kind da, aber wir schlagen uns durch. Weißt du, was einen daran so süchtig macht?«
Sie beugt sich zu mir und flüstert mir ins Ohr: »Das Trinkgeld! Aber früher haben die Leute viel mehr gegeben. Jetzt kann ich davon kaum noch tanken, es ist ein Witz. Und hier im Dorf wohnen ist teuer, man zahlt für die Aussicht. Ich zahl achthundert Euro im Monat.«
Jeden Tag werde ich etwas mehr Anton Morsink, ich wachse in meine Rolle hinein, doch gleichzeitig wird meine Lage dadurch auch bedenklich. Wer ist dieser Anton Morsink? Wo kommt er her? Was macht die Gastronomie bei ihm kaputt?
Was soll er antworten, wenn seine Kollegen fragen: »Was hast du früher gemacht, Anton?«
»Anton«, ruft Diana, »fünf kleine Helle!«
Ich mache mich ans Zapfen. Nach ein paar Sekunden kriege ich einen Anpfiff, weil ich keine Schaumkrone zustande bringe, aber das stört mich nicht weiter.
Freundlich lächelnd lässt man die kleinen Demütigungen über sich ergehen.
Heute Morgen klagte ein Gast, dass sein Frühstücksei zu weich sei. Ich erging mich in Entschuldigungen, obwohl ich fürs Eierkochen gar nicht zuständig bin.
Es klingt vielleicht unbescheiden, aber ich habe ein Talent zum Sklaven. Wer dem Tod entronnen ist, ist ein Sklave des Lebens.
Morgens um Viertel nach sechs beginnt meine Arbeit, ab nachmittags um drei habe ich frei.
Weil Obstessen dabei meist auf der Strecke bleibt, kaufe ich zwei Pfirsiche und vier Pflaumen, die ich bei mir aufs Fensterbrett lege.
Auf Zimmer elf wohnt immer noch die junge Österreicherin. Jeden Morgen um sieben erscheint sie zum Frühstück. Wenn sie fertig ist, stellt sie Tasse und Teller zusammen, knüllt ihre Serviette zu einer Kugel und stopft sie in die Kaffeetasse. Dann geht sie eine Zigarette rauchen.
Heute Morgen habe ich in ihren Sachen geschnüffelt – um auf dem Flur zu saugen, muss ich an die Steckdose auf ihrem Zimmer. Wie ich vermutete, ist sie Vertreterin und beliefert chemische Reinigungen – fragt sich allerdings nur: womit?
Auf dem Nachtschränkchen wieder eine Dose mit Nüssen. Jetzt liest sie nicht mehr über die Geheimnisse des Unterbewussten, stattdessen die Lebensgeschichte der Ulrike Meinhof: Lieber wütend als traurig.
Heute Morgen trug sie die Strickjacke, die ich vor einigen Tagen für sie zusammengelegt habe. Walter Benjamin schrieb einmal: »Einen Menschen kennt einzig nur der, welcher ohne Hoffnung ihn liebt.«7
Das türkische Dienstmädchen betrachtet mich immer mehr als echten Kollegen. Auf Zimmer drei sagt sie: »Kurz mal ausruhen.«
Wir ruhen uns aus.
Sie schaut aus dem Fenster und sieht Kinder. »Schön, Kinder da draußen«, sagt sie.
Ich stimme ihr zu.
»Bald gehe Rente«, sagt Esmeralda, »dann krieg achthundert Euro. Miete allein schon vierhundert. Darum geh zurück nach Türkei, aber da kenn niemanden mehr. Mein Mann 1982 zurückgegangen, mit andere Frau. Seitdem keine Mann mehr gehabt, auch keine Freund, überhaupt keine Mann. Immer nur arbeiten, vier Söhne. Woche über Textilfirma, Samstag und Sonntag in Küche von Direktor.«
Esmeralda schaut mich an.
»Immer nur arbeiten«, sage ich. »Das ist …« Aber ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
Zum Mittagessen helfe ich der Frau mit den weißen Socken und den Sandalen im Service. Sie heißt Meryem, aber alle hier nennen sie Maria.
»Du machst den Tresen, ich die Tische«, erklärt sie.
Ich schenke Limonade ein und zapfe Bier, als hätte ich nie etwas anderes getan.
Um halb zwei gibt Meryem mir zehn Euro.
»Was ist das?«, frage ich.
»Weil du mir immer so gut hilfst, Anton.«
»Ach, lass«, sage ich.
»Jetzt nimm’s schon«, zischt sie. Beschämt stecke ich den Zehner in die Tasche. Es gibt keinen Weg zurück. Ich muss Anton Morsink bleiben. Ich darf nicht mehr aus der Rolle fallen.
Offenbar hat Anton Morsink auch eine Mutter. Wie könnte es auch anders sein?
Seine Mutter redet genauso wie meine.
Die Mutter sagt am Telefon: »Wie kannst du so was nur machen?«
»Was?«, frage ich.
»Schreiben, dass das Hotel die Laken nicht wechselt, wenn Gäste nur eine Nacht bleiben. Da nimmt so ein Hotel dich gutgläubig als Praktikanten, und dann verrätst du die Leute. Pfui. Genau wie damals, als du geschrieben hast, ich würde in Hotels Toilettenpapier klauen8, das war auch Verrat. Ich stehle kein Toilettenpapier, ich verbrauche weniger als andere, darum nehme ich mir hinterher immer was mit.«
»Genau, Mama«, sage ich.
Offiziell besteht mein Lohn hier aus Kost und Logis, doch in der Praxis esse ich außer Haus. Mit dem Blick der Chefin auf dem Teller schmeckt es einem nicht richtig.
Nach dem Essen mache ich einen Abendspaziergang, um Viertel vor elf gehe ich schlafen. Der Tag eines Zimmerjungen beginnt zeitig.
Was habe ich sonst noch über Anton Morsink erfahren? Er findet es herrlich, wenn seine Vorgesetzten zufrieden sind. Wenn seine Kollegen sagen: »Du wirst uns fehlen«, beginnt er innerlich zu strahlen. Was für ein Schleimer, dieser Anton. Was für ein Streber.
Beim Abendspaziergang gestern begegnete ich drei Touristinnen, die mir den Weg versperrten. Junge Ungarinnen auf der Durchreise.
Vor allem das »auf der Durchreise« gefiel mir.
»Ich arbeite im Hotel B.«, sagte ich. »Kommt doch morgen zum Frühstück vorbei.«
Am Morgen stehen sie vor der Tür. Sie haben mich beim Wort genommen. Ich bin überrascht.
»Wer ist das?«, fragt meine Chefin.
»Freundinnen«, antworte ich schnell.
»Frühstück für Nicht-Hotelgäste kostet acht Euro«, muss ich den Ungarinnen ausrichten.
»So viel haben wir nicht«, sagen die Mädchen.
Da ist die Scham wieder.
»Ihr bekommt einen Espresso«, sage ich.
Beim Servieren schiebe ich einen Zehner unter eine der Tassen. »Bezahlt damit«, flüstere ich. Anton, der Charmeur. Anton, der Lügner.
Meine Chefin hat etwas gegen Verschwendung, und sie hasst das Wort »gratis«. Aber sie hat auch ihre menschlichen Seiten.
Manchmal legt sie ihre Brille in die Spülmaschine, um sie gründlich sauber zu kriegen. Erst dachte ich, sie sei vergesslich. Aber so reinigt sie ihre Brille.
»Morgen kriegen wir hundert Leute zum Mittagessen«, sage ich, »das wird ein anstrengender Tag.« Ich identifiziere mich mit meiner Arbeit, und so gehört es sich auch.
Alles wird für die hundert Gäste vorbereitet. Das Frühstücksbüfett, dessen Zubehör sonst tagsüber stehen bleibt, wird jetzt abgeräumt und das Geschirr in einen antiken Schrank weggeschlossen.
Weil uns ständig die Eierbecher ausgehen, werden sie nie richtig abgewaschen. Wir halten sie kurz unter Wasser, und wenn etwas Schale dran klebt, kratzen wir die mit den Nägeln ab. Ein bisschen Spucke tut Wunder.
Um Viertel nach elf sind wir fertig. Jetzt müssen wir warten.
»Isst du gern Weißwurst?«, fragt Meryem.
»Ja«, sage ich. Jede andere Antwort wäre unhöflich. Weißwurst ist eine Spezialität des Landes.
Schnell essen wir zwei Weißwürste mit Senf und eine Brezel.
Meryem isst, wie sie raucht: verstohlen und hastig.
»Wo kommt der Name Meryem her?«, will ich wissen.
»Aus der Türkei«, antwortet sie. »Bist du verheiratet?«
Ich schüttle den Kopf.
»Hast du eine Freundin?«
Normalerweise gebe ich mich als Junggeselle aus, doch unter diesen Umständen erscheint mir das unvernünftig.
»Die Chefin kommt«, zischt Meryem, »schnell aufessen.«
Wir haben drei Chefs. Die alte und die junge Chefin und den Chef persönlich.
Samstagmittag um zwölf sind hundert Leute im Gastraum. Sie kommen von einer Beerdigung.
Normalerweise legen wir hellgrüne Servietten auf den Tisch. Doch wegen des Trauerfalls nehmen wir heute dunkelgrüne.
Auf dem Tisch, wo sonst die Faltblätter und Broschüren liegen, steht jetzt ein Foto der Toten. Eine alte Frau.
Niemand nimmt Notiz davon.
Die Leute bekommen Schweinebraten mit Knödeln.
Ich serviere nicht gern Schweinebraten. Schweinebraten hat immer viel Soße.
»Sie tropfen«, ruft eine Frau erbost.
Hundert Gäste, die gleichzeitig essen wollen, das ist kein Zuckerschlecken. Wir sind unterbesetzt, die Chefin hilft beim Zapfen. Auf dem Tisch stehen große Schüsseln mit Rotkraut. Es schmeckt den Leuten.
Um zwei Uhr sind nur noch zwanzig Gäste übrig. Sie sitzen beim Bier und spielen Karten. Schwarze Krawatten hängen über den Stühlen.
»Ich glaube, du kannst das Totenfoto wegstellen«, sagt Meryem.
An meinem ersten freien Tag besuche ich eine Ausstellung über Ödön von Horváth. Ich mag sein Werk, und einige Zeit hat er in diesem Ort gewohnt.
Kurz nach der Machtergreifung, am 10. Februar 1933, spricht Hitler im Radio zum Volk. Ödön von Horváth sitzt in seiner Stammkneipe, dem Hotel Post. (Das Hotel gibt es noch immer.) Er fragt, ob man das Radio leiser stellen könne. Das macht die anwesenden SA-Leute wütend. Sie eskortieren ihn zu seiner Wohnung. Am nächsten Morgen muss Horváth aus dem Ort fliehen.
Am I. Juni 1938 spaziert der Schriftsteller über die Avenue Marigny in Paris. Ein Baum wird vom Blitz getroffen, und ein Ast fällt Horváth auf den Kopf. Er ist sofort tot.
Die Ausstellung vermerkt, dass die NSDAP-Anhängerschaft hier im Ort größer war als im Rest Deutschlands und Bayerns. Bei den letzten Wahlen im März 1933 kam die NSDAP auf knapp vierundvierzig Prozent. Hier im Ort waren es fast dreiundfünfzig.
Eine Gruppe älterer Männer logiert im Hotel. Sie machen einen Radurlaub. Früh am Morgen erscheinen sie im Radlerdress zum Frühstück. Hemden und Hosen sitzen eng. Alles zeichnet sich ab.
Unterwegs vom Museum zu meiner Dienstbotenunterkunft hält einer der Radler mich an.
Als Zimmerjunge ist man immer im Einsatz.
»Du bist doch der Junge vom Frühstück?«
»Ja«, sage ich.
»Was machst du sonst noch?«
»Ich mache die Zimmer«, antworte ich.
»Ich hab ein Problem«, sagt der Radler.
»Und das wäre?«
»Zum Frühstück gibt es zu wenig Quark.« Er fasst mich freundschaftlich an der Schulter. »Wir fahren jeden Tag vierzig Kilometer. Wir brauchen viel Quark.«
Ich verspreche ihm, für mehr Quark zu sorgen. Perfektion ist mein Motto.
Im Biergarten des Hotels spielt eine Blaskapelle. Auf dem nahe gelegenen See fuhr am Nachmittag eine Blaskapelle auf einem Schiff vorbei.
Historisch gesehen, schulde ich den Deutschen so manches, ich bin froh, meine Schuld einlösen zu können.
Ich betrachte die Gäste. Der Tod braucht kein Mann mit Baseballschläger zu sein, ein Baum genügt auch.
Heute Morgen um halb sieben sagte ich zur Schwiegermutter der Wirtin: »Wo waren Sie vorgestern? Ich hab Sie vermisst.«
Ich dachte, ihr mit der Frage eine Freude zu machen. Jeder ist gern unersetzlich. Und da mein Praktikum hier unter ihrer Obhut verläuft, bin ich auf ihre gute Laune angewiesen. Je schlechter die Laune, desto mehr muss ich arbeiten.
»Ich war mit Freunden in Garmisch-Partenkirchen«, sagt sie. »Alle acht Wochen darf ich ja wohl mal einen Tag frei machen. Alle acht Wochen!«
Offiziell braucht die Schwiegermutter auch heute nicht zu arbeiten.
»Was machen Sie dann hier?«, fragt Meryem. »Sie wollten doch verreisen?«
Die Schwiegermutter wirft ihr Geschirrtuch hin und läuft wütend davon. Manche Leute ertragen keine freien Tage.
In einem Familienbetrieb gibt es viele interne Spannungen. Die Schwiegertochter beklagt sich beim Personal über ihre Schwiegermutter. »Wenn sie zu eitel ist, eine Brille zu tragen, soll sie sich nicht in die Küche stellen«, höre ich sie sagen.
Im Grunde ist natürlich jede Familie ein Familienbetrieb.
Die Schwiegermutter hier ist ein Monster, aber doch eins, für das ich immer mehr Sympathie entwickle. Ich kann gut verstehen, dass man seine freien Tage hasst.
Wir haben ein neues Zimmermädchen. Eine Türkin namens Aische. Sie trägt kurze Hosen, und ihr Deutsch beschränkt sich auf kaum zwanzig Worte.
Weil Esmeralda ihren freien Tag hat, muss ich Aische einarbeiten. So schnell geht das. Einen Moment lang bin ich der Chef.
In jedem Zimmer fragt Aische: »Laken sauber?«
Ich tue, was ich gelernt habe. Ich rieche und sage: »Sauber.«
Der Gast ist der natürliche Feind des Zimmerpersonals, merke ich. Ich beginne, meinen Rücken zu spüren.
Ein Ärgernis sind auch die Pyjamas. Ich dachte, die Dinger seien längst ausgestorben, doch hier lege ich Pyjamas zusammen und verstaue sie unterm Kopfkissen, als könnte der Mensch ohne sie nicht schlafen.
Mein Eifer lässt langsam nach.
»Schmutzige Handtücher?«, fragt Aische. »Weg?«
Die Gäste bleiben noch bis Samstag. Ein junges Pärchen aus Hamburg. Ich kenne sie vom Frühstück. Kein Lächeln kommt ihnen über die Lippen. Ich habe keine Lust, ihre Handtücher zu wechseln. Ich drehe die Tücher um, damit man die braunen Flecken nicht sieht.
»Unser Geheimnis«, sage ich zu Aische.
Ich schaue mich kurz um. »Das Zimmer ist fertig«, erkläre ich entschieden.
Hier im Hotel geschieht viel im Verborgenen.
Heute Morgen richte ich das Frühstück zusammen mit Christel. Sie ist schon etwas älter, rennt aber herum wie eine Zwanzigjährige. Sie rennt auch, wenn es keinen Grund dazu gibt, nur zu mir sagt sie dauernd: »Mach bloß nicht zu schnell, Anton aus Tirol.«
So nennt sie mich: Anton aus Tirol.
Ein Gast hat eine Semmel auf dem Teller liegen lassen. Wie es aussieht, hat er sie nicht angerührt. Eigentlich muss die Semmel zurück in den Korb auf dem Büfett.
Christel sagt: »Also ich persönlich find das ekelig.«
Sie schaut, ob die Chefin nicht guckt, nimmt einen Bissen von der Semmel, spuckt ihn wieder aus und erklärt: »So, die kann jedenfalls nicht mehr recycelt werden.« Ich will weitergehen, doch Christel nimmt mich beiseite: »Das bleibt aber unter uns, Anton aus Tirol.«
Bayernkönig Ludwig II. ertrank zusammen mit seinem Psychiater in einem See nicht weit von unserem Hotel. Die Umstände seines Todes wurden nie aufgeklärt, ziemlich fest steht nur, dass der König wahnsinnig war.
Klaus Mann schrieb eine Novelle über Ludwig II., Vergittertes Fenster. Darin lässt er den König denken: »Anblick und Geruch der Menschen beleidigten mich. Schon das Tageslicht tat meinen Augen meistens weh. Ich zog die Nacht vor.«9
In der Küche herrscht Herr Neumann, der Chefkoch, ebenfalls ein Mann der Nacht. Selbst die Chefin hat Angst vor ihm. »Schnell, alles muss sauber sein, gleich kommt Herr Neumann«, sagt sie um halb neun.
Einmal hat Herr Neumann mich mit dem Messer aus der Küche gejagt. Ich hatte den Auftrag, sechs Eier zu kochen, weil die am Frühstücksbüfett ausgegangen waren.
»In meiner Küche kochst du keine Eier«, rief Herr Neumann und richtete sein Messer gegen mich.
Ich habe den Vorfall der Chefin gemeldet, doch die sagte, in der Küche sei es gang und gäbe, mit dem Messer herumzufuchteln. Die Hitze bringt das Blut in Wallung.
Seitdem grüße ich Herrn Neumann immer besonders freundlich. Ich glaube, dass auch er die Nacht vorzieht.
»Dein Kissen sieht aus wie tote Maus«, sagt Esmeralda.
Ich kann inzwischen viel, aber wie man ein Kissen richtig aufschüttelt, ist mir immer noch ein Rätsel.
Am glücklichsten bin ich, wenn ich allein mit Esmeralda arbeite, unbeobachtet von den Chefs; Esmeralda ist am glücklichsten, wenn die Gäste nicht duschen.
Im Grunde herrschen hier immer noch Zustände wie zu Zeiten der Leibeigenschaft. In der Küche, hinter den Kulissen, manchmal auch davor, arbeiten Leute mit teils zweifelhaften Papieren, die darum bereit sind, viel zu arbeiten, ohne zu viel zu verlangen. Nicht Geldgier, Angst ist die große Triebfeder.
Der Tellerwäscher heißt Ricardo, seine Herkunft habe ich nicht eruieren können, weil er den ganzen Tag immer nur murmelt: »Alles Scheiße hier, große Scheiße.«
Ich stand daneben, als er gemahnt wurde, weil er zu oft aufs Klo ging. »Hast du eine Ahnung, was all das Wasser uns kostet?«, fragte die Chefin. Er versprach, die Toilette in Zukunft seltener zu benutzen.
Die Chefs sind nett und menschlich, aber eben doch Chefs.
»Dein Vorgänger hieß Mario«, sagt Esmeralda.
Ach, Anton Morsink hatte einen Vorgänger?
»Guter Junge«, sagt Esmeralda. »Manchmal sagte: ›Ich mach schon mal Zimmer vier.‹ Kam ich auf Zimmer vier – lag da und schläft. Zu viel trinken. Du nicht zu viel trinken?«
»Nein«, sage ich.
»Aber Kissen aufschütteln kannst auch nicht«, sagt Esmeralda. »Nicht schlimm. Wenn hier weg, nie mehr Kissen aufschütteln, stimmt’s?«
Ob sie etwas ahnt?
»Ich glaube nicht«, antworte ich.
Wenn die Zimmer fertig sind, muss ich im Mittagsservice helfen.
Gerade noch habe ich eine Toilette geschrubbt, jetzt laufe ich mit gebratener Forelle und Petersilienkartoffeln durchs Restaurant.
Niemand hat mich zum Händewaschen aufgefordert. Also lasse ich es auch bleiben. Eigeninitiative wird hier nicht geschätzt.
In der Nacht gehe ich zum See. Ich ziehe mich aus. Das Wasser ist weniger kalt, als ich gedacht hatte.
Was würde geschehen, wenn ich mich morgen für zwei Jahre bei der us Army verpflichten würde? Ich habe ein großes Bedürfnis, mich überall zu assimilieren.
Heute ist Zimmer neun nicht zum Frühstück erschienen. Esmeralda hat hineingesehen und berichtet: »Zimmer stinkt nach Bier. Mann liegt auf Bett, redet fremde Sprache.«
Ich werde zur Chefin geschickt und fasse die Worte des Zimmermädchens zusammen.
Die Chefin hebt die Augenbrauen und sagt: »Zimmer neun kommt aus Dubai. Die dürfen doch gar nicht trinken?«
Heute sitzt Esmeralda der Schalk im Nacken. Auf Zimmer drei riecht sie am Parfüm, auf Zimmer fünf probiert sie den Hut eines Gasts und betrachtet sich im Spiegel.
Morgen sehe ich Esmeralda zum letzten Mal. Ich habe Blumen für sie gekauft.
Fast drei Wochen habe ich hier gearbeitet. Die Illusionen des Gaststättengewerbes verinnerlicht. Sauber ist, was sauber aussieht, das Lächeln auf dem Gesicht der Bedienung ist freundlich, solange der Gast hinschaut. Was Machiavelli über den Fürsten schrieb, hätte er auch über uns, Kellner und Zimmermädchen des Hotels B., sagen können: Der Schein ist wichtiger als das Sein.
»Was sollen wir ohne dich anfangen, Anton?«, fragt die Chefin. »Kommst du nächstes Jahr wieder?«
Weil ich gut gearbeitet habe, darf ich heute im Restaurant essen. Ich bestelle Kaiserschmarrn, ein Gericht, das ich mindestens hundertmal serviert habe. Ich könnte mich reinsetzen.
Würden die Kollegen sich verraten fühlen, wenn sie wüssten, dass ich nicht Anton Morsink heiße? Was könnte ich sagen? Verrat ist mein Handwerk. Ich bin gut darin.
Doch sie werden es niemals erfahren.
Ansonsten kommt in jedem Leben der Moment, in dem man alles rundheraus leugnen muss, empört leugnen, wie die beleidigte Unschuld. So überlebt man. Oder auch nicht.
Der Rest ist Melancholie.
Morgen um diese Zeit werde ich hier mein letztes Bett machen. Danach nehme ich den Zug nach Oberammergau. Es soll eine schöne Fahrt sein.
Auf dem Kirmesplatz des Ortes organisiert der Bayerische Rundfunk ein »Fest mit viel Musik!«. Mein Hotel wird an einem Stand Essen verkaufen. Vor allem Fischsemmeln.
Meryem sagt: »Komm doch noch mal vorbei, es ist dein letzter Abend, dann gehen wir hinterher in die Disko.«
Ich kann nicht kneifen, meine Verpflichtungen gehen weiter, als bloß Zimmer sauberzumachen.
Trotz des sehr mäßigen Wetters sind fünftausend Leute gekommen, um zur Musik von Bayern I Bier zu trinken und Fischsemmeln zu essen. Durch den Regen hat sich der Festplatz in eine Schlammpiste verwandelt. Meine Kollegen riechen nach Fisch.
In die Diskothek kommen wir nicht mehr.
Wir setzen uns in ein Zelt, trinken Bier, und die es können, reden bayrisch.
»Lass mal was von dir hören«, sagt Meryem. »Du hast meine Nummer.«
Am nächsten Morgen packe ich in aller Frühe meinen Koffer. Ich ziehe mein Bett ab, um den Kollegen weniger Arbeit zu machen.
In mir eine unbestimmte Trauer.
Als ich in Brooklyn mit dem Tod bedroht wurde, begann ich laut zu beten. Nicht weil ich plötzlich gläubig geworden wäre, sondern weil ich davon ausging, dass, wer laut betet, zu erkennen gibt, dass er nicht sterben will.
Ich will aus diesem Dorf nicht mehr weg.
Vielleicht schlummert tief in mir doch das Bedürfnis nach einem Ort, den man Zuhause nennt.
Oder ist es wie in dem Witz von Groucho Marx, nur umgekehrt, dass ich unbedingt Mitglied eines Clubs werden möchte, der mich niemals als Mitglied aufnehmen würde? Doch vielleicht ist selbst das nicht die ganze Wahrheit. Vielleicht bin ich längst Mitglied in diesem Club.
»Er neu. Ich muss alles beibringen!«
Bedienen in Schweizer Zügen
(Juli 2008)
In seinen Memoiren eines Antisemiten beschreibt Gregor von Rezzori die Kunst, der Realität immer wieder andere Facetten der eigenen Person abzugewinnen, immer neue Erfindungen.
Die Realität mit Erfundenem im weitesten Sinne des Wortes zu konfrontieren ist die ideale Umschreibung dafür, wie ich meine Aufgabe als Romanschriftsteller verstehe.
Im Sommer 2007 arbeitete ich knapp drei Wochen als Zimmerjunge in einem bayrischen Hotel. Ich war glücklich.
Doch muss man das Glück auch an anderen Orten suchen. Ich habe das im Irak, in Afghanistan, auf Guantánamo Bay und im Libanon getan.
Der Traum vom Glück im Zug jedoch ließ mich nicht los, und von allen Zügen am lautesten lockten mich die der Schweizer Bahn.
Wer einmal auf der Strecke Chur–St. Moritz im Speisewagen gesessen hat, träumt davon, irgendwann einmal in diesem Speisewagen Gäste bedienen zu dürfen.
Leider wollte RailGourmino Swiss Alps von der Rhätischen Bahn meine Dienste nicht in Anspruch nehmen. Die Schweizer Speisewagengesellschaft Elvetino, die auf den meisten anderen Linien aktiv ist, dagegen schon.
ZÜRICH
»Der Kunde im Speisewagen ist Egoist«, sagt mir der Elvetino-Chef. »Er will nichts Gesundes essen, er will etwas Fettes. Er will keinen frisch gepressten Orangensaft, er möchte ein Bier oder einen Wein, ohne dass seine Frau zu ihm sagt: ›Lass das doch!‹«
Zehn Tage lang werde ich für Elvetino arbeiten.
Es gibt eine Geschichte des niederländischen Dichters Nico Slothouwer, in der das romantische Abenteuer mit einem »Nachtzug nach Mailand« beginnt.10
Für die Geschäftsleitung bin ich ein Romancier auf Recherche in der Welt des Speisewagens, mich selbst lockt zudem noch die Möglichkeit des Nachtzugs nach Mailand.
»Vor fünf Jahren habe ich meinen Posten hier angetreten«, erklärt der Chef. »Ich habe der Schweizer Bahn versprochen, dass die Minibars Espressomaschinen bekommen, und das ist mir gelungen.«
Die Minibar ist eine Bar nebst Kiosk auf Rädern. Auch ich werde solch einen Wagen hinter mir herziehen und dabei rufen: »Wein, Mineralwasser, Kaffee!«
Die technische Umsetzung der Idee ist einem indischen Angestellten zu verdanken. Er fand einen Weg, wie die Espressomaschinen in der fahrenden Bar funktionieren konnten.
»Er ist ein Genie«, sagt der Chef, als er mich dem Herrn vorstellt. »Das Geheimnis sind die Batterien: In jeder Espressomaschine stecken gut dreißig Notebook-Batterien, denn unterwegs durch den Zug hat man auf dem Wagen natürlich keinen Strom. Selbst wenn man mit dem Messer daran herumfummelt, kann nichts passieren!«
Die Sekretärin des Chefs bringt mich zur Kleiderkammer, wo ich meine Uniform bekomme. »Und immer den Schlips umlassen!«, sagt sie.
Eine Uniform bietet eine unhinterfragte, fix und fertige Identität. Darum habe ich solch eine Vorliebe dafür.
Als ich wieder in seinem Büro bin, zeigt mein Chef auf einen Busbahnhof vor dem Gebäude. »Die Zukunft gehört der Bahn«, sagt er. »Aber die Busse da fahren auf den Balkan. Während der Kriege dort haben die Schweizer Jugoslawen sich jeden Freitag damit auf den Weg nach Hause gemacht, um ein bisschen Krieg zu spielen. Am Montagmorgen waren sie wieder zurück, und eine Stunde später standen sie an der Arbeit.«
Für den Krieg gibt es offenbar Rückfahrkarten, der romantische Reiz des Nachtzugs nach Mailand jedoch liegt in der einfachen Fahrt.
LUZERN–INTERLAKEN–LUZERN
Morgens um sieben Uhr dreißig melde ich mich auf Gleis 12 des Bahnhofs Luzern, wo der Zug nach Interlaken bereitsteht.
Die kommenden zwei Tage werde ich im Speisewagen dieses Zuges wohnen.
Im Inneren wartet laut mir ausgehändigtem Dienstplan Herr Konstantin K. auf mich (Namen wurden geändert).
Auf meiner Weste trage ich ein Schild mit der Aufschrift »Trainee«.