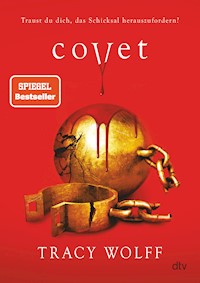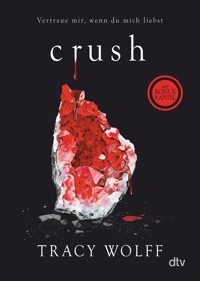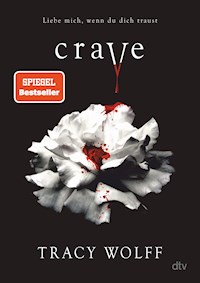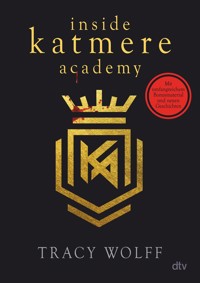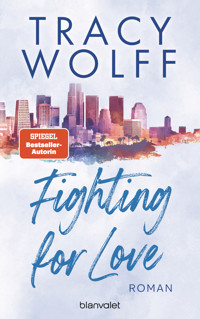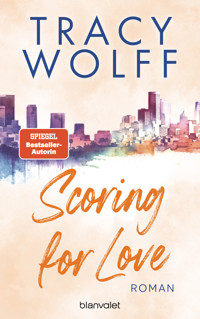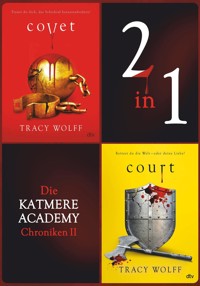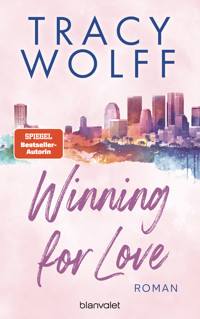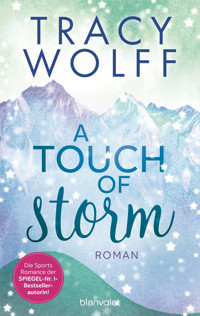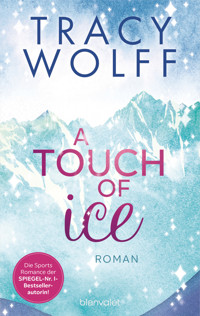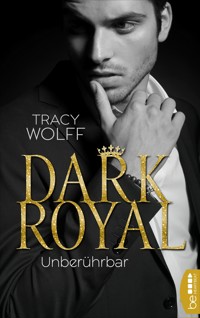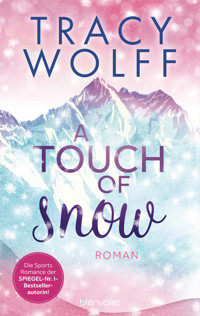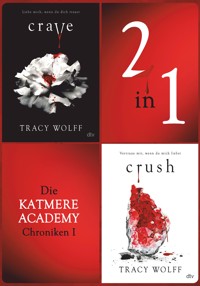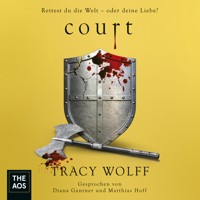
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: The AOS
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Katmere Academy Chroniken
- Sprache: Deutsch
Rettest du die Welt – oder deine Liebe? Der letzte Kampf hat Grace und ihre Freunde einen hohen Preis gekostet und doch scheint alles verloren. Mächtige Gegner bringen sich in Position, um sie endgültig zu schlagen, bevor Grace ihre volle Macht entdecken kann. Gleichzeitig plagen Grace große Zweifel – nicht nur wegen ihrer Herkunft, sondern auch wegen ihres Liebeslebens, das chaotischer ist denn je. Grace bleibt keine Wahl: Will sie die Welt retten, muss sie herausfinden, wer sie wirklich ist – auch wenn sie sich vor der Antwort fürchtet und Gefahr läuft, dabei ihre große Liebe oder sich selbst zu verlieren … Alle Bände der Katmere-Academy-Chroniken: Band 1: Crave Band 2: Crush Band 3: Covet Band 4: Court Band 5: Charm Band 6: Cherish Die Spin-off-Reihe: Die Calder-Academy-Chroniken von Tracy Wolff bei dtv: Band 1: Sweet Nightmare Band 2: Sweet Chaos (erscheint im Herbst 2026) Band 3: Sweet Vengeance (erscheint 2027) Die Bände sind nicht unabhängig voneinander lesbar.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Rettest du die Welt – oder deine Liebe?
Aus dem Kampf um die Insel der Bestie ist niemand ohne Verluste hervorgegangen, doch die Chancen für Grace, alles zum Guten zu wenden, scheinen immer weiter zu schwinden. Flint ist verbittert und wütend auf die Welt, Jaxon wird immer mehr zu jemandem, den Grace kaum wiedererkennt, und Hudson hat eine Mauer um sich gezogen, die undurchdringlich scheint. Noch dazu ist der Krieg, den der Vampirkönig heraufbeschworen hat, unausweichlich. Grace wird eine Armee benötigen, wenn sie irgendwie gewinnen will. Doch zunächst muss sie sich ihrer größten Angst stellen – der Frage, wer sie wirklich ist. Ob sie alle überleben werden, hängt nicht zuletzt davon ab, ob Grace zu ihrer vollen Macht finden kann und was sie bereit ist, dafür aufzugeben …
Knisternde Romance, neue Gefahren und rasantes Tempo – der vierte Teil der Bestsellerreihe
Von Tracy Wolff ist bei dtv außerdem lieferbar:
Crave
Crush
Covet
TRACY WOLFF
c o u r t
Roman
Aus dem amerikanischen Englischvon Michelle Gyo
Für StephanieDanke, dass du Ja gesagt hast
Anmerkung der Autorin:
Dieses Buch stellt Aspekte von Panikattacken, Tod und Gewalt, emotionaler und psychologischer Folter, insektenbezogene Situationen, lebensbedrohliche Situationen, Amputation sowie sexuelle Inhalte dar. Ich hoffe, dass ich diese Elemente sensibel und angemessen behandelt habe.
0
Ertrage es, bis es dich zerbricht – Hudson –
WIR SIND TOTAL AM ARSCH.
Der verängstigten Miene von Grace nach zu urteilen, sieht sie das auch so. Ich möchte ihr sagen, dass alles gut wird, aber tatsächlich habe ich auch Angst. Nur nicht aus denselben Gründen wie sie, auch wenn ich noch nicht so weit bin, das zuzugeben.
Im Moment sitzt sie auf meiner Couch vor dem Feuer, das Haar nass von der Dusche und ihre Locken glänzen im flackernden Licht. Sie trägt eins meiner T-Shirts und eine von meinen Jogginghosen, die sie hochgerollt hat.
Sie hat noch nie schöner ausgesehen.
Oder schutzloser.
Panik droht mich bei diesem Gedanken zu überwältigen, obwohl ich mir sage, dass sie nicht annähernd so wehrlos ist, wie sie wirkt. Obwohl ich mir sage, dass sie mit allem zurechtkommt, was unsere verdammte Welt ihr entgegenstellt.
Mit allem, außer mit Cyrus.
Wenn ich eins über meinen Vater weiß, dann, dass er nie aufhört. Nicht, bis er hat, was er will, scheiß auf die Konsequenzen.
Bei diesem Gedanken gefriert mir das Blut.
Ich hatte in meinem ganzen elenden Leben nie vor etwas Angst – nicht vor dem Leben und definitiv nicht vor dem Sterben. Und dann kam Grace und jetzt lebe ich in ständiger Furcht.
Furcht davor, sie zu verlieren, und Furcht davor, dass sie dann das Licht mit sich nimmt. Ich weiß, wie es ist, in den Schatten zu leben – mein ganzes verflixtes Leben habe ich in der Dunkelheit verbracht.
Und dahin möchte ich nicht zurück.
»Soll ich …« Ich räuspere mich und fange noch mal an. »Soll ich dir was zu trinken holen?«, frage ich, aber Grace reagiert nicht. Ich bin nicht mal sicher, ob sie mich hört, denn sie starrt weiter auf ihr Telefon, möchte keine Nachricht zu Flint verpassen. Der Spezialist kam vor zehn Minuten zu ihm, und die Warterei auf die Information, ob das Bein gerettet werden kann, scheint endlos. Sie möchte bei ihm auf der Krankenstation sein – das möchten wir alle –, aber als er um etwas Privatsphäre bat, konnten wir nicht ablehnen. »Ja. Okay. Ich bin gleich wieder da«, sage ich, denn auch ich brauche jetzt dringend eine Dusche.
Sie antwortet immer noch nicht und ich frage mich, was sie wohl denkt. Was sie fühlt. Sie hat nicht mehr als ein paar Worte gesagt, seit wir zurück sind und feststellen mussten, dass Cyrus uns ausgetrickst und alle Schüler und Schülerinnen entführt hat, während wir auf der Insel gegen ihn kämpften. Ich wünschte, ich wüsste, wie ich ihr helfen kann. Wie ich zu ihr durchdringen kann, bevor alles wieder zum Teufel geht.
Denn das wird es. Das beweisen Cyrus’ furchterregende neue Bündnisse. Ebenso wie die dreiste Entführung der Kinder der mächtigsten Paranormalen der Welt. Von hier an gibt es für ihn keinen anderen Weg, kann er nichts mehr tun, als alles zu zerstören.
Ich möchte Grace nicht allein in der Stille sitzen lassen, also gehe ich zu meiner Schallplattensammlung und blättere die Alben durch, bis meine Finger bei Nina Simone landen. Ich ziehe die Platte aus der Hülle und lege sie auf den Teller und warte, dass die Nadel vorschwingt und sich mit einem klaren statischen Knistern absenkt, dann ertönt Ninas Whiskystimme und erfüllt den leeren Raum. Ich passe die Lautstärke zu Hintergrundmusik an und mit einem letzten Blick auf Grace drehe ich mich um und gehe zum Badezimmer.
Ich nehme die schnellste Dusche der Geschichte, besonders angesichts der Menge an Blut, Ekelzeug und Tod, die ich wegspülen muss. Und fast genauso schnell ziehe ich mich wieder an.
Ich weiß nicht, warum ich mich beeile, weiß nicht, was ich vorzufinden fürchte, wenn …
Mein rasendes Herz beruhigt sich ein wenig, als ich Grace dort entdecke, wo ich sie zurückgelassen habe. Und endlich gestehe ich mir selbst ein: Ich wollte sie nicht aus den Augen lassen aus Angst, dass sie bemerkt, dass mich zu wählen ein Fehler war.
Ist diese Angst irrational, wenn sie doch sagte, dass sie mich liebt? Dass sie mich wählt trotz allem, sogar in dem Wissen, was für eine Last meine Gaben sind? Absolut.
Lässt das meine Angst verschwinden? Nicht im Geringsten.
Diese Macht hat sie über mich und diese Macht wird sie immer haben.
»Irgendwas zu Flint?«, frage ich und nehme eine Wasserflasche aus dem Kühlschrank, gehe damit zu ihr.
»Noch nichts im Gruppenchat.«
Ich will ihr das Wasser reichen, doch als sie es nicht aus meiner ausgestreckten Hand nimmt, gehe ich zur anderen Seite der Couch und setze mich neben sie, stelle das Wasser auf den Tisch vor uns.
Da wendet sie sich vom Feuer ab, bezwingt mich mit ihrem verwundeten Blick und flüstert: »Ich liebe dich.« Und mein Herz hämmert erneut.
Sie sieht so ernst aus, zu ernst, und sogar ein wenig verzweifelt. Also tue ich das, was ich immer tue, um sie aus ihren Gedanken zu holen: Ich necke sie, dieses Mal mit unserem liebsten Filmzitat. »Ich weiß.«
Langsam tritt ein Lächeln in die Schatten in ihren Augen und ich weiß, dass ich die richtige Wahl getroffen habe. Ich strecke die Hände aus und ziehe sie auf meinen Schoß, genieße das Gefühl, sie ganz an mir zu spüren. Ich fahre mit dem Finger über den Ring, den ich ihr schenkte, erinnere mich an meinen Schwur, an die Überzeugung in meiner Stimme, mit der ich die schicksalsträchtigen Worte sprach, und meine Brust wird eng.
»Weißt du noch«, sagt sie und zieht meinen Blick mit ihrem an, »du hast gesagt, wenn ich errate, welches Versprechen du gemacht hast, dann sagst du es mir. Ich glaube, ich weiß es jetzt.«
Ich ziehe eine Augenbraue hoch. »Ach?«
Sie nickt. »Du hast versprochen, mir für den Rest meines Lebens das Frühstück ans Bett zu bringen.«
Ich schnaublache. »Zweifelhaft. Morgens bist du eine echte Herausforderung.«
Das erste echte Lächeln seit gefühlten Ewigkeiten erhellt ihr Gesicht. »Hey, dem widerspiegle ich.« Dann lacht sie über ihren eigenen Witz und ich kann nicht anders, als mitzulachen. Es ist so verflucht schön, sie lachen zu sehen.
»Ich glaube …«, fährt sie fort und tut so, als würde sie nachdenken. »Du hast versprochen, mich bei jedem Streit gewinnen zu lassen?«
Ich lache tief aus dem Bauch heraus angesichts dieses lächerlichen Einfalls. Sie liebt es, sich mit mir zu streiten. Das wäre das Letzte, was sie jemals von mir wollen würde, dass ich einfach umknicke und ihr ihren Willen lasse. »Unwahrscheinlich.«
»Erzählst du es mir jemals?«
Sie ist noch nicht bereit zu hören, was ich versprach, bevor ich auch nur wusste, ob sie meine Liebe je erwidern würde. Also mache ich stattdessen einen weiteren Witz. »Wo bliebe denn da der Spaß?«
Sie täuscht einen Schlag gegen meine Schulter an. »Ich bekomme das eines Tags noch aus dir raus.« Mit ihrer weichen Hand fährt sie über die Stoppeln an meinem Kiefer und ihr Blick wird wieder ernst. »Ich habe die Ewigkeit, um es zu erraten, Gefährte.«
Und einfach so stehe ich in Flammen.
»Ich liebe dich«, flüstere ich und streife mit meinen Lippen ihre. Einmal, zweimal. Doch davon will Grace gar nichts wissen. Sie hält meinen Kopf zwischen ihren Handflächen, ihre Wimpern flattern über ihre Wangen und dann fordert sie alles von mir. Meinen Atem. Mein Herz. Meine Seele.
Als wir beide atemlos sind, lehne ich mich zurück und halte ihren Blick. In den Tiefen ihrer warmen braunen Augen könnte ich mich auf ewig verlieren.
»Ich liebe dich«, sage ich erneut.
»Ich weiß«, wiederholt sie meine Worte von vorhin neckisch.
»Diese clevere Klappe wird irgendwann mein Tod sein«, murmle ich und will sie noch einmal küssen, während der Gedanke, sie hochzuheben und zu meinem Bett zu tragen, durch meinen Kopf wirbelt. Aber sie erstarrt und ich erkenne, dass mein gedankenloser Kommentar über den Tod sie daran erinnert hat, uns beide daran erinnert hat, was wir schon alles verloren haben – und immer noch verlieren können.
Mein Herz bleibt fast stehen, als ich die Tränen in ihren Augen sehe. »Es tut mir leid«, murmle ich.
Sie schüttelt kurz den Kopf, als solle ich mich nicht für den Ausrutscher fertigmachen, aber na ja, das wird nicht passieren. Dann beißt sie sich auf die Lippe, das Kinn zittert, weil sie versucht, all den Schmerz für sich zu behalten, und zum millionsten Mal möchte ich mich selbst treten, weil ich immer erst rede und dann denke, wenn sie in meiner Nähe ist.
»Babe, alles wird gut«, sage ich, auch wenn sich alles in mir verflüssigt. Knochen, Adern, Muskeln, alles zerfließt in der Spanne zwischen einem Atemzug und dem nächsten und ich kann nur noch daran denken, was ich ohne Grace wäre. Eine leere, blutende Hülle.
»Was kann ich tun?«, frage ich. »Was brauchst du …«
Sie unterbricht mich, indem sie ihre kleinen, kalten Finger auf meinen Mund legt.
»Luca ist umsonst gestorben. Flints Bein, Jaxons Herz, alles … Es war alles umsonst, Hudson«, flüstert sie.
Ich ziehe sie in meine Arme, halte sie, während die Qual dessen, was wir überlebt haben, sich durch sie hindurcharbeitet, ihr Zittern wird jetzt zu meinem, denn ich weiß, dass ich keine Entschuldigungen mehr übrig habe.
In diesem Augenblick, in dem ich das Mädchen halte, das ich liebe – das Mädchen, das ich um jeden Preis retten würde –, weiß ich, dass meine Zeit um ist. Die kalte, harte Wahrheit, die zu ignorieren ich in der letzten Stunde mein verdammt noch mal Bestes gegeben habe, haut mich um und raubt mir den Atem.
Es ist alles meine Schuld.
Alles. Alle Qual, jeder Tod, jeder schmerzhafte Augenblick, den Grace und die anderen auf dieser Insel erlitten – all das ist meine verdammte Schuld.
Weil ich selbstsüchtig war. Weil ich sie noch nicht aufgeben wollte. Weil ich schwach war.
Mein ganzes Leben bin ich vor dem Schicksal davongelaufen, das mein Vater immer für mich vorsah, aber jetzt begreife ich, dass ich keine Wahl habe. Es kommt, ob ich es will oder nicht, und ich kann einen Scheiß tun, um ihm zu entgehen. Kein zweites Mal. Nicht wenn das Glück von Grace auf dem Spiel steht.
Und wenn ich mich endlich meinem Schicksal ergebe, wird es uns möglicherweise alle zerstören.
1
Manchmal wird aus zwei Richtigen ein sehr großes Falsch
ICH MÖCHTE ÜBERALL SEIN, nur nicht hier.
Überall, nur nicht hier mitten in diesem eisigen Zimmer, das praktisch nach Schmerz und Elend und einer ordentlichen Portion Desinfektionsmittel stinkt. Ich lächle Hudson kurz an, dann wende ich mich dem Rest der Gang zu.
»Was machen wir zuerst?« Macy spricht leise, aber die Frage meiner Cousine hallt durch die zerstörte Krankenstation, prallt von den leeren Wänden und zerbrochenen Betten ab wie ein Schuss.
Genau das ist die Eine-Million-Dollar-Frage, die Eine-Milliarde-Dollar-Frage. Und in diesem Moment habe ich keine Ahnung, was ich Macy und den anderen darauf antworten soll.
Ich stehe unter Schock, seit wir an der Katmere ankamen und sie geplündert vorfanden, mit blutbespritzten Wänden, zertrümmerten Zimmern und ohne einen Schüler oder Lehrerin. Und jetzt zu erfahren, dass Flints Bein nicht gerettet werden konnte? Ich bin am Boden zerstört, und die Tatsache, dass er sich so sehr bemüht, stark zu sein, macht es eine Million Mal schlimmer.
Jetzt bin ich dank der Dusche vielleicht sauberer als vor einer Stunde, von dem Unglück all dessen jedoch immer noch vollkommen erschüttert.
Schlimmer noch, als ich jetzt in die Gesichter meiner Leute sehe – Jaxon, Flint, Rafael, Liam, Byron, Mekhi, Eden, Macy, Hudson –, wird mir klar, dass sie genauso erschüttert sind. Und sie scheinen ebenfalls keine Ahnung zu haben, was als Nächstes ansteht.
Andererseits, was soll man auch tun, während die gesamte uns bekannte Welt vor dem Ende steht, man selbst mittendrin steckt und dabei zusehen muss, wie sie Stein um Stein auseinanderfällt? Während jede Mauer, die man hochzieht, an anderer Stelle eine Lücke aufreißt, damit alles um einen herum zusammenbricht?
Es ist nicht das erste Mal, dass wir einen Verlust erleiden, aber es ist das erste Mal seit dem Tod meiner Eltern, dass alles für uns alle wirklich hoffnungslos scheint.
Selbst als ich allein auf dem Ludares-Feld stand, wusste ich, dass alles gut würde – wenn nicht für mich, dann doch für diejenigen, die mir wichtig waren. Oder beim Kampf gegen die Riesen mit Hudson – ich wusste immer, dass er überleben würde. Und als wir auf der Insel der Unzerstörbaren Bestie waren, uns dem Vampirkönig und seinen Truppen stellten, hatte ich immer noch das Gefühl, wir hätten eine Chance. Hatte immer noch das Gefühl, wir könnten irgendwie eine Möglichkeit finden, Cyrus und seine unheilige Allianz zu besiegen.
Und am Ende, als er floh, glaubten wir, wir hätten es geschafft.
Glaubten, wir hätten mindestens diese Schlacht gewonnen, wenn nicht gar den Krieg.
Glaubten, die Opfer – die vielen, zu vielen Opfer –, die wir erbracht hatten, wären es wert gewesen.
Bis wir an die Katmere zurückkamen und begriffen, dass wir gar keinen Krieg ausgefochten hatten – nicht einmal eine Schlacht. Nein, was für uns ein Kampf auf Leben und Tod war, was uns in die Knie gezwungen und uns in einen Abgrund der Verzweiflung gesandt hatte, war gar kein Kampf gewesen. Es war kaum mehr als eine Verabredung zum Spielen, dazu gedacht, die Kinder zu beschäftigen, während die Erwachsenen den echten Krieg gewannen.
Ich fühle mich wie eine Närrin … und eine Versagerin. Denn trotz des Wissens, dass man Cyrus nicht trauen darf, dass er jede Menge Asse im Ärmel hat, fielen wir darauf herein. Schlimmer noch, manche von uns starben sogar dafür.
Luca starb dafür und jetzt hat Flint sein Bein verloren.
Den Mienen aller auf der Krankenstation nach zu urteilen, fühle nicht nur ich mich so. Eine bittere Mischung aus Elend und Zorn lastet schwer auf uns. So schwer, dass kaum Raum ist für andere Gefühle – kaum Raum für andere Gedanken.
Marise, die praktizierende Schulkrankenschwester und einzig zurückgebliebene Überlebende der Katmere, liegt auf einem Krankenbett und hat immer noch sichtbare Prellungen und Schnitte an Armen und Wangen, was zeigt, wie heftig sie sich gewehrt haben muss, wenn ihr vampirischer Metabolismus sie noch nicht geheilt hat. Macy bringt ihr eine Flasche Blut aus dem Kühlschrank und Marise nickt dankend, bevor sie trinkt. Dem Spezialisten bei Flints Versorgung zu helfen, hat ihr offensichtlich die verbliebene Stärke ganz genommen.
Ich sehe zu Flint, der auf einem Krankenbett in der Ecke sitzt und hochlagert, was von seinem Bein übrig ist. Sehe den Schmerz, der in sein normalerweise von einem breiten, albernen Grinsen verzogenem Gesicht eingegraben ist, und mein Magen sackt ab. Er wirkt so klein, die Schultern gekrümmt vor Schmerz und Trauer, und ich muss die Gallenflüssigkeit niederringen, die mir in der Kehle aufsteigt. Nur schiere Willenskraft hält mich noch aufrecht – die und Hudson, der einen Arm um meine Taille schlingt, als wüsste er, dass ich ohne seine Unterstützung fallen würde. Sein Halt, sein offensichtlicher Trostversuch, sollte mich beruhigen. Und vielleicht würde es das, wenn er nicht ebenso sehr zittern würde wie ich.
Die Stille zwischen uns ist so straff gespannt wie eine Geigensaite, bis Jaxon sich räuspert und mit einer Stimme, so wund, wie wir uns alle fühlen, sagt: »Wir müssen über Luca reden. Es bleibt nicht viel Zeit.«
»Luca?«, fragt Marise und der Schmerz ist deutlich zu hören in dem gekrächzten Wort. »Er hat es nicht geschafft?«
»Nein.« Flints Antwort ist so ausdruckslos wie seine Augen. »Hat er nicht.«
»Wir haben seinen Leichnam zurück an die Katmere gebracht«, fügt Mekhi hinzu.
»Gut. Er sollte nicht auf dieser verfluchten Insel bleiben.« Marise will noch etwas sagen, aber ihre Stimme versagt. Sie räuspert sich, versucht es erneut. »Aber du hast recht. Es bleibt nicht viel Zeit.«
»Zeit wofür?«, frage ich und sehe zu Byron, der sein Telefon zückt.
»Lucas Eltern müssen benachrichtigt werden«, antwortet er und scrollt dabei. »Er muss innerhalb von vierundzwanzig Stunden beigesetzt werden.«
»Vierundzwanzig Stunden?«, wiederhole ich. »Das scheint mir furchtbar schnell.«
»Das ist schnell«, antwortet Mekhi. »Doch wenn er bis dahin nicht in einer Gruft versiegelt wurde, löst er sich auf.«
Die Härte seiner Antwort – die Härte dieser Welt – sorgt dafür, dass mir der Atem in der Kehle festsitzt.
Natürlich verwandeln wir uns am Ende alle in Staub, aber wie schrecklich, wenn es so schnell passiert. Vielleicht sogar, bevor Lucas Eltern es hierherschaffen, um ihn zu sehen. Definitiv bevor einer von uns begreifen kann, dass er wirklich weg ist.
Bevor wir auch nur Lebewohl sagen können.
»Byron hat recht«, sagt Macy leise. »Lucas Eltern verdienen die Gelegenheit, sich zu verabschieden.«
»Natürlich«, stimmt Hudson zu, wonach die Stille wie eine pulsierende Wunde pocht. »Aber wir können es uns nicht leisten, ihnen diese Gelegenheit zu geben.«
Darauf scheint niemand eine Antwort zu haben und so starren wir ihn alle verblüfft an. Ich frage mich, ob ich ihn falsch verstanden habe, und dem Ausdruck auf den Mienen der anderen nach zu urteilen, geht es ihnen genauso.
»Wir müssen es ihnen sagen«, stellt Jaxon fest. Es ist deutlich, dass er nicht in der Stimmung ist, dieses Thema zu diskutieren.
»Was meinst du?«, fragt Macy zugleich. Sie klingt nicht böse. Nur besorgt.
»Sie brauchen Zeit, um ihn zur Familiengruft zu bringen«, sagt Byron, aber er hat aufgehört, auf seinem Telefon zu scrollen – entweder, weil er endlich die Nummer gefunden hat, oder weil er nicht glauben kann, was er da hört. »Wenn wir sie jetzt nicht anrufen, wird nichts mehr von ihm übrig sein.«
Hudson nimmt den Arm von meiner Taille und macht einen Schritt weg und ich zittere unwillkürlich beim Verlust seiner Wärme. »Das weiß ich«, erwiderte er und verschränkt die Arme. »Aber sie sind Vampire, vom Vampirhof. Woher wissen wir, dass wir ihnen trauen können?«
»Ihr Sohn ist tot.« Flints Stimme knackt vor Empörung und er versucht aufzustehen. Ich kann nicht glauben, dass er schon wieder auf ist, aber Wandler heilen schnell, sogar unter den fatalsten Umständen. Jaxon dreht sich um und will ihm helfen, aber Flint streckt die Hand in einer stummen »Bleib bloß weg«-Geste aus, obwohl sein Blick Hudsons nicht loslässt. »Du kannst nicht wirklich denken, dass sie Cyrus’ Partei ergreifen?«
»Ist dieser Gedanke wirklich so abwegig?« Hudsons Miene ist ausdruckslos, als er sich zu Jaxon umdreht. »Du hast deine letzte Begegnung mit deinem eigenen Vater kaum überlebt.«
»Das ist anders«, faucht Jaxon.
»Warum? Weil er Cyrus ist? Glaubst du wirklich, er ist der Einzige, der so denkt?« Hudson hebt eine Braue. »Denn wenn er das wäre, wären nicht so verflixt viele Leute auf der Insel gewesen, um zu kämpfen.«
Die Stille dehnt sich aus, bis Eden sagt: »Es tut weh, aber ich denke, Hudson hat recht.« Sie schüttelt den Kopf. »Wir wissen nicht, ob wir Lucas Eltern trauen können. Wir wissen nicht, ob wir irgendjemandem trauen können.«
»Ihr Sohn ist tot «, wiederholt Flint eindringlich und sieht mit schmalen Augen zu Eden. »Sie müssen es erfahren, solange sie noch die Zeit haben, ihn beizusetzen. Wenn ihr alle zu feige seid, mach ich es.« Er nagelt Hudson mit einem hitzigen Blick fest. »Mal dran gedacht, dass wir sie gar nicht benachrichtigen müssten, wenn du deinen Job gemacht hättest?«
Ich keuche auf, die Worte prallen gegen meinen Körper wie ein physischer Schlag. Es ist offensichtlich, dass er Hudsons Fähigkeit meint, Feinde mit einem Gedanken aufzulösen, und ich will Flint böse sein, weil er so etwas auch nur andeutet, ganz zu schweigen davon, dass er es erwartet hätte, aber ich weiß auch, dass er leidet und jetzt nicht die richtige Zeit ist.
Hudsons sieht kurz zu mir und so versuche ich, ihn mit einem Blick zu überzeugen, dass es nicht seine Schuld ist. Aber blitzschnell fokussiert er sich wieder auf Flint und macht mit beiden Armen eine ungläubige, ausholende Geste. »Ich war da und habe gekämpft, genau wie du.«
»Aber das ist nicht dasselbe, oder?« Flint hebt eine Braue. »Du tust so, als hättest du alles gegeben in dem Kampf, dabei wissen wir alle, dass das nicht stimmt. Warum fragst du dich nicht mal selbst: Wäre Grace in Lebensgefahr gewesen, würden wir diese Unterhaltung dann überhaupt führen oder wäre Luca noch am Leben?«
Hudsons Kiefer spannt sich an. »Du weißt nicht, wovon zum Teufel du da redest.«
»Ja, das red dir mal schön weiter ein.« Und dann hopst Flint vom Bettrand zu einem Paar Krücken in der Ecke. Er schiebt sie sich unter die Arme und schlurft ohne ein weiteres Wort hinaus.
Hudson sagt nichts. Niemand sagt was.
Meine Brust zieht sich fest zusammen angesichts der Entscheidungen, die er treffen muss, der Erwartungen, die auf seinen Schultern lasten. Erwartungen, die für jeden zu schwer zu tragen sind. Und doch tut er es. Immer.
Aber das heißt nicht, dass er sie allein tragen muss.
Ich ziehe ihn zurück in meine Arme und lege den Kopf an seine Brust, schließe die Augen und lausche seinem regelmäßigen Herzschlag, bis seine Schultern sich entspannen, bis seine Lippen einen Kuss auf mein Haar hauchen. Erst da seufze ich. Er kommt klar. Wir kommen klar.
Doch als ich die Augen öffne, landet mein Blick auf den anderen und mir stockt der Atem.
Bedauern. Wut. Vorwürfe. Das alles steht darin – und richtet sich gegen Hudson und mich.
Da begreife ich, welchen Sieg Cyrus heute wirklich errungen hat.
Wir sind gespalten.
Und das ist nur eine andere Art zu sagen, dass wir vollkommen am Arsch sind. Schon wieder.
2
Unentschieden und geliefert
MIT DIESEN DÜSTEREN GEFÜHLEN auf den Mienen stellt sich der Orden hinter Jaxon, Hudson gegenüber. Mein Magen schlägt einen raschen, unangenehmen Salto. Das hier entwickelt sich zu einem echten Showdown wie in einem alten Western und ich habe kein Interesse daran, ins Kreuzfeuer zu geraten. Oder zuzusehen, wie jemand anderes hineingerät.
Weshalb ich zwischen Jaxon und meinen Gefährten trete. Hudson macht ein ungehaltenes Geräusch, aber er versucht nicht mich aufzuhalten. Ich denke darüber nach, Hudsons Entscheidungen auf dem Schlachtfeld zu verteidigen, aber am Ende beschließe ich, dass wir uns zuerst auf Luca konzentrieren müssen. Die Minuten bis zu seinem Zerfall verstreichen unaufhörlich.
Wir werden diese Konversation über unsere Erwartungen an Hudson in einem Kampf führen, aber nicht heute. Wir haben so schon genug Probleme.
»Ich verstehe es, Jaxon.« Beschwichtigend halte ich eine Hand dem Jungen entgegen, der mir einmal alles bedeutete. »Das hier ist scheiße. Wirklich scheiße. Aber du siehst bestimmt auch, wie riskant es ist, Lucas Eltern hierher einzuladen.«
»Riskant?« Er wirft mir einen ungläubigen Blick zu und hebt die Arme in einer ähnlichen Geste wie Hudson gerade noch. Anscheinend kann man die Verwandtschaft wirklich sehen. »Was sollten sie der Katmere noch antun? Falls es dir entgangen ist, sie ist bereits völlig zerlegt.«
»Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass sie nicht erst auf eine handgeschriebene Einladungskarte warten müssten, wenn sie uns angreifen wollen«, wirft Byron ein. »Wir sind im Moment nicht gerade gut verteidigt.«
»Ja, aber sie wissen nicht, dass wir hier sind«, wirft jetzt Eden ein und tritt vor, neben Hudson. »Soweit sie wissen, sind wir aufgetaucht, haben diese Zerstörung gesehen und sind mit unbekanntem Ziel wieder abgehauen. Was vielleicht das ist, was wir tun sollten.«
»Ich kann Lucas Eltern benachrichtigen.« Marise setzt sich im Krankenhausbett auf, und obwohl sie noch blass ist, fangen ihre Wunden endlich an zu heilen. »Während ihr euch in Sicherheit bringt, fern vom Campus.«
»Wir lassen dich nicht zurück, Marise.« Macy klingt bestimmt, als sie zu Marise geht, die in der Nähe des Ordens ist. »Wenn wir gehen, kommst du mit.«
»Dafür bin ich noch nicht stark genug«, erwidert die Vampirheilerin.
»Was heißt, dass wir erst einmal nirgendwo hingehen«, antwortet Macy. »Außerdem haben sie dich zum Sterben zurückgelassen, also wissen sie offensichtlich, dass du auf unserer Seite stehst. Sie werden dich mit genauso großer Wahrscheinlichkeit verfolgen wie uns, wenn sie erfahren, dass du noch lebst.«
»Sie werden mir nichts tun«, sagt Marise, klingt jedoch selbst nicht überzeugt.
»Wir verlassen dich nicht«, bekräftige ich und gehe zum Kühlschrank, um ihr noch eine Flasche Blut zu holen. Sie nimmt sie, trinkt einen kräftigen Schluck, dann stellt sie den Rest auf den Tisch neben ihrem Bett.
»Lucas Eltern haben ein Recht darauf, es zu erfahren«, sagt Jaxon wieder, aber die latente Aggressivität schwindet bei jedem Wort ein wenig mehr aus seiner Haltung. »Ob sie nun Verräter sind oder nicht, sie verdienen die Chance, ihr Kind beizusetzen. Was immer auch passiert, wenn wir sie hierherbitten, welche Probleme es auch verursacht, wir kümmern uns darum. Denn ihnen diese Chance zu verwehren …« Er schließt die Augen, schüttelt den Kopf. »Ihnen das zu verwehren …«
»Macht uns nicht besser als Cyrus«, beendet Hudson den Satz und klingt so resigniert, wie Jaxon aussieht.
»Manches ist das Risiko wert«, sagt Mekhi. »Das Richtige zu tun, gehört dazu.«
Eden beißt sich auf die Lippe, als wolle sie etwas dagegen sagen, aber dann fährt sie sich frustriert mit der Hand durchs Haar und nickt.
Jaxon wartet, ob noch jemand etwas vorbringen will, blickt von einem zum anderen. Glücklicherweise scheint Hudsons Einwilligung alle überzeugt zu haben. Niemand regt sich und so wendet Jaxon sich an Marise. »Ich erledige den Anruf.«
Mit seinem Telefon phadet Jaxon quer durch das Zimmer, durch die Tür und auf den Flur hinaus.
»Und was jetzt?«, fragt Macy. Ihre Stimme klingt so zittrig, wie ich mich fühle.
»Jetzt warten wir«, antwortet Hudson, den Blick auf die Tür gerichtet, durch die Jaxon verschwunden ist. »Und hoffen, dass wir keinen riesigen Fehler machen.«
3
Ein verdammt blutiges Verhalten am Krankenbett
ZWANZIG MINUTEN SPÄTER IST FLINT wieder in seinem Krankenbett und angepisst wie Hölle, während Marise alles für die vom Spezialisten vorgegebene Wundverpflegung bereit macht.
»Warte genau hier«, sagt sie zu ihm. »Ich muss mehr Verbandszeug holen.«
»Und ich dachte schon, ich kann eben den Denali rauf«, antwortet er bemüht ironisch. Sie schüttelt nur den Kopf und geht schwerfällig zu einem Schrank in der anderen Ecke der Krankenstation – ein eindeutiges Zeichen, dass sie sich noch immer nicht annähernd so gut fühlt, wie sie uns weismachen will.
Jaxon und der Orden sind gegangen, um sich um Luca zu kümmern, und sie bestand darauf, dass ich Flint zurückbringe, damit sie nach seinem Bein sehen kann. Ich hatte gedacht, Hudson würde auch gehen, nachdem Flint ihm beim Betreten der Krankenstation einen mordlüsternen Blick zugeworfen hat. Man muss es ihm zugutehalten, dass er dennoch geblieben ist. Natürlich lehnt er gerade an einer Wand und tut so, als würde er durch sein Telefon scrollen, aber er ist hier, unterstützt Flint, so gut der es zulässt.
Flint dabei zuzusehen, wie er versucht, tapfer zu sein im Angesicht all dessen, was er verloren hat, sorgt dafür, dass mein Magen sich vor allzu vertrauter Panik verkrampft, und ich atme langsam und tief durch.
Marise schließt den Glasschrank auf und schiebt mehrere Pillenfläschchen herum, bis sie findet, was sie sucht. »Hier, es ist Zeit für mehr Schmerzmittel«, sagt sie und reicht Flint zwei blaue Pillen.
Nachdem Marise die Wunde gereinigt und mit dem mühsamen Prozess, einen neuen Verband anzulegen, begonnen hat, stellen Macy und Eden ihr Fragen über den Angriff.
»Es tut mir leid, Mädchen«, sagt Marise, nachdem sie keine neuen Informationen auf eine weitere Fragerunde liefert. »Ich wünschte, ich hätte mehr Antworten für euch.«
Macy und Eden tauschen einen Blick, bevor Macy erwidert: »Nein, nein, ist schon gut. Du hast um dein Leben gekämpft – das verstehen wir. Nicht die beste Zeit, um Fragen zu stellen. Wir wünschten nur, du wüsstest etwas, das uns bei der Planung unserer nächsten Schritte helfen würde.«
»Also ich denke, ihr solltet einfach an der Katmere bleiben, wo ihr in Sicherheit seid«, antwortet Marise und sammelt die benutzten Verbände ein. »Es ist absolut sinnlos, sich erwischen zu lassen und Cyrus eine Gelegenheit zu liefern, auch euch eure Macht zu rauben.«
»Moment, Cyrus hat die Kinder entführt, um ein Druckmittel gegen ihre Eltern zu haben, damit er sie dazu zwingen kann zu tun, was er befiehlt«, sagt Eden und ihre Augenbrauen schießen in die Höhe. »Oder?«
Ich beuge mich vor. Haben wir das alle falsch verstanden?
Marise zuckt mit den Schultern und sieht wieder auf Flints Bein hinab. »Davon weiß ich nichts, aber ich habe gehört, wie ein Wolf davon sprach, dass sie junge Magie als Energiequelle für irgendwas benötigen.«
Ich keuche und schüttle den Kopf. Nein, nein, nein. Das kann nicht stimmen.
»Er hat sie entführt, um ihre Magie zu stehlen?« Macys Stimme bricht, ihre Augen werden groß vor Entsetzen. »Aber unsere Magie ist an unsere Seelen gebunden. Wenn Cyrus diese abzapft, wird er sie umbringen!«
Ich sehe zu Hudson, ob er das auch hört, und bin nicht überrascht, dass er die ältere Vampirin eindringlich anstarrt.
»Es tut mir leid«, sagt Marise und dreht sich um, lässt Flints Verbände in einen Medizinabfalleimer fallen. »Das ist alles, was ich weiß.«
Macy fragt noch etwas, aber ich verstehe nichts über dem Dröhnen in meinen Ohren. Als wir an der Schule ankamen und begriffen, dass Cyrus die gesamte Schülerschaft entführt hat, waren wir alle entsetzt. Dennoch hatten wir wohl nicht geglaubt, dass er sie umbringen will. Er kann sie ja schwerlich als Druckmittel gegen ihre Eltern einsetzen, wenn sie tot sind, richtig?
Doch jetzt begreife ich, dass er sie vielleicht nur wegen ihrer Magie will und gar keinen Bedarf hat, sie am Leben zu lassen, sobald er ihnen genommen hat, was er von ihnen will, und ich kann nicht glauben, dass ich mir die Zeit für eine Dusche genommen habe. Oder – oh mein Gott – mit Hudson herumgemacht habe, während sie vielleicht sterben.
Ich blicke zu meinem Gefährten auf, dann wünschte ich, ich hätte es nicht getan, denn mir stehen meine Gedanken bestimmt ins Gesicht geschrieben. Die Reue. Die Scham. Das Entsetzen.
Sein Kiefer spannt sich an, bevor er sich daran hindern kann, dann wird sein Gesicht vollkommen ausdruckslos, weil er bemerkt, wie aufgewühlt ich bin. Bedauern macht sich in meinem Magen breit und windet sich darin. Denn egal wie sehr mich diese Erkenntnis mitnimmt, es ist nichts im Vergleich zu dem, was Hudson fühlen muss. Nicht nach all dem, was Flint ihm vorhin vorgeworfen hat.
Oh, er hat versucht, so zu tun, als wäre es keine große Sache, hat versucht, so zu tun, als wären Flints Worte einfach von ihm abgeprallt. Was mir vielleicht nicht so viel ausgemacht hätte, wenn er sich nur für die anderen verstellt hätte. Aber er macht es auch bei mir, und das sagt mir mehr als alles andere, wie sehr er wirklich am Boden zerstört ist.
Hudson und ich machen einander nichts vor – das haben wir nie getan. Nicht als er in meinem Kopf eingesperrt war und es uns unmöglich war, etwas voreinander zu verbergen. Und auch jetzt nicht, da er draußen ist, denn so sind wir nicht. Wir sagen einander die Wahrheit, selbst wenn es schwerfällt. Wenn er also so weit ist, dass er etwas vor mir verheimlicht, ist es übel. Wirklich, wirklich übel.
Angst lässt mein Blut zu Eis erstarren und ich will auf ihn zugehen. Er muss wissen, dass dies nicht seine Schuld ist, muss verstehen, dass man nichts hiervon ihm vorwerfen kann. Doch bevor ich das tun kann, hält Marise Flint eine Abhandlung mit Anweisungen zu seinem Bein.
Wir drängen uns alle um das Bett, wollen wissen, wie – wenn überhaupt – wir helfen können. Sogar Hudson legt sein Telefon weg, auch wenn er nicht näher tritt.
Irgendwann gibt es keine weiteren Fragen. Nur das Wissen, dass wir uns noch so sehr wünschen können, dass das hier nicht passiert, dennoch können wir nichts tun, als Flint zu unterstützen.
Denn die Wahrheit ist, egal über wie viel Macht man verfügt, manchmal muss Kaputtes kaputt bleiben, auch wenn wir es uns anders wünschten.
»Es tut mir so leid, dass dir das passiert ist«, sagt Macy zu ihm und reibt tröstlich mit der Hand über seinen Arm. »Aber wir tun alles, was wir können, für dich. Wir können dich zum Hexenhof bringen; die Heiler dort können dir eine Prothese …«
»Sind das dieselben Hexen, die gerade versucht haben, uns umzubringen?«, fragt er schneidend.
»Es tut mir leid«, flüstert sie und Tränen treten ihr in die Augen. »Ich wollte nicht …«
Flint murmelt etwas vor sich hin, schüttelt den Kopf. »Ignorier mich. Ich hab miese Laune.«
»Ja, na ja, wenn jemand das Recht dazu hat …« Macy blinzelt die Tränen weg. »Dann definitiv du.«
Ich fühle mich ein wenig voyeuristisch, dazustehen und Flint leiden zu sehen, also wende ich ihm den Rücken zu, als Marise zu ihm sagt: »Positiv ist doch, du heilst gut, sogar schneller, als Wandler das normalerweise tun. Deine Wunde ist schon fast vollkommen verschlossen und ich rechne damit, dass die Haut in den nächsten vierundzwanzig Stunden vollständig verheilt. In der Zwischenzeit wirst du ein Antibiotikum und weitere Verbände zum Wechseln brauchen.«
Eden tritt näher und stößt ihre Schulter gegen seine. »Du wirst gesund«, sagt sie nachdrücklich. »Dafür sorgen wir.«
»Ja, das werden wir«, stimmt Macy zu.
»Ich kann nicht glauben, dass das passiert«, flüstere ich zu niemandem im Besonderen und dann ist Hudson neben mir, dreht mich an den Schultern zu ihm um.
»Flint wird wieder gesund«, sagt er. »Alles kommt wieder in Ordnung.«
Ich hebe eine Braue. »Das wäre wirklich nett, wenn ich glauben würde, dass du das tatsächlich so siehst.«
Bevor ihm eine Erwiderung einfällt, kommt Jaxon zurück ins Zimmer und bleibt auf der anderen Bettseite stehen.
»Lucas Eltern machen sich auf den Weg.« Seine Miene ist grimmig, seine Augen tiefe Seen aus unendlicher Trauer. »Sie werden bis zum Morgen hier sein.«
4
Zu verschlossen für einen Abschluss
»DEIN DAD ENTZIEHT DEN KINDERN ihre Magie und könnte sie dabei töten«, platze ich heraus. Vermutlich nicht die beste Art, Jaxon diese Nachricht beizubringen, aber es vertreibt immerhin die Trauer aus seinen Augen. Stattdessen brennt dort nun glühend heißer Zorn, der einen Schauder meinen Rücken hinabjagen lässt.
»Ich bringe ihn um!« Jaxon sieht aus, als würde er sofort damit loslegen wollen.
»Lass uns ›Wer darf unseren lieben Vater zuerst umbringen‹auf morgen vertagen«, sagt Hudson gedehnt. »Wir alle brauchen Schlaf, sonst stirbt niemand außer uns.«
Alle grummeln, aber wir wissen, dass er recht hat. Ich habe das Gefühl, vor Erschöpfung gleich umzufallen. Marise versucht uns ein Versprechen abzuringen, nichts zu überstürzen, aber Jaxon stimmt nur zu, nicht vor dem Morgen loszuziehen. Er wartet, bis Flint wieder auf den Krücken ist, dann gehen er und der Orden auf ihre Zimmer.
Als wir hinter ihnen aus der Tür treten, schlingt Hudson stützend einen Arm um meine Taille und phadet uns innerhalb eines Wimpernschlags zu den Stufen, die zu seinem Zimmer führen. Manchmal ist das ganze Phaden echt praktisch – besonders da es bei der Geschwindigkeit unmöglich ist, den gesamten Schaden zu begutachten, den die Katmere Academy erlitten hat. Ich muss es mir irgendwann ansehen, aber im Moment ertrage ich den Anblick nicht, wie viel Cyrus’ Lakaien von meinem neu gefundenen Zuhause zerstören konnten.
Hudson stellt mich sanft neben dem Bett ab, sein Blick geht durchs ganze Zimmer, er sieht überallhin, nur nicht zu mir. »Du brauchst Schlaf. Ich nehme die Couch, damit ich dich nicht störe.«
»Mich stören? Als könntest du das.« Er mag ja vor mir stehen, aber ich kann nicht anders, als den Elefanten zwischen uns zu bemerken. »Hudson, wir sollten über das reden, was auf der Krankenstation passiert ist.«
»Was gibt es da zu reden?«, fragt er grimmig. »Es ist, wie es ist.«
Sanft lege ich eine Hand auf seinen Arm. »Es tut mir l…«
»Grace, halt.« Er klingt entschlossen, aber nicht böse. Und nicht annähernd so erledigt wie ich.
»Warum benimmst du dich so?«, frage ich und hasse es, wie bedürftig ich klinge. Hasse es sogar noch mehr, wie bedürftig und unsicher ich mich fühle. »Was ist los?«
Er wirft mir einen »Ernsthaft?«-Blick zu. Und, ja, ich weiß – alles ist los. Aber das ist nichts Neues. Das sind nicht wir. Das ist nur alles um uns herum. Nur dass …
Nur dass es sich schrecklich danach anfühlt, als ob es doch wir sein könnten, wenn er sich so verhält.
Damit bin ich nicht einverstanden, nicht nach allem, was wir durchgemacht haben, um hierherzugelangen. Und ich bin definitiv nicht damit einverstanden, dass er sich einfach entzieht, um seine Wunden zu lecken, statt seine Bedenken mit mir zu teilen.
»Hudson, bitte«, sage ich und will nach ihm greifen. »Tu das nicht.«
»Tu was nicht?«, fragt er.
Jetzt bin ich an der Reihe, ihm einen Blick zuzuwerfen. Und er muss ihn treffen, denn sein Kiefer spannt sich an und plötzlich interessiert er sich wirklich sehr für die Wand direkt hinter meinem Kopf.
»Rede mit mir«, flüstere ich und komme ihm näher und näher, bis unsere Körper sich beinahe berühren und wir die gleiche Luft atmen.
Er bleibt, wo er ist, eine Sekunde, zwei, dann macht er einen bewussten Schritt zurück. Und es schneidet wie ein Messer. »Ich habe nichts zu sagen.«
»Es gibt wohl für alles ein erstes Mal«, will ich ihn necken, ihn hoffentlich zu einer Reaktion verleiten. Hoffe, den Hudson zurückzubringen, der seiner selbst so sicher ist, großspuriger, als gut für ihn ist.
Da sieht er mich endlich an und ich fühle, wie ich in seinem ozeanischen Blick ertrinke – seiner Endlosigkeit.
Aber je näher ich hinsehe, desto mehr erkenne ich, dass er auch ertrinkt. Und er lässt nicht zu, dass ich ihm einen Rettungsring zuwerfe.
»Lass mich dir helfen«, flüstere ich.
Er stößt ein trauriges Halblachen aus. »Ich brauche deine Hilfe nicht, Grace.«
»Was brauchst du dann?« Ich halte ihn fest, dränge mich nah an ihn. »Sag mir, was, und ich finde einen Weg, es dir zu geben.«
Er antwortet nicht, schlingt seine Arme nicht um mich, rührt sich nicht einmal. Und plötzlich ist die Angst ein knurrendes Tier in mir, das verzweifelt nach meinen Innereien krallt, um herauszukommen.
Das ist nicht mein Hudson. Das ist ein Fremder und ich weiß nicht, wie ich ihn zurückbringen soll. Ich weiß nicht einmal, wie ich ihn unter all diesem Eis finden soll. Ich weiß nur, dass ich es versuchen muss.
Weshalb ich ihn festhalte, als er sich wieder rückwärtsbewegen will. Ich packe sein Hemd mit meinen Händen, drücke meinen Körper gegen seinen, halte seinen Blick mit meinem fest. Und weigere mich loszulassen.
Denn Hudson Vega ist mein, und ich werde ihn nicht an die Dämonen verlieren, die in ihm begraben sind. Nicht jetzt, niemals.
Ich weiß nicht, wie lange wir so stehen, aber es ist lange genug, dass meine Kehle eng wird. Lange genug, dass meine Handflächen feucht werden. Mehr als lange genug, dass ein Schluchzer in meiner Brust aufsteigt.
Und doch sehe ich nicht weg. Lasse ihn nicht los.
Und dann passiert es.
Mit angespanntem Kiefer und hüpfender Kehle schiebt er seine Finger um meinen Nacken und ballt seine Hand in meinem Haar. Dann neigt er meinen Kopf zurück, den Blick immer noch mit meinem verschränkt. »Grace.« Seine Stimme ist so rau und von Schmerz geplagt, dass mein gesamter Körper sich in Erwartung und Verzweiflung anspannt.
»Es tut mir leid«, sagt er. »Ich kann nicht … ich habe nicht …«
»Es ist in Ordnung«, antworte ich und ziehe seinen Kopf zu meinem hinab.
Einen Augenblick denke ich, er wird sich mir entziehen, dass er mich doch nicht küssen will. Aber dann macht er ein Geräusch tief in der Kehle und schon huschen alle Ängste und alles Versagen in dem hektischen, fieberhaften Druck seiner Lippen auf meinen davon.
Im einen Moment versuche ich, ihn zu öffnen, und im nächsten ertrinke ich in Sandelholz und Amber und hartem, festem Mann.
Und nichts hat sich je so gut angefühlt. Denn das ist Hudson, mein Hudson. Mein Gefährte. Und selbst wenn Dinge schiefgehen, ist das hier so, so richtig.
Als wolle er es beweisen, knabbert er an meiner Unterlippe, seine Fangzähne kratzen über die empfindliche Haut an meinen Mundwinkeln und ich kann mich nur in der Hitze seines dunklen und verzweifelten Herzens verlieren.
»Es ist in Ordnung«, murmle ich, als seine Finger meinen Rücken umklammern und sein zitternder Körper sich an meinen presst. »Hudson, es ist in Ordnung.«
Er scheint mich nicht zu hören – oder vielleicht ist es nur so, dass er mir nicht glaubt – und er vertieft den Kuss und reißt die Welt, und mich, weit auf.
Blitze zucken, Donner kracht und ich kann trotzdem nur ihn hören. Ich kann nur ihn sehen oder fühlen oder riechen, noch bevor seine Zunge über meine gleitet.
Er schmeckt nach Honig – süß, warm, gefährlich. Es macht süchtig, er macht süchtig, und ich stöhne, gebe ihm alles, das ich ihm geben kann. Gebe ihm alles, das er will, und flehe ihn an, mehr zu nehmen. So viel mehr.
Wir beide keuchen, als er sich endlich löst. Ich versuche, ihn noch ein wenig festzuhalten, will die Verbindung zwischen uns halten. Denn solange er in mich eingewickelt ist – in uns –, ist er nicht in seinem Kopf eingesperrt, zerstört sich nicht für etwas, das er nicht ändern kann und auch nicht sollte.
Schließlich zieht er sich zurück, aber ich bin noch nicht bereit, ihn loszulassen. Ich verschränke meine Arme um seine Taille, presse meinen Körper an seinen. Nur noch ein wenig länger, flehe ich stumm. Gib mir nur noch ein paar Minuten von dir und mir und dem Vergessen, das ich spüre, wenn wir uns berühren.
Er muss meine Verzweiflung fühlen – und die Zerbrechlichkeit, die ich so sehr zu verbergen versuche –, denn er bewegt sich nicht.
Ich warte, dass er etwas Geistreiches oder Sarkastisches oder einfach Lächerliches sagt, auf die Art, wie nur er das kann, aber er schweigt. Hält mich einfach und lässt mich ihn halten.
Und für den Moment ist es genug.
Wir haben die letzten vierundzwanzig Stunden so viel durchgemacht. Mussten gegen Riesen kämpfen, einem Gefängnis entkommen, diese schreckliche Schlacht schlagen, haben Luca verloren – und Jaxon und Flint fast –, und die Katmere zerstört vorgefunden. Ein Teil von mir findet es bemerkenswert, dass wir noch stehen. Der Rest von mir ist nur dankbar dafür, dass wir noch stehen.
»Es tut mir leid«, flüstert Hudson erneut, sein Atem heiß an meinem Gesicht. »Es tut mir so leid.«
Ein mächtiger Schauder packt seine lange, schlanke Gestalt.
»Was?«, frage ich und lehne mich zurück, damit ich sein Gesicht sehen kann.
»Ich hätte ihn retten sollen«, sagt er und unsere Blicke prallen aufeinander und seine Stimme bricht. »Ich hätte sie alle retten sollen.«
Ich kann sehen, dass die Schuld ihn bei lebendigem Leib auffrisst, und ich erlaube es nicht. Das kann ich nicht. »Du hast nichts falsch gemacht, Hudson«, sage ich entschieden.
»Flint hatte recht. Ich hätte sie aufhalten sollen.«
»Mit ›sie aufhalten‹ meinst du, Hunderte Leute an Ort und Stelle auflösen?«, frage ich mit hochgezogenen Brauen.
Er will sich beschämt abwenden, doch ich halte ihn fest. Ich trage diese Form der Schuld und des Schmerzes mit mir herum, seit meine Eltern starben, und es macht nicht gerade Spaß. Auf keinen Fall werde ich Hudson das ebenfalls durchmachen lassen. Nicht, wenn ich es verhindern kann.
»Was solltest du tun?«, frage ich. »Cyrus und alle anderen, die gegen uns standen, einfach«, ich schüttle den Kopf, suche nach den richtigen Worten, »in Luft auflösen?«
»Wenn ich das getan hätte, wäre Luca noch am Leben. Flint hätte noch sein Bein. Und Jaxon und Nuri …«
»Hättest du das tun können?«, frage ich, denn ich habe seine Verwirrung zu Beginn dieser Schlacht gespürt, wie er sich bemüht hatte, die Kontrolle über sich und die Lage zu erlangen, während das Chaos um uns herum herabregnete. »Am Anfang, als alles so ein Chaos war, hättest du es da tun können?«
»Natürlich hätte ich …« Er bricht ab, fährt sich mit der Hand durchs Haar. »Ich weiß es nicht. Alles war so nah und so chaotisch. Und als Jaxon sich einfach mittenrein stürzte …«
»Du hast dich mit ihm mittenrein gestürzt. Weil du das Risiko nicht auf dich nehmen konntest, danebenzuzielen und ihn oder die anderen zu verletzen. Und du wärst lieber selbst gestorben, als Jaxon etwas zustoßen zu lassen.«
»Du hast ihn ja gesehen«, sagt Hudson gedehnt und einen Augenblick klingt er wie sein altes Ich. »Der Kleine braucht offensichtlich Schutz. In der Sekunde, in der ich ihm den Rücken zuwende, geht er los und lässt sich das Herz aus der Brust reißen.«
»Ich bin nicht sicher, ob das so abgelaufen ist«, sage ich und schnaube. »Aber ich weiß, du würdest alles tun, um ihn und mich zu beschützen. Ich weiß auch, du würdest alles tun, um die anderen zu schützen. Du hast am Anfang nicht alle aufgelöst, weil du nicht sicher sein konntest, dass du nicht jemanden von uns erwischst. Und nachdem du sicher warst, nachdem du es garantieren konntest, hast du gedroht, es zu tun, und hättest es auch getan. Da bin ich sicher.«
Er starrt wieder auf die Wand über meiner Schulter. »Du verstehst das nicht. Niemand tut das. Es ist nicht so einfach.« Er seufzt. »Ich hasse dieses Ding in mir.«
»Das weiß ich.« Ich lasse meine Hände von seiner Taille gleiten und umschließe sein Gesicht, warte geduldig, bis sein Blick meinem wieder begegnet. »Aber ich weiß auch, wenn Cyrus und die anderen nicht gegangen wären, als du sie gewarnt hast, hättest du sie aufgelöst, und du hättest es für uns getan. Ich habe keinen Zweifel, dass du es getan hättest, wenn es bedeutet hätte, uns zu beschützen.«
Sein Blick hält meinen und er gibt zu: »Um dich zu beschützen, dafür hätte ich alles getan.«
Aber das kaufe ich ihm nicht ab. Hudson liebt mich, das weiß ich, aber ich glaube, er begreift selbst nicht, wie viel er auch für alle anderen geopfert hätte, nicht nur allein für mich. »Um alle zu schützen.«
Er zuckt mit den Schultern, doch ich kann spüren, wie er sich dieses Mal ein winziges bisschen entspannt. Also schlinge ich wieder meine Arme um ihn und halte ihn fester, gebe mein Bestes, ihm zu zeigen, dass ich an ihn glaube, selbst wenn er nicht an sich selbst glaubt.
»So oder so …« Hudson hustet und fügt dann hinzu: »Bevor wir uns Cyrus erneut stellen, muss ich mit Macy darüber sprechen, wie man einen Sinneszauber aushebelt.«
»Einen Sinneszauber?«
»Das muss Cyrus benutzt haben«, fährt er fort. »Cyrus hat die Hexen auf sie alle etwas wirken lassen – da bin ich fast sicher. Weshalb seine Truppen mich nicht einmal bemerkt haben, als ich versuchte, sie vom Rückzug zu überzeugen. Es war, als ob …«
»Sie dich gar nicht hören würden?«, beende ich den Satz.
»Ja.« Angewidert schüttelt er den Kopf – ob wegen sich selbst oder seines Vaters, weiß ich nicht. »Ich hätte damit rechnen sollen, dass er so etwas macht.«
»Weil du allwissend bist?«, frage ich sarkastisch. Ich verstehe, warum er sich selbst die Schuld gibt – er ist Hudson und er lädt sich die Last der ganzen Welt auf die Schultern, ob sie da nun hingehört oder nicht –, aber genug ist genug. »Oder weil du ein Gott bist?«
Seine stürmischen blauen Augen werden ein kleines bisschen schmal vor Ärger. »Weil ich meinen Vater kenne. Ich weiß, wie er denkt. Und ich weiß, er wird vor nichts haltmachen, um zu bekommen, was er will.«
»Das stimmt«, sage ich. »Er wird vor nichts haltmachen. Was heißt, alles, was auf der Insel geschah, lag einzig an ihm und nicht an dir.«
Hudson will widersprechen, bleibt angesichts des scharfen Blicks, den ich ihm zuwerfe, aber stumm. Er weiß, dass ich recht habe, ob ihm das nun passt oder nicht.
Wir bleiben gefühlt eine Ewigkeit so, Blicke ineinander verhakt, Körper aneinandergedrückt, alles, was wir gesehen und getan haben, setzt sich wie nasser Zement zwischen uns. Ich wünschte nur, ich könnte sicher sein, dass es uns verbindet und keine Mauer bildet.
Denn dieser Krieg ist noch lange nicht vorbei. Wir haben noch ein weites Stück Weg vor uns, wenn wir hoffen wollen, die Kinder zu retten, bevor Cyrus sie umbringt, und es gibt keine Garantie, dass es so enden wird, wie wir das möchten.
Keine Garantie, dass irgendwas jemals wieder in Ordnung sein wird.
Weshalb ich tief Luft hole und ihm von der Angst erzähle, die mich plagt, seit wir zurück sind. »Ich glaube nicht, dass die Krone das ist, was wir dachten.«
5
Schrei im Schlaf nach mir
HUDSON SIEHT AUF MEINE HANDFLÄCHE, und ich kann die eine Million unterschiedlichen Gedanken und Szenarien praktisch durch seinen Kopf rasen sehen, während er überlegt, wie er darauf antworten soll. Am Ende sagt er nur: »Nur weil du noch nicht herausgefunden hast, welche Macht sie hat, heißt das nicht, dass sie nicht existiert.«
»Vielleicht nicht«, stimme ich zweifelnd zu. »Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich etwas spüren würde, wenn ich eine neue Fähigkeit hätte.«
»So wie du wusstest, dass du eine Gargoyle bist, bei deiner Ankunft an der Katmere?«, fragt er mit hochgezogener Augenbraue.
Die Frage lässt meinen Magen rumoren, also schiebe ich sie – und jede potenzielle Antwort – so tief in mich, wie ich nur kann. Es ist weit von der besten Lösung entfernt, aber bis die Unzerstörbare Bestie aufwacht und mir ein paar Fragen beantwortet, stecke ich fest. Es bringt nichts, mich die nächsten Stunden wahnsinnig zu machen, wenn ich es vermeiden kann. Besonders nicht, wenn ich wirklich dringend schlafen muss.
»Uns bleibt später Zeit, über die Krone nachzudenken«, sagt Hudson. Er lockert seinen Griff um meine Taille und dreht mich zu seinem großen Bett um, das für meine müden Augen aussieht wie der Himmel. Hudson drückt mir einen Kuss auf den Scheitel. »Warum kriechst du nicht rein?«
Ich bin zu erschöpft, um mehr zu tun, als seiner Anregung Folge zu leisten, also steige ich ins Bett, ziehe die Decke über mich, während er zum Bad geht. Fast sofort schließen sich meine Augen trotz meiner Entschlossenheit, auf Hudson zu warten. Es dauert nur eine Minute, bis ich in einen Nebel sinke und Bilder des Kampfs meinen Kopf in einer gefühlt niemals endenden Montage aus halben Erinnerungen und halben Träumen durchzucken.
Ich winde mich, während Bilder von Lucas Tod sich mit Erinnerungen an die Zeit im Gefängnis vermischen. Blut von Flints Bein bedeckt meine Hände, Remys wirbelnde Augen sagen mir, dass er mich bald wiedersehen wird. Ich drehe mich, will wissen, wo ich bin. Mein Herz rast. Bin ich noch im Gefängnis? Habe ich geträumt, dass wir freikamen, dass wir die Unzerstörbare Bestie gerettet haben – nein, einen Gargoyle, ruft mir mein erschöpfter Geist in Erinnerung.
Besorgt, Grace. So besorgt.
Die Stimme des älteren Gargoyle schneidet in meinen Verstand, rutscht zwischen die Bilder, die immer noch durch mein Hirn zucken. Ich kämpfe mich durch mein Bewusstsein, jede Sekunde zieht mich weiter hinab, als steckte ich in Treibsand fest.
Keine Zeit, keine Zeit. Seine Stimme klingt rasender denn je, durchdringt den Nebel. Und dann, deutlicher, als er je zu mir gesprochen hat, als würde er sich auf jedes Wort konzentrieren: Wach auf, Grace! Uns bleibt fast keine Zeit mehr!
6
Knisper, knasper, nicht ganz knusper
DER BEFEHLSTON IN SEINER STIMME lässt mich blitzartig im Bett hochschießen.
Mein Herz rast, mein Blut rauscht in meinen Ohren und es fühlt sich fast an, als wache ich inmitten einer ausgewachsenen Panikattacke auf. Nur dass mein Hirn klar ist und das Adrenalin, das durch meinen Körper pulsiert, von der Dringlichkeit rührt und nicht von der Angst.
Ich blicke zu Hudson, doch er schläft ausnahmsweise einmal richtig. Seine Atmung geht gleichmäßig, die blassen Prellungen an seiner Wange eine krasse Erinnerung an all das, was er die letzten paar Tage durchgemacht hat. Die meisten Zeichen von seinen Kämpfen im Gefängnis sind schon verblasst, aber er wird mehr als nur Blut brauchen, um die Erschöpfung unter seinen Augen auszuradieren. Ich fahre sanft mit einem zitternden Finger über seine Wange. Seine Lider flattern kurz und ich fürchte, ich habe ihn aufgeweckt. Doch dann rollt er sich mit einem Seufzen herum und fällt wieder in Schlaf.
Zu blöd, dass ich das nicht auch kann.
Ein rascher Blick auf mein Telefon zeigt mir, dass ich tatsächlich ein paar Stunden geschlafen habe – und das heißt, mir bleiben noch eine Handvoll Stunden vor dem Morgen. Ich rolle mich aus dem Bett, als die Sonne gerade über die Spitze des Denali lugt. Es ist noch mitten in der Nacht, aber in Alaska geht die Sonne im Frühling um vier Uhr morgens auf.
Rote und dunkellila Schatten färben den Himmel und die Berge sind durch die Halbfenster von Hudsons Zimmer zu erkennen. Es ist wunderschön, zweifellos, aber etwas Dunkles am Horizont, das aussieht wie ein heraufziehender Sturm, wirkt unheilvoll wie Hölle. Als blute der Himmel auf die Berge, tauche die ganze Welt in Blut und Kummer und Angst.
Vielleicht übertrage aber auch nur ich meine Gefühle auf den Anblick. Es fühlt sich zumindest an, als schwimme meine ganze Welt in Blut.
Ich denke darüber nach, wieder ins Bett zu gehen, noch etwas Schlaf abzubekommen. Aber der Zug ist abgefahren. Und da ich meine dreckigen Sachen nicht wieder anziehen möchte, muss ich in mein Zimmer und mir frische holen, bevor wir losmüssen.
Mein Magen flattert, während ich die Treppe hinaufgehe und durch die ramponierten Hauptflure laufe, mich daran erinnere, wie ich zum ersten Mal durch diese Gänge wanderte, nachdem mein gesamtes Leben sich von jetzt auf gleich verändert hatte und ich nicht schlafen konnte.
Es fühlt sich an, als stünde ich an der Kante eines weiteren Abgrunds, die bei jeder Bewegung weiter unter mir zerbröselt. So viel ist anders seit dieser ersten Nacht – meine Gargoyle, Hudson, Jaxon und sogar die Katmere selbst –, und doch fühlt es sich an, als wäre einiges genau gleich.
Wie zum Beispiel, dass die Chancen gar nicht so gering sind, dass wieder ein paar blutrünstige Wölfe auftauchen und mich in den Schnee werfen wollen.
Ich sage mir, dass ich bescheuert bin – es ist unwahrscheinlich, dass Cyrus die Wölfe auf uns hetzt, nachdem er die Schüler und Schülerinnen schon hat –, aber ich nehme trotzdem zwei Stufen auf einmal hinauf zu meinem Zimmer. Falls der Feind doch angreift, möchte ich wenigstens eine Hose tragen.
Macy schläft tief und fest in unserem Zimmer, also bewege ich mich so leise wie möglich. Ich benutze das Licht meines Telefons und verfluche wieder den Umstand, dass ich trotz meiner Gargoyle nicht wie die Vampire oder Wölfe in der Dunkelheit sehen kann.
Ich leuchte zu Boden – sodass ich gerade genug erkenne, um nicht zu stolpern und aus Versehen auf der schlafenden Macy zu landen – und gehe zu meinem Schrank.
Ich schnappe mir meinen Rucksack und stopfe ein paar Dinge hinein, die ich brauchen werde, wenn ich in Hudsons Zimmer bleibe. Eine Jeans und noch ein T-Shirt, Unterwäsche, meine Kulturtasche, eine Handvoll Haargummis und – große Überraschung – eine Packung Cherry-Pop-Tarts. Wenn ich nichts gelernt habe in den letzten Monaten in Bezug auf unberechenbare Situationen mit nur Vampiren als Begleiter, so doch wenigstens, dass ich immer einen Snack einpacken sollte, wenn ich nicht verhungern möchte.
Nachdem ich alles verstaut habe, werfe ich mir noch einen Hoodie über, dann lasse ich mich auf den Boden sinken und ziehe Socken und meine Lieblingsstiefel an.
Ich stehe wieder auf und lasse den Blick ein letztes Mal durchs Zimmer wandern, um sicherzugehen, dass ich nichts Wichtiges vergesse, dann erinnere ich mich an zwei Dinge, ohne die ich niemals gehen möchte. Ich schleiche zum Schmuckkästchen auf meiner Kommode, hebe den Deckel und nehme den Diamanten, den Hudson mir geschenkt hat, und auch die Halskette von Jaxon. Beide geliebten Gegenstände verstaue ich in die vordere Reißverschlusstasche und auch noch eine Tube mit pinker Lippenpflege, die Macy mir geschenkt hat, dann werfe ich mir den Rucksack über die Schulter und schleiche auf Zehenspitzen zur Tür.
Da regt Macy sich ein wenig und wimmert im Schlaf. Ich erstarre, warte ab, ob sie mich braucht, aber nach ein paar leisen, leidenden Geräuschen verfällt sie wieder in ihr näselndes Schnarchen, an das ich mich in den vergangenen Monaten so gewöhnt habe.
Bei diesem Geräusch sehne ich mich nach meiner Anfangszeit an der Katmere, bevor alles so verrückt wurde und meine größte Sorge noch war, wie laut meine Cousine schnarcht – nämlich sehr. Ich blicke zwischen Macy und meinem Bett hin und her und frage mich, ob ich vielleicht doch noch ein paar Stunden schlafen könnte … immerhin könnte das für wer weiß wie lange die letzte Gelegenheit sein, dass wir eine Nacht vernünftig schlafen können.
Ich mache mir nicht mal die Mühe, die Stiefel auszuziehen – ich rolle mich einfach auf der Decke zusammen, kuschle mich ins Kissen und lasse mich vom Rhythmus von Macys Schnarchen in den Schlaf wiegen.
Keine Zeit!
Eine Stimme in meinem Kopf weckt mich auf. Ich sehe auf mein Telefon – ich habe noch zwei Stunden geschlafen. Macy schnarcht immer noch leise, aber ich weiß, dass das für mich keine Option mehr ist.
Mit Glück schaffe ich es vielleicht zurück in Hudsons Zimmer, ohne ihn aufzuwecken.
Kaum bin ich am Treppenabsatz, ist die Stimme der Bestie wieder in meinem Kopf. Keine Zeit. Keine Zeit. Keine Zeit.
Keine Zeit wofür? Frage ich in meinem Kopf. Geht es dir g …
Ich verstumme, als ich den Gargoyle in Menschengestalt am kaputten Schachtisch am Fuß der Treppe sitzen sehe, eine der wenigen überlebenden Schachfiguren in der Hand.
Ein übelkeiterregendes Déjà-vu überkommt mich, denn die Figur in seiner Hand ist keine andere als die Vampirkönigin.
7
Bitte was?
ICH SPRECHE DAS OFFENSICHTLICHE AUS: »Du bist wieder ein Mensch.«
Er nickt und ich gehe langsam die letzten paar Stufen hinunter. Ich möchte begreifen, was hier los ist, aber ich habe keine Ahnung. Was soll ich zur Unzerstörbaren Bestie sagen, wie soll ich sie behandeln? Er ist ein Gargoyle, der einzige andere lebende Gargoyle auf der Welt, und das heißt, wir sollten ein paar Gemeinsamkeiten haben.
Aber tatsächlich habe ich mich nie weiter von jemandem entfernt gefühlt – was mehr als seltsam ist, bedenkt man, dass ich ihn sogar in meinem Kopf hören kann.
»Geht es dir gut?«, frage ich und setze mich auf den Stuhl auf der anderen Seite des Schachtischs.
»Besorgt. So besorgt«, sagt er laut und ich bin verblüfft, dass ich seine Stimme höre. Ja, er hat auf der Insel mit mir gesprochen, aber ich bin so daran gewöhnt, ihn in meinem Kopf zu hören, dass es einen Augenblick dauert, mich darauf einzustellen.
Ich nicke. »Ja, ich weiß. Ich habe dich gehört, während ich schlief. Und als ich aufwachte.«
»Tut mir leid.« Er wirkt verlegen. »Muss beeilen.«
»Entschuldige dich nicht«, erwidere ich und schüttle den Kopf. »Aber warum müssen wir uns beeilen? Was ist los?«
»Keine Zeit mehr.«
Ich kann nicht sagen, ob er uns meint, sich oder jemand anderen. Ich hoffe wirklich, er meint, dass Cyrus keine Zeit mehr hat, aber ich wage zu bezweifeln, dass ich so viel Glück habe. »Wer hat keine Zeit mehr?«
Er antwortet nicht, beugt sich nur auf seinem Stuhl vor, um die Dringlichkeit seiner Botschaft zu betonen. »Keine Zeit.«