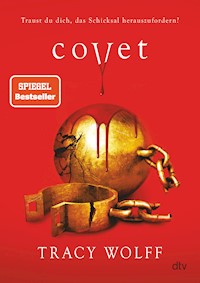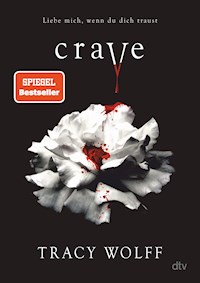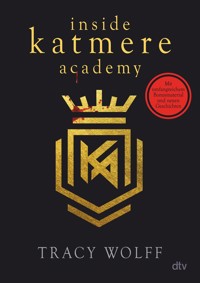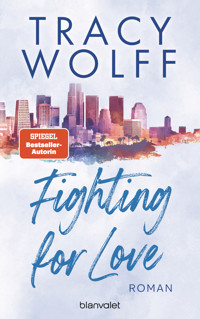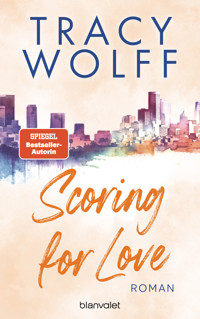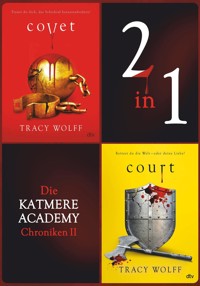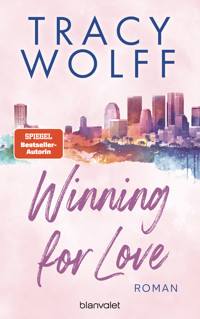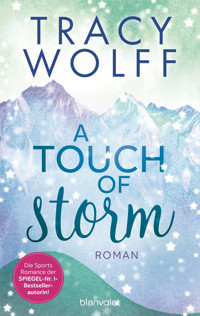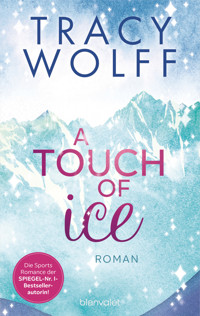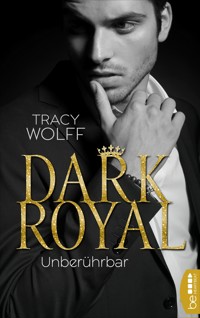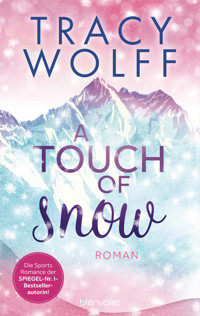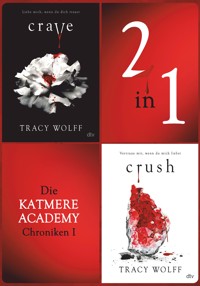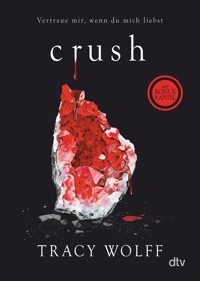
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Katmere Academy Chroniken
- Sprache: Deutsch
Vertraue mir, wenn du mich liebst Als Grace sich in Jaxon Vega verliebte und in seine gefährliche Welt eintauchte, wurde ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt: Jaxon ist der mächtige Sohn der herrschenden Vampirfamilie und auch Grace ist nicht, wer sie ihr ganzes Leben zu sein glaubte. Wenn sie in dieser Welt überleben will, muss Grace ihre neuen Fähigkeiten schnellstens meistern. Doch ihre Liebe zu Jaxon und das Leben ihrer Freunde sind in Gefahr. Beide zu retten, wird ein Opfer verlangen, von dem Grace nicht weiß, ob sie es zu erbringen bereit ist … Alle Bände der Katmere-Academy-Chroniken: Band 1: Crave Band 2: Crush Band 3: Covet Band 4: Court Band 5: Charm Band 6: Cherish Die Spin-off-Reihe: Die Calder-Academy-Chroniken von Tracy Wolff bei dtv: Band 1: Sweet Nightmare Band 2: Sweet Chaos (erscheint im Herbst 2026) Band 3: Sweet Vengeance (erscheint 2027) Die Bände sind nicht unabhängig voneinander lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1028
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
»Manchmal gibt dir das Leben mehr als einen Satz neuer Karten – es gibt dir vielleicht sogar ein ganz neues Spiel.«
Als erste Gargolye in über 1000 Jahren steht Grace mehr denn je im Zentrum der Aufmerksamkeit. Wenn sie nur wüsste, was es bedeutet, die einzige ihrer Art zu sein – oder zumindest die Gedächtnislücken schließen könnte, auf die sie zunehmend stößt. Mit Jaxon und Macy an ihrer Seite sollte Grace endlich in Sicherheit sein, doch spätestens mit dem unangekündigten Besuch des Vampirkönigspaars wird klar, dass genau das Gegenteil der Fall ist
Als immer mehr Geheimnisse rund um Jaxons Bruder ans Licht kommen, muss Grace sich entscheiden, wem sie trauen kann. Eins weiß sie aber ganz sicher: Wenn sie in dieser Welt überleben will, muss Grace ihre neuen Fähigkeiten in den Griff bekommen – und um ihre Liebe und ihre neuen Freunde zu retten, vielleicht ein Opfer bringen, das mehr fordert, als sie geben will …
Der zweite Teil der Bestsellerreihe – noch dramatischer, noch spannender, noch intensiver
Von Tracy Wolff ist bei dtv lieferbar:
Crave (Band 1)
Crush (Band 2)
Covet (Band 3)
Court (Band 4)
Charm (Band 5)
Cherish (Band 6)
Inside Katmere Academy
Sweet Nightmare (Band 1)
Star Bringer (mit Nina Croft)
Tracy Wolff
crush
Band 2
Aus dem amerikanischen Englisch von Michelle Gyo
Für Elizabeth Pelletier und Emily Sylvan Kim
Die beiden tollsten Frauen im Business
Es gibt niemanden, mit dem ich diese Reise lieber unternehmen würde als mit euch
Dieses Buch behandelt Themen, die potenziell belastend wirken können. Bitte dazu die Anmerkung der Autorin beachten.
1Bin so aufgewacht
Der einzige Mensch an einer Schule für Paranormale zu sein, ist in besten Zeiten heikel.
In den schlimmsten Zeiten ist es ein wenig, als wäre man das letzte Kauspielzeug in einem Raum voller tollwütiger Hunde.
Und in normalen Zeiten … na ja, da ist es schon ziemlich cool.
Zu blöd nur, dass heute definitiv kein normaler Tag ist.
Ich weiß nicht, warum, aber alles fühlt sich etwas merkwürdig an, während ich den Flur zu meinem Unterricht in Britischer Literatur entlanglaufe und den Gurt meines Rucksacks wie eine Rettungsleine umklammere.
Vielleicht liegt es daran, dass ich friere, mein ganzer Körper zittert vor Kälte, die mir bis ins Mark gedrungen ist.
Vielleicht liegt es daran, dass die Hand, die meinen Rucksackgurt umklammert, geprellt und wund ist, als hätte ich mich mit einer Mauer angelegt – und den Kampf ganz eindeutig verloren.
Oder vielleicht liegt es auch daran, dass alle, und ich meine alle, mich anstarren – und das nicht auf diese »in den besten Zeiten«-Art.
Andererseits, wann gibt es die auch schon mal?
Man sollte meinen, ich hätte mich mittlerweile an diese Blicke gewöhnt, denn so ist das eben, wenn man mit einem Vampirprinzen zusammen ist. Aber nope. Und es ist definitiv nicht in Ordnung, wenn jeder Vampir, jede Hexe, jeder Drache und Wolf stehen bleibt und dich mit aufgerissenen Augen und noch weiter aufgerissenen Mündern anstarrt – wie heute.
Was keinem so wirklich gut steht. Ich meine, ernsthaft. Sollte nicht ich diejenige sein, die hier total verwundert ist? Sie wussten die ganze Zeit, dass Menschen existieren. Ich habe erst vor etwa einer Woche herausgefunden, dass die Monster unter meinem Bett echt sind. So wie die in meinem Zimmer, in meinem Unterricht … und manchmal in meinen Armen. Sollte da nicht ich mit offenem Mund herumlaufen, während ich sie anstarre?
»Grace?« Ich erkenne die Stimme, drehe mich mit einem Lächeln um und sehe, dass Mekhi mich angafft, und dass sein normalerweise warmbrauner Teint wächserner ist, als ich es je erlebt habe.
»Hey, da bist du ja.« Ich grinse ihn an. »Ich dachte schon, du würdest mich und Hamlet heute im Stich lassen.«
»Hamlet?« Seine Stimme ist rau, und die Hände, die das Telefon aus seiner vorderen Tasche zerren, sind alles andere als ruhig.
»Ja, Hamlet. Das Stück, das wir bei Maclean lesen, seit ich hier bin?« Ich trete von einem Fuß auf den anderen und mir ist plötzlich unbehaglich, weil er mich weiter anstarrt, als hätte er einen Geist gesehen … oder Schlimmeres. Das ist definitiv kein normales Mekhi-Verhalten. »Wir tragen heute eine Szene vor, vergessen?«
»Wir lesen nicht me…« Er bricht mitten im Wort ab und seine Daumen fliegen über das Telefon, dann verschickt er eine Nachricht, die, seiner Miene nach zu urteilen, die wichtigste seines Lebens ist.
»Geht es dir gut?«, frage ich und trete näher. »Du siehst nicht so gut aus.«
»Ich sehe nicht so gut aus?« Er stößt ein harsches Lachen aus, fährt sich mit einer zitternden Hand durch die langen, dunklen Locks. »Grace, du bist …«
»Miss Foster?«
Mekhi verstummt, als eine Stimme, die ich nicht erkenne, durch den Flur hallt.
»Ist alles in Ordnung?«
Ich werfe Mekhi einen »WTF?«-Blick zu, während wir uns beide umdrehen und Mr Badar sehen, den Mondkunde- und Astronomielehrer, der den Gang hinabeilt.
»Mir geht es gut«, antworte ich. »Ich will nur zum Unterricht, bevor es klingelt.« Ich sehe zu ihm auf, als er direkt vor uns anhält. Er sieht mich erschrockener an, als es eine Unterhaltung auf dem Flur am frühen Morgen rechtfertigt. Vor allem, da ich nichts anderes tue, als mit einem Freund zu sprechen.
»Wir müssen zu deinem Onkel«, sagt er und legt eine Hand unter meinen Ellbogen, dreht mich um und führt mich dann in die Richtung, aus der ich gerade gekommen bin.
Etwas klingt in seiner Stimme mit – keine Androhung, aber mehr als eine Aufforderung – das mich dazu bringt, ohne Widerworte durch den langen Gang mit den Lanzettbögen zu laufen. Gut, und dass der normalerweise durch nichts aus der Ruhe zu bringende Mekhi sich beeilt, uns den Weg freizumachen.
Mit jedem Schritt verstärkt sich das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Besonders, als die Leute buchstäblich wie angewurzelt stehen bleiben und uns anstarren, während wir vorbeigehen, was Mr Badar nur noch nervöser zu machen scheint.
»Können Sie mir bitte sagen, was hier los ist?«, frage ich, während die Menge sich vor uns teilt. Es ist nicht das erste Mal, dass ich dieses Phänomen erlebe – ich date immerhin Jaxon Vega –, aber es ist das erste Mal, während mein Freund nicht in der Nähe ist. Das ist megaseltsam.
Mr Badar sieht mich an, als wäre mir ein zweiter Kopf gewachsen. »Das weißt du nicht?« Die Tatsache, dass er etwas außer sich klingt und seine tiefe Stimme einen ungläubigen Tonfall annimmt, lässt meine Nervosität in die Höhe schnellen. Besonders, da es mich an den Ausdruck auf Mekhis Gesicht erinnert, als er vor ein paar Minuten nach seinem Telefon gegriffen hat.
Es ist der gleiche Ausdruck, den ich auf Cams Gesicht sehe, als wir an ihm vorbeirauschen, während er in der Tür zu einem der Chemieräume steht. Und Gwens. Und Flints.
»Grace!«, ruft Flint mir zu und kommt aus dem Klassenzimmer, um neben Mr Badar und mir herzulaufen. »Oh mein Gott, Grace! Du bist zurück!«
»Nicht jetzt, Mr Montgomery«, blafft der Lehrer und bei jedem Wort klicken seine Zähne scharf aufeinander.
Also definitiv Wolf … wenigstens der Größe dieser Eckzähne nach zu urteilen, die ich hinter seiner Lippe hervorspitzen sehe. Dann denke ich, dass ich das wohl anhand des Fachs hätte erraten sollen, das er unterrichtet – wer ist mehr an der Astronomie des Monds interessiert als die Kreaturen, die ihn gelegentlich anheulen?
Zum ersten Mal frage ich mich, ob heute Morgen etwas passiert ist, von dem ich nichts weiß. Sind Jaxon und Cole, der Alphawolf, wieder aneinandergeraten? Oder diesmal Jaxon und ein anderer Wolf – vielleicht Quinn oder Marc? Es ist eigentlich unwahrscheinlich, da zuletzt alle einen großen Bogen um uns gemacht haben, aber warum sonst sollte ein Wolflehrer, den ich so gut wie gar nicht kenne, mich so panisch und zielstrebig zu meinem Onkel bringen wollen?
»Warte, Grace …« Flint streckt die Hand nach mir aus, aber Mr Badar blockt sie ab, bevor sie mich berührt.
»Ich sagte, nicht jetzt, Flint! Geh in den Unterricht!« Die Worte, nichts anderes als ein Knurren, dringen tief aus seiner Kehle.
Flint sieht aus, als würde er etwas erwidern wollen, und seine eigenen Zähne glänzen plötzlich scharf im sanften Kronleuchterlicht des Gangs auf. Er muss wohl entscheiden, dass es das nicht wert ist – trotz seiner geballten Fäuste –, denn am Ende sagt er nichts. Er verharrt nur mitten im Schritt und sieht uns stattdessen nach … so wie alle anderen auch.
Mehrere Leute scheinen zu uns zu wollen – Macys Freundin Gwen zum Beispiel – aber ein leises, warnendes Grollen des Lehrers, der mich jetzt praktisch den Gang hinabschiebt, lässt die ganze Gruppe beschließen, sich von uns fernzuhalten.
»Gleich geschafft, Grace. Wir sind fast da.«
»Fast wo?« Ich möchte eine Antwort einfordern, aber meine Stimme klingt kratzig.
»Im Büro deines Onkels natürlich. Er hat schon lange auf dich gewartet.«
Das ergibt keinen Sinn. Ich habe Onkel Finn doch gestern erst gesehen.
Unbehagen kriecht mir über den Nacken und das Rückgrat hinab, scharf wie ein Rasiermesser, und die Härchen auf meinen Armen kribbeln.
Nichts hiervon fühlt sich okay an.
Nichts hiervon fühlt sich richtig an.
Wir biegen wieder um eine Ecke, diesmal in den mit Wandteppichen behangenen Gang, der vor Onkel Finns Büro verläuft, und jetzt bin ich es, die in die Tasche nach ihrem Telefon greift. Ich möchte mit Jaxon reden. Er wird mir sagen, was hier los ist.
Ich meine, hier kann es nicht nur um Cole gehen, richtig? Oder um Lia. Oder um – ich japse auf, als meine Gedanken gegen etwas prallen, das sich wie eine gewaltige Mauer anfühlt. Eine, aus der riesige Metalldornen herausragen, die sich direkt in meinen Kopf bohren.
Auch wenn die Mauer nicht greifbar ist, tut es erstaunlich weh, mental gegen sie zu rennen. Einen Augenblick erstarre ich einfach, zutiefst erschüttert. Als ich die Überraschung überwunden habe – und den Schmerz –, versuche ich noch angestrengter, an dem Hindernis vorbeizukommen, dehne meinen Geist in der Bemühung, meine Gedanken zu sammeln. Sie zu zwingen, diesen mentalen Pfad zu beschreiten, der plötzlich vor mir versperrt ist.
Da begreife ich – ich kann mich nicht daran erinnern, heute Morgen aufgewacht zu sein. Ich kann mich nicht ans Frühstück erinnern. Oder daran, mich angezogen zu haben. Oder mit Macy geredet zu haben. Ich kann mich an gar nichts erinnern, was heute passiert ist.
»Was zur Hölle ist hier los?«
Ich merke nicht, dass ich die Worte laut ausgesprochen habe, bis der Lehrer antwortet, und zwar ziemlich grimmig. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass Foster gehofft hat, dass du ihm das verraten kannst.«
Das ist nicht die Antwort, die ich suche, also greife ich wieder in die Tasche nach meinem Telefon, entschlossen, mich dieses Mal nicht ablenken zu lassen. Ich will Jaxon.
Nur, dass mein Telefon nicht in der Tasche ist, wo ich es immer aufbewahre, und es ist auch nicht in einer meiner anderen Taschen. Wie ist das möglich? Ich vergesse mein Telefon niemals.
Unbehagen wird zu Angst und Angst zu einer heimtückischen Panik, die mich mit Frage um Frage bombardiert. Ich versuche, ruhig zu bleiben, versuche, den zwei Dutzend Leuten, die mich in genau diesem Moment beobachten, nicht zu zeigen, wie aufgewühlt ich wirklich bin. Es ist aber schwer, cool zu bleiben, wenn ich keine Ahnung habe, was hier los ist.
Mr Badar stupst meinen Ellbogen an, damit ich mich wieder in Bewegung setze, und ich folge ihm wie auf Autopilot.
Wir biegen noch einmal ab und stehen vor der Tür, die ins Vorzimmer von Katmeres Schulleiter führt, auch bekannt als mein Onkel Finn. Ich erwarte, dass Mr Badar anklopft, aber er stößt einfach die Tür auf und schiebt uns ins Vorzimmer des Büros, in dem Onkel Finns Sekretärin an ihrem Schreibtisch sitzt und auf ihrem Laptop vor sich hin tippt.
»Ich bin gleich da«, sagt Mrs Haversham. »Ich brauche nur eine …«
Sie blickt zu uns auf – über den Rand ihres Bildschirms und ihrer lilafarbenen Halbmondbrille – und verstummt mitten im Satz, als ihr Blick meinem begegnet. Abrupt springt sie auf, ihr Stuhl kracht gegen die Wand hinter ihr und sie schreit nach meinem Onkel. »Finn, komm schnell!« Sie tritt hinter ihrem Schreibtisch hervor und wirft die Arme um mich. »Grace, es ist so schön, dich zu sehen! Ich bin so froh, dass du hier bist!«
Ich habe keinen Schimmer, was sie meint, so wie ich keinen Schimmer habe, warum sie mich umarmt. Ich meine, Mrs Haversham ist eine nette Lady, aber ich hatte keine Ahnung, dass unsere Beziehung von formalen Begrüßungen zu spontanen und offensichtlich ekstatischen Umarmungen fortgeschritten ist.
Und doch erwidere ich die Umarmung. Ich tätschle ihr sogar den Rücken – ein wenig vorsichtig, aber es ist ja der Gedanke, der zählt. Auf der Haben-Seite: Ihre weichen weißen Locken riechen nach Honig.
»Es ist auch schön, Sie zu sehen«, erwidere ich und ziehe mich ein wenig zurück, hoffe, dass eine Fünf-Sekunden-Umarmung reicht in dieser ohnehin schon bizarren Situation.
Aber Mrs Haversham ist an einer langfristigen Sache interessiert, ihre Arme sind so fest um mich geschlungen, dass es etwas schwer wird zu atmen. Ganz zu schweigen von peinlich.
»Finn!«, schreit sie wieder und schenkt der Tatsache, dass ihre roten Lippen dabei direkt neben meinem Ohr sind, keine Beachtung. »Finn! Es ist …«
Die Tür zu Onkel Finns Büro fliegt auf. »Gladys, wir haben eine Sprechanlage für …« Auch er verstummt mitten im Satz und seine Augen werden groß, als er mein Gesicht erblickt.
»Hey, Onkel Finn.« Ich lächle ihn an, während Mrs Haversham mich endlich aus ihrem Klammergriff entlässt. »Es tut mir leid, dass ich dich störe.«
Mein Onkel antwortet nicht. Stattdessen starrt er mich einfach weiter an, sein Mund bewegt sich, aber es kommt kein Ton heraus.
Und mein Magen fühlt sich plötzlich an, als wäre er voll gesplittertem Glas.
Ich weiß vielleicht nicht, was ich zum Frühstück hatte, aber eins weiß ich ganz sicher: Irgendwas stimmt hier so überhaupt gar nicht.
2Okay … Was hab ich verpasst?
Ich will meinen Mut zusammennehmen und Onkel Finn fragen, was los ist – er belügt mich normalerweise nicht (wenn er direkt konfrontiert wird zumindest) –, aber bevor ich die Worte aus meiner absurd trockenen Kehle zwingen kann, ruft er: »Grace!«
Und dann rennt er durch das Zimmer, direkt auf mich zu.
»Grace, oh mein Gott! Du bist zurück.«
Zurück? Warum sagen die Leute das die ganze Zeit? Wo genau bin ich denn hingegangen? Und warum sollten sie nicht damit gerechnet haben, dass ich zurückkomme?
Wieder durchsuche ich meine Erinnerungen und wieder knalle ich gegen diese gigantische Mauer. Es tut dieses Mal nicht so weh wie beim ersten Mal – vielleicht weil der Schock verflogen ist –, aber es ist immer noch unangenehm.
Wie Mrs Haversham packt Onkel Finn mich in der gleichen Sekunde, in der er bei mir ankommt, seine Arme schlingen sich in einer festen, ungestümen Umarmung um mich und sein waldiger Duft hüllt mich ein. Es ist tröstlicher, als ich es erwartet habe, und ich merke, wie ich mich ein wenig gegen ihn sinken lasse, während ich herauszufinden versuche, was in aller Welt hier passiert. Und warum ich mich an nichts erinnern kann, das diese Art der Reaktion auslösen könnte bei meinem Onkel … oder bei jeder anderen Person, der ich begegnet bin, wo wir schon mal dabei sind.
Ich bin doch einfach den Flur entlang zum Unterricht gegangen, so wie alle anderen auch.
Schließlich löst Onkel Finn sich von mir, aber nur so weit, dass er mir ins Gesicht sehen kann. »Grace. Ich kann nicht glauben, dass du wirklich zu uns zurückgekommen bist. Wir haben dich so sehr vermisst.«
»Mich vermisst?«, wiederhole ich, entschlossen, Antworten zu bekommen, und trete ein paar Schritte zurück. »Was heißt das? Und warum benehmen sich alle, als hätten sie einen Geist gesehen?«
Eine Sekunde lang, nur einen Bruchteil, sehe ich das Aufblitzen meiner eigenen Panik in dem Blick, den Onkel Finn dem Lehrer zuwirft, der mich hergebracht hat. Aber dann glättet sich sein Gesicht wieder und seine Augen werden leer (was so gar nicht beängstigend ist), und er legt einen Arm um meine Schultern. »Lass uns in mein Büro gehen und darüber reden, ja, Grace?«
Er wirft noch mal einen Blick zu Mr Badar zurück. »Danke, Raj. Ich weiß es zu schätzen, dass du Grace zu mir gebracht hast.«
Mr Badar nickt in stummer Bestätigung, sein Blick wird kurz schmal, als er mich ansieht, dann geht er hinaus.
Onkel Finn schiebt mich sanft auf seine Bürotür zu – was soll das heute eigentlich, dass alle mich rumschieben? – und redet dabei die ganze Zeit mit Mrs Haversham. »Kannst du Jaxon Vega benachrichtigen und ihn bitten, so schnell es geht herzukommen? Und sieh nach, wann meine Tochter mit den …« – er blickt zu mir, dann zu seiner Sekretärin – »Tests fertig ist, bitte.«
Mrs Haversham nickt, und die Tür, durch die Mr Badar hinausgegangen ist, fliegt so schwungvoll und schnell auf, dass der Türknauf tatsächlich gegen die Steinwand dahinter knallt.
Meine Nervenenden stehen sofort auf Alarm, und jedes Haar, das ich habe, richtet sich plötzlich auf. Denn sogar ohne mich umzudrehen, weiß jede Zelle in meinem Körper genau, wer gerade ins Büro meines Onkels gekommen ist.
Jaxon.
Ein rascher Blick über meine Schulter auf sein Gesicht verrät mir alles, was ich wissen muss. Einschließlich der Tatsache, dass er einen Riesenaufstand machen wird. Und zwar nicht von der guten Sorte.
»Grace.« Seine Stimme ist gedämpft, aber der Boden unter meinen Füßen grollt, als sich unsere Blicke begegnen.
»Es ist okay, Jaxon. Mir geht es gut«, versichere ich ihm, aber das scheint nichts zu bewirken. In kaum einer Sekunde durchquert er das Zimmer, zieht mich aus Onkel Finns widerstandslosem Griff und in seine muskulösen Arme.
Es ist das Letzte, womit ich gerechnet habe – Intimitäten vor meinem Onkel – aber in dem Augenblick, in dem sich unsere Körper berühren, kann ich mich nicht dazu bringen, dass es mir peinlich ist. Nicht, wenn all meine Anspannung bei der ersten Berührung seiner Haut an meiner schmilzt. Und nicht, wenn es sich anfühlt, als könnte ich zum ersten Mal wieder atmen, seit Mekhi im Flur meinen Namen gerufen hat. Und vielleicht sogar noch sehr viel länger.
Das hier habe ich vermisst, begreife ich, als ich mich tiefer in seine Umarmung kuschle. Das hier hat mir gefehlt, ohne zu wissen, dass es so war, bis zu dem Augenblick, in dem sich seine Arme um mich schlossen.
Jaxon muss das genauso empfinden, denn er drückt mich noch fester an sich und stößt dabei einen langen, langsamen Atemzug aus. Er zittert, vibriert förmlich, und obwohl der Boden aufgehört hat, zu beben, kann ich spüren, dass er immer noch nicht ganz ruhig ist.
Ich drücke Jaxon fester. »Mir geht es gut«, versichere ich ihm wieder, auch wenn ich nicht verstehe, was ihn so aufgeregt hat. Oder warum Onkel Finn so geschockt ist, mich zu sehen. Aber die Verwirrung macht meiner kaum im Zaum gehaltenen Panik jetzt verdammt schnell Platz.
»Ich verstehe es nicht«, murmle ich und beuge mich etwas zurück, um Jaxon in die Augen zu blicken. »Was ist los?«
»Alles wird gut.« Die Worte sind knapp, und sein Blick – dunkel, intensiv, vernichtend – lässt meinen nicht los.
Es ist viel, besonders in Kombination mit allem anderen, was an diesem Morgen geschehen ist, und plötzlich ist es zu viel. Ich sehe weg, nur um wieder zu Atem zu kommen, aber das fühlt sich auch nicht richtig an, deshalb vergrabe ich am Ende mein Gesicht wieder an seiner festen Brust und atme einfach ihn ein.
Sein Herz schlägt hart und schnell – zu schnell – unter meiner Wange, aber er fühlt sich trotzdem an wie zu Hause. Riecht immer noch wie zu Hause, nach Orangen und dunklem Eiswasser. Vertraut. Sexy.
Mein.
Ich seufze wieder, vergrabe mich tiefer. Ich habe das hier vermisst und ich weiß nicht einmal, warum. Wir waren praktisch unzertrennlich, seit ich vor ein paar Tagen von der Krankenstation kam.
Seit er mir gesagt hat, dass er mich liebt.
»Grace.« Er atmet meinen Namen, als wäre er ein Gebet, gibt unbewusst meine eigenen Gedanken wieder. »Meine Grace.«
»Dein«, stimme ich flüsternd zu und ich hoffe wirklich, dass Onkel Finn nichts hört und schlinge die Arme fester um Jaxons Taille.
Und einfach so erwacht etwas in mir zum Leben – heftig und mächtig und alles verschlingend. Es durchzuckt mich wie eine Explosion, erschüttert mich bis in die Tiefen meiner Seele.
Stopp!
Nicht!
Nicht mit ihm.
3Dornröschen ist nichts gegen mich
Ohne nachzudenken, schubse ich Jaxon weg und stolpere ein paar Schritte zurück.
Tief in seiner Kehle ertönt ein Geräusch, aber er versucht nicht, mich aufzuhalten. Stattdessen sieht er mich einfach nur an, so schockiert und zittrig, wie ich mich fühle.
»Was war das?«, flüstere ich.
»Was war was?«, antwortet er und beobachtet mich aufmerksam. Da begreife ich, dass er es nicht gehört hat, es nicht gefühlt hat.
»Ich weiß nicht. Es tut mir leid.« Die Worte kommen unwillkürlich heraus. »Ich wollte nicht …«
Er schüttelt den Kopf, während er auch einen entschiedenen Schritt zurück macht. »Mach dir darüber keine Sorgen, Grace. Ist in Ordnung. Du hast viel durchgemacht.«
Er meint das, was mit Lia passiert ist, sage ich mir. Aber er hat dabei auch viel durchgemacht. Und man sieht es, begreife ich, als ich ihn mustere. Er ist dünner, als ich ihn jemals gesehen habe, sodass seine unfassbar schönen Wangenknochen und der glasklare Kiefer sogar noch definierter wirken als sonst schon. Sein dunkles Haar ist etwas länger, ein wenig zerzauster, als ich es gewohnt bin, sodass seine Narbe kaum sichtbar ist, und die purpurnen Ringe unter seinen Augen sind so dunkel, dass sie wie blaue Flecke aussehen.
Er ist immer noch wunderschön, aber jetzt ist diese Schönheit wie eine offene Wunde. Eine, die mich Schmerz empfinden lässt.
Je länger ich ihn ansehe, desto tiefer packt mich die Panik. Denn das sind keine Veränderungen, die über Nacht passieren. Haare wachsen nicht in ein oder zwei Tagen und man verliert auch normalerweise nicht so schnell an Gewicht. Etwas ist passiert, etwas Großes, und aus irgendeinem Grund kann ich mich nicht daran erinnern, was es ist.
»Was passiert hier, Jaxon?« Als er nicht schnell genug antwortet, drehe ich mich zu meinem Onkel um und plötzlich brennt Wut unter meiner Haut. Mir ist schlecht und ich bin es leid, dass man mich immer im Dunkeln lässt.
»Sag es mir, Onkel Finn. Ich weiß, dass etwas nicht stimmt. Ich kann es fühlen. Außerdem ist mein Gedächtnis total schwammig und …«
»Dein Gedächtnis ist schwammig?«, wiederholt Onkel Finn und tritt zum ersten Mal, seit Jaxon im Zimmer ist, näher zu mir heran. »Was genau heißt das?«
»Das heißt, dass ich mich nicht daran erinnern kann, was ich heute Morgen zum Frühstück hatte. Oder worüber Macy und ich gestern Abend geredet haben, bevor wir ins Bett gegangen sind.«
Wieder tauschen Jaxon und Onkel Finn einen langen Blick.
»Macht das nicht«, sage ich. »Schließt mich nicht aus.«
»Wir schließen dich nicht aus«, versichert Onkel Finn mir und hebt besänftigend die Hand. »Wir versuchen nur auch, alles zu verstehen. Warum gehen wir nicht in mein Büro und unterhalten uns dort einen Moment?« Er wendet sich an Mrs Haversham. »Kannst du bitte Marise anrufen? Sag ihr, dass Grace hier ist, und bitte sie, so bald wie möglich herzukommen.«
Sie nickt. »Natürlich. Ich sage ihr, dass es dringend ist.«
»Warum brauchen wir Marise?« Mein Magen ballt sich zusammen bei dem Gedanken daran, wieder von Katmeres praktizierender Krankenschwester untersucht zu werden – die zufällig auch eine Vampirin ist. Die letzten beiden Male habe ich danach länger im Bett liegen müssen, als ich wollte. »Ich fühl mich nicht schlecht.«
Allerdings mache ich den Fehler, zum zweiten Mal heute auf meine Hände hinabzublicken, und endlich kommt bei mir an, wie zerschrammt und blutig sie sind.
»Du siehst etwas mitgenommen aus«, sagt mein Onkel mit ganz bewusst besänftigender Stimme, als wir sein Büro betreten und er die Tür hinter uns schließt. »Ich will dich nur durchchecken lassen, sichergehen, dass alles in Ordnung ist.«
Ich habe eine Million Fragen, und ich bin entschlossen, Antworten auf alle zu bekommen. Aber als ich auf einem der Stühle vor Onkel Finns massivem Kirschholzschreibtisch sitze, und er auf der Ecke von ebendiesem sitzt, beginnt er selbst, Fragen zu stellen.
»Ich weiß, dass es sich vermutlich merkwürdig anhört, aber kannst du mir sagen, welchen Monat wir haben, Grace?«
»Welcher Monat?« Mein Magen sackt ab wie ein Stein. Das nächste Wort bekomme ich kaum raus, weil sich meine Kehle zusammenzieht. »November.«
Als Jaxons und Onkel Finns Blicke aufeinanderprallen, weiß ich, dass mit meiner Antwort etwas wirklich nicht stimmt.
Sorge schliddert mein Rückgrat hinab und ich hole tief Luft, aber es fühlt sich an, als würde ein Gewicht auf meiner Brust lasten, das mir das Atmen unmöglich macht. Das Pochen in meinen Schläfen verschlimmert das Gefühl, aber ich weigere mich, den Anfängen dessen nachzugeben, was zu einer ausgewachsenen Panikattacke werden könnte.
Stattdessen umklammere ich die Stuhlkanten, um mich zu verankern. Dann nehme ich mir eine Minute, um mehrere Dinge im Zimmer im Kopf aufzuzählen, so wie Heathers Mom es mir beigebracht hat, nachdem meine Eltern gestorben sind.
Schreibtisch. Uhr. Pflanze. Stab. Laptop. Buch. Stift. Ordner. Noch ein Buch. Lineal.
Als ich das Ende dieser Liste erreiche, ist mein Herzschlag fast wieder normal und meine Atmung auch. Und die absolute Gewissheit, dass etwas sehr Schlimmes passiert ist.
»Welchen Monat haben wir?«, frage ich leise und wende mich an Jaxon. Er war vom ersten Tag an, den ich hier auf der Katmere Academy war, so geradeheraus wie es nur ging, und genau das brauche ich jetzt. »Ich komme klar mit dem, was hier vor sich geht, was immer das auch ist. Ich muss nur die Wahrheit wissen.« Ich greife nach seiner Hand, halte sie mit meinen beiden fest. »Bitte, Jaxon, sag mir einfach, was ich hier verpasse.«
Jaxon nickt zögerlich. Dann flüstert er: »Du warst fast vier Monate lang weg.«
»Fast vier Monate?« Erneut durchzuckt mich der Schock. »Fast vier Monate? Das ist unmöglich!«
»Ich weiß, dass es sich nicht so anfühlt«, versucht Onkel Finn, mich zu beschwichtigen. »Aber es ist März, Grace.«
»März«, wiederhole ich, weil Wiederholungen anscheinend alles sind, was ich gerade noch hinbekomme. »Der wievielte März?«
»Der fünfte.« Jaxons Stimme ist grimmig.
»Der fünfte März.« Panik ist abgehakt, jetzt durchzuckt mich ausgewachsenes Entsetzen und prügelt auf meine Eingeweide ein. Sorgt dafür, dass ich mich wund und entblößt und leer fühle auf eine Art, die ich nicht beschreiben kann. Monate meines Lebens – meines Abschlussjahrs – sind verschwunden und ich kann mich an keinen davon erinnern. »Ich verstehe das nicht. Wie konnte ich …«
»Es ist okay, Grace.« Jaxons Blick ist ruhig, sein Griff um meine Hände so fest und stützend, wie ich es mir nur wünschen kann. »Wir finden das raus.«
»Wie kann es okay sein? Ich habe ganze Monate verloren, Jaxon!« Meine Stimme bricht, als ich seinen Namen sage, und ich hole schaudernd Luft und setze neu an. »Was ist passiert?«
Mein Onkel greift hinüber und drückt meine Schulter. »Hol noch mal tief Luft, Grace. Gut.« Er lächelt aufmunternd. »Okay, und jetzt noch mal und dann langsam wieder ausatmen.«
Ich tue, was er sagt, bemerke, dass sich seine Lippen die ganze Zeit bewegen, während ich ausatme. Ein Beruhigungszauber?, frage ich mich, als ich noch einmal einatme und ausatme und dabei bis zehn zähle.
Falls es einer ist, scheint er nicht allzu gut zu funktionieren.
»Und wenn du bereit bist, erzähl mir von der letzten Sache, an die du dich erinnerst.« Sein warmer Blick hält meinen fest.
Das Letzte, an das ich mich erinnere.
Das Letzte, an das ich mich erinnere …
Das sollte eine einfache Frage sein, aber das ist sie nicht. Zum Teil wegen der gähnenden Schwärze in meinem Kopf und zum Teil, weil sich so viel von dem, an das ich mich erinnere, trüb und unerreichbar anfühlt. Als würden meine Erinnerungen tief unter Wasser herumschwimmen und ich könnte nur den Schatten dessen erkennen, was da ist. Der Schatten dessen, was da war.
»Ich erinnere mich an alles, was mit Lia passiert ist«, sage ich endlich, weil es stimmt. »Ich erinnere mich daran, auf der Krankenstation gewesen zu sein. Ich erinnere mich daran … einen Schneemann zu bauen.«
Die Erinnerung wärmt mich und ich lächle Jaxon an, der zurücklächelt – wenigstens mit dem Mund. Seine Augen blicken so ernsthaft besorgt wie zuvor.
»Ich erinnere mich daran, dass Flint sich entschuldigt hat, weil er mich umbringen wollte. Ich erinnere mich daran …« Ich verstumme, drücke die Hand an meine plötzlich heiße Wange, als ich mich an das Gefühl von Fangzähnen erinnere, die über die empfindliche Haut an meinem Hals und meinen Schultern streichen, bevor sie hineinsinken. »Jaxon. Ich erinnere mich an Jaxon.«
Mein Onkel räuspert sich, sieht selbst mehr als nur ein wenig verlegen aus. »Noch was?«
»Ich weiß es nicht. Es ist alles irgendwie so …« Ich breche ab, als eine kristallklare Erinnerung durch mein Gehirn wischt. Ich wende mich an Jaxon, damit er sie bestätigt. »Wir sind den Flur runtergegangen. Du hast mir einen Witz erzählt. Den mit dem …« Die Klarheit verschwindet, wird von der Unschärfe ersetzt, die gerade so viele meiner Erinnerungen einhüllt. Ich kämpfe mich hindurch, entschlossen, diesen einen klaren Gedanken festzuhalten. »Nein, das stimmt nicht. Ich habe dich nach der Pointe gefragt. Von dem Piratenwitz.«
Ich erstarre, als ein weiterer, sehr viel gruseligerer Teil meiner Erinnerung klar wird.
»Oh mein Gott. Hudson! Lia hat es geschafft. Sie hat ihn zurückgebracht. Er war hier. Er war wirklich hier.«
Ich sehe zwischen Jaxon und Onkel Finn hin und her, suche nach der Bestätigung, während meine Erinnerung mich überflutet. Mich hinabzieht. »Lebt er?«, frage ich und meine Stimme zittert unter dem Gewicht von allem, was Jaxon mir über seinen Bruder erzählt hat. »Ist er hier?«
Onkel Finn sieht grimmig drein, als er antwortet. »Das ist genau das, was wir dich fragen wollten.«
4Stellt sich raus, dass The Sixth Sense eigentlich Menschenopfer sind
»Ich? Warum sollte ich das beantworten können?« Nur dass mich eine weitere Erinnerung trifft, als ich diese Frage stelle. Ich sehe Jaxon an, der mittlerweile aussieht, als hätte ihn das Grauen vollkommen gepackt. »Ich habe mich zwischen euch gestellt.«
»Ja.« Seine Kehle bewegt sich krampfhaft und seine Augen, die normalerweise die Farbe einer sternenlosen Nacht haben, sind irgendwie noch schwärzer und schattiger als sonst.
»Er hatte ein Messer.«
»Tatsächlich war es ein Schwert«, wirft mein Onkel ein.
»Das stimmt.« Ich schließe die Augen und alles kommt zurück.
Wie ich den überfüllten Gang entlanggehe.
Wie ich plötzlich Hudson sehe, mit erhobenem Schwert, aus dem Augenwinkel.
Wie ich zwischen ihn und Jaxon trete, denn Jaxon ist mein – mein zu lieben und mein zu beschützen.
Das Schwert, das herabfährt.
Und dann … nichts. Das ist es. Das ist alles, an was ich mich erinnere.
»Oh mein Gott.« Das Grauen schlägt über mir zusammen, weil mir etwas Neues und Schreckliches einfällt. »Oh mein Gott.«
»Es ist okay, Grace.« Mein Onkel tätschelt mir wieder die Schulter, aber ich bewege mich bereits.
»Oh mein GOTT!« Ich stoße den Sessel zurück, springe auf. »Bin ich tot? Kann ich mich deshalb an nichts sonst erinnern? Starren mich deshalb alle an? Das ist es, oder? Ich bin tot.«
Ich beginne, hin und her zu laufen, weil mein Gehirn in etwa zwanzig Richtungen gleichzeitig ausflippt. »Aber ich bin immer noch hier. Und Leute können mich offenbar sehen. Heißt das, ich bin ein Geist?«
Ich mühe mich ab, diesen Gedanken in den Kopf zu bekommen, da fällt mir etwas anderes – etwas Schlimmeres – ein.
Ich wirble zu Jaxon herum. »Sag mir, dass ich ein Geist bin. Sag mir, dass du mit mir nicht das gemacht hast, was Lia gemacht hat. Sag mir, dass du nicht irgendeinen armen Menschen da unten in diesem schrecklichen, ekligen Kerker eingesperrt und benutzt hast, um mich zurückzubringen. Sag mir, dass du das nicht gemacht hast, Jaxon. Sag mir, dass ich nicht hier herumlaufe wegen eines Menschenopferrituals, das …«
»Whoa, whoa, whoa!« Jaxon stürzt um meinen Sessel herum und packt mich an den Schultern. »Grace …«
»Ich mein’s ernst. Du hast besser keinen auf Dr. Frankenstein gemacht, um mich zurückzubringen.« Ich flippe total aus, und ich weiß es, aber ich kann anscheinend nicht aufhören, während Schrecken und Entsetzen und Ekel in mir herumwüten und sich zu einer dunklen und giftigen Masse vereinen, über die ich keine Kontrolle habe. »Es gab hoffentlich kein Blut. Oder Gesänge. Oder …«
Er schüttelt den Kopf, sein längeres Haar streicht ihm über die Schultern. »So was habe ich nicht gemacht!«
»Also bin ich ein Geist?« Ich hebe die Hände, starre auf das frische Blut auf meinen Fingerspitzen. »Aber wie kann ich bluten, wenn ich tot bin? Wie kann ich …«
Jaxon packt sanft meine Schultern, damit ich ihn ansehe. »Du bist kein Geist, Grace. Du warst nicht tot. Und ich habe definitiv kein Opfer dargebracht – menschlich oder sonst eins – um dich zurückzubringen.«
Es dauert eine Sekunde, aber dann dringen seine Worte und der ernste Ton, mit dem er sie sagt, zu mir durch. »Hast du nicht?«
»Nein, habe ich nicht.« Er schmunzelt ein wenig. »Ich sage nicht, dass ich es nicht tun würde. Diese letzten Monate haben mir tonnenweise Sympathie für Lia beschert. Aber das musste ich nicht tun.«
Ich wäge seine Worte aufmerksam ab, suche nach Schlupflöchern, während ich sie mit der plötzlich so kristallklaren Erinnerung an das Schwert, das meinen Hals trifft, vergleiche. »Musstest du nicht, weil es eine andere Möglichkeit gibt, jemanden von den Toten zurückzubringen? Oder weil …?«
»Weil du nicht tot warst, Grace. Du bist nicht gestorben, als Hudson dich mit dem Schwert getroffen hat.«
»Oh.« Von allem, gegen das ich mich gewappnet habe, hat es das nicht mal unter die Top Zehn geschafft. Vielleicht nicht mal unter die Top Zwanzig. Aber jetzt, da ich mich mit dieser sehr logischen, wenn auch sehr unwahrscheinlichen Antwort konfrontiert sehe, habe ich keine Ahnung, was ich als Nächstes sagen soll. Bis auf: »Also … Koma?«
»Nein, Grace.« Diesmal antwortet mein Onkel. »Kein Koma.«
»Was geht dann hier vor sich? Ich hab vielleicht riesige Löcher in meinen Erinnerungen, aber das Letzte, an das ich mich erinnere, ist dein psychopathischer Bruder, der versucht, dich umzubringen, und …«
»Du bist dazwischengetreten, um den Schlag abzufangen.« Jaxon knurrt, und nicht zum ersten Mal bemerke ich, wie nah seine Emotionen unter der Oberfläche liegen. Ich hatte bis gerade eben nur nicht gemerkt, dass eine dieser Emotionen Wut ist. Was ich verstehe, aber …
»Du hättest dasselbe getan«, sage ich leise zu ihm. »Leugne es nicht.«
»Ich leugne es nicht. Aber es ist okay, wenn ich das mache. Ich bin der …«
»Mann?« Ich unterbreche ihn mit einem Tonfall, der ihn warnt, jetzt ganz vorsichtig zu sein.
Aber er verdreht nur die Augen. »Vampir. Ich bin der Vampir.«
»Und deshalb was? Willst du damit sagen, dieses Schwert hätte dich nicht wirklich töten können? Denn von da, wo ich stand, sah es für mich aus, als würde Hudson dich wirklich gern umbringen.«
»Es hätte mich töten können.« Es ist ein widerwilliges Eingeständnis.
»Das dachte ich mir. Wie sieht dein Argument dann aus? Oh, richtig: Du bist der Mann.« Ich lasse meine Stimme beim letzten Wort vor Geringschätzung triefen. Aber es hält nicht lange an, weil der Adrenalinrausch der letzten paar Minuten endlich abflaut. »Wo war ich dann während dieser Zeit?«
»Drei Monate, dreizehn Tage und ungefähr drei Stunden, wenn du es genau wissen willst«, sagt Jaxon, und obwohl seine Stimme ruhig und sein Gesicht ausdruckslos ist, kann ich die Qual in den Worten hören. Ich kann alles hören, was er nicht sagt, und es bereitet mir Schmerzen. Wegen ihm. Wegen mir. Wegen uns.
Mit geballten Fäusten, angespanntem Kiefer, die Narbe an seiner Wange straff gespannt – sieht er aus, als würde er Streit suchen, wenn er nur wüsste, wem oder was er die Schuld geben sollte.
Ich streiche tröstend mit der Hand über seine Schultern, dann wende ich mich an meinen Onkel. Denn wenn ich gerade fast vier Monate meines Lebens verloren habe, möchte ich wissen, warum. Und wie.
Und ob das wieder passieren wird.
5Gargoyles sind das neue Schwarz
»Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, wie ich mich gegen den Schlag von Hudsons Schwert wappne.« Ich blicke von meinem Onkel zu Jaxon, die beide die Kiefer fest aufeinanderpressen, als wollten sie nicht diejenigen sein, die mir etwas verraten. »Was ist dann passiert? Hat er mich erwischt?«
»Nicht direkt«, sagt mein Onkel. »Ich meine, das Schwert hat getroffen, also ja. Aber es hat dich nicht verletzt, weil du dich schon in Stein verwandelt hattest.«
Ich spiele seine Worte wieder und wieder in meinem Kopf ab, aber egal wie viele Male und auf wie viele Arten ich es wiederhole, ergeben sie immer noch absolut gar keinen Sinn. »Tut mir leid. Hast du gerade gesagt, ich habe mich in …«
»Stein. Du hast dich in Stein verwandelt, Grace, verdammt noch mal direkt vor meiner Nase«, sagt Jaxon. »Und du warst jeden einzelnen der letzten einhundertfünf Tage Stein.«
»Was genau meinst du mit ›Stein‹?«, frage ich wieder und versuche immer noch, etwas in den Kopf zu bekommen, was unmöglich klingt.
»Ich meine, dein ganzer Körper war aus Stein«, antwortet mein Onkel geduldig.
»Wie in ›ich hab mich in eine Statue verwandelt‹? So eine Art Stein?«
»Keine Statue«, versichert Onkel Finn mir schnell, obwohl er mich vorsichtig mustert, als würde er zu entscheiden versuchen, wie viel mehr Informationen ich noch verkrafte. Was ein Teil von mir verstehen kann, auch wenn es mich höllisch wütend macht.
»Bitte, erzählt es mir einfach«, sage ich schließlich. »Glaubt mir, es ist schlimmer, in meinem Kopf festzusitzen und das zu begreifen zu versuchen, als es einfach zu wissen. Wenn ich also keine Statue war, dann war ich … was?« Ich fische in meinem Kopf herum nach Ideen, nach überhaupt irgendwelchen Ideen, aber da ist nichts.
Und immer noch zögert mein Onkel, was mich glauben lässt, dass die Antwort, wie auch immer sie aussieht, wirklich, wirklich schlimm ist.
»Eine Gargoyle, Grace.« Jaxon ist derjenige, der mir endlich die Wahrheit sagt, so wie immer. »Du bist eine Gargoyle.«
»Eine Gargoyle?« Ich kann den Unglauben nicht aus meiner Stimme bannen.
Mein Onkel wirft Jaxon einen frustrierten Blick zu, aber schließlich nickt er zögerlich. »Eine Gargoyle.«
»Eine Gargoyle?« Das kann nicht ihr Ernst sein. Das kann absolut und wirklich nicht ihr Ernst sein. »So wie bei alten Kirchen?«
»Genau.« Jaxon grinst jetzt – nur ein bisschen, als würde er selbst bemerken, wie lächerlich das klingt. »Du bist eine Gar…«
Ich hebe eine Hand. »Bitte, sag es nicht noch mal. Die ersten drei Male waren schwer genug. Schweig einfach kurz.«
Ich drehe mich um und gehe zur hinteren Wand von Onkel Finns Büro. »Ich brauch eine Minute«, sage ich zu den beiden. »Nur eine Minute, um …« Es aufzunehmen? Es zu leugnen? Zu weinen? Zu schreien?
Schreien klingt ziemlich gut, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es Jaxon und Onkel Finn nur noch mehr erschrecken würde, also …
Ich atme. Ich muss nur atmen. Denn ich habe keine Ahnung, was ich als Nächstes sagen oder tun soll.
Ich meine, da ist eine Seite von mir, die ihnen auf den Kopf zusagen will, dass ich ihren Witz durchschaue – so witzig, haha – aber ein anderer, größerer Teil von mir weiß, dass sie nicht lügen. Nicht hierbei. Zum Teil, weil weder mein Onkel noch Jaxon mir so was antun würden, und zum Teil, weil da etwas tief in mir ist, etwas Kleines und Verängstigtes und fest Zusammengerolltes, das sich einfach … in dem Augenblick entspannte, in dem sie das Wort sagten. Als hätte es das die ganze Zeit gewusst und nur darauf gewartet, dass ich es bemerke.
Dass ich es verstehe.
Dass ich es glaube.
Gut. Gargoyle. Okay. Das ist nicht zu schlimm, richtig? Ich meine, es könnte schlimmer sein. Ich schaudere. Das Schwert hätte mir den Kopf abschlagen können.
Ich hole tief Luft, lehne die Stirn an die kühle graue Bürowand und schließe für einen Moment die Augen, während ich herauszufinden versuche, wie ich mich deshalb fühlen soll.
Gargoyle. Wie in »gewaltige Steinfigur mit Flügeln und gebleckten Zähnen und … Hörnern«? Verstohlen fahre ich mir mit einer Hand über den Kopf, nur um zu sehen, ob mir irgendwie Hörner gewachsen sind und ich davon nichts bemerkt habe.
Aber nein. Ich spüre nur meine normalen lockigen braunen Haare. Genauso lang, genauso widerspenstig, so nervig wie immer, aber definitiv keine Hörner. Oder Reißzähne, bemerke ich, als ich mit der Zunge über meine vorderen Zähne streiche. Tatsächlich fühlt sich alles an mir ganz genauso an wie immer. Gott sei Dank.
»Hey.« Jaxon tritt hinter mich und jetzt legt er mir sanft die Hand auf den Rücken. »Du weißt, dass alles gut wird, richtig?«
Sicher. Natürlich. Absolut und gar keine große Sache. Ich meine, Gargoyles sind voll im Trend, richtig? Irgendwie glaube ich nicht, dass sie meinen Sarkasmus zu schätzen wüssten, also verbeiße ich ihn mir schließlich und nicke einfach.
»Ich meine es ernst«, fährt er fort. »Wir bekommen das hier hin. Und außerdem, Gargoyles sind total super.«
Absolut. Gewaltige, dräuende Steinbrocken. Total super. Nicht.
»Ich weiß«, flüstere ich.
»Bist du dir da sicher?« Er rückt näher, duckt sich ein wenig, sodass sein Gesicht sehr dicht an der Seite von meinem ist. »Weil du nicht so aussiehst, als wüsstest du es. Und du klingst definitiv nicht so.«
Er ist so nah, dass ich seinen Atem an meiner Wange spüren kann, und ein paar kostbare Sekunden lang schließe ich die Augen und tue so, als wäre es vor vier Monaten, als Jaxon und ich allein in seinem Zimmer waren, Pläne schmiedeten und herummachten und dachten, dass wir endlich alles unter Kontrolle hätten.
Was für ein Witz das war. Ich hatte niemals weniger das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben, sogar verglichen mit den ersten paar Tagen, nachdem meine Eltern gestorben sind. Da war ich wenigstens noch menschlich … oder zumindest dachte ich das. Jetzt bin ich eine Gargoyle, und ich habe keine Ahnung, was das überhaupt heißt, ganz zu schweigen davon, wie es passiert ist. Oder wie ich es geschafft habe, fast vier Monate meines Lebens in Stein eingeschlossen zu verlieren.
Warum sollte ich das überhaupt tun? Ich meine, ich verstehe, warum ich mich in Stein verwandelt habe – ich nehme an, ein latenter Impuls tief in mir kam zum Vorschein in der Bemühung, meinen Tod zu verhindern. Ist es wirklich so weit hergeholt, vor allem wenn man bedenkt, dass ich erst vor Kurzem erfahren habe, dass mein Dad ein Hexer war? Aber warum bin ich dann so lange Stein geblieben? Warum bin ich nicht bei der ersten sich mir bietenden Gelegenheit zu Jaxon zurückgekehrt?
Ich durchforste fieberhaft mein Gehirn, suche nach einer Antwort, aber da ist immer noch nichts außer einem nichtssagenden und leeren Abgrund, wo meine Erinnerungen sein sollten.
Jetzt ist es an mir, die Fäuste zu ballen, und dabei beginnen meine angeschlagenen Finger zu pochen. Ich blicke auf sie hinab und frage mich, wie ich mich selbst so habe zurichten können. Es sieht aus, als hätte ich mir den Weg durch Stein freigegraben, um hierher zu gelangen. Vielleicht habe ich das ja sogar. Oder vielleicht habe ich noch etwas Schlimmeres getan. Ich weiß es nicht. Das ist das Problem, ich weiß es einfach nicht. Nichts.
Ich weiß nicht, was ich die letzten Monate gemacht habe.
Ich weiß nicht, wie es mir möglich war, mich in eine Gargoyle zu verwandeln – oder wie es mir möglich war, mich wieder in einen Menschen zu verwandeln.
Und, erkenne ich mit Entsetzen, das mich bis in die Seele gefrieren lässt, ich weiß die Antwort auf die wichtigste Frage von allen nicht.
Ich wirble herum und starre meinen Onkel an. »Was ist mit Hudson passiert?«
6Vampirroulette ist einfach nicht das Gleiche ohne Blut
Onkel Finn scheint direkt vor mir zu altern, seine Augen werden trüb und seine Schultern sacken herab auf eine Art, die schrecklich an eine Niederlage erinnert. »Wir wissen es nicht«, sagt er. »In der einen Sekunde hat Hudson versucht, Jaxon umzubringen, und in der nächsten …«
»War er weg. Und du auch.« Jaxons Hand umschließt meine unwillkürlich fester.
»Sie war nicht weg«, korrigiert Onkel Finn ihn. »Sie war nur eine Weile außer Reichweite.«
Wieder sieht Jaxon unbeeindruckt aus von dieser Aufsummierung der Ereignisse, aber er wendet nichts dagegen ein. Stattdessen sieht er mich nur an. »Erinnerst du dich wirklich an nichts?«
Ich zucke mit den Schultern. »Wirklich nicht.«
»Das ist so seltsam.« Mein Onkel schüttelt den Kopf. »Wir haben alle Experten zu Rate gezogen, die wir für Gargoyles finden konnten. Alle hatten sich einander widersprechende Geschichten und Ratschläge, aber niemand hat auch nur angedeutet, dass du dich nicht daran erinnern können würdest, wo du warst, wenn du es endlich wieder zurückschaffst. Oder was du geworden bist.« Die Stimme meines Onkels ist leise und, da bin ich sicher, soll beruhigend sein, aber jedes Wort, das er sagt, macht mich nur noch angespannter.
»Denkst du, mit mir stimmt was nicht?«, frage ich nervös und blicke zwischen ihm und Jaxon hin und her.
»Nichts stimmt nicht mit dir«, knurrt Jaxon, und das ist genauso eine offene Warnung an Onkel Finn, wie es eine Versicherung für mich ist.
»Natürlich«, stimmt Onkel Finn zu. »Denk nicht mal so. Es tut mir nur leid, dass wir so unzureichend darauf vorbereitet sind, dir zu helfen. Wir haben hiermit nicht gerechnet.«
»Euch trifft keine Schuld. Ich wünschte nur …« Ich verstumme, weil ich wieder gegen diese verdammte Mauer renne. Ich drücke dagegen, aber sie ist undurchdringlich.
»Erzwing es nicht«, sagt Jaxon und dieses Mal legt er sanft einen Arm um meine Schultern.
Es fühlt sich gut an – er fühlt sich gut an – und ich lasse mich gegen ihn sinken, auch wenn Angst und Frust weiter in mir kreisen. »Ich muss mich dagegenstemmen«, sage ich zu ihm und kuschle mich fester an ihn. »Wie sonst sollen wir herausfinden, wo Hudson ist?«
Die Heizung ist an, aber plötzlich friere ich – ich schätze mal, ein paar Monate als Stein machen das mit einem Mädchen – und ich reibe mir mit den Händen über die Arme, um sie zu wärmen.
Onkel Finn beobachtet mich ein paar Sekunden lang, dann murmelt er etwas vor sich hin und winkt mit der Hand durch die Luft. Momente später legt sich eine warme Decke um Jaxon und mich.
»Besser?«, fragt er.
»So sehr. Danke.« Ich ziehe sie fest um mich.
Er lehnt sich wieder an die Ecke seines Schreibtischs. »Eigentlich hatten wir beide Angst, dass er bei dir ist, Grace. Und genauso viel Angst, dass er es nicht war.«
Seine letzten Worte hängen in der Luft wie ein Schwergewicht.
»Vielleicht war er bei mir.« Nur daran zu denken, mit Hudson eingesperrt zu sein, sorgt dafür, dass sich ein großer Klumpen in meinem Hals festsetzt. Ich schweige, zwinge mich, ihn hinunterzuschlucken. »Falls er bei mir war, denkt ihr … Habe ich ihn mit mir zurückgebracht? Ist er jetzt hier?«
Ich blicke zwischen meinem Onkel und Jaxon hin und her, und sie beide starren mich mit willentlich ausdruckslosen Gesichtern an. Der Anblick verwandelt meine Adern, mein Herz, meine ganze Seele zu Eis. Denn solange Hudson herumläuft, ist Jaxon nicht sicher. Und auch sonst niemand.
Mein Magen dreht sich übelkeiterregend um, während ich mein Hirn durchforste. Das hier passiert nicht wirklich. Bitte sag mir, dass das nicht passiert. Ich kann nicht dafür verantwortlich sein, dass Hudson wieder frei ist, kann nicht verantwortlich sein dafür, ihn zurückgebracht zu haben, wo er jeden terrorisieren und eine Armee aus geborenen Vampiren und ihren Sympathisanten ausheben kann.
»Das würdest du nicht tun«, sagt Jaxon endlich. »Ich kenne dich, Grace. Du wärst niemals zurückgekommen, wenn du denken würdest, dass Hudson immer noch eine Bedrohung wäre.«
»Dem stimme ich zu«, sagt mein Onkel schließlich. Er fährt fort, und ich versuche, mich an seine Worte zu klammern und nicht an die Stille, die ihnen vorausging. »Dann lasst uns jetzt unter dieser Mutmaßung vorgehen. Dass du nur zurückgekommen bist, weil es sicher war. Das bedeutet, Hudson ist sehr wahrscheinlich weg und wir müssen uns keine Sorgen machen.«
Und doch sieht er immer noch besorgt aus. Natürlich. Denn egal wie sehr wir alle glauben wollen, dass Hudson weg ist, gibt es einen großen Fehler in dieser Logik – hauptsächlich, dass sie beide darüber reden, dass ich hier bin, als hätte ich entschieden zurückzukommen.
Aber was, wenn ich das nicht getan habe? Wenn ich nicht bewusst den Entschluss gefasst habe, zu Stein zu werden vor all den Monaten, dann habe ich auch jetzt vielleicht nicht bewusst die Entscheidung getroffen, wieder menschlich zu werden. Und wenn das der Fall ist, wo genau ist dann Hudson?
Tot?
Zu Stein erstarrt in einer alternativen Realität?
Oder versteckt er sich irgendwo an der Katmere, wartet nur auf seine Chance, seine Rache an Jaxon zu verüben?
Mir gefällt keine dieser Alternativen, aber die letzte ist definitiv die Schlimmste. Am Ende schiebe ich sie beiseite, weil es mir nichts bringt auszuflippen.
Aber wir müssen irgendwo anfangen, also beschließe ich, bei Onkel Finns Mutmaßung mitzuspielen – größtenteils, weil sie mir besser gefällt als alle anderen Alternativen zusammengenommen. »Okay. Lasst uns annehmen, dass ich Hudson nicht hätte gehen lassen, falls ich die Kontrolle über ihn hatte. Was jetzt?«
»Jetzt machen wir uns ein bisschen locker. Wir hören auf, uns über Hudson zu sorgen und fangen an, uns um dich zu sorgen.« Mein Onkel lächelt aufmunternd. »Marise sollte jede Minute hier sein und falls sie nach der Untersuchung befindet, dass du gesund bist, sollten wir die Dinge eine Weile lang einfach laufen lassen. Sehen, an was du dich in ein paar Tagen erinnerst, nachdem du was gegessen und geschlafen und wieder eine normale Routine hast.«
»Die Dinge laufen lassen?«, fragt Jaxon und seine Stimme trieft mit der gleichen Ungläubigkeit, die ich in mir spüre.
»Ja.« Zum ersten Mal ist ein Hauch Stahl in der Stimme meines Onkels. »Was Grace jetzt gerade braucht, ist Normalität.«
Er vergisst da, dass es für mich so ziemlich normal war, einen psychopathischen Vampir an den Hacken zu haben, seit ich an diese Schule gekommen bin. Die Tatsache, dass wir offenbar Lia gegen Hudson eingetauscht haben, fühlt sich an, als wäre es nicht anders zu erwarten gewesen. Was gelinde gesagt deprimierend ist, aber auch wahr.
Ich schwöre, wenn ich diese Geschichte lesen würde, fände ich die Plottwists langsam lächerlich. Aber ich lese sie nicht. Ich lebe sie und das ist so viel schlimmer.
»Was Grace braucht«, korrigiert Jaxon, »ist es, sich sicher zu fühlen. Was sie nicht kann, bis wir dafür sorgen, dass Hudson keine Bedrohung mehr ist.«
»Nein, was Grace braucht«, fährt mein Onkel fort, »ist Routine. Es bietet Sicherheit zu wissen, was geschehen wird, und wann es geschehen wird. Ihr wird es besser gehen …«
»Grace wird es besser gehen«, unterbreche ich und die Wut steigt an die Oberfläche, »wenn ihr Onkel und ihr Freund anfangen, mit ihr zu reden statt über sie. Da ich ein halbfunktionales Gehirn habe und Handlungsmacht in meinem eigenen Leben, wisst ihr.«
Man muss es anerkennen, dass beide bei dieser verbalen Ohrfeige beschämt aussehen. Was sie auch sollten. Ich bin vielleicht kein Vampir oder ein Hexer, aber das heißt nicht, dass ich kusche und »das Männervolk« für mich die Entscheidungen über mein Leben treffen lasse. Besonders nicht, wenn sie beide der »Grace in Watte packen und beschützen«-Meinung sind. Was bei mir auch nicht läuft.
»Du hast recht«, stimmt mein Onkel mit verhaltener Stimme zu. »Was willst du, Grace?«
Ich denke nach. »Ich möchte, dass die Dinge normal sind – oder so normal wie sie für ein Mädchen sein können, das mit einer Hexe lebt und einen Vampir datet. Aber ich möchte auch herausfinden, was mit Hudson passiert ist. Ich habe das Gefühl, dass wir ihn finden müssen, wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, dass alle sicher sind.«
»Ich mache mir keine Sorgen darüber, dass alle in Sicherheit sind«, knurrt Jaxon. »Ich mache mir nur darüber Sorgen, dich zu beschützen.«
Das klingt gut und ich schmelze innerlich ein wenig dahin. Aber von außen bleibe ich hart, denn jemand muss dieses Durcheinander entwirren, und da ich die Einzige mit einem Platz in der vorderen Reihe bin – auch wenn ich mich nicht daran erinnere, was ich von dem Platz aus gesehen habe –, werde ich dieser jemand sein müssen.
Frustriert balle ich die Fäuste, ignoriere den Schmerz, der dabei durch meine schon so misshandelten Fingerspitzen schießt. Das ist wichtig, wirklich wichtig. Ich muss mich daran erinnern, was mit Hudson passiert ist.
Habe ich ihn irgendwo angekettet zurückgelassen, für niemanden eine Bedrohung?
Ist er entkommen und deshalb sind meine Hände so aufgeschlagen – weil ich versucht habe, ihn aufzuhalten?
Oder – und diesen Gedanken hasse ich am meisten – hat er seine Gabe der Überzeugung genutzt und mich dazu gebracht, ihn einfach gehen zu lassen? Und falls ja, ist meine Erinnerung deshalb so zerschossen?
Das Nichtwissen bringt mich um, so wie die Angst, dass ich alle im Stich gelassen habe.
Jaxon hat so hart darum gekämpft, Hudson beim ersten Mal loszuwerden. Er hat alles geopfert, einschließlich der Liebe seiner Mutter, um seinen Bruder zu zerstören – und um Hudson davon abzuhalten, die ganze Welt zu vernichten.
Wie kann ich mit mir selbst leben, wenn wir herausfinden, dass ich ihn einfach habe davonspazieren lassen? Dass ich ihm eine Chance gab, damit weiterzumachen, Katmere und die Welt ins Chaos zu stürzen?
Dass ich ihm eine weitere Chance gab, den Jungen zu verletzen, den ich liebe?
Dieser Gedanke nährt mehr als jeder andere die Angst in mir, und ich krächze hervor: »Wir müssen herausfinden, wo er hingegangen ist, und sicherstellen, dass er niemandem sonst wehtun kann.«
Und wir müssen herausfinden, warum ich sicher bin, dass ich etwas sehr Wichtiges vergessen habe, das während dieser Monate passiert ist.
Bevor es zu spät ist.
7Unwissenheit schützt vor Strafe nicht … oder vor Verletzungen
Nachdem Marise mich gefühlt stundenlang durchgecheckt hat, lässt Onkel Finn endlich zu, dass Jaxon mich mitnimmt. So, wie die beiden und Marise sich um mich sorgen, wird klar, dass keiner meine Gesundheit für selbstverständlich hält, was tröstlich ist. Marise hat mich sogar auf eine Hirnverletzung hin überprüft, weil, Hallo, Amnesie.
Ich bin aber unfassbar gesund, bis auf ein paar Schrammen und Prellungen an den Händen, und damit wieder bereit für die Katmere Academy. Anscheinend könnte es der nächste große Gesundheitshype werden, einige Monate als Stein zu verbringen.
Jaxon und ich schlendern zu meinem Zimmer, aber mein Kopf kann nicht aufhören, einen Teil meiner Unterhaltung mit Marise immer wieder abzuspulen, bei dem sie sich entschuldigte, weil sie nicht mehr über meine Gargoylephysiologie weiß.
»Du bist die erste Gargoyle seit tausend Jahren.«
Fantastisch. Denn wer träumt nicht davon, mit seiner grundlegenden Physiologie einen Trend zu setzen? Oh, richtig. Jeder.
Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich die Information, dass ich die Erste meiner Art in der Gegenwart bin, verarbeiten soll, also lege ich sie für später ab in einem Ordner mit der Aufschrift: »Scheiß, für den ich heute keine Zeit habe«. Und noch eine Kopie in den mit dem Titel »Danke für die Vorwarnung, Mom und Dad«.
Und da fällt mir auf, dass Jaxon mich nicht zu meinem Zimmer bringt, sondern zu seinem Turm. Ich ziehe an seiner Hand. »Hey, wir können nicht zu dir. Ich muss ein paar Minuten zu mir; ich möchte duschen und mir einen Müsliriegel schnappen, bevor ich in den Unterricht gehe.«
»Unterricht?« Er blickt schockiert drein. »Willst du dich heute nicht lieber ausruhen?«
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die letzten Monate ›geruht‹ habe. Ich möchte wirklich gerne zurück in den Unterricht und nachholen, was ich verpasst habe. Ich soll in zweieinhalb Monaten meinen Abschluss machen, und ich möchte nicht mal daran denken, wie viel ich verpasst habe.«
»Wir wussten immer, dass du zurückkommst, Grace.« Er lächelt auf mich hinab und drückt meine Hand. »Dein Onkel und das Kollegium haben deshalb schon einen Plan gemacht. Du musst nur Termine mit ihnen machen, um darüber zu reden.«
»Oh, wow. Das ist super.« Ich umarme ihn fest. »Danke für deine Hilfe bei allem.«
Er erwidert die Umarmung. »Du musst mir nicht danken. Dafür bin ich hier.« Er dreht auf dem Absatz um, und wir ändern die Richtung zu meinem Zimmer. »Mrs Haversham sollte dir mittlerweile deinen Stundenplan gemailt haben. Er hat zum Halbjahr gewechselt, obwohl …« Seine Stimme verliert sich.
»Obwohl ich nicht da war«, beende ich den Satz, denn ich habe gerade beschlossen, dass ich nicht den Rest des Schuljahrs um meine neue Realität herumschleiche wie um den heißen Brei. Sie ist, wie sie ist, und je früher wir alle lernen, damit zu leben, desto früher wird alles wieder normal. Ich selbst eingeschlossen.
Ich habe eine lange Liste mit Fragen, die ich Jaxon und Macy über Gargoyles stellen will. Und wenn ich diese Antworten habe, finde ich heraus, wie ich würdevoll damit leben kann. Morgen. Und positiv ist doch, dass der würdevolle Teil sehr viel leichter zu ertragen sein sollte, da ich keine Hörner habe.
Jaxon starrt auf mich hinab, und ich erwarte, dass er mich küsst – ich will ihn so dringend küssen, seit dem Augenblick, in dem er ins Büro meines Onkels kam – aber als ich mich vorbeuge, schüttelt er unauffällig den Kopf. Die Zurückweisung zwickt ein wenig, zumindest bis mir wieder einfällt, wie viele Leute mich angestarrt haben, während ich vorhin durch die Gänge lief.
Das war vor über einer Stunde. Jetzt, wo es sich vermutlich rumgesprochen hat, dass die Internatsgargoyle wieder ein Mensch ist, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie viele Leute uns beobachten würden – obwohl gerade Unterricht sein sollte.
Und tatsächlich, wir biegen um die Ecke in einen der Nebenflure und da sind überall Leute – und jeder Einzelne sieht uns an. Ich spüre, wie ich mich anspanne, bevor wir auch nur einen oder zwei Schritte weiter gegangen sind. Allerdings senken sie den Blick, als Jaxon vorbeigeht.
Jaxon legt einen Arm um meine Schultern, dann neigt er den Kopf, sodass sein Mund fast mein Ohr berührt. »Mach dir keine Gedanken wegen denen«, murmelt er. »Das beruhigt sich wieder, wenn dich erst mal jeder gesehen hat.«
Ich weiß, dass er recht hat – nach meinen ersten paar Tagen hier hat mich niemand mehr beachtet, außer wenn ich mit Jaxon unterwegs war. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sich das jetzt ändern wird. Dankenswerterweise. Bekannt zu sein, ist nicht so mein Ding.
Wir gehen rasch bis zu meinem Zimmer und brauchen dabei für einen Weg, der normalerweise etwa zehn Minuten dauert, nur fünf oder sechs. Und es ist trotzdem nicht schnell genug. Nicht mit Jaxon neben mir, seinen Arm um meine Schultern. Sein hochaufgeschossener, schlanker Körper an meine Seite gedrückt.
Ich brauche ihn näher bei mir, muss seine Arme um mich spüren und seine weichen Lippen an meinen.
Jaxon muss es genauso gehen, denn als wir den Treppenabsatz erreichen, beschleunigt er seinen raschen Schritt und läuft fast. Und als wir mein Zimmer erreichen, zittern meine Hände und mein Herz schlägt viel zu schnell.
Gott sei Dank hat Macy die Tür nicht abgeschlossen, denn ich bin nicht sicher, ob Jaxon sie nicht ansonsten aus den Angeln gerissen hätte. So stößt er die Tür auf und scheucht mich beinahe hinein, faucht nur ein bisschen, weil Macys verzauberter Vorhang seinen nackten Unterarm streift.
»Geht es deinem Arm gut?«, frage ich, nachdem sich die Tür hinter uns geschlossen hat. Doch Jaxon ist zu sehr damit beschäftigt, mich dagegen zu drängen, um zu antworten.
»Ich hab dich vermisst«, knurrt er, seine Lippen kaum einen Zentimeter von meinen entfernt.
»Ich hab dich verm…«, ist alles, was ich herausbringen kann, bevor sein Mund auf meinen prallt.
8Überschütte mich mit Liebe
Ich wusste es nicht.
Ich wusste nicht, wie sehr ich das hier vermisst habe, wusste nicht, wie sehr ich Jaxon vermisste, bis zu diesem Augenblick.
Seinen Körper an meinem.
Seine Hände, die mein Gesicht umschließen, die Finger in meinem Haar vergraben.
Sein Mund, der meinen verschlingt – Lippen und Zähne und Zunge, die mich von innen in Brand setzen. Die mich wollen lassen. Brauchen lassen.
Jaxon. Immer Jaxon.
Ich dränge mich an ihn, will so sehr dichter an ihn heran, und er knurrt tief in der Kehle. Ich spürte die Anspannung in seinem Körper, spüre den gleichen Drang in ihm, der tief in mir brennt. Doch durch all das hindurch bleibt sein Griff sanft, seine Finger streicheln mein Haar, statt daran zu ziehen, sein Körper schmiegt sich an meinen, statt in meinen persönlichen Freiraum einzudringen.
»Mein.« Ich flüstere das Wort an seinen Lippen, und er erschaudert, löst seinen Mund von meinem.
Ich wimmere, versuche, ihn wieder an mich zu ziehen, aber er erschaudert erneut, vergräbt sein Gesicht in meiner Halsbeuge. Und dann atmet er einfach – lange, langsame, tiefe Atemzüge – als versuchte er, meine Essenz tief in sich hineinzusaugen.
Ich kenne das Gefühl.