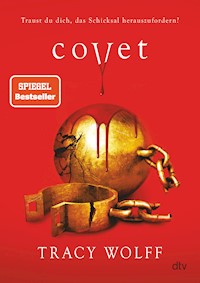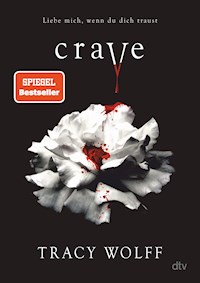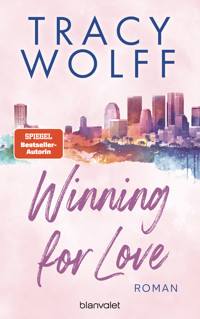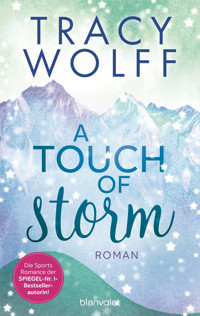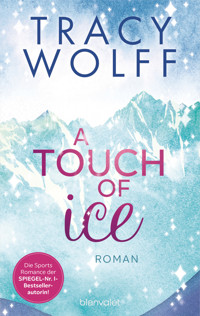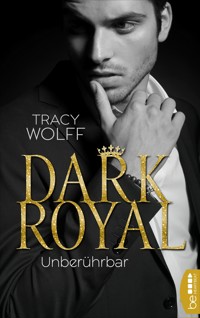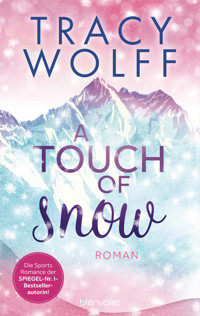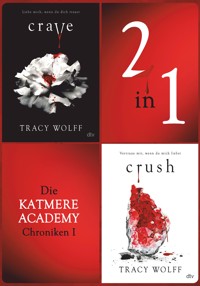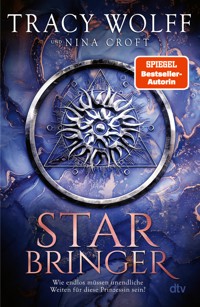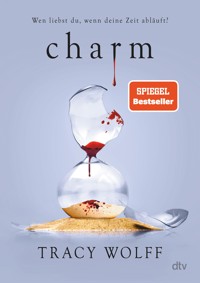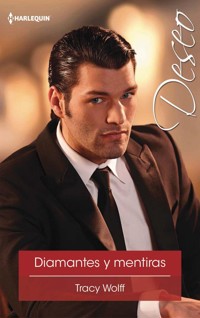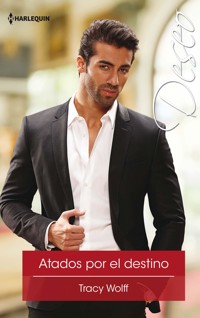Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: The AOS
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Calder Academy Chroniken
- Sprache: Deutsch
Er ist die größte Gefahr für ihr Herz … und ihre einzige Chance zu überleben Für Clementine Calder ist die Academy ihrer Familie, eine Schule auf einer abgelegenen Insel für gefährliche Paranormale, auch ihr Zuhause. Von den Geistern der Insel und den dunklen Geheimnissen ihrer Familie verfolgt träumt sie davon, weit weg von Calder zu sein – und von Jude Abernathy-Lee, dem Typen, der ihr das Herz gebrochen hat. Jude weiß, dass er ein wandelnder Albtraum ist und sich von der einzigen Person, die ihm je etwas bedeutet hat, fernhalten muss. Schließlich kann man seiner gefährlichen Macht nicht trauen. Doch ein Sturm über der Insel weckt Gefahren, die nicht nur die Calder Academy, sondern die ganze Welt bedrohen. Jude und Clementine werden zusammenarbeiten müssen, wenn sie überleben wollen. Und vielleicht muss Clementine sich eigestehen, dass sie nicht jeden Moment in Judes Nähe hasst … Die Calder-Academy-Chroniken von Tracy Wolff bei dtv: Band 1: Sweet Nightmare Band 2: Sweet Chaos (erscheint im Herbst 2026) Band 3: Sweet Vengeance (erscheint 2027) Die Katmere-Academy-Chroniken von Tracy Wolff bei dtv: Band 1: Crave Band 2: Crush Band 3: Covet Band 4: Court Band 5: Charm Band 6: Cherish Die Bände sind nicht unabhängig voneinander lesbar.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Er ist die größte Gefahr für ihr Herz … und ihre einzige Chance zu überleben
Für Clementine Calder ist die Academy ihrer Familie auf einer abgelegenen Insel gleichzeitig ihr Zuhause und ein Gefängnis. Denn anders als alle anderen ist Clementine unverschuldet an dieser Schule für gefährliche Paranormale. Von den Geistern der Insel und den dunklen Geheimnissen ihrer Familie verfolgt träumt sie davon, weit weg von der Calder Academy zu sein – und von Jude Abernathy-Lee, dem Typen, der ihr das Herz gebrochen hat. Doch ein Sturm über der Insel weckt Gefahren, die nicht nur die Academy, sondern die ganze Welt bedrohen. Jude und Clementine werden zusammenarbeiten müssen, wenn sie überleben wollen.
Atemberaubende Spannung und große Gefühle – ein verführerischer Romantic-Fantasy-Reihenauftakt!
Von Tracy Wolff sind bei dtv außerdem lieferbar:
Crave (Band 1)
Crush (Band 2)
Covet (Band 3)
Court (Band 4)
Charm (Band 5)
Cherish (Band 6)
Star Bringer (mit Nina Croft)
Tracy Wolff
Sweet Nightmare
Die Calder Academy Chroniken
Band 1
Roman
Aus dem amerikanischen Englischen von Michelle Gyo
Für alle, die sich ihrem schlimmsten Albtraum gestellt haben und gestärkt daraus hervorgegangen sind.
Dieses Buch ist für euch.
Anmerkung der Autorin
Sweet Nightmare ist eine actionreiche Paranormal Romance mit leichten Horrorelementen. Als solche kommen in der Handlung Dinge vor, auf die Lesende vielleicht sensibel reagieren. Dazu zählen unter anderem Aspekte von Gewalt, grausame Szenen, Tod, Blut, Erbrechen, Feuer und Verbrennen, Ertrinken, Gifte und Vergiftungen, Mobbing, Halluzinationen, Schimpfworte, Monsterangriffe, die sich auf gängige Phobien beziehen, und Naturkatastrophen. Todesfälle von Familienmitgliedern werden thematisiert. Ich hoffe, dass ich diese Elemente sensibel und angemessen behandelt habe, aber falls diese Themen für dich belastend sein könnten, bitte ich hiermit um Kenntnisnahme.
PrologNacht um nächtlichen Albtraum
Jude
ICH KENNE DEINEN SCHLIMMSTEN ALBTRAUM.
Nein, nicht den. Den anderen.
Den, von dem du nicht auf Partys zum Spaß erzählst.
Den, den du nicht spätabends deiner besten Freundin zuflüsterst.
Den, den du dir nicht einmal selbst eingestehst, bis es drei Uhr nachts ist, alle Lichter aus sind und du vor Angst so gelähmt bist, dass du nicht mal die Hand ausstrecken und die Nachttischlampe anknipsen kannst. Also liegst du nur da, mit rasendem Herzen und rauschendem Blut, lauschst angespannt auf das Scharren am Fenster, das Knarren der Tür, die Schritte auf der Treppe.
Das Monster unter dem Bett.
Das Monster in deinem Kopf.
Aber schäme dich nicht. Alle haben einen – sogar ich.
Meiner beginnt immer gleich.
Vollmond. Die Luft ist heiß, schwül. Das Spanische Moos hängt so tief von den Bäumen, dass es bei einem nächtlichen Spaziergang das Gesicht streift. Wellen donnern ans Ufer. Eine Hütte – ein Mädchen – ein Sturm – ein Traum, auf ewig unerreichbar.
Ich weiß, das klingt nicht schlimm, aber die Story steckt nicht in dem Setting. Sondern im Blut und im Verrat.
Schlaf also ruhig ein, wenn du dich traust. Aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Denn ich kann nur versprechen, dass meine Albträume schlimmer sind als deine.
1Kein schnelles Entkommen
Clementine
VON ALL DEN BESTRAFUNGEN, die diese Schule für Außenseiter und Versager bereithält, musste ich ausgerechnet diese abbekommen? Erst letzte Woche hat einer von den neuen Vampiren fast eine Hexe leergesaugt und dafür nur Abwaschdienst aufgebrummt bekommen.
Ironisch? Absolut.
Fair? Kein bisschen.
Dann wiederum muss man sagen, dass Fairness hier an der Calder Academy ein ziemlich nebulöses Konstrukt ist, genau wie Sicherheit und Augenmaß. Und daher denkt meine Mutter – auch bekannt als Schulleiterin der Nicht-Extraklasse von diesem nicht-so-erstklassigen Etablissement –, dass es für die Aufseher vollkommen okay ist, wenn man mir die Versorgung der Chrickler aufdrückt.
Spoiler: Es ist nicht okay. Es ist echt elendig. Und nicht zu vergessen verdammt gefährlich.
Aber fast drei Jahre in diesem Albtraum haben mich ein paar Dinge gelehrt, darunter am wichtigsten: leise zu gehen – und langsam – und einen wirklich großen Sack mit Trockenfutter dabeizuhaben.
Ein schneller Blick durch das Gehege bestätigt mir, dass das Futter wieder einmal seine Aufgabe erfüllt hat. Die kleinen Monster sind abgelenkt. Zumindest fürs Erste.
Ich mache einen kleinen, wohlüberlegten Schritt zurück in Richtung Tür. Als keiner der Chrickler auch nur eine pelzige Augenbraue hebt, geschweige denn von den langen, vollen Futtertrögen aufsieht, mache ich einen weiteren. Und noch einen. Die alte Holztür, die mich vom Kellerflur trennt, ist fast in Reichweite. Nur noch ein paar Schritte und ich schaffe es vielleicht sogar hier raus, ohne einen Tropfen Blut zu verlieren.
Die Hoffnung, zusammen mit der Arschigkeit, stirbt zuletzt.
Ein Schweißtropfen läuft mir den Rücken hinab, während ich weiter vorsichtig rückwärtsgehe. Dann halte ich den Atem an und taste hinter mir nach dem altmodischen Schnappriegel, der die Chrickler – und mich – in diesem kühlen, dunklen Gehege einsperrt.
Aber in dem Moment, in dem meine Finger den Verschluss berühren, grollt lauter Donner über den Himmel.
Shit, shit, shit.
Hunderte Köpfe schnellen gleichzeitig hoch und wenden sich dann alle mir zu. Augen werden zu Schlitzen. Zähne werden gebleckt. Vielstimmiges Knurren hallt von den Wänden.
Und so bin ich ganz unverhofft total am Arsch.
Krallen kratzen über den Boden, als sie gesammelt auf mich zurennen.
Scheiß auf die Kraft in der Ruhe. Ich wirble herum und hechte zur Tür, gerade als die erste Welle mich erreicht.
Krallen kratzen über meine Waden, während ich mit dem Riegel hantiere. Ich schüttle die ersten paar ab und keuche auf, als Zähne sich in meinen Oberschenkel und meine Hüfte bohren. Mit einer Hand kann ich ein paar der kleinen Mistviecher abschütteln.
Aber einer der schlaueren Chrickler schafft es, sich festzuklammern und meinen Rücken hinaufzuklettern. Er hat lange, spitze Zähne, die eine Wunde in meine Schulter schlagen, während seine noch längeren und spitzeren Krallen meinen rechten Bizeps schreddern.
Ich versuche einen Aufschrei zu unterdrücken, als frisches Blut – mein Blut – auf die Spitze meiner ramponierten, aber geliebten Adidas Gazelles spritzt, gebe es jedoch auf, den Chrickler von mir schleudern zu wollen. Die Freiheit liegt genau vor mir. Zum Greifen nah … ich muss nur aufpassen, dass sie mich nicht gleich wieder anfallen.
Ich mühe mich mit dem eisernen Riegel ab. Er ist uralt und klemmt gern, aber ich habe das hier oft genug gemacht, um alle Tricks zu kennen. Ich drücke die linke Seite ein wenig rein, ruckle die rechte nach oben und ziehe, so fest ich kann.
Der Hebel gibt nach, gerade als ein weiterer Chrickler – oder vielleicht auch derselbe, wer weiß das schon – mich heftig in den Knöchel beißt. Ich trete, so fest ich kann, nach hinten aus und schüttle dabei mein Bein wie wild, während ich gleichzeitig an der Tür zerre, ebenfalls so fest ich kann. Sie ist schwer und meine Schulter pocht, aber ich ignoriere den Schmerz, reiße mir den letzten Chrickler vom Leib und stürze durch einen Spalt, der kaum breiter ist als meine Hüften, dann knalle ich das Ding hinter mir zu.
Um sicherzugehen, dass mir nichts hinausgefolgt ist – so heimtückisch sind Chrickler nämlich –, werfe ich mich mit dem Rücken gegen das alte Holz. Genau in dem Augenblick tritt mein bester Freund Luis ins Dämmerlicht des Kellers.
»Suchst du das?« Er hat mein Erste-Hilfe-Set in Händen, hält aber jäh inne, als er mich genauer ansieht. »Verdammt, Clementine, hat dir mal jemand gesagt, dass du wirklich weißt, wie man einen Auftritt hinlegt?«
»Meinst du nicht einen Austritt?«, krächze ich und ignoriere seine entsetzte Miene. »Der heraufziehende Sturm scheint die Chrickler noch mehr aufzustacheln.«
»›Aufstacheln‹? So nennst du das?« Ein lauter, animalischer Schrei, der jetzt hinter der Tür erklingt, übertönt ihn fast. »Was ist das für ein gottserbärmlicher Lärm?«
»Ich weiß es nicht.« Ich drehe mich um, sehe aber nichts. Andererseits wird der Korridor nur von genau einer traurigen, nackten Glühbirne erhellt, die von der Decke baumelt, deshalb sehe ich auch nicht gerade viel. Wie beim Rest der Schule ist die Dunkelheit auch hier im Keller definitiv eine gute Freundin.
Doch das Jammern wird eindeutig lauter … und jetzt begreife ich, dass es aus dem Gehege kommt.
»Oh, shit.« Ich lasse das letzte Schloss einrasten und entdecke dabei, dass eine kleine Chrickler-Pfote zwischen der Tür und dem Rahmen eingeklemmt ist.
Luis folgt meinem starren Blick. »Fuck, nein. Clementine, denk nicht mal dran!«
Ich weiß, dass er recht hat, aber … »Ich kann das arme Ding nicht einfach so zurücklassen.«
»Das ›arme Ding‹ wollte dir gerade die Eingeweide rausreißen!«, gibt er zurück.
»Ich weiß! Glaub mir, das weiß ich!« Bedenkt man, an wie vielen Stellen mein Körper aktuell pocht, ist das unmöglich zu vergessen.
Er verdreht seine silbernen Wolfsaugen so heftig, dass es mich ein klein wenig überrascht, dass sie nicht in seinem Schädel verschwinden.
Mittlerweile ist das Jaulen zu gedämpften Japsern verklungen und ich kann es einfach nicht so zurücklassen, Monster hin oder her. »Ich muss diese Tür öffnen, Luis.«
»Verdammt noch mal, Clementine!« Doch er tritt als Backup hinter mich. »Fürs Protokoll möchte ich festhalten, dass ich gegen diese Entscheidung bin.«
»Ist vermerkt«, erwidere ich, hole tief Luft und klappe das Schloss, das ich gerade erst verriegelt habe, zögerlich wieder auf. »Wird schon schiefgehen.«
2Calder-zeit bereit
»LASS DIE HAND AN DER TÜR!«, drängt Luis und beugt sich über meine Schulter, um mich zu mikromanagen, wie er das in so vielen anderen Bereichen meines Lebens auch tut.
»Habe ich vor«, antworte ich, schließe eine Hand um den Griff und lege die zweite direkt darüber, damit ich die Tür sofort wieder zudrücken kann, sobald die Chrickler-Pfote befreit ist.
Ich ziehe, wie ich hoffe, gerade fest genug an der Tür, und in der Sekunde, in der die Pfote verschwindet, werfe ich mich mit meinem ganzen Gewicht dagegen und knalle sie zu, so fest ich kann. Wie durch ein Wunder gelingt es mir tatsächlich, keine neue Katastrophe auszulösen.
Ein Chor aus entrüstetem Jaulen erhebt sich aus dem Gehege, aber sonst passiert nichts.
Ich bin in Sicherheit … wenigstens bis zum nächsten Mal.
Das letzte Adrenalin ist verpufft und ich lehne mich völlig erschöpft an die Tür und rutsche daran herunter, bis mein Hintern den Boden berührt, dann atme ich. Atme einfach.
Luis sinkt neben mir nieder, nickt zum umfangreichen Erste-Hilfe-Set, das er ein paar Schritte entfernt hat fallen lassen. Er hat sich schon sehr früh angewöhnt, es an jedem Tag mitzubringen, an dem ich Chrickler-Dienst habe – und leider habe ich es selten mal nicht nötig.
»Wir sollten vielleicht anfangen dich zusammenzuflicken. Die Glocke läutet in ein paar Minuten.«
Ich stöhne auf. »Ich dachte, ich würde schneller werden.«
»Es gibt schneller und es gibt schnell«, sagt er mit einem zerknirschten Grinsen. »Du musst wirklich nicht dafür sorgen, dass in jedem Napf dieser kleinen Monster eiskaltes Wasser ist. Zimmertemperatur reicht völlig.«
»Es ist September. In Texas. Kaltes Wasser ist zwingend notwendig.«
»Und welchen Dank bekommst du für deine Mühen?« Sein schwarzes Haar fällt ihm über das linke Auge, als er den zerfetzten Ärmel meines Hemds mustert – und die tiefen Kratzer darunter.
Jetzt bin ich dran mit Augenrollen, greife dabei nach dem Erste-Hilfe-Set. »Es hält mir die Direktorin vom Leib?«
»Ich bin sicher, deine Mutter würde es verstehen, wenn du ihnen lauwarmes Wasser hinstellst und dir den ausufernden Blutverlust ersparst. Sie besteht immerhin darauf, diese Viecher zu beherbergen.« Er betrachtet das große Pflaster, das ich aus dem Set hole. »Brauchst du Hilfe?«
»Vielleicht«, antworte ich zähneknirschend. »Kümmere dich um den am Rücken, ja? Und ich denke, dieser ganze Chrickler-Dienst soll eine Strafe sein, also glaube ich nicht, dass sie dabei meine Gefühle auf dem Zettel hat.«
Er schnaubt eine Bestätigung und zieht dabei den Kragen meines roten Uniformhemds gerade so weit herab, dass er das Pflaster auf meine zerkratzte und immer noch blutende Schulter kleben kann. »Aber du bist nicht an dieser Schule, weil du etwas Schlimmes gemacht hast oder wegen fies-bösem Benehmen, so wie der Rest von uns.«
»Und doch bin ich hier. Das Glück, einfach eine Calder zu sein …«
»Tja, Calder hin oder her, du solltest den Chrickler-Dienst kündigen, sonst schaffst du es vermutlich nicht bis zum Abschluss.«
»Oh, ich schaffe den Abschluss«, erwidere ich und klatsche mir noch ein paar Pflaster drauf. »Wenn schon nur, um endlich, endlich von dieser Hölleninsel runterzukommen.«
Ich zähle die Tage bis zum Abschluss, seit ich in der neunten Klasse war. Jetzt bin ich endlich in der zwölften und werde bestimmt nicht zulassen, dass mich etwas davon abhält, aus dieser Hölle zu entkommen und mir irgendwo ein Leben aufzubauen, wo ich nicht ständig auf der Hut sein muss – oder zumindest nicht mehr so übertrieben.
»Noch ein Jahr.« Luis streckt die Hand nach dem Erste-Hilfe-Set aus. »Dann sind wir beide hier weg.«
»Genauer gesagt zweihunderteinundsechzig Tage.« Ich stecke die Schachtel mit den Pflastern zurück ins Erste-Hilfe-Set und reiche es ihm. Dann stehe ich auf und ignoriere dabei all die Stellen an meinem Körper, die wehtun.
Wir setzen uns den deprimierend feuchten Gang hinab in Bewegung, da beginnt die Glühbirne im vollkommen ruhigen Flur zu schwingen und zu knistern.
»Was zur Hölle?«, fragt Luis.
»Ein sehr eindeutiger Wink, dass wir uns beeilen sollten«, antworte ich, denn es ist nie eine gute Idee, sich länger als nötig im Untergeschoss/Verlies der Calder Academy aufzuhalten. Aber bevor wir auch nur ein paar Schritte geschafft haben, macht die Birne plopp. Sekunden später explodiert sie, Funken sprühen – dann liegt der Korridor im Dunkeln.
»Na, das ist mal so gar nicht gruselig.« Luis bleibt stehen und späht zögerlich in die Schwärze.
»Du hast doch nicht ernsthaft Angst vor der Dunkelheit, oder?« Ich kann nicht anders, als ihn ein bisschen damit zu necken, ziehe dabei aber mein Telefon aus der Tasche.
»Natürlich nicht. Ich bin ein Wolf, wie du weißt. Ich kann im Dunkeln sehen.«
»Kannst trotzdem ein Angsthase sein«, ziehe ich ihn auf.
Ich wische mit dem Daumen über die Taschenlampen-App auf meinem Telefon und leuchte damit den Gang hinab.
Schließlich sind Chrickler nicht die einzigen Monster hier unten. Nur die kleinsten und harmlosesten.
Wie aufs Stichwort bebt die Tür vor Luis heftig.
Mehr Motivation brauchen wir nicht. Wir rennen los und der Strahl meiner Taschenlampe hüpft bei jedem meiner Schritte mit. Als ich kurz zurückblicke, um sicherzugehen, dass nichts hinter uns her ist, fällt der Strahl auf etwas, das wie ein riesiger buckliger Schatten im angrenzenden Korridor aussieht. Ich leuchte in diese Richtung, aber da ist nichts.
Mir wird schlecht, denn ich weiß, dass ich etwas gesehen habe. Aber dann ertönt ein lautes Poltern aus dem Zimmer links, gefolgt von Kettengeklirr und einem schrillen, animalischen Kreischen, das nicht von der dicken Holztür, die zwischen uns liegt, gedämpft zu sein scheint – und zwar nicht im Geringsten.
Luis legt noch mal an Tempo zu und ich renne jetzt neben ihm her, an mehreren Türen vorbei, bevor die direkt vor uns so heftig zu vibrieren beginnt, dass ich fürchte, sie könnte jeden Augenblick aus den Angeln fliegen.
Ich ignoriere sie und zwinge mich zur Ruhe. Noch eine Ecke, ein wilder Spurt, dann sind wir am Treppenaufgang. In Sicherheit.
Anscheinend bin ich Luis nicht schnell genug, denn er packt meine Hand und zieht mich mit, während ein lauter, zorniger Schrei uns um die Ecke folgt.
»Los, Clementine!«, schreit er und schubst mich vor sich her in den Treppenaufgang.
Wir poltern die Stufen hinauf und stürmen oben durch die Flügeltüren, gerade als die Glocke ertönt.
3Die nächste Fee beißt in den Glitzerstaub
»DU HAST DIE KRAFT, DIE MONSTER in dir zu bezwingen«, sagt eine besänftigende Stimme über den Lautsprecher. Diese Affirmation, die als Glocke fungiert, tönt durch den Gang, während Luis und ich anhalten, um wieder zu Atem zu kommen.
»Nichts gegen deine Tante Claudia und ihre täglichen Affirmationen«, keucht er, »aber ich glaube nicht, dass wir uns wegen der Monster in uns Gedanken machen müssen.«
»Aber echt«, erwidere ich und schicke zugleich Onkel Carter eine Nachricht, um ihm zu sagen, dass er die Schlösser der Monstergehege dringend überprüfen muss.
Mein Onkel Carter hat die Aufsicht über die Menagerie im Keller. Ganz früher war die Insel der Calder Academy ein Sanatorium gewesen, in das reiche Paranormale ihre Familienmitglieder abschoben, damit sie dort ›rekonvaleszieren‹ konnten. Den Gerüchten nach war der Keller aber damals den gefährlich Geisteskranken vorbehalten – was die gewaltigen, achtzig Pfund schweren Türen an jeder Zelle erklärt. Nicht so super für Menschen, aber praktisch, wenn man verhindern will, dass alle möglichen Kreaturen Zerstörung anrichten.
»Wieso denkt deine Mutter noch gleich, es wäre eine gute Idee, einige der kaputtesten Monster, die es gibt, hier unterzubringen?«, fragt Luis und steckt sich das rote Polohemd in die schwarze Uniformhose.
»Offenbar braucht die Schule das Geld, um ›den Standard zu erhalten, den die Schülerinnen und Schüler gewohnt sind‹«, zitiere ich.
Wir lassen uns einen Moment Zeit, diesen vermeintlichen Standard zu bewundern, bevor wir uns ducken müssen, weil eine lose Deckenfliese zu Boden kracht. Nachdem das Sanatorium geschlossen wurde, war nicht viel zu tun, um die verschnörkelten viktorianischen Gebäude in ein Luxushotel für Paranormale zu verwandeln, das die Insel beheimatete, bis meine Familie sie vor achtzig Jahren kaufte.
Die Gebäude selbst waren in Auftrag gegeben worden, als man noch wunderschöne Bauten um der Architektur willen schuf, selbst wenn diese zu einem Hospital gehörten. Diese Überbleibsel einer längst vergangenen Ära kann man immer noch unter dem Verschleiß vieler Jahre erkennen. Wie die aus Marmor gehauenen Treppen, jetzt von Füßen und Zeit abgenutzt, die großen, bogenverbundenen Türme, die Erkerfenster oder das aufwendige Mauerwerk, das den Eingang zum Verwaltungsgebäude ziert, in dem die meisten unserer Kurse stattfinden. Doch dieser ganze potenzielle Charme wird überlagert von der grünen Anstaltsfarbe, die auf jede Wand und die abgehängten Decken geklatscht wurde und hinter der sich mit Sicherheit ziemlich coole Zierelemente verbergen.
Luis schüttelt kichernd den Kopf, da vibriert mein Telefon, eine Nachricht von meiner Zimmergenossin Eva.
Eva
Wo bleibst du?
Eva
Ich darf nicht zu spät zu Aggressionsbewältigung kommen. Danson ist ein Depp
Eva
Wenn er mich wieder zusammenscheißt, hau ich ihm eine rein, das schwöre ich
Ich antworte schnell, dass ich unterwegs bin.
»Geht’s dir gut?«, hakt Luis nach, als wir rasch weiterlaufen, um nicht von den Flurtrollen angeblökt zu werden.
»Dank dir, ja«, erwiderte ich und umarme ihn kurz, bevor ich die Tür zum Mädchenklo in der Mitte des Flurs aufdrücke. »Hab dich lieb, Luis.«
Er tut meinen Softie-Anfall mit einem bissigen »Will ich dir auch geraten haben« ab, dann schließt sich die Tür hinter mir.
»Verdammt, Clementine. Du sollst die Chrickler füttern, nicht dich auffressen lassen.« Eva, die an einem altmodischen Emaille-Waschbecken lehnt, richtet sich auf.
Ich schnippe mit den Fingern. »Ich wusste doch, ich mache was falsch.«
»Ich habe dir Kaffee mitgebracht.« Ihre langen, schwarzen Locken hüpfen, als sie sich vorbeugt und mir einen türkis-pinken Turnbeutel reicht.
Freude durchflutet mich, weil ich die beiden To-go-Becher mit Evas berühmtem Café con Leche entdecke. Sie macht ihn nach einem Rezept ihrer puerto-ricanischen Familie mit einem Hauch einer speziellen Gewürzmischung. Er ist praktisch legendär bei der Zwölften. Gierig strecke ich die Hand danach aus. »Gib.«
Sie nickt zu dem Beutel. »Die Uhr tickt. Erst umziehen, dann Kaffee.«
Ich stöhne auf, reiße mir aber schon das Hemd vom Leib und werfe es in den Mülleimer. Dann ziehe ich das frische Polohemd hervor, das sie mir mitgebracht hat, und – nach einem kurzen Blick in den Spiegel – den roten Hoodie, den sie draufgepackt hat.
Obwohl draußen über achtunddreißig Grad pure Luftfeuchtigkeit herrschen, ist das immer noch besser, als den Rest des Tages mit einer Zielscheibe auf dem Rücken herumzulaufen. Selbst das kleinste Anzeichen von Schwäche weckt das Raubtier in den anderen Schülerinnen und Schülern. Obwohl ihre Kräfte hier blockiert sind, haben sie immer noch Fäuste – und Zähne – und die setzen sie nur allzu gern ein.
Dreißig Sekunden später habe ich mir das Gesicht gewaschen, mein Haar zu einem Pferdeschwanz frisiert und einen großen Schluck Café con Leche im Bauch.
»Bist du so weit?«, fragt Eva und mustert mich mit ihren braunen Augen besorgt von Kopf bis Fuß.
»So sehr ich das je sein werde«, erwidere ich und hebe den Kaffeebecher in stummem Dank. Dann treten wir wieder hinaus in den Flur.
Ein rascher Blick auf mein Telefon zeigt mir eine Nachricht von Onkel Carter, in der steht, dass er auf dem Weg in den Keller ist, um alles zu prüfen. Ich winke Eva zu, dann laufe ich durch den Korridor zu meinem Kurs in Britischer Literatur.
Ein kleines Rudel Leopardenwandler hängt neben der Tür zum Chemielabor herum. Einer beäugt mich, als wäre ich sein Nachmittagssnack, und lässt einen elfenbeinfarbenen Reißzahn aufblitzen. Das Mädchen neben ihm spürt seine Aufregung und pirscht auf mich zu. Ich wende den Blick ab – einen Machtkampf kann ich jetzt wirklich nicht gebrauchen.
Da sehe ich, wie eine Neuntklässlerin – eine Hexe, glaube ich – mich und die Wandler direkt ansieht. Ganz dumme Idee, Kleine. Sie riechen den Köder sofort und sehen zu ihr. Will man hier überleben, ist direkter Blickkontakt für gewöhnlich nicht die richtige Strategie.
Ich zögere, weiß nicht recht, was ich tun soll, da stößt das Mädchen einen ohrenbetäubenden Schrei aus, der durch den Flur hallt. Auf dem Weg zu meinen protestierenden Trommelfellen wird er von jeder harten Oberfläche zurückgeworfen. Keine Hexe also, sondern eine Todesfee, stelle ich fest, während die Leoparden auseinanderlaufen und zu ihrem Unterricht gehen.
Gerettet vom Schrei.
Schnell gehe ich zu meinem Spind. Ich schnappe mir den Rucksack, haste durch die Tür und erreiche meinen Platz etwa eine Sekunde, bevor die letzte Affirmation erklingt.
»Ich bin stärker als all die Probleme und Herausforderungen, denen ich begegne. Ich muss nur an mich glauben.«
Ein allgemeines Stöhnen erklingt, dann zwitschert Ms Aguilar: »Und das war die Glocke! Dann legen wir uns heute mal ins Zeug, einverstanden?«, in einer Tonlage, die noch viel fröhlicher klingt, als die Affirmationsglocke oder diese Schule es rechtfertigen.
Andererseits ist Ms Aguilar sowieso viel zu grell und glitzernd für die Calder Academy. Vom elektrisch-gelben Haar und den strahlend blauen Augen bis zum manischen Lächeln und ihrer beunruhigend fröhlichen Art schreit alles an ihr, dass die Fee hier nicht hingehört. Und als würde das nicht reichen, sagt mir das gemeine Kichern der fiesen Fae in der letzten Reihe, dass sie gleich dafür sorgen werden, dass Ms Aguilar und alle anderen hier das auch wissen.
»Fuck, beim Mittagessen zu viel Feenstaub geschnupft, oder was?«, ruft Jean-Luc und schleudert sich mit einer Kopfbewegung das aufwendig verwuschelte blonde Haar aus den Augen.
»Und uns nichts mitgebracht.« Sein Freund und Gefolgsmann Jean-Claude grinst höhnisch. Beim Lachen leuchten seine grünen Augen dank der unnatürlichen Elektrizität auf, die Fae mit dunkler Magie zu eigen ist. »Teilen macht doch Freude.«
Die Tatsache, dass die beiden – sowie die anderen beiden Mitglieder ihrer kleinen, unreifen und bösartigen Bande, Jean-Paul und Jean-Jacques – anfangen zu gackern wie Hyänen, verrät jedem, dass sie etwas im Schilde führen.
Und in der Sekunde, in der Ms Aguilar uns den Rücken zuwendet, um etwas an die Tafel zu schreiben, schleudert Jean-Jacques eine Handvoll Skittles nach vorn.
Ich schwöre, diese Kerle könnten nicht nerviger werden, selbst wenn sie sich darum bemühten.
Ms Aguilar wird ganz starr, als die Skittles sie treffen. Aber statt die fiesen Fae zu maßregeln, ignoriert sie sie und schreibt weiter an die Tafel.
Ihr Schweigen stachelt die Fae nur weiter an und sie werfen eine weitere Handvoll Skittles nach ihr – aber dieses Mal haben sie sie vorher angelutscht, sodass sie regenbogenfarbige Streifen auf ihrer weißen Bluse hinterlassen. Von denen, die sich in ihrem stachligen Haar verfangen, ganz zu schweigen.
Sie sieht weiter zur Tafel, um ihre Tränen zu verbergen, wie ich mir ziemlich sicher bin, da stürzt Jean-Luc wie ein Blitz nach vorn – Fae sind übernatürlich schnell, sogar ohne ihre Kräfte –, stellt sich vor sie und beginnt, vulgäre Fratzen zu ziehen und ihr den Mittelfinger zu zeigen.
Der größte Teil der Klasse lacht jetzt los, doch einige sehen auch unbehaglich zu Boden. Ms Aguilar wirbelt herum, aber Jean-Luc ist schon wieder an seinem Platz und lächelt unschuldig auf einen Ellbogen gestützt. Bevor sie verarbeiten kann, was passiert ist, fliegt ihr noch eine Handvoll Skittles entgegen. Die meisten treffen sie an der Brust, aber ein paar landen genau zwischen ihren Augen.
Sie quietscht leise auf, ihre Brust hebt und senkt sich, aber sie sagt immer noch kein Wort. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie neu ist und keine Klassenführungsfähigkeiten besitzt, oder ob sie einfach Angst davor hat, die Jean-Jerks runterzuputzen, weil sie aus einigen der mächtigsten – und gefährlichsten – Mafiafamilien der paranormalen Welt stammen. Es könnte durchaus auch beides sein.
Jetzt fliegen speichelgetränkte Papiergeschosse auf sie zu und ich will etwas einwenden, so wie ich das meistens mache, aber dann zögere ich. Wenn sie nicht lernt für sich selbst einzustehen, und zwar schnell, wird diese Schule sie bei lebendigem Leib verschlingen. Ich habe Ms Aguilars Hintern diese Woche schon dreimal gerettet – und habe blaue Flecke als Beweis. Man kommt keinem Mitglied des Fae-Hofs, die über die allerdunkelste Magie verfügen, in die Quere, ohne eine heftige Tracht Prügel einzustecken. Außerdem bin ich noch wacklig auf den Beinen wegen der ganzen Chrickler, gegen die ich mich eben noch wehren musste. Ich weiß nicht, ob ich es nach dem Unterricht noch mal mit anderen Monstern aufnehmen kann.
Ms Aguilar sagt nichts. Sie dreht sich nur wieder zur Tafel um und schreibt etwas in ihrer geschwungenen Handschrift. Das ist das absolute Dümmste, was sie tun kann, denn die Jean-Jerks – und ein paar andere weniger einfallsreiche Individuen – fassen das als Eröffnung der Jagdsaison auf.
Mehr Papiergeschosse fliegen, verfangen sich in den Spitzen ihrer Stachelfrisur.
Mehr Skittles landen auf ihrem Hintern.
Und Jean-Claude beschließt – Arsch, der er ist –, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für ein paar zweideutige Bemerkungen ist.
Und da reicht es mir. Es reicht einfach. Scheiß doch auf die Schmerzen. Ihre normale Arschlochnummer war etwas anderes, aber jetzt haben sie eine Grenze überschritten. Niemand, nicht einmal die Söhne der Fae-Mafia-Dons, belästigt eine Frau sexuell und kommt damit durch. Auf gar keinen Fall.
Ich räuspere mich, bereite mich innerlich auf eine weitere Abreibung von den Jean-Jerks nach dem Unterricht vor, aber bevor mir eine ausreichend vernichtende Beleidigung einfällt, um sie zum Schweigen zu bringen, raschelt es links von mir.
Es ist leise, so leise, dass die meisten in der Klasse es nicht einmal hören. Aber ich kenne diesen langsamen, berechneten Rhythmus, mit dem diese Person von Reglosigkeit in Aktion wechselt, nur zu gut und obwohl es eine Weile her ist, richten sich immer noch alle Härchen an meinem Körper auf, während mich zugleich ungewollt Erleichterung überkommt.
Anscheinend bin ich nicht die Einzige in dieser Klasse, die findet, dass dieser Ausflug in die sexuelle Belästigung schlimmer ist als ihr übliches schlechtes Benehmen und dass es unterbunden gehört.
Ich drehe mich ein klein wenig nach links und sehe, wie die gesamten zwei Meter des prächtigen, grimmig dreinblickenden, breitschultrigen Jude Abernathy-Lee sich auf seinem Platz herumdrehen. Eine Sekunde lang prallt mein Blick auf den seiner tiefgründigen, verschiedenfarbigen Augen, aber dann sieht er direkt durch mich hindurch zu den Mitgliedern des Jean-Jerk-Clubs.
Ich erwarte, dass er etwas zu den Fae sagt, aber offenbar muss er das gar nicht. Ein Blick lässt ihre Worte, und das Lachen, wie Staub zerfallen.
Mehrere Sekunden lang hängt Stille – gedehnt, gespannt, geschliffen – in der Luft, während die gesamte Klasse den Atem anhält und abwartet, was als Nächstes geschieht. Denn jetzt wird das nicht aufhaltbare Arschloch-Sein der Jean-Jerks auf Judes unbewegliches Alles-Sein prallen.
4Ein Fae, schlimmer als der Tod
BLITZE ZUCKEN VOR DEM FENSTER im Queen-Anne-Stil, durchbohren die unvermittelte, unnatürliche Dunkelheit des frühen Nachmittagshimmels.
Als wolle er den Ernst des heraufziehenden Sturms noch unterstreichen – ganz zu schweigen von der Atmosphäre im Klassenzimmer –, dröhnt der Donner nur Sekunden darauf. Er ist so laut, dass das Fenster scheppert und der Boden bebt. Die Hälfte der Klasse keucht auf, als das Licht flackert, aber statt die Anspannung aufzulösen, macht der Wutanfall von Mutter Natur es nur noch schlimmer.
Vielleicht haben wir ja Glück und ein Blitz trifft einen Jean-Jerk. Flambierter Fae klingt gerade gar nicht so übel.
Ms Aguilar sieht beunruhigt zum Fenster. »Bei so vielen Blitzen hoffe ich doch, dass jemand nach den Feuerlöschern gesehen hat.«
Es donnert wieder und weitere Schüler rutschen unruhig auf ihren Plätzen herum. Normalerweise würde man hier für so einen heraufziehenden Septembersturm keinen müden Blick übrig haben. Die gehören auf dieser Insel vor der amerikanischen Golfküste praktisch zum Leben dazu – vor allem während der Hurrikan-Saison.
Doch dieser hier hat sich nicht so angekündigt, wie das diese Stürme sonst tun. Er tauchte praktisch aus dem Nichts auf, seine Heftigkeit scheint die explosive Energie im Zimmer nachzuäffen, und jetzt rutschen Jean-Paul und seine Bande nicht-ganz-so-fröhlicher Verlierer auf ihre Stuhlkanten vor, als hätten sie ihr ganzes Leben lang auf diesen Augenblick gewartet.
Mein Magen rumort und ich schiebe die Beine unter meinem Tisch hervor, aufs Schlimmste gefasst.
»Denk nicht mal dran, dich da einzumischen«, faucht das neue Mädchen – Izzy, glaube ich – hinter mir. »Ich warte seit meinem ersten Tag hier darauf, dass sie den Hintern versohlt bekommen. Bei dir nicht so sehr.«
»Danke?«, flüstere ich zurück und denke, dass ich auf sie hören sollte.
Doch bevor Izzy noch etwas sagen kann, stößt Jean-Luc ein Geräusch aus, halb Husten, halb Lachen, und fährt sich mit der Hand durch das lange blonde Haar. »Hast du ein Problem, Abernathy-Lee?«
Jude antwortet nicht, hebt nur eine dunkle Braue und starrt Jean-Luc und die anderen weiter nieder. Jean-Luc sieht nicht weg, aber da glänzt Zweifel in seinen Augen.
Dieses Glänzen verwandelt sich in gewaltige Besorgnis, als Jude sie weiter mustert, und das Unbehagen ist praktisch mit Händen zu greifen und scheint jetzt mit der Luftfeuchtigkeit zusammen wie ein Laken im Raum zu hängen. Aber Jean-Jacques muss wohl zu sehr mit sich selbst beschäftigt sein, um das zu bemerken, denn er höhnt: »Tja, dachten wir uns schon. Du legst dich mit …«
Er verstummt, als – aus dem Nichts – Jean-Lucs Hand vorzuckt, Jean-Jacques’ Hinterkopf trifft und sein Gesicht voll auf den Tisch knallt, bevor er noch weitere Dummheiten von sich geben kann.
»Wofür war das denn?«, heult Jean-Jacques auf und wischt sich mit einer dunklen Hand etwas Blut weg, das aus seiner Nase rinnt.
»Halt verdammt noch mal das Maul«, knurrt Jean-Luc, sieht weiter Jude an, der immer noch nicht mehr bewegt hat als die eine Augenbraue. Doch seine Reglosigkeit scheint Jean-Luc nichts auszumachen, zumindest nicht seiner streitlustigen Miene nach zu urteilen. »Wir haben doch nur Quatsch gemacht, Mann. Wir haben hier kein Problem.«
Judes zweite Augenbraue hebt sich, wie um zu fragen: Haben wir nicht?
Als niemand sonst antwortet – oder auch nur atmet, muss man fairerweise sagen –, geht sein Blick von Jean-Luc zu Jean-Claude, der sich unruhig auf seinem Stuhl windet. In dem Moment, in dem sich ihre Blicke begegnen, entwickelt Jean-Claude plötzlich ein sehr gründliches und inniges Interesse an seinem Telefon – was ihm die anderen drei Jean-Jerks mit den eigenen Telefonen in rascher Folge nachmachen.
Plötzlich will keiner von ihnen Jude in die Augen sehen.
Und ganz einfach so ist die Gefahr gebannt, die Spannung entweicht aus dem Raum wie Helium aus einem alten Luftballon. Zumindest fürs Erste.
Ms Aguilar muss es auch spüren, denn sie atmet erleichtert auf, dann deutet sie auf das blumige Zitat, das sie mit einem leuchtend pinken Whiteboardstift auf die Tafel geschrieben hat. »›Das einzige Mittel, den eigenen Intellekt zu stärken, ist sich zu nichts zu entscheiden.‹« Ihre Stimme hebt und senkt sich mit den Worten, als würde sie ein Lied singen. Dann deutet sie zu der Zeile, die in Petrolblau daruntersteht. »›Und den Geist eine Passage für alle Gedanken sein zu lassen.‹«
Sieht aus, als würden wir einfach über das elefantengroße Fae-Problem im Raum hinweggehen und mit einem Zitat von einem toten weißen Kerl weitermachen. Andererseits kommt mir das gerade nicht unrecht.
Nach einer, wie ich vermute, dramatischen Pause fährt Ms Aguilar fort. »Das, meine Lieben, ist ein Zitat von meinem Lieblingsdichter der Romantik. Errät ihn jemand?«
Niemand meldet sich freiwillig. Tatsächlich sitzen wir alle herum, starren sie ungläubig oder überrascht an.
Ihre Miene fällt in sich zusammen, während sie sich umsieht. »Niemand eine Idee?«
Immer noch keine Reaktion.
Als sie einen herzzerreißenden Seufzer ausstößt, probiert es eine der Hexen in der vorletzten Reihe mit einem zögerlichen: »Lord Byron?«
»Byron?« Irgendwie sieht Ms Aguilar sogar noch enttäuschter drein. »Ganz sicher nicht. Er ist sehr viel cooler, Veronica. Immer noch keine Ideen?« Traurig schüttelt sie den Kopf. »Ihr braucht wohl noch ein Zitat.«
Sie tippt sich mit einem zuckerwattefarbenen Fingernagel ans Kinn. »Aber welches? Vielleicht …«
»Ach verflucht noch mal«, platzt Izzy hinter mir heraus. »Das ist der verdammte John Keats.«
Ms Aguilar zuckt vor Überraschung zusammen, doch die Freude folgt rasch. »Du kennst ihn!«, quietscht sie und klatscht in die Hände.
»Natürlich kenne ich ihn, verflixt noch mal. Ich bin aus Großbritannien, oder nicht?«, blafft Izzy.
»Das. Ist. Wundervoll!« Ms Aguilar tänzelt praktisch zu ihrem Schreibtisch und ergreift einen Stapel Papier. »Ich bin so froh, dass du ihn schon mal gelesen hast! Ist er nicht einfach himmlisch? ›Melodien sind süß …‹«
»Er war ein egoistischer Angeber«, unterbricht Izzy sie, bevor die Lehrerin erneut durchs ganze Klassenzimmer schwirren kann. »So wie der Rest der romantischen Dichter.«
Ms Aguilar hält vor Entsetzen mitten in einer schwungvollen Geste inne. »Isadora! John Keats ist einer der brillantesten Dichter – nein, einer der brillantesten Menschen – die je über das Angesicht der Erde wandelten, wie ihr alle mit Sicherheit bald begreifen werdet, weil wir uns mit ihm in den nächsten Stunden beschäftigen werden.«
War ja klar. Für ihn steht sie ein. Vielleicht würde sie sogar den Jean-Jerks Kontra geben, wenn sie die Bilder der Dichter, die sie überall an den Wänden aufgehängt hat, mit Skittles bewerfen würden.
Sie kommt zu mir und wirft den Packen Papier auf meinen Tisch. »Clementine, sei so nett und teil die für mich aus, ja?«
Ich erwidere: »Klar«, obwohl mein geschundener Körper viel mehr für ein »Teufel, nein« zu haben wäre.
Die Jean-Jerks sehen kaum auf, als ich jedem einen Stapel auf den Tisch fallen lasse. Bei Jude rechne ich auch damit – aber er sieht mich an.
In dem Augenblick, in dem unsere Blicke sich begegnen, ist es, als würde alles in mir zugleich erfrieren und verbrennen. Mein Herz beschleunigt, mein Hirn wird langsamer und meine Lunge zieht sich zusammen, bis das Atmen schmerzt.
Es ist das erste Mal, dass er mich direkt angesehen hat – das erste Mal, dass wir einander angesehen haben – seit der neunten Klasse und ich weiß nicht, was ich tun soll … oder was ich empfinde.
Aber da verdüstert sich sein widerlich wundervolles Gesicht.
Sein rasiermesserscharfer Kiefer spannt sich an.
Seine hellbraune Haut strafft sich über den scharfkantigen Wangenknochen.
Und seine Augen – eins so braun, dass es fast schwarz wirkt, das andere funkelnd silbrig-grün – werden vollkommen ausdruckslos.
Drei Jahre lang habe ich diese Mauer in mir hochgezogen für genau diesen Moment und ein Blick von ihm jagt sie wie eine Stange Dynamit in die Luft. Ich kam mir noch nie im Leben armseliger vor.
Entschlossen, so schnell wie möglich von ihm wegzukommen, schmeiße ich ihm sein Päckchen praktisch zu.
Der Rest des Unterrichts vergeht wie im Flug, während ich mich innerlich niedermache, wütend, weil nicht ich die ganze Sache als Erste abgehakt hatte. Dass er, nach allem, was zwischen uns passiert ist, mich hat abblitzen lassen statt andersherum.
Doch kurz bevor die Glocke läutet und wir alle anfangen einzupacken, klatscht Ms Aguilar in die Hände. »Die Zeit reicht nie, nicht wahr?«, lamentiert sie. »Aber um dem Problem bei der nächsten Stunde entgegenzuwirken, teile ich euch jetzt eure Partner zu.«
»Partner?«, ruft einer der Drachenwandler. »Wofür?«
»Für euer Keats-Projekt, Dummerchen. Ich weise heute jedem einen Partner zu, dann könnt ihr morgen sofort mit der Arbeit beginnen.«
Statt eine Liste vorzulesen, die sich an Sitznähe oder Alphabet orientiert, wie das jede normale Lehrkraft tun würde, fängt sie an sich umzusehen und Leute scheinbar wahllos nach den »empfangenen Vibes« einzuteilen.
Ich weiß nicht, welchen Vibe ich ausstrahle, und es könnte mir auch nicht egaler sein. Jetzt, da das Adrenalin vom Chrickler-Dienst nachgelassen hat, kickt der Schmerz. Dazu noch der schräge Scheiß, der da gerade mit Jude gelaufen ist, und ich will nur noch die nächste Stunde hinter mich bringen, in mein Zimmer gehen und ein paar Schmerztabletten nehmen.
Und heiß duschen.
Ich blende Ms Aguilar aus und träume die nächsten paar Minuten von viel heißem Wasser, nur um abrupt in der Realität zu landen, als sie meinen Namen aufruft … gefolgt von Judes.
Fuck, nein.
5Besser spät als eine Calder
MS AGUILAR FÄHRT FORT, Leute zusammenzuspannen, bis jeder einen Partner oder eine Partnerin hat, und merkt null, dass sie gerade mein Leben zerstört hat.
Endlich ertönt die Glocke. »Du bist auf dem richtigen Weg. Behalte ihn bei.«
Himmel, Tante Claudia. Geht’s noch platter?
Ich bleibe an meinem Platz zurück. Als alle draußen sind, gehe ich zu Ms Aguilar, die mich erwartungsvoll ansieht.
»Du brauchst mir nicht zu danken, Clementine«, sagt sie mit einem verschwörerischen Grinsen.
»Hm?«, mache ich verwirrt.
»Dass ich dich mit Jude verpartnert habe. Ich habe doch gemerkt, dass zwischen euch beiden etwas läuft.«
»Da läuft garnichts zwischen mir und Jude …«
»Ach, komm schon, du brauchst das nicht zu verheimlichen. Immerhin habe ich eine poetische Seele.«
»Ich verberge gar nichts. Jude und ich haben eine … sehr starke gegenseitige Abneigung.« Zumindest ist das der Vibe, den er mir entgegenschleudert, seit er mich ohne Vorwarnung und vollkommen ohne Erklärung abserviert hat.
»Oh.« Sie sieht überrascht aus. »Na, dann kannst du es vielleicht nutzen, um die Wogen zu glätten.«
Wogen glätten? Mit Jude Abernathy-Lee gibt es kein »Wogen zu glätten«. Wie auch, wenn er die Wogen zusammen mit dem gesamten Meer schon vor langer Zeit ausgeleert hat? »Tatsächlich hatte ich gehofft, ich könnte den Partner tauschen.«
»Partnertausch?« Ihre Augen werden groß und sie klimpert mit ihren von Natur aus glitzernden Wimpern, als wäre sie selbst nie mal auf den Gedanken gekommen, aus einer ihr zugeteilten Gruppe auszusteigen. »Oh, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, findest du nicht?«
»Doch, absolut!« Ich schenke ihr mein überzeugendstes Lächeln. Zumindest versuche ich es. Doch so wie sie zurückzuckt, muss mein Trauma des Tages es wohl in eine furchterregende Fratze verwandelt haben. »Deshalb habe ich es ja angesprochen.«
»Tja, es ist so, ich kann nicht einfach deine Partner rumtauschen, Clementine. Wenn ich das tue, wird jeder einen Tausch erwarten. Und wenn ich das bei ihnen dann nicht mache, wird man mir vorwerfen, dass ich die Tochter der Direktorin bevorzuge, und das kann ich mir nicht leisten. Ich habe hier gerade erst angefangen.«
»Es braucht ja niemand zu erfahren!«
»Ich habe die Gruppen vor der ganzen Klasse eingeteilt. Jeder wird es erfahren.« Sie schüttelt den Kopf. »Du musst das Beste daraus machen. Und vielleicht merkst du ja auch, dass ihr beiden mehr gemeinsam habt, als du denkst. Jetzt geh zum Unterricht. Du kommst noch zu spät.«
Sie dreht sich zu ihrem Computer um, um mir zu zeigen, dass diese Unterhaltung beendet ist. Ich winke ihr halbherzig zu und verlasse resigniert das Klassenzimmer.
Ich schaffe es zu meinem letzten Kurs des Tages, Aggressionsbewältigung mit Danson dem Deppen, gerade als die Affirmationsglocke ertönt. Ich höre ihm eine elend lange Stunde zu, wie scheiße wir sind und dass wir es nie zu etwas bringen werden, wenn wir nicht lernen, unsere Fähigkeiten zu beherrschen. Nur zu gern würde ich ihn fragen, wie man seine Magie beherrschen lernen soll, wenn die Kräfte aller Schülerinnen und Schüler von der Ankunft auf dieser verdammten Insel bis zu der Sekunde, in der das Abschlussjahrgangsboot ablegt, blockiert sind, aber das packe ich heute einfach nicht mehr.
Nach dem Unterricht stürze ich zur Treppe. Heute Nachmittag ist Calder-Klausur und in etwas anderem als der Galauniform dort zu erscheinen, ist »vollkommen inakzeptabel«. Nur Zuspätkommen ist schlimmer – na ja, das und sie ganz zu verpassen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass man dafür tot sein müsste – obwohl ich nicht sicher bin, dass selbst mein Tod meine Mutter davon abhalten würde, meine Anwesenheit bei diesen Treffen einzufordern.
Donner dröhnt über mir, als ich zu den Wohneinheiten der Schüler renne, aber der Regen, der den ganzen Tag schon droht, fällt nicht. Das macht die Hitze und Feuchtigkeit nur noch schlimmer zu ertragen – in Texas ist September nur ein anderes Wort für Hölle – und als ich den großen Zaun erreiche, der die Gebäude mit den Klassenzimmern von den Schlafquartieren trennt, klebt mir mein Uniformhemd am Rücken. Die beiden von Riesenschmieden geschaffenen Zäune, die die gesamte Insel umgeben und die Gebäude der Akademie von den Schlafquartieren trennen, stellen sicher, dass alle Schüler der Calder Academy von einer Kombination aus Magie blockierenden Zaubern und paranormaler Technologie ihrer Kräfte beraubt werden. Eva und ich nennen das gern das Misstrauenssystem.
Und ich unterliege denselben drakonischen Regeln.
Selbst wenn ich meiner Mutter nicht kategorisch bei absolut allem widersprechen würde, wäre ich allein deshalb sauer auf sie. Sie ist mit ihren Fähigkeiten aufgewachsen. Meine Tanten und Onkel sind mit ihren Fähigkeiten aufgewachsen. Ein besonderer Zauber schließt sie von der Blockade aus und ermöglicht den Erwachsenen Zugriff auf ihre Kräfte, während sie auf der Insel sind. Sie erneuern den Zauber sogar jedes Jahr, wann immer er sich abnutzt. Aber wenn es um meine Cousins, Cousinen und mich geht, so ist uns nicht zuzutrauen, Zugriff auf unsere Fähigkeiten zu haben.
Genau das macht den Vortrag von Danson dem Deppen so gemein und unfair. Ich habe meine Macht nie missbraucht, habe nie die Kontrolle über meine Magie verloren, habe nie jemandem wehgetan – wie auch, wo ich doch nie, nicht mal eine Sekunde lang, erlebt habe, wie es ist, Fähigkeiten zu besitzen?
Ich habe Schmerzen und bin genervt, als ich den gewundenen Fußweg entlanglaufe, der zu unseren Schlafquartieren führt. Rechts und links des Wegs stehen wahllos angepflanzte Lebenseichen, die gespenstische Schatten werfen, während das Spanische Moos, das von ihren Zweigen hängt, wild im Wind raschelt und wispert. Ich laufe schneller, weil ihre verächtliche Unterhaltung mir ein Frösteln über den Rücken jagt, bis ich endlich auf die lange Promenade abbiegen kann, die zu den »Hütten« der Schülerinnen und Schüler des zwölften Jahrgangs führt.
Die neunten bis elften Klassen müssen im Hauptschlaftrakt wohnen, der einmal das Hauptgebäude des Resorts war – während die Abschlussklasse das Privileg hat, in den mittlerweile heruntergekommenen Gästehütten zu leben. Die kleinen Bungalows im New-Orleans-Stil haben vorn je eine Veranda, Sturmläden vor Fenstern und Türen und sind in einem schnörkeligen Architekturstil namens Gingerbread erbaut, dessen Pastellfarben mittlerweile verblasst sind und abblättern.
Das Häuschen von Eva und mir hat zwei gesprungene Fenster und eine Mäusefamilie im Vorratsschrank, aber wenigstens funktioniert die Klimaanlage, deshalb beschweren wir uns nicht. Das gehört ebenso zu besagtem Standard, an den wir uns gewöhnt haben.
Eva ist noch nicht zu Hause, also streife ich meine widerlich verschwitzte Uniform in der Sekunde ab, in der ich die Tür öffne, um gleich unter die Dusche zu stürmen. Mir bleibt nur Zeit für ein kurzes Einseifen der Chrickler-Bisse – die ausufernde Dusche meiner Träume muss bis später warten. Dann trockne ich mich ab, schlinge mein nasses Haar in einen Dutt und schnappe mir meine Galauniform aus dem Korb mit der ungefalteten Wäsche am Fuß meines Schranks.
Eine weiße Button-down-Bluse und ein rot karierter Rock später und ich bin fast fertig. Ich ziehe Socken an, zwinge die Füße in die schwarzen Loafer, auf die meine Mutter besteht, und schnappe mir mein Telefon, bevor ich zurück zum Verwaltungsgebäude hetze.
Die Klausur beginnt in fünf Minuten und leider braucht man für die Strecke eigentlich zehn Minuten, wenn man joggt. Das eine Mal, als ich zu spät war, bekam ich den Chrickler-Dienst bis zu meinem Abschluss aufgebrummt. Und ich möchte wirklich nicht upgraden zu den Gehegen mit den größeren Monstern.
Ich schwitze und hechle heftig – Scheißluftfeuchtigkeit –, als ich den Konferenzraum im dritten Stock des Verwaltungsgebäudes erreiche, aber ich habe noch zehn Sekunden, also verbuche ich das als Sieg. Zumindest bis mein Telefon klingelt, gerade als ich mich ins Zimmer stehlen will, und alle zwölf Mitglieder meiner erweiterten Familie sich umdrehen und mich mit offensichtlichem Missfallen anstarren.
6Gaslighting am Ende des Tunnels
MEIN TELEFON KLINGELT IN DER absoluten Stille weiter. Um mir weitere familiäre Schmach zu ersparen, ziehe ich es aus der Tasche und lehne den Anruf ab. Es ist meine Freundin Serena, die letztes Jahr den Abschluss gemacht hat und jetzt in Phoenix lebt, also schreibe ich ihr rasch, dass jetzt Klausur ist und ich sie danach anrufe. Dann rutsche ich auf meinen Platz – der dritte von links am anderen Ende des Tischs, so wie immer.
»Nett von dir, dass du dich auch zu uns gesellst, Clementine«, sagt meine Mutter kühl, die Augenbrauen hochgezogen und die blutrot bemalten Lippen zusammengekniffen. »Vielleicht achtest du beim nächsten Mal darauf, dass deine Uniform sauber ist.«
Sie starrt auf meine Brust, also folge ich ihrem Blick und entdecke einen großen braunen Fleck direkt über meiner linken Brust. Ich muss diese Uniform aus dem Korb mit der Dreckwäsche gezogen haben, nicht aus dem mit der sauberen.
Passt perfekt zu meinem Tag.
»Ich würde dir ja Tee anbieten«, höhnt meine Cousine Carlotta, »aber es sieht aus, als hättest du schon welchen gehabt.« Sie ist dieses Jahr in der zehnten Klasse und gibt total damit an.
»Hör nicht auf sie, Liebling«, sagt meine Großmutter mit ihrem zuckersüßen Südstaatenakzent. »Die netten Jungs mögen Mädchen, die nicht zu viel auf ihr Äußeres geben.«
»Red jetzt ja nicht mit meinem lieben Mädchen über Jungs, Viola«, rügt mein Großvater sie mit einer Bewegung seiner behaarten Hand. »Du weißt, dass sie dafür zu jung ist.«
»Ja, Claude«, erwidert meine Großmutter, zwinkert mir dabei aber zu.
Ich schenke ihnen beiden ein dankbares Lächeln – es ist schön, jemanden auf meiner Seite zu haben. Manchmal frage ich mich, ob es anders wäre, wenn mein Dad nicht verschwunden wäre, bevor ich geboren wurde. Aber das ist er und jetzt hat es meine Mutter sich zur Aufgabe gemacht, ihn zu bestrafen, indem sie mich seine Fehler ausbaden lässt – ob sie das nun merkt oder nicht.
»Jetzt, wo Clementine auch da ist, erkläre ich diese Klausur für eröffnet«, sagt mein Onkel Christopher und schlägt mit dem Hammer so fest auf den Tisch, dass die ganzen winzigen Porzellantässchen klirren, auf die meine Mutter besteht. »Beatrice, der Tee, bitte.«
Innerhalb von Sekunden ist der Konferenzraum voller Küchenhexen, die Teewagen vor sich herschieben. Einer ist voller Teekannen und Zubehör. Auf einem anderen stapeln sich belegte Sandwiches, während auf einem dritten eine Auswahl an Scones und kunstvollem Gebäck liegt.
Wir alle sitzen stumm da, während alles perfekt auf dem Lieblingsblumentischtuch meiner Mutter angerichtet wird.
Flavia, eine der jüngsten Küchenhexen, lächelt, als sie einen Teller mit kleinen Cupcakes auf den Tisch neben mich stellt. »Ich habe deinen Lieblings-Ananas-Cream-Cheese-Guss für den Karottenkuchen gemacht, Clementine«, flüstert sie.
»Vielen lieben Dank«, wispere ich mit einem breiten Lächeln zurück – und ernte prompt ein verärgertes Stirnrunzeln von meiner Mom.
Ich ignoriere sie.
Flavia ist einfach nur nett – was hier an der Calder nicht gerade geschätzt wird. Ganz zu schweigen davon, dass sie einen unfassbar leckeren Karottenkuchen macht.
Nachdem der ach-so-pompöse Calder-Familienmittwochsnachmittagstee serviert ist und sich alle die Teller beladen haben, übernimmt meine Mutter zeremoniell den Hammer von Onkel Christopher. Sie ist die älteste der fünf Geschwister, die um den Tisch versammelt sind. Diese Position nimmt sie sehr ernst, seit sie sie von ihrer ältesten Schwester geerbt hat, als diese irgendwann vor meiner Geburt starb … und das lässt sie ihre Geschwister – oder deren Familien – auch niemals vergessen.
Obwohl sie den Hammer in der Hand hält, tut sie nichts so Linkisches, wie damit auf den Tisch zu schlagen. Sie hebt ihn hoch, während sie darauf wartet, dass alle am Tisch verstummen. Es dauert nur eine Sekunde – ich bin nicht die Einzige im Zimmer, die unter den endlosen Vorträgen meiner Mutter oder ihren diabolischen Strafen gelitten hat. Wobei ich behaupte, dass mein Chrickler-Dienst immer noch viel besser ist als damals, als sie meine Cousine Carolina dazu gezwungen hat, einen Monat lang das Monsterfischaquarium zu reinigen … von innen.
»Wir haben heute ein volles Programm«, fängt meine Mutter an. »Also würde ich gern gegen die Regeln verstoßen und mit dem Geschäftsteil beginnen, bevor wir mit dem Essen fertig sind, solange niemand Einwand erhebt.«
Niemand erhebt Einwand – obwohl meine Lieblingstante, Claudia, aussieht, als würde sie gerne. Ihr leuchtend roter Dutt bebt entweder vor Empörung oder Nervosität, aber sie ist so schüchtern und introvertiert, dass es mir schwerfällt, das klar einzuordnen.
Meine Mom, Onkel Christopher und Tante Carmen stehen eindeutig gern im Mittelpunkt bei diesen Treffen, während Onkel Carter die meiste Zeit versucht, den Fokus auf sich zu ziehen. Ohne Erfolg. Das ist ein wesentlicher Mantikorcharakterzug, der nur Tante Claudia und mir zu fehlen scheint. Alle anderen streiten sich um das Scheinwerferlicht, als wäre es das Einzige, was zwischen ihnen und dem sicheren Untergang steht.
»Die ersten beiden Unterrichtswochen liefen ausnehmend gut«, intoniert meine Mutter. »Die neuen Korridorstrecken, die die Flurtrolle eingeführt haben, scheinen den Schülerfluss zwischen den Klassenräumen zu ordnen und auch die Streitereien in den Gängen zu verhindern, so wie wir es gehofft haben. Es gibt keine Verletzten.«
»Eigentlich«, meldet Tante Claudia sich atemlos zu Wort, kaum lauter als ein Flüstern, »habe ich im Heilerinnenbüro mehrere Kampfverletzungen behandelt. Aber die waren alle eher klein, also …«
»Wie ich schon sagte, keine größeren Verletzungen«, unterbricht meine Mutter sie und sieht ihre Schwester aus schmalen Augen an. »Was das Gleiche ist.«
Ein finsterer Blick von meiner Mutter und Tante Claudia weiß, dass es ein aussichtsloser Kampf ist. Onkel Brandt tätschelt ihr das Knie und sie lächelt ihm dankbar zu.
»Der Wetterbericht meldet gerade eine Sturmsichtung im Golf, aber wir sollten hier keine Probleme bekommen«, kann Onkel Christopher sogar ohne den Hammer einwerfen. »Unsere Schutzmaßnahmen sollten ausreichen und falls der Sturm sich verschlimmert, sollte er dennoch direkt an uns vorbeiziehen.«
»Muss ich mit Vivian und Victoria sprechen?«, fragt Tante Carmen, fällt – wie sie das immer tut – bei der ersten Gelegenheit ein. »Sollen sie einen weiteren Schutzzauber wirken?«
Onkel Christopher zwirbelt sich das Ende seines rotbraunen Schnauzers um den Finger, während er über ihren Vorschlag nachdenkt. »Ich schätze, das kann nicht schaden. Was denkst du, Camilla?«
Meine Mutter zuckt mit den Schultern. »Ich denke, das ist unnötig, aber wenn du dich dann besser fühlst, Carmen, wer bin ich, dich aufzuhalten?«
»Dann sage ich den Hexen, sie sollen sich darum kümmern.« Tante Carmens Stimme ist fast so steif und kalt wie die meiner Mutter. Meine Mutter und Tante Carmen, die ihr altersmäßig am nächsten ist, können einander nicht ausstehen.
Sie hat mehrere Male Putschversuche angezettelt, um meine Mutter als Direktorin abzusetzen. Das hat nie geklappt, aber es hat den Unterhaltungswert der Familienklausur gesteigert.
»Was ist mit der, ähm …« Tante Claudia senkt die Stimme, als wolle sie uns ein Geheimnis verraten. »… der Sache im, äh, untersten Stockwerk …?«
»Du meinst den Kerker?«, korrigiert meine Großmutter sie mit einem Kopfschütteln. »Sprich wenigstens aus, zu was ihr es gemacht habt.«
Ich bin da voll bei ihr. Dieses feuchte, dunkle Areal qualifiziert sich eindeutig als Kerker.
»Die Sache mit dem Keller«, sagt Onkel Carter mit stählerner Stimme, »habe ich vollständig unter Kontrolle.«
»Da bin ich nicht so sicher. Heute ist fast etwas aus seinem Gehege entkommen, als ich vorhin unten war.« Die Worte rutschen mir heraus, bevor ich überhaupt weiß, dass ich sie aussprechen will. Alle drehen sich zu mir um und starren mich an, als wäre ich ein besonders fieses Untier.
Ich sollte es bereuen, überhaupt etwas gesagt zu haben, aber ab und an mal die Familie aufzustacheln, ist das Einzige, was die Klausur erträglich macht.
»Dort unten ist alles sicher, Clementine«, sagt meine Mutter, die Augen zu so schmalen Schlitzen verzogen, dass ich nur noch einen winzigen Streifen Blau sehe. »Du musst mit diesen Falschmeldungen aufhören.«
»Das war keine Falschmeldung«, entgegne ich, ziehe den Finger durch den Guss auf meinem Stück Kuchen und lecke ihn ab. »Frag Onkel Carter.«
Aller Augen wenden sich schweigend meinem Onkel zu, der Calder-Academy-rot wird.
»Das ist einfach nicht wahr. Unsere Security ist erstklassig. Da brauchst du dir gar keine Gedanken zu machen, Camilla«, poltert er und sein Ziegenbärtchen bebt beleidigt.
Ich denke darüber nach, mein Telefon rauszuholen und diese ganze Scharade auffliegen zu lassen, aber das wäre den Hausarrest nicht wert, den ich dann ganz sicher bekommen würde.
Stattdessen senke ich also den Kopf. Diesmal tätschelt Onkel Brandt meine Schulter und kurz ist mir nach Weinen zumute. Nicht wegen meiner Mom, sondern weil sein Lächeln mich so sehr an das seiner Tochter – meiner Cousine Carolina – erinnert, die vor ein paar Monaten starb, nachdem sie aus dem schrecklichsten Gefängnis der paranormalen Welt entkommen war.
Man schickte sie dorthin, als wir beide in der neunten Klasse waren, und nicht ein Tag vergeht, an dem ich sie nicht vermisse. Und das Wissen, dass sie jetzt für immer fort ist, hat diesen Schmerz noch viel größer gemacht.
Meine Mutter fährt mit ihrer Tagesordnung fort, aber nach ein paar weiteren Minuten blende ich sie aus.
Gerade als ich die Freiheit schmecken kann, reicht sie Onkel Christopher den Hammer zurück.
»Unser letzter Tagesordnungspunkt heute ist ein wenig familiärer.« Er grinst stolz, ebenso wie meine Tante Lucinda, die vor Begeisterung auf ihrem Stuhl herumrutscht.
Die Spannung dauert mehrere Sekunden an, dann verkündet Onkel Christopher: »Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Caspian zur frühzeitigen Aufnahme ins renommierte Programm für Paranormale Studien an der University of Salem zu gratulieren!«
Alle am Tisch brechen in Jubel aus, während ich einfach dasitze und mich fühle, als wäre ich von einer Klippe gestoßen worden.
7Die Essigchips einfach mal fallen lassen
»HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!« Tante Carmen hebt ihre Teetasse.
»Das sind fantastische Neuigkeiten!« Onkel Carter springt auf und stößt in dem Bemühen, der Erste zu sein, der Caspian auf den Rücken klopft, seinen Stuhl um.
Die anderen folgen ihm schnell und es dauert nicht lange, da aalt mein Cousin sich in all der Aufmerksamkeit und den Glückwünschen.
Ich zwinge mich dazu, zu ihm zu gehen und ihn zu umarmen. Immerhin ist es nicht seine Schuld, dass mir der Kopf schwirrt. Genauso wenig wie es seine Schuld ist, dass meine Mutter nicht einmal einen Blick in meine Richtung wirft.
Sie hat mir verboten, Bewerbungen rauszuschicken.
Sie sagte, ich könne nicht gehen – dass keiner aus unserer vierten Generation die Insel verlassen könne, um ans College zu gehen.
Sie fragte sogar, warum ich nicht mehr wie Caspian sein könne und mich einfach darüber freuen, dass ich nach dem Abschluss auf der Insel bleibe – die Akademie übernehmen, wie es mir und uns bestimmt ist.
Und jetzt finde ich heraus, dass er sich schon die ganze Zeit beworben hat? Dass seine Eltern ihn unterstützt haben?
Wut überkommt mich, als ich Caspian umarme.
Er mag ja ein Depp sein, aber ich nehme ihm nicht übel, dass er eine Chance gefunden hat, von der Insel herunterzukommen, und sie ergriffen hat.
Aber meine Mutter? Ihr nehme ich das definitiv übel.
»Herzlichen Glückwunsch!«, sage ich zu meinem Cousin, als er mich endlich loslässt.
Er strahlt mich an, seine leuchtend blauen Augen glänzen in seiner kupferfarbenen Haut. »Danke, Clementine! Ich kann gar nicht abwarten zu erfahren, wo du hingehst.«
Mein Magen sackt ab, denn was soll ich dazu sagen?
Warum haben Caspian und ich uns zuvor nicht übers College unterhalten? Warum habe ich einfach auf meine Mutter gehört, wo ich doch weiß, dass sie gerne mal falsches Spiel mit der Wahrheit spielt?
Ich zwinge mich zu einem Lächeln, während ich überlege, was ich antworten soll, da stößt Carlotta mich mit dem Ellbogen aus dem Weg, um Caspian zu gratulieren.
Ich versuche mich zu beruhigen, sage mir, dass ich immer noch Zeit habe, um mich überall da zu bewerben, wo ich hinwill. Ich stecke hier nicht fest. Ich kann nach meinem Abschluss immer noch zusehen, wie diese Insel hinter mir zurückbleibt.
Ihre Kontrolle über mich ist fast vorbei.
Dieser Gedanke lässt mich den Rest der Klausur durchstehen. Er lässt mich Caspians lächerlich pompöse Ansprache und Onkel Christophers stolzes Geprahle durchstehen. Lässt mich sogar die Weigerung meiner Mutter durchstehen, mir in die Augen zu sehen.
Doch in der Sekunde, in der das Meeting aufgehoben wird, renne ich zur Tür.
Meine Mutter konfrontiere ich morgen mit meinen sehr berechtigten Beschwerden. Heute Abend muss ich so weit weg von ihr und dem Rest meiner Familie, wie es nur geht.
Grandma ruft mir hinterher, als ich den Flur hinabstürze, aber ich drehe mich nicht um. Denn sonst breche ich in Tränen aus. Tränen sind gezeigte Gefühle und Gefühle sind Schwächen. Meine Mutter respektiert keine Schwäche. Also renne ich einfach weiter, um meine Tränen zu kaschieren.
Mein Telefon vibriert genau in dem Moment, in dem ich die Hütte erreiche. Ein Teil von mir denkt, dass es meine Mom ist, die verlangt, dass ich zu ihr komme zum Reden, aber an der Front ist alles ruhig. Es ist Serena.
Serena
Ich hoffe, Flavias Karottenkuchen hat’s erträglicher gemacht. Ich will alle fiesen Details hören
Ich
Hat geholfen, aber es gibt nicht genug Karottenkuchen auf der ganzen Welt
Serena
Ich mach’s endlich
Ich
Was?
Serena
Meinen ersten Zauber ausprobieren
Serena
Heute Nacht ist Vollmond. Ich habe alle Zutaten gesammelt, die ich brauche. Sobald es dunkel wird, zeichne ich einen Kreis, rufe den Mond und tue es
Ich schicke ein Party-Gif.
Ich
Was für einen Zauber?
Serena
Ein Glückszauber. Ich habe immer noch keinen neuen Job und die Miete wird fällig
Ich
Warum wirkst du nicht einfach einen Wohlstandszauber? Dann hast du Zeit, um etwas zu finden
Serena
Alle Bücher sagen, das soll man nicht machen. Wohlstandszauber gehen immer nach hinten los. Aber ich habe morgen ein Vorstellungsgespräch, also hoffe ich, dass Glück mir dabei hilft, den Job zu kriegen
Ich
Du wirst das toll machen, mit oder ohne den Zauber. Schick mir Bilder von dem Kreis!
Serena
Mach ich! Wünsch mir Glück!
Ich
Immer <3
Ich denke kurz darüber nach, Serena anzurufen und ihr davon zu erzählen, was mit meiner Mom passiert ist, aber sie wirkt in den Nachrichten so glücklich und vorfreudig auf ihren ersten Zauber, dass ich ihr die Laune auf keinen Fall verderben will.
Das Licht auf der Veranda geht an und die Motten drängen sich sofort darum. Eine Sekunde später steckt Eva den Kopf aus der Tür. »Kommst du rein?«, fragt sie. Dann wirft sie einen Blick auf mein Gesicht und sagt: »Oh-oh, schlimme Klausur?«
»Schlimmes Alles«, antworte ich und gehe rein.
Sie guckt Wednesday auf Netflix und auf dem Sofatisch steht eine halb leere Schüssel M&Ms. »Anscheinend bin ich nicht die Einzige, die einen schlimmen Tag hatte.«
»Kerle sind scheiße«, antwortet sie.
»Und Mütter auch.« Ich lasse mich vornüber auf das blaue Samtsofa fallen, das den größten Teil unserer Sitzecke einnimmt, und vergrabe mein Gesicht in einem der leuchtend lila Kissen.
»Und Englischlehrer.«
Sie setzt sich ans Ende des Sofas und ein paar Sekunden später höre ich, wie sie mit der M&Ms-Schüssel neben meinem Ohr rasselt. »Schokolade macht alles besser.«
»Ich bin nicht sicher, ob sie hier helfen kann«, stöhne ich. Trotzdem nehme ich mir ein paar. »Was hat Amari getan?«
Sie schnaubt. »Mich mit einer Meerjungfrau betrogen.«
»Was für ein Arschloch!«
»Es war ja nicht meine große Liebe oder so.« Sie zuckt mit den Schultern. »Aber ich mochte den großen Trottel.«
Der Leopardenwandler hat leider einen Ruf als Fuckboy. »Wie hast du es rausgefunden?«
»Sie war im Theater, hat vor ihren Freundinnen mit ihrem Fick angegeben und dass ich ›keine Ahnung‹ hätte. Sie wusste nicht, dass ich hinter der Bühne war und Kulissen gemalt habe.« Sie durchwühlt die Schüssel, bis sie eine Handvoll grüne M&Ms zusammen hat, dann wirft sie sich eins nach dem anderen in den Mund. »Kurz habe ich mir wirklich gewünscht, Zugriff auf meine Magie zu haben.«
»Ich kann sie für dich hauen«, biete ich an. »Ich weiß, das ist nicht dasselbe, aber es könnte amüsant sein.«
Eva zuckt erneut die Schultern. »Sie ist es nicht wert. Obwohl ich darüber nachgedacht habe, Amari zu hauen, als ich ihn damit konfrontiert habe und er versucht hat, es auf mich zu schieben.«
»Auf dich? Wieso?«
»Weil ich ihn ›nicht verstehe‹. Und weil er mit seinem Schwanz denkt, klar.« Sie greift wieder nach der Schüssel und dieses Mal wählt sie alle orangefarbenen M&Ms aus. »Und jetzt erzähl, was war bei dir?«
»Caspian geht an die Uni in Salem.«
»Was? Ich dachte, ihr könntet nicht …«
»Anscheinend gilt diese Regel nur für mich. Caspian darf machen, was er will.«
»Wow. Das ist nicht cool.« Sie reicht mir die Schüssel. »Was hat deine Mom gesagt?«