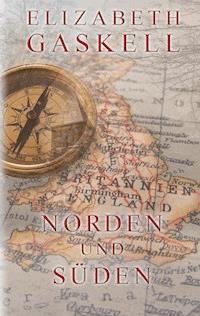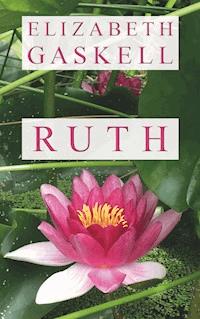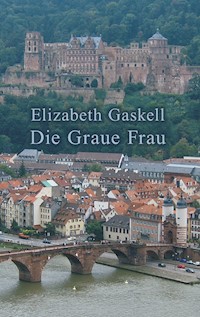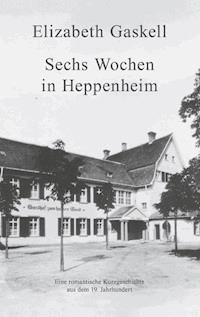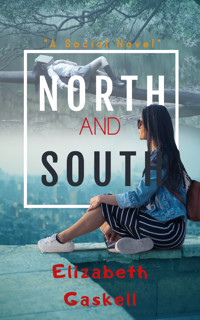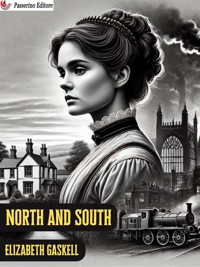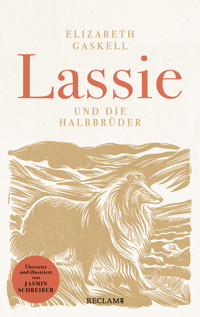2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Cranford" entführt uns Elizabeth Gaskell in das beschauliche Leben einer englischen Kleinstadt des 19. Jahrhunderts. Der Roman, in einem charmanten, erzählerischen Stil verfasst, zeichnet ein lebendiges Bild der sozialen Betrachtungen und der alltäglichen Gepflogenheiten von Frauen in einer von Männern dominierten Gesellschaft. Gaskells Meisterschaft liegt in der detaillierten Beschreibung ihrer Charaktere und der subtilen Kritik an sozialen Normen, wodurch sie ein vielschichtiges Porträt der damaligen Gesellschaft entwirft. Die Erzählung ist reich an Humor und Melancholie, während die Protagonisten – insbesondere die eigenwilligen Frauen – in ihren wunderlichen, oft nostalgischen Alltagsgeschichten lebendig werden. Elizabeth Gaskell, eine bedeutende Stimme der viktorianischen Literatur, schrieb "Cranford" inspiriert von ihren eigenen Erfahrungen in einer ähnlichen Gemeinde. Sie förderte die Empathie für das weibliche Dasein und reflektierte dabei oft die Herausforderungen und den Zusammenhalt der weiblichen Gemeinschaft. Gaskells eigene, oft von Verlusten geprägte Lebensgeschichte gibt dem Buch eine authentische Tiefe, die den Leser nachdenklich zurücklässt. "Cranford" ist nicht nur eine unterhaltsame Lektüre, sondern auch eine gesellschaftskritische Analyse, die moderne Leser ansprechen wird. Durch die lebendige Darstellung des Lebens der Frauen in dieser Zeit können Leser die zeitlosen Kämpfe und Errungenschaften des weiblichen Geschlechts nachvollziehen. Dieses Buch ist eine wertvolle Ergänzung für jedes literarische Regal und ein Muss für jeden Liebhaber klassischer Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cranford
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I. Unsere Gesellschaft
Zunächst einmal ist Cranford im Besitz der Amazonen; alle Besitzer von Häusern, die eine bestimmte Miete übersteigen, sind Frauen. Wenn ein Ehepaar in die Stadt kommt, um sich dort niederzulassen, verschwindet der Herr irgendwie; entweder hat er ziemliche Angst, der einzige Mann auf den Abendgesellschaften in Cranford zu sein, oder er wird damit entschuldigt, dass er die ganze Woche über bei seinem Regiment, auf seinem Schiff oder geschäftlich in der großen benachbarten Handelsstadt Drumble, die nur zwanzig Meilen mit der Eisenbahn entfernt ist, beschäftigt ist. Kurz gesagt, was auch immer aus den Herren wird, sie sind nicht in Cranford. Was könnten sie tun, wenn sie dort wären? Der Chirurg hat seine Visite im Umkreis von dreißig Meilen und übernachtet in Cranford; aber nicht jeder kann Chirurg sein. Für die Pflege der gepflegten Gärten voller erlesener Blumen, in denen kein Unkraut zu sehen ist; für das Verscheuchen kleiner Jungen, die durch das Gitter sehnsüchtig auf die besagten Blumen blicken; für das Verjagen der Gänse, die sich gelegentlich in die Gärten wagen, wenn die Tore offen gelassen werden; für die Entscheidung aller Fragen der Literatur und Politik, ohne sich mit unnötigen Gründen oder Argumenten aufzuhalten; für die Erlangung klarer und korrekter Kenntnisse über die Angelegenheiten aller in der Gemeinde; für die Aufrechterhaltung der tadellosen Ordnung ihrer Dienstmädchen; für ihre (etwas diktatorische) Freundlichkeit gegenüber den Armen und ihre wirklich liebevollen, guten Ämter füreinander, wann immer sie in Not sind, sind die Damen von Cranford völlig ausreichend. „Ein Mann“, wie eine von ihnen mir einmal sagte, „ist so im Weg im Haus!“ Obwohl die Damen von Cranford alle Vorgänge der jeweils anderen kennen, sind sie den Meinungen der anderen gegenüber äußerst gleichgültig. Da jede von ihnen ihre eigene Individualität, um nicht zu sagen Exzentrizität, ziemlich stark entwickelt hat, ist nichts so einfach wie verbale Vergeltung; aber irgendwie herrscht unter ihnen ein beträchtliches Maß an gutem Willen.
Die Damen von Cranford haben nur gelegentlich einen kleinen Streit, der sich in ein paar scharfen Worten und wütenden Kopfbewegungen äußert; gerade genug, um zu verhindern, dass der gleichmäßige Tenor ihres Lebens zu flach wird. Ihre Kleidung ist sehr unabhängig von der Mode; sie sagen sich: „Was bedeutet es schon, wie wir uns hier in Cranford kleiden, wo uns doch jeder kennt?“ Und wenn sie das Haus verlassen, ist ihre Begründung ebenso überzeugend: „Was bedeutet es schon, wie wir uns hier kleiden, wo uns doch niemand kennt?“ Die Materialien ihrer Kleidung sind im Allgemeinen gut und schlicht, und die meisten von ihnen sind fast so gewissenhaft wie Fräulein Tyler, deren Erinnerung noch rein ist; aber ich kann dafür garantieren, dass das letzte Keulenstück, der letzte enge und knappe Petticoat, der in England getragen wurde, in Cranford gesehen wurde – und zwar ohne ein Lächeln.
Ich kann einen prächtigen roten Seidenschirm der Familie bezeugen, unter dem eine sanfte kleine Jungfer, die von vielen Brüdern und Schwestern allein zurückgelassen wurde, an Regentagen zur Kirche schlenderte. Gibt es in London rote Seidenschirme? Wir hatten eine Tradition des ersten, der jemals in Cranford gesehen wurde; und die kleinen Jungen belagerten ihn und nannten ihn „einen Stock in Petticoats“. Es könnte genau der rote Seidenschirm gewesen sein, den ich beschrieben habe, gehalten von einem starken Vater über einer Schar kleiner Kinder; die arme kleine Dame – die Überlebende von allen – konnte ihn kaum tragen.
Dann gab es Regeln und Vorschriften für Besuche und Anrufe; und diese wurden den jungen Leuten, die sich möglicherweise in der Stadt aufhielten, mit all der Feierlichkeit verkündet, mit der einst die alten Gesetze der Manx einmal im Jahr auf dem Tinwald-Hügel verlesen wurden.
„Unsere Freunde haben sich erkundigt, wie es dir nach deiner Reise heute Abend geht, meine Liebe“ (24 km in einer Kutsche für Gentlemen); „sie werden dir morgen etwas Ruhe gönnen, aber ich habe keinen Zweifel, dass sie am nächsten Tag vorbeikommen werden; du kannst also ab zwölf Uhr frei sein – von zwölf bis drei Uhr sind unsere Besuchszeiten.“
Dann, nachdem sie angerufen hatten –
„Es ist der dritte Tag; ich wage zu behaupten, dass deine Mutter dir gesagt hat, meine Liebe, dass du zwischen dem Erhalt eines Besuchs und der Erwiderung nie mehr als drei Tage verstreichen lassen sollst; und auch, dass du nie länger als eine Viertelstunde bleiben sollst.“
„Aber soll ich auf meine Uhr schauen? Wie soll ich herausfinden, wann eine Viertelstunde vergangen ist?“
„Sie müssen immer an die Zeit denken, meine Liebe, und dürfen sie nicht im Gespräch vergessen.“
Da jeder diese Regel im Hinterkopf hatte, wurde natürlich nie über ein interessantes Thema gesprochen, egal ob man einen Besuch erhielt oder einen machte. Wir hielten uns an kurze Sätze des Smalltalks und waren pünktlich.
Ich kann mir vorstellen, dass einige der vornehmen Leute in Cranford arm waren und Schwierigkeiten hatten, über die Runden zu kommen; aber sie waren wie die Spartaner und verbargen ihre Klugheit unter einem lächelnden Gesicht. Wir sprachen nie über Geld, denn dieses Thema roch nach Kommerz und Handel, und auch wenn einige arm sein könnten, waren wir alle aristokratisch. Die Cranfordianer hatten diesen freundlichen Korpsgeist, der sie alle Unzulänglichkeiten im Erfolg übersehen ließ, wenn einige von ihnen versuchten, ihre Armut zu verbergen. Als Frau Forrester zum Beispiel eine Party in ihrem winzigen Haus gab und das kleine Mädchen die Damen auf dem Sofa mit der Bitte störte, das Teetablett hervorzuholen, hielten alle dieses neuartige Vorgehen für die natürlichste Sache der Welt und sprachen über Haushaltsformen und -zeremonien, als ob wir alle glaubten, dass unsere Gastgeberin eine richtige Dienerschaft mit einem zweiten Tisch, einer Haushälterin und einem Verwalter hatte, anstelle des einen kleinen Waisenhausmädchen, deren kurze, rötliche Arme niemals stark genug gewesen wären, um das Tablett nach oben zu tragen, wenn sie nicht von ihrer Herrin, die nun in ihrer Würde saß und vorgab, nicht zu wissen, welche Kuchen nach oben geschickt wurden, obwohl sie es wusste, und wir es wussten, und sie wusste, dass wir es wussten, und wir wussten, dass sie wusste, dass wir es wussten, ihr den ganzen Morgen lang dabei geholfen hätte, Teegebäck und Biskuitkuchen zu backen.
Aus dieser allgemeinen, aber nicht zugegebenen Armut und dieser sehr anerkannten Vornehmheit ergaben sich ein oder zwei Konsequenzen, die nicht unangebracht waren und die in vielen Kreisen der Gesellschaft zu ihrer großen Verbesserung eingeführt werden könnten. Zum Beispiel hielten die Einwohner von Cranford früh Feierabend und klapperten gegen neun Uhr abends unter der Führung eines Laternenträgers in ihren Holzschuhen nach Hause; und um halb elf war die ganze Stadt im Bett und schlief. Außerdem galt es als „vulgär“ (ein ungeheuerliches Wort in Cranford), bei den Abendveranstaltungen etwas Teuereres in Form von Ess- oder Trinkbarem zu geben. Die ehrenwerte Frau Jamieson gab nur Butterbrote und Biskuits, und sie war die Schwägerin des verstorbenen Earl of Glenmire, obwohl sie eine so „elegante Sparsamkeit“ praktizierte.
„Elegante Sparsamkeit!“ Wie natürlich man in die Ausdrucksweise von Cranford zurückfällt! Dort war Sparsamkeit stets „elegant“, und Geld auszugeben immer „vulgär und prahlerisch“; eine Art von sauren Trauben-Philosophie, die uns sehr friedlich und zufrieden machte. Ich werde nie das Entsetzen vergessen, das aufkam, als ein gewisser Hauptmann Brown nach Cranford zog und offen über seine Armut sprach – nicht im Flüsterton zu einem vertrauten Freund, nachdem Türen und Fenster zuvor geschlossen worden waren, sondern auf der öffentlichen Straße! Mit lauter, militärischer Stimme! Und er führte seine Armut als Grund an, warum er ein bestimmtes Haus nicht nehmen konnte. Die Damen von Cranford waren ohnehin schon recht bestürzt über die Invasion ihres Territoriums durch einen Mann und einen Gentleman. Er war ein Hauptmann im Ruhestand und hatte eine Anstellung bei einer nahegelegenen Eisenbahn erhalten, gegen die die kleine Stadt heftig protestiert hatte; und wenn er zusätzlich zu seinem männlichen Geschlecht und seiner Verbindung mit der verhassten Eisenbahn auch noch so dreist war, offen über Armut zu sprechen – nun, dann musste er wirklich nach Coventry geschickt werden. Der Tod war ebenso wahr und ebenso alltäglich wie Armut; doch darüber sprach man nie laut auf der Straße. Es war ein Wort, das man nicht vor feinen Ohren erwähnte. Wir hatten stillschweigend vereinbart, zu ignorieren, dass irgendjemand, mit dem wir auf gleicher gesellschaftlicher Ebene verkehrten, jemals durch Armut daran gehindert werden könnte, etwas zu tun, was er wollte. Wenn wir zu einer Gesellschaft zu Fuß gingen oder von dort zurückkehrten, dann war es, weil die Nacht so schön oder die Luft so erfrischend war, nicht etwa, weil Sänften teuer waren. Wenn wir Baumwollstoffe statt Sommerseide trugen, dann war es, weil wir ein waschbares Material bevorzugten; und so weiter, bis wir uns selbst die vulgäre Tatsache verklärten, dass wir alle Menschen mit sehr bescheidenen Mitteln waren. Natürlich wussten wir daher nicht, was wir von einem Mann halten sollten, der über Armut sprach, als sei sie keine Schande. Und doch schaffte es Hauptmann Brown irgendwie, sich in Cranford Respekt zu verschaffen, und wurde besucht, trotz aller gegenteiligen Vorsätze. Ich war überrascht, seine Ansichten als Autorität zitiert zu hören, als ich etwa ein Jahr nach seiner Ansiedlung Cranford besuchte. Meine eigenen Freunde hatten noch zwölf Monate zuvor zu den erbittertsten Gegnern jeglichen Vorschlags gehört, den Hauptmann und seine Töchter zu besuchen; und nun wurde er sogar in den tabuisierten Stunden vor zwölf Uhr empfangen. Zugegeben, es war, um die Ursache eines rauchenden Kamins zu ergründen, bevor das Feuer angezündet wurde; aber dennoch stieg Hauptmann Brown unerschrocken die Treppe hinauf, sprach mit einer Stimme, die viel zu groß für das Zimmer war, und scherzte ganz wie ein zahmer Mann im Haus. Er hatte all die kleinen Kränkungen und das Auslassen trivialer Förmlichkeiten, mit denen er empfangen worden war, nicht beachtet. Er war freundlich gewesen, obwohl die Damen von Cranford kühl geblieben waren; er hatte kleine sarkastische Komplimente gutgläubig beantwortet; und mit seiner männlichen Offenheit hatte er all die Zurückhaltung überwunden, die ihm als einem Mann entgegenschlug, der sich nicht schämte, arm zu sein. Schließlich hatten sein ausgezeichneter männlicher gesunder Menschenverstand und seine Fähigkeit, Lösungen für häusliche Probleme zu finden, ihm eine außergewöhnliche Stellung als Autorität unter den Damen von Cranford verschafft. Er selbst ging seinen Weg weiter, ebenso unbewusst von seiner Beliebtheit wie zuvor von der Ablehnung; und ich bin sicher, er war eines Tages überrascht, als er feststellte, dass sein Rat so hoch geschätzt wurde, dass ein Ratschlag, den er im Scherz gegeben hatte, in aller Ernsthaftigkeit befolgt wurde.
Es handelte sich um Folgendes: Eine alte Dame besaß eine Alderney-Kuh, die sie wie eine Tochter betrachtete. Man konnte keinen kurzen Viertelstundenbesuch bei ihr machen, ohne von der wunderbaren Milch oder der erstaunlichen Intelligenz dieses Tieres zu hören. Die ganze Stadt kannte und schätzte Miss Betsy Barkers Alderney-Kuh; daher war das Mitgefühl und Bedauern groß, als die arme Kuh in einem unachtsamen Moment in eine Kalkgrube stürzte. Sie brüllte so laut, dass man sie bald hörte und rettete; doch inzwischen hatte das arme Tier den größten Teil seines Fells verloren und kam nackt, frierend und elend in bloßer Haut wieder heraus. Jeder bedauerte das Tier, obwohl einige ihr Lächeln über ihr komisches Aussehen nicht unterdrücken konnten. Miss Betsy Barker weinte regelrecht vor Kummer und Bestürzung; und es hieß, sie habe daran gedacht, ein Ölbad auszuprobieren. Dieses Mittel wurde ihr vielleicht von jemandem aus der Schar der Ratgeber empfohlen, die sie um Rat fragte; doch der Vorschlag, falls er je gemacht wurde, wurde von Hauptmann Browns entschiedener Bemerkung zunichtegemacht: „Besorgen Sie ihr ein Flanellunterhemd und Flanellunterhosen, gnädige Frau, wenn Sie sie am Leben halten wollen. Aber mein Rat ist, töten Sie das arme Geschöpf sofort.“
Fräulein Betsy Barker trocknete sich die Augen und dankte dem Captain herzlich; sie machte sich an die Arbeit, und nach und nach kam die ganze Stadt heraus, um zu sehen, wie die Alderney-Kuh in dunkelgrauem Flanell gekleidet sanftmütig auf ihre Weide ging. Ich habe sie selbst schon oft beobachtet. Sehen Sie in London jemals Kühe in grauem Flanell?
Hauptmann Brown hatte ein kleines Haus am Stadtrand gemietet, in dem er mit seinen beiden Töchtern lebte. Er musste damals, als ich Cranford nach meiner Zeit dort als Bewohnerin zum ersten Mal wieder besuchte, über sechzig Jahre alt gewesen sein. Doch er hatte eine drahtige, gut trainierte, elastische Gestalt, einen steifen, militärischen Rückschwung des Kopfes und einen federnden Schritt, die ihn viel jünger erscheinen ließen, als er tatsächlich war. Seine älteste Tochter sah fast so alt aus wie er selbst und verriet damit, dass sein wahres Alter höher war, als es den Anschein hatte. Fräulein Brown musste etwa vierzig Jahre alt sein; sie hatte einen kränklichen, schmerzvollen, sorgenvollen Ausdruck im Gesicht und wirkte, als sei die Fröhlichkeit der Jugend längst aus ihrem Leben verschwunden. Selbst in ihrer Jugend musste sie schlicht und markant ausgesehen haben. Fräulein Jessie Brown war zehn Jahre jünger als ihre Schwester und zwanzig Nuancen hübscher. Ihr Gesicht war rund und von Grübchen geziert. Fräulein Jenkyns sagte einmal, in einem Anfall von Ärger gegen Hauptmann Brown (dessen Ursache ich Ihnen gleich erzählen werde), „dass sie es für an der Zeit hielt, dass Fräulein Jessie ihre Grübchen ablegte und aufhörte, immer wie ein Kind aussehen zu wollen.“ Es war wahr, dass etwas Kindliches in ihrem Gesicht lag; und ich glaube, das wird so bleiben, bis sie stirbt, selbst wenn sie hundert Jahre alt werden sollte. Ihre Augen waren große, blaue, staunende Augen, die einen direkt ansahen; ihre Nase war unvollkommen und stupsig, und ihre Lippen waren rot und feucht. Sie trug ihr Haar in kleinen Reihen von Locken, die diesen Eindruck noch verstärkten. Ich weiß nicht, ob sie hübsch war oder nicht; aber ich mochte ihr Gesicht, und das tat jeder, und ich glaube nicht, dass sie ihre Grübchen hätte unterdrücken können. Sie hatte etwas von der beschwingten Haltung und Art ihres Vaters; und jede weibliche Beobachterin hätte einen leichten Unterschied in der Kleidung der beiden Schwestern bemerkt – die von Fräulein Jessie war etwa zwei Pfund pro Jahr teurer als die von Fräulein Brown. Zwei Pfund waren eine beträchtliche Summe in den jährlichen Ausgaben von Hauptmann Brown.
Diesen Eindruck machte die Familie Brown auf mich, als ich sie zum ersten Mal alle zusammen in der Kirche von Cranford sah. Den Captain hatte ich schon einmal getroffen – anlässlich des rauchigen Kamins, den er durch eine einfache Änderung des Kaminsystems behoben hatte. In der Kirche hielt er während des Morgenliedes seine Doppelbrille an die Augen, richtete dann seinen Kopf auf und sang laut und fröhlich. Er antwortete lauter als der Küster – ein alter Mann mit einer schwachen, piepsenden Stimme, der sich, wie ich glaube, über den sonoren Bass des Kapitäns ärgerte und infolgedessen immer höher und höher zitterte.
Als der lebhafte Captain die Kirche verließ, schenkte er seinen beiden Töchtern die galanteste Aufmerksamkeit. Er nickte und lächelte seinen Bekannten zu, aber er schüttelte niemandem die Hand, bis er Fräulein Brown geholfen hatte, ihren Regenschirm aufzuspannen, ihr das Gebetbuch abgenommen und geduldig gewartet hatte, bis sie mit zitternden, nervösen Händen ihr Kleid hochgehoben hatte, um durch die nassen Straßen zu gehen.
Ich frage mich, was die Damen von Cranford mit Captain Brown auf ihren Partys gemacht haben. Früher hatten wir uns oft darüber gefreut, dass es bei den Kartenpartys keinen Gentleman gab, um den man sich kümmern und mit dem man sich unterhalten konnte. Wir hatten uns über die Gemütlichkeit der Abende gefreut; und in unserer Liebe zur Vornehmheit und Abneigung gegen die Menschheit hatten wir uns fast selbst davon überzeugt, dass ein Mann zu sein „vulgär“ sei; so dass ich mich sehr fragte, wie der Abend wohl verlaufen würde, als ich erfuhr, dass meine Freundin und Gastgeberin, Fräulein Jenkyns, eine Party zu meinen Ehren geben würde und dass der Kapitän und die Fräulein Browns eingeladen waren. Die Spieltische mit grünen Filzauflagen wurden wie üblich bei Tageslicht gedeckt; es war die dritte Novemberwoche, sodass es gegen vier Uhr dunkel wurde. Auf jedem Tisch standen Kerzen und saubere Kartenspiele. Das Feuer war entfacht; die ordentliche Magd hatte ihre letzten Anweisungen erhalten; und da standen wir, in unseren besten Kleidern, jeweils mit einem Kerzenanzünder in der Hand, bereit, uns auf die Kerzen zu stürzen, sobald das erste Klopfen ertönte. Partys in Cranford waren feierliche Festlichkeiten, bei denen sich die Damen in ihren besten Kleidern ernsthaft beschwingt fühlten. Sobald drei eingetroffen waren, setzten wir uns zum „Preference“, wobei ich die unglückliche Vierte war. Die nächsten vier Ankömmlinge wurden sofort an einen anderen Tisch gesetzt; und bald darauf wurden die Teetabletts, die ich morgens beim Reingehen im Vorratsraum hatte ausliegen sehen, jeweils in die Mitte eines Kartentisches gestellt. Das Porzellan war zart wie Eierschalen; das altmodische Silber glänzte vom Polieren; aber die Speisen waren von der bescheidensten Art. Während die Tabletts noch auf den Tischen standen, kamen der Kapitän und die Fräulein Browns herein; und ich konnte sehen, dass der Kapitän irgendwie bei allen anwesenden Damen beliebt war. Die gerunzelten Stirnfalten glätteten sich, die scharfen Stimmen senkten sich bei seiner Annäherung. Fräulein Brown sah krank aus und war fast bis zur Düsterkeit niedergeschlagen. Fräulein Jessie lächelte wie immer und schien fast so beliebt wie ihr Vater. Er nahm sofort und leise den Platz des Mannes im Raum ein; kümmerte sich um die Bedürfnisse aller, erleichterte der hübschen Magd die Arbeit, indem er leere Tassen und Damen ohne Brot und Butter bediente; und tat dies alles auf so leichte und würdevolle Weise und so sehr, als wäre es für den Starken selbstverständlich, sich um den Schwachen zu kümmern, dass er durch und durch ein wahrer Mann war. Er spielte um drei Penny-Punkte mit so großem Interesse, als wären es Pfund gewesen; und doch hatte er bei all seiner Aufmerksamkeit für Fremde ein Auge auf seine leidende Tochter – denn ich war mir sicher, dass sie litt, auch wenn sie in den Augen vieler nur reizbar zu sein schien. Fräulein Jessie konnte nicht Karten spielen, aber sie unterhielt sich mit den Kartengebern, die vor ihrem Kommen eher dazu neigten, gereizt zu sein. Sie sang auch auf einem alten, rissigen Klavier, das in seiner Jugend wohl ein Spinett gewesen war. Fräulein Jessie sang „Jock of Hazeldean“ ein wenig verstimmt; aber wir waren alle nicht musikalisch, obwohl Fräulein Jenkyns den Takt schlug, um den Eindruck zu erwecken, dass sie es tat.
Es war sehr nett von Fräulein Jenkyns, dies zu tun; denn ich hatte gesehen, dass sie sich kurz zuvor über Fräulein Jessie Browns unbedachtes Geständnis (in Bezug auf Shetlandwolle) geärgert hatte, dass sie einen Onkel hatte, den Bruder ihrer Mutter, der ein Ladenbesitzer in Edinburgh war. Fräulein Jenkyns versuchte, dieses Geständnis durch einen schrecklichen Hustenanfall zu übertönen – denn die ehrenwerte Frau Jamieson saß an einem Kartentisch in der Nähe von Fräulein Jessie, und was würde sie sagen oder denken, wenn sie herausfände, dass sie sich mit der Nichte eines Ladenbesitzers im selben Raum befand! Aber Fräulein Jessie Brown (die, wie wir uns alle am nächsten Morgen einig waren, kein Taktgefühl hatte) wiederholte die Information und versicherte Fräulein Pole, dass sie ihr die benötigte Shetlandwolle problemlos besorgen könne, „über meinen Onkel, der die beste Auswahl an Shetlandwaren in ganz Edinburgh hat“. Um uns den Geschmack zu nehmen und den Klang aus unseren Ohren zu bekommen, schlug Fräulein Jenkyns Musik vor; ich sage also wieder, es war sehr nett von ihr, den Takt zum Lied zu schlagen.
Als die Tabletts pünktlich um Viertel vor neun mit Keksen und Wein wieder auftauchten, entspann sich eine Unterhaltung, ein Vergleich der Karten und ein Besprechen der gespielten Stiche; doch nach und nach brachte Hauptmann Brown ein Stück Literatur ins Spiel.
„Haben Sie schon einige Hefte der ‚Pickwickier‘ gesehen?“ fragte er. (Sie wurden damals in Fortsetzungen veröffentlicht.) „Großartig!“
Fräulein Jenkyns war die Tochter eines verstorbenen Pfarrers von Cranford und hielt sich aufgrund einer Reihe von Manuskriptpredigten und einer recht guten Bibliothek über Theologie für literarisch gebildet und betrachtete jedes Gespräch über Bücher als Herausforderung für sich. Also antwortete sie und sagte: „Ja, sie hatte sie gesehen; in der Tat könnte sie sagen, dass sie sie gelesen hatte.“
„Und was halten Sie von ihnen?“, fragte Captain Brown. „Sind sie nicht berühmt berüchtigt gut?“
So gedrängt, konnte Fräulein Jenkyns nicht anders, als zu sprechen.
„Ich muss sagen, ich finde, sie sind keineswegs mit Dr. Johnson gleichzusetzen. Dennoch, vielleicht ist der Autor noch jung. Lassen wir ihn beharrlich weitermachen, und wer weiß, was aus ihm werden kann, wenn er den großen Doktor zu seinem Vorbild nimmt?“ Das war offenbar zu viel für Hauptmann Brown, um es gelassen hinzunehmen; und ich sah die Worte bereits auf seiner Zunge liegen, noch bevor Fräulein Jenkyns ihren Satz beendet hatte.
„Das ist etwas ganz anderes, meine liebe Dame“, begann er.
„Das ist mir durchaus bewusst“, entgegnete sie. „Und ich nehme Rücksicht, Herr Hauptmann Brown.“
„Erlauben Sie mir, Ihnen eine Szene aus der diesjährigen Ausgabe vorzulesen“, bat er. „Ich habe sie erst heute Morgen erhalten und ich glaube nicht, dass die Firma sie schon gelesen hat.“
„Wie Sie wünschen“, sagte sie und ließ sich mit einem resignierten Gesichtsausdruck nieder. Er las den Bericht über den „Swarry“, den Sam Weller in Bath gegeben hatte. Einige von uns lachten herzlich. Ich wagte es nicht, weil ich im Haus blieb. Fräulein Jenkyns saß mit geduldiger Ernsthaftigkeit da. Als er zu Ende war, wandte sie sich mir zu und sagte mit milder Würde:
„Holen Sie mir bitte “Rasselas„ aus dem Bücherzimmer.“
Als ich es ihr gebracht hatte, wandte sie sich an Hauptmann Brown—
„Erlauben Sie mir nun, Ihnen eine Szene vorzulesen, und dann kann die anwesende Gesellschaft zwischen Ihrem Favoriten, Herr Boz, und Dr. Johnson, entscheiden.“
Sie las eine der Unterhaltungen zwischen Rasselas und Imlac mit hoher, majestätischer Stimme vor. Als sie geendet hatte, sagte sie: „Ich denke, ich bin jetzt in meiner Vorliebe für Dr. Johnson als Romanautor bestätigt.“ Der Kapitän presste die Lippen zusammen und trommelte auf dem Tisch herum, aber er sagte nichts. Sie dachte, sie würde ihm noch den einen oder anderen Schlag versetzen.
„Ich halte es für vulgär und unter der Würde der Literatur, in Nummern zu veröffentlichen.“
„Wie wurde der Rambler veröffentlicht, Ma'am?“, fragte Captain Brown mit leiser Stimme, die Fräulein Jenkyns wohl nicht gehört haben konnte.
„Dr. Johnsons Stil ist ein Vorbild für junge Anfänger. Mein Vater hat ihn mir empfohlen, als ich anfing, Briefe zu schreiben – ich habe meinen eigenen Stil darauf aufgebaut; ich habe ihn Ihrem Liebling empfohlen.“
„Es würde mir sehr leid tun, wenn er seinen Stil gegen solch eine pompöse Schreibweise eintauschen würde“, sagte Captain Brown.
Fräulein Jenkyns empfand dies als eine persönliche Kränkung, auf eine Weise, die der Hauptmann sich nicht im Geringsten hätte ausmalen können. Briefliches Schreiben galt ihr und ihren Freundinnen als ihre Stärke. So manches Exemplar so mancher Briefe habe ich gesehen, die zunächst auf einer Schiefertafel geschrieben und korrigiert wurden, bevor sie „die halbe Stunde unmittelbar vor der Postzeit nutzte, um“ ihren Freundinnen dies oder jenes zu versichern; und Dr. Johnson war, wie sie sagte, ihr Vorbild in diesen Kompositionen. Sie richtete sich mit Würde auf und antwortete auf die letzte Bemerkung des Hauptmanns lediglich, indem sie mit betonter Nachdrücklichkeit auf jede Silbe sagte: „Ich ziehe Dr. Johnson Herrn Boz vor.“
Man sagt – ich bürge nicht für die Wahrheit dieser Behauptung –, dass Hauptmann Brown halblaut geäußert habe: „Verdammter Dr. Johnson!“ Falls er es tatsächlich gesagt haben sollte, zeigte er sich später reumütig, wie er bewies, indem er sich in die Nähe von Miss Jenkyns’ Lehnstuhl begab und versuchte, sie mit einem angenehmeren Gesprächsthema zu unterhalten. Doch sie war unerbittlich. Am nächsten Tag machte sie die Bemerkung, die ich bereits erwähnt habe, über Miss Jessies Grübchen.
Kapitel II. Der Kapitän
Es war unmöglich, einen Monat in Cranford zu leben, ohne die täglichen Gewohnheiten der jeweiligen Bewohner zu kennen; und lange vor dem Ende meines Besuchs wusste ich viel über das gesamte Brown-Trio. Es gab nichts Neues über ihre Armut zu entdecken; denn darüber hatten sie von Anfang an einfach und offen gesprochen. Sie machten kein Geheimnis aus der Notwendigkeit, sparsam zu sein. Alles, was noch zu entdecken war, war die unendliche Herzensgüte des Kapitäns und die verschiedenen Arten, in denen er sie unbewusst zum Ausdruck brachte. Einige kleine Anekdoten wurden noch eine Weile nach ihrem Auftreten besprochen. Da wir nicht viel lasen und alle Damen mit Dienstboten gut zurechtkamen, fehlte es an Gesprächsthemen. Wir sprachen daher über den Umstand, dass der Captain einer armen alten Frau an einem sehr rutschigen Sonntag das Abendessen aus den Händen genommen hatte. Er hatte sie getroffen, als er von der Kirche kam und aus dem Backhaus zurückkehrte, und bemerkte, dass sie unsicher auf den Beinen war; und mit der ernsten Würde, mit der er alles tat, nahm er ihr die Last ab und ging an ihrer Seite die Straße entlang, wobei er ihr gebackenes Hammelfleisch und die Kartoffeln sicher nach Hause trug. Das wurde für sehr exzentrisch gehalten; und man erwartete eher, dass er am Montagmorgen bei allen vorbeischauen würde, um sich zu erklären und sich beim Sinn für Anstand in Cranford zu entschuldigen: Aber er tat nichts dergleichen: Und dann wurde entschieden, dass er sich schämte und sich versteckt hielt. Aus Mitleid mit ihm begannen wir zu sagen: „Schließlich hat das Ereignis am Sonntagmorgen große Herzensgüte gezeigt“, und es wurde beschlossen, dass er bei seinem nächsten Auftritt unter uns getröstet werden sollte; aber siehe da! Er kam auf uns herab, unberührt von jeglichem Schamgefühl, sprach laut und mit tiefer Stimme wie immer, den Kopf in den Nacken geworfen, seine Perücke so keck und gut gelockt wie üblich, und wir mussten zu dem Schluss kommen, dass er alles vom Sonntag vergessen hatte .
Fräulein Pole und Fräulein Jessie Brown hatten auf Grundlage der Shetlandwolle und der neuen Strickmuster eine Art Vertrautheit entwickelt; so kam es, dass ich, wenn ich Fräulein Pole besuchte, mehr von den Browns sah, als ich es während meines Aufenthalts bei Fräulein Jenkyns getan hatte. Fräulein Jenkyns hatte sich nämlich nie über das hinwegsetzen können, was sie als Hauptmann Browns abfällige Bemerkungen über Dr. Johnson als Verfasser leichter und unterhaltsamer Literatur bezeichnete. Ich stellte fest, dass Fräulein Brown ernsthaft an einer langwierigen, unheilbaren Krankheit litt, deren Schmerzen den unruhigen Ausdruck auf ihrem Gesicht hervorriefen, den ich zuvor für ungemilderte Missmutigkeit gehalten hatte. Missmutig war sie allerdings auch zuweilen, wenn die nervöse Reizbarkeit, die ihre Krankheit mit sich brachte, unerträglich wurde. Fräulein Jessie ertrug sie in solchen Momenten mit einer Geduld, die noch größer war als die, mit der sie die bitteren Selbstvorwürfe hinnahm, die stets darauf folgten. Fräulein Brown beschuldigte sich nicht nur eines hastigen und reizbaren Temperaments, sondern auch, der Grund dafür zu sein, dass ihr Vater und ihre Schwester sich einschränken mussten, um ihr die kleinen Annehmlichkeiten zu ermöglichen, die in ihrem Zustand notwendig waren. Sie hätte so gerne Opfer für sie gebracht und ihre Sorgen erleichtert, dass die ursprüngliche Großzügigkeit ihres Wesens ihrer Gereiztheit noch Schärfe verlieh. All dies ertrugen Fräulein Jessie und ihr Vater nicht nur mit Gelassenheit, sondern mit wahrer Zärtlichkeit. Ich verzieh Fräulein Jessie ihr falsches Singen und ihre jugendliche Kleidung, als ich sie zu Hause sah. Ich begann zu verstehen, dass Hauptmann Browns dunkle Brutus-Perücke und sein gepolsterter Mantel (leider allzu oft abgetragen) Überbleibsel der militärischen Eleganz seiner Jugend waren, die er nun unbewusst trug. Er war ein Mann von unerschöpflichen Ressourcen, die er in seiner Garnisonserfahrung erworben hatte. Wie er gestand, konnte niemand seine Stiefel zu seiner Zufriedenheit putzen außer ihm selbst; doch tatsächlich war er sich nicht zu schade, der kleinen Dienstmagd die Arbeit in jeder Hinsicht zu erleichtern – wohl wissend, dass die Krankheit seiner Tochter die Stellung zu einer schweren machte.
Er bemühte sich, sich mit Fräulein Jenkyns bald nach dem denkwürdigen Streit, den ich genannt habe, durch ein Geschenk eines hölzernen Feuerschaufels (seine eigene Herstellung) zu versöhnen, nachdem er sie sagen hörte, wie sehr sie das Gitter einer eisernen Schaufel störte. Sie nahm das Geschenk mit kühler Dankbarkeit entgegen und dankte ihm förmlich. Als er gegangen war, bat sie mich, es in der Abstellkammer wegzuräumen; wahrscheinlich weil sie dachte, dass kein Geschenk von einem Mann, der Herrn Boz Herrn Dr. Johnson vorzog, weniger störend sein könnte als eine eiserne Feuerschaufel.
So war die Lage der Dinge, als ich Cranford verließ und nach Drumble ging. Ich hatte jedoch mehrere Korrespondenten, die mich über die Vorgänge in der lieben kleinen Stadt auf dem Laufenden hielten. Da war Fräulein Pole, die sich jetzt genauso sehr dem Häkeln widmete wie früher dem Stricken, und die in ihren Briefen etwa Folgendes schrieb: „Aber vergessen Sie nicht die weiße Kammgarn bei Flint“, wie es in dem alten Lied heißt; denn am Ende jedes Satzes mit Neuigkeiten kam eine neue Anweisung für einen Häkelauftrag, den ich für sie ausführen sollte. Fräulein Matilda Jenkyns (der es nichts ausmachte, Fräulein Matty genannt zu werden, wenn Fräulein Jenkyns nicht in der Nähe war) schrieb nette, freundliche, ausschweifende Briefe, in denen sie ab und zu ihre eigene Meinung äußerte; aber plötzlich riss sie sich zusammen und flehte mich entweder an, nicht zu nennen, was sie gesagt hatte, da Deborah anders dachte und sie es wusste, oder sie fügte ein Postskriptum mit dem Hinweis ein, dass sie seit dem Schreiben des oben Gesagten mit Deborah über das Thema gesprochen habe und nun ziemlich überzeugt sei, usw. – (hier folgte wahrscheinlich ein Widerruf jeder Meinung, die sie in dem Brief geäußert hatte). Dann kam Fräulein Jenkyns – Deborah, wie sie von Fräulein Matty genannt werden wollte, da ihr Vater einmal gesagt hatte, dass der hebräische Name so ausgesprochen werden sollte. Ich glaube insgeheim, dass sie sich die hebräische Prophetin zum Vorbild genommen hat; und in der Tat war sie der strengen Prophetin in mancher Hinsicht nicht unähnlich, wenn man natürlich die modernen Sitten und die unterschiedliche Kleidung berücksichtigt. Fräulein Jenkyns trug ein Halstuch und eine kleine Haube wie eine Jockeymütze und sah insgesamt wie eine willensstarke Frau aus; obwohl sie die moderne Vorstellung, dass Frauen den Männern gleichgestellt sind, verachtet hätte. Gleichberechtigt, in der Tat! Sie wusste, dass sie überlegen waren. Aber um auf ihre Briefe zurückzukommen. Alles in ihnen war würdevoll und großartig wie sie selbst. Ich habe sie mir angesehen (liebes Fräulein Jenkyns, wie sehr habe ich sie geehrt!) und ich werde einen Auszug daraus geben, insbesondere weil er sich auf unseren Freund Captain Brown bezieht:
„Die ehrenwerte Frau Jamieson hat mich soeben verlassen; und im Laufe unseres Gesprächs teilte sie mir die Neuigkeit mit, dass sie gestern einen Besuch von dem ehemaligen Freund ihres verehrten Gatten, Lord Mauleverer, erhalten habe. Sie werden kaum erraten, was seine Lordschaft in die bescheidenen Grenzen unserer kleinen Stadt geführt hat. Es war, um Hauptmann Brown zu sehen, mit dem seine Lordschaft, wie es scheint, in den ‚befiederten Kriegen‘ bekannt war und der das Privileg hatte, die Zerstörung von seiner Lordschafts Haupt abzuwenden, als eine große Gefahr über ihm schwebte, vor dem irreführend benannten Kap der Guten Hoffnung. Sie kennen unsere Freundin, die ehrenwerte Frau Jamieson, und ihre mangelnde Neigung zu unschuldiger Neugier, und daher werden Sie nicht allzu überrascht sein, wenn ich Ihnen sage, dass sie mir die genaue Natur der besagten Gefahr nicht offenlegen konnte. Ich war, ich gestehe es, neugierig zu erfahren, auf welche Weise Hauptmann Brown mit seinem bescheidenen Haushalt einen so erlauchten Gast empfangen konnte; und ich fand heraus, dass seine Lordschaft sich zur Ruhe begab – und, so wollen wir hoffen, zu erfrischendem Schlummer – im Angel Hotel, jedoch während der zwei Tage, die er Cranford mit seiner erhabenen Anwesenheit beehrte, die Mahlzeiten der Browns teilte. Frau Johnson, die freundliche Frau unseres Metzgers, informierte mich, dass Miss Jessie ein Lammkeule erwarb; doch abgesehen davon kann ich von keinerlei weiteren Vorbereitungen hören, die getroffen wurden, um einen so angesehenen Besucher angemessen zu empfangen. Vielleicht bewirteten sie ihn mit ‚dem Fest der Vernunft und dem Fluss der Seele‘; und für uns, die wir mit Hauptmann Browns bedauerlichem Mangel an Geschmack für ‚die reinen Quellen des unverdorbenen Englischen‘ vertraut sind, mag es ein Grund zur Freude sein, dass er die Gelegenheit hatte, seinen Geschmack durch den Umgang mit einem eleganten und kultivierten Mitglied der britischen Aristokratie zu verfeinern. Doch wer ist schon gänzlich frei von weltlichen Schwächen?“
Fräulein Pole und Fräulein Matty schrieben mir mit derselben Postzustellung. Eine Nachricht wie der Besuch von Lord Mauleverer durfte den Briefschreiberinnen von Cranford nicht entgehen: Sie machten das Beste daraus. Fräulein Matty entschuldigte sich demütig dafür, dass sie zur gleichen Zeit wie ihre Schwester geschrieben hatte, die viel besser als sie in der Lage war, die Ehre zu beschreiben, die Cranford zuteil wurde; aber trotz einiger Rechtschreibfehler gab mir Fräulein Mattys Bericht die beste Vorstellung von dem Aufruhr, den der Besuch seiner Lordschaft verursacht hatte, nachdem er stattgefunden hatte; denn außer den Leuten im Angel, den Browns, Frau Jamieson und einem kleinen Jungen, den seine Lordschaft beschimpft hatte , weil er einen schmutzigen Reifen gegen die Beine des Aristokraten geschossen hatte, konnte ich von niemandem hören, mit dem seine Lordschaft ein Gespräch geführt hatte.
Mein nächster Besuch in Cranford fand im Sommer statt. Seit meinem letzten Besuch hatte es weder Geburten, Todesfälle noch Hochzeiten gegeben. Alle wohnten im selben Haus und trugen fast alle die gleichen gut erhaltenen, altmodischen Kleider. Das größte Ereignis war, dass Fräulein Jenkyns einen neuen Teppich für den Salon gekauft hatte. Oh, wie viel Arbeit hatten Fräulein Matty und ich damit, die Sonnenstrahlen zu jagen, die an einem Nachmittag durch das fensterlose Fenster direkt auf diesen Teppich fielen! Wir breiteten Zeitungen über die Stellen aus und setzten uns zu unserem Buch oder unserer Arbeit; und siehe da! In einer Viertelstunde hatte sich die Sonne bewegt und brannte auf eine frische Stelle; und wieder gingen wir auf die Knie, um die Position der Zeitungen zu ändern. Wir waren auch einen ganzen Morgen lang sehr beschäftigt, bevor Fräulein Jenkyns ihre Party gab, indem wir ihren Anweisungen folgten und Zeitungsstücke ausschneiden und zusammennähten, um kleine Wege zu jedem Stuhl zu bilden, der für die erwarteten Besucher gedeckt war, damit ihre Schuhe nicht schmutzig werden oder die Reinheit des Teppichs beflecken könnten. Legen Sie in London für jeden Gast einen Weg aus Papier aus, auf dem er gehen kann?
Hauptmann Brown und Miss Jenkyns waren einander nicht besonders zugetan. Der literarische Streit, dessen Anfang ich miterlebt hatte, war eine „wunde Stelle“, bei der schon die geringste Berührung sie zusammenzucken ließ. Es war die einzige Meinungsverschiedenheit, die sie je gehabt hatten; doch diese eine reichte aus. Miss Jenkyns konnte es nicht lassen, in ihrer Rede auf Hauptmann Brown anzuspielen; und obwohl er nicht antwortete, trommelte er mit den Fingern, was sie als äußerst abfällig gegenüber Dr. Johnson empfand und ihm übelnahm. Er zeigte sich recht demonstrativ in seiner Vorliebe für die Schriften von Mr. Boz; er ging so vertieft in deren Lektüre durch die Straßen, dass er beinahe mit Miss Jenkyns zusammenstieß. Und obwohl seine Entschuldigungen aufrichtig und ernsthaft waren und er in Wahrheit nicht mehr tat, als sie und sich selbst zu erschrecken, gestand sie mir, sie hätte es vorgezogen, er hätte sie umgerannt – vorausgesetzt, er hätte dabei eine anspruchsvollere Literatur gelesen. Der arme, tapfere Hauptmann! Er sah älter und abgekämpfter aus, und seine Kleidung war sehr abgetragen. Doch er schien so heiter und lebensfroh wie eh und je – es sei denn, man fragte ihn nach dem Gesundheitszustand seiner Tochter.