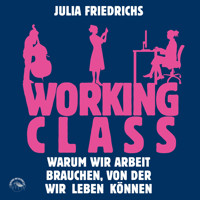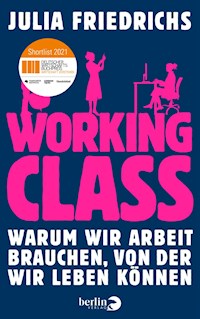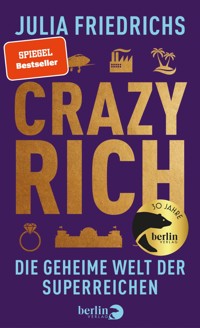
23,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 23,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
WAS WÜRDEN SIE MIT 1000 MILLIONEN EURO TUN? Wie grenzenlos der Reichtum einiger weniger wirklich ist und wie ihr Vermögen das Land verändert. Julia Friedrichs ist gelungen, was es so noch nicht gegeben hat: Sie bittet Superreiche zum Gespräch, und diese erlauben ihr umfassende Einblicke in ihre Welt und stellen sich ihren Fragen. Ist Vermögen eine Privatangelegenheit? Braucht es ein anderes Steuersystem? Kann es richtig sein, dass sich extremste Vermögen in den Händen ganz weniger ballen? Wann habe ich genug? Auf den Spuren des Geldes Ihre Recherche-Reise führt die Autorin zu Luxusjachten, in Family-Offices und Steueroasen. Im Gespräch mit Wissenschaftlern und Experten fördert sie exklusive neue Daten zutage über die vermögendsten Familien des Landes. Ein augenöffnender Trip durch die Welt des Geldes und ein vielschichtiger Blick auf jene, die sonst schweigen. Wer sind Deutschlands Superreiche? Superreich ist ein Mensch, der über viele Millionen Euro verfügt. Hierzulande sind es 2900 Personen, die gut 20 Prozent des gesamten Finanzvermögens besitzen. Aber auch in anderen Ländern nimmt die Zahl der Superreichen zu. Mit dem Geld, das man braucht, um ihre Superjachten auch nur ein Jahr instandzuhalten, könnte man mittlerweile die Schulden aller Entwicklungsländer tilgen - auf einen Schlag. Müssen wir dem Reichtum Grenzen setzen? Welches Ausmaß an Ungleichheit verträgt eine Gemeinschaft, verträgt die Demokratie, in der zumindest theoretisch jede Stimme gleich viel wert sein soll? Wie viel dürfen Einzelne für sich beanspruchen in einer Welt, in der die Ressourcen endlich sind? Müssen wir dem Reichtum Grenzen setzen? Julia Friedrichs begibt sich auf die Spuren des Geldes. Eine eindringliche Reportage über die Frage, wie wir als Gesellschaft zusammenleben wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Impressum ePUB
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2024
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic®, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Information
1. Auftakt
2. Wer ist reich?
Keine Antwort auf einfache Fragen 1: Lauwarm oder kochend heiß?
Keine Antwort auf einfache Fragen 2: How much is the fish?
3. 11 a. m.: Meet-up Mr. Superrich oder Der Vormittag, an dem sich Tausende Millionen Euro auf meinen Küchenstuhl setzten
4. »Ich wollte Cash« – Ein Milliardärswochenende in Paris
5. Keiner soll es wissen – Secret Billionaire
6. Exkurs: Superreiche im Film
7. Unknown and unseen? Eine Soziologie der Superreichen
8. Exkurs: Chosen – Warum Geld uns besonders macht
9. Die natürliche Ordnung – Der Glaube an das Millionärs-Mindset
10. With a little help from my friends – Die Berater der Superreichen
11. Wir Neider
12. Exkurs: Mäuschen, sag mal piep oder Ein Päckchen von Theo Müller
13. Gut reden über sehr viel Geld
14. Business – Was Geld bewegt
15. Wenn aus Reichtum Macht wird
16. Let’s talk about tax
17. Money changes everything
Why is it so difficult to tax the rich?
Joe, le taxeur
18. Nestbeschmutzer – Eine Millionärin will ihr Vermögen loswerden
Verteilen
Exkurs: Gutes tun
Demokratie ist keine Murmelgruppe
Wer entscheidet über die Millionen
Raus mit dem Geld!
19. Überfluss: Die Reichen und das Klima
20. Genug ist genug – Braucht es eine Diskussion über eine Reichtumsgrenze?
21. Und nun?
Danke
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Information
Zur Wahrung von Persönlichkeitsrechten wurden einige Namen, charakteristische Merkmale von Personen sowie Örtlichkeiten und andere Details verändert.
1. Auftakt
Seit ich mich mit Superreichen beschäftige, bin ich Abonnentin der Boote Exclusiv, einer der Zeitschriften, die sich dem teuersten Produkt widmen, das momentan zu kaufen ist: Superjachten. Und eigentlich braucht es nicht viel mehr als das Sonderheft zu den 200 größten Motorjachten, um zu verstehen, dass der Reichtum einiger Menschen Dimensionen erreicht hat, die schwer fassbar sind. Da wird in einer großen Bildstrecke die AHPO vorgestellt, die neue 115-Meter-Jacht der deutschen Werft Lürssen: ein wuchtiges weißes Schiff, sechs Etagen hoch, vorn, auf Holzplanken, das große H, Landeplatz für den Zubringerhubschrauber.
Ich lese: »Der 205 Quadratmeter große Wellnessbereich auf dem Unterdeck eignet sich perfekt als Startpunkt für eine Tour über die sechs Decks von AHPO.« Man streift vorbei am Hamam, am Gym, »einem der größten Fitnessräume, die je auf einer Jacht realisiert wurden«, entdeckt »auf der Backbordseite« ein Kino mit zwölf Sitzplätzen oder vielleicht einen der Pools mit Gegenstromanlage, dann, eine Finesse der Jacht, durchquert man den »gläsernen Gang durch den Maschinenraum«, gelangt nach oben, in den Konferenzraum, gekrönt von einem Kristalllüster, der über einer antiken und in Bronze gravierten Jamaika-Karte hängt. Ein Schritt weiter der Salon mit selbstspielendem Steinway-Flügel, »Akzentmarmore« an den Wänden, genau wie in der 245 Quadratmeter großen Mastersuite mit Kingsize-Bett, und schließlich das Herzstück: der Panoramasalon mit 180-Grad-Blick auf die See.
Für 2,6 Millionen Euro die Woche lässt sich das Boot mieten – wobei die 36-köpfige Crew extra bezahlt werden muss. Genau wie die Tankfüllung. Einmal Volltanken meint bei der AHPO rund 409 000 Liter und kostet eine gute halbe Million Euro.
Die AHPO ist nicht die Einzige, die mich fasziniert. Über Wochen, nein, seien wir ehrlich: über Monate tauche ich ab in die Welt der maximalen Dekadenz, die Welt der Luxusjachten. Ich informiere mich über Kaufpreise: 50, 100, 300, 500 Millionen Euro. Und ich lese im New Yorker: »Im Moment ist die Gigajacht das teuerste Ding, das unsere Spezies besitzen kann.« 2019 habe ein Hedgefonds-Milliardär die bis dato teuerste Immobilie des Landes gekauft: eine Wohnung über vier Etagen direkt am Central Park für 240 Millionen Dollar. Andy Warhols Porträt von Marilyn Monroe ging für 195 Millionen Dollar an einen unbekannten Reichen. In der Welt der Luxusjachten ordentliche, aber keinesfalls rekordverdächtige Budgets.
Ich lerne, wie bei einem Trumpf-Quartett, Längen: Das Basismodell, die Superjacht, misst mindestens 24 Meter. Eine Kategorie darüber, die Megajacht: über 60. Früher eine absolute Rarität, mittlerweile fast niedlich. Wer wirklich etwas auf sich hält, knackt die 100-Meter-Marke: Die Gigajacht ist so lang wie ein schwimmendes Fußballfeld.
Ich schaue mir Videos von Charterfirmen an, die für das Familienleben auf der Jacht werben. So schöne Bilder! Die Kinder fahren Jetski und toben auf einem aufblasbaren Wasserpark herum. Der Personal Trainer fordert den Vater beim Kickboxen. Der Mutter werden im Spa der Rücken massiert und die Nägel gefeilt. Am Abend geht die Jacht vor Anker. Private Cooking am Beach, der Lobster liegt auf dem Grill, der Champagner steht im Kühlkübel bereit. Eltern und Kinder applaudieren dem Personal für all die Mühe. Als die Sonne sinkt, läuft ein Film im Bordkino. Es gibt Kräcker mit Kaviar und im Bett einen menschgroßen Riesenteddy für den Junior. »Follow me home«, singt eine Männerstimme immer wieder.
Ich sammle in einem Ordner Anekdoten über einzelne Boote. Die über die Roma, bei deren Ausstattung die Gattin des Eigners einen ganz besonderen Wunsch geäußert hatte: Die Oberflächen der Möbel sollten mit Rochenhaut bezogen werden. Die Hersteller schwitzten, aber schafften es am Ende, die Möbel in Fischleder einzufassen. Als dann aber Gattin und Eigner zur Abnahme kamen, gefiel ihm ihr besonderer Deko-Clou so gar nicht. Der Rochen musste ab-, neues Leder aufgezogen werden.
Über die Savannah, die ein ganz besonderes Feature hat. Das Fenster ihrer »Nemo-Lounge« liegt zum Teil unter Wasser. Liegt das Schiff vor Anker, so lese ich, gehört es zu den Aufgaben der Crew, in ein Meerjungfrauen-Kostüm zu schlüpfen und zum Amüsement der Gäste vor dem Fenster vorbeizuschwimmen.
Dazu schreibe ich mir Beispiele auf für die Maßlosigkeit der Jachtbesitzer, die ich finde. Da sind die 1000 weißen Rosen, die eine Oligarchen-Gattin eingeflogen haben wollte, die ihr dann aber doch nicht gefielen. Da ist der Jachtbesitzer, der das Reinigungsteam mit seinen zwei Hobbys in den Wahnsinn trieb: weiße Teppiche – und frei laufende Kaninchen. Die zahllosen Wünsche nach Sonderausstattungen: ein gläserner Grill für eine halbe Million; ein Tennisplatz in Wettkampfgröße; eine Dusche, aus der nach Bedarf entweder Wasser oder Champagner fließt; ein Schneeraum an Bord, der steigenden Temperaturen wegen; ein System, das Raketen orten kann, just in case.
Ich löse ein Presseticket für die größte Jachtshow der Welt Ende September 2023 in Monaco, wo ich endlich ein paar der Boote, über die ich so viel gelesen habe, von innen sehen werde (genau wie einige Highlights des Jahres, wie das U-Boot der Firma U-Boat Worx für Privatexpeditionen).
Ich notiere schier unglaubliche Statistiken. Eine Luxusjacht zu betreiben ist wahnwitzig teuer. Vor allem, weil man das gute Stück ständig gegen die zerstörerische Kraft des Salzwassers verteidigen muss. Der Unterhalt beträgt ein Zehntel des Anschaffungspreises pro Jahr, verschlingt also problemlos 10, 20, 30 Millionen Dollar. Es ist, wie Geld in den Ausguss zu kippen.
Der Journalist Rupert Neate hat berechnet, dass man mit all dem Geld, das man braucht, um 6000 Superjachten nur ein Jahr instand zu halten, auch auf einen Schlag die Schulden aller Entwicklungsländer tilgen könnte. Macht man aber nicht. Stattdessen spüren die Werften, dass der Club der Superreichen weltweit wächst. Sie können sich allen Millionenkosten zum Trotz vor Nachfrage nicht retten. Sie seien ausgebucht bis 2026, sagt mir ein deutscher Luxusjachtbauer. Selbst Stammkunden müssten sich mit einem ungewohnten Platz auf der Warteliste begnügen.
Über 1000 neue Jachten wurden im vergangenen Jahr geordert. 25 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Seit 1990 ist die Zahl der Gigajachten von zehn auf 170 angestiegen. Jede einzelne übrigens eine Dreckschleuder de luxe. Im Schnitt stößt jede Superjacht im Jahr 7000 Tonnen CO2 aus. Menschen kommen im Schnitt auf fünf Tonnen pro Jahr. Eine einzige Luxusjacht bläst also so viel Treibhausgas in die Atmosphäre wie etwa 1400 Menschen zusammen.
Je mehr ich lese, desto mehr überhöhe ich die Superjacht zur Super-Metapher. Zur Metapher für eine Ungleichheit, die jedes Maß verloren hat. Für eine Dekadenz, die an die Höfe des Sonnenkönigs erinnert. Für die Sinnlosigkeit der Ballung von immer mehr Millionen und Milliarden Euro auf den Konten derer, die ohnehin schon mehr als alles Wünschbare haben. Für die absolute Gleichgültigkeit angesichts der drohenden Klimaapokalypse. Ich sehe die Roma und die Savannah als Teil eines monumentalen Gemäldes, das von einer Epoche der Plutokratie, des Geldadels erzählt.
Ein Gemälde, angesichts dessen scharfe Schlussfolgerungen wie die der US-Autorin Nicole Aschoff allzu plausibel erscheinen, die schreibt: »Die Superjachten lehren uns vier Dinge über die Superreichen.« Erstens: Sie leben in ihrer eigenen Welt. Zweitens: Sie stehen über den Wirtschaftszyklen. Drittens: Sie scheren sich nicht um den Planeten. Und viertens: Sie müssten erheblich mehr Steuern zahlen. »In den Superjachten materialisiert sich alles, was in unserem profitorientierten System schiefläuft«, schreibt sie. »Während Milliarden Menschen um ihr Überleben kämpfen, der Planet in einer ökologischen Katastrophe versinkt, segeln die Reichsten der Welt davon, geschützt von der rauen See des Kapitalismus.«[1]
Stopp. Schnitt. Aus. In diesem Moment gehe ich von Bord der vermeintlich alles erklärenden Metapher. Sie ist zwar verlockend, aber dann doch zu simpel. An Land zu stehen und gleichermaßen fasziniert wie verstört auf große Boote zu blicken, mag das Uferlose der Vermögenssummen einiger Menschen überdeutlich machen, mag einen Scheinwerfer auf ihre Exzesse werfen. Aber es ist gleichzeitig eine unlautere Abkürzung zu einem einfachen, einem klaren Urteil zu einem der wichtigsten, aber auch schwierigsten Probleme, vor denen wir stehen: Wie gehen wir damit um, dass sich extreme Vermögen in den Händen ganz weniger ballen?
In Deutschland besitzen 3300 Superreiche (Menschen mit mehr als 100 Millionen US-Dollar Vermögen) 23 Prozent des Finanzvermögens. Welches Ausmaß an Ungleichheit verträgt das Zusammenleben in einer Gemeinschaft, verträgt die Demokratie, in der zumindest theoretisch doch jede Stimme gleich viel wert sein muss? Und, eine Frage, die sich zum Glück immer mehr in den Vordergrund schiebt: Wie viel dürfen Einzelne für sich beanspruchen in einer Welt, in der die Ressourcen endlich sind – und in der jede Tonne CO2, die verfahren und verflogen wird, eigentlich woanders wieder eingespart werden muss? Müssen wir dem Reichtum Grenzen setzen? Aber wie, um Himmels willen, soll das funktionieren? Und wer würde diese Grenzen definieren? Wäre ein Motorboot in Ordnung, eine Superjacht eventuell, eine Gigajacht aber ein Grenzübertritt?
Menschen, die wie ich aus der Ferne auf Luxusjachten starren, werden sicher keine Antworten finden. (Außer reflexartige wie: Braucht doch kein Mensch! Wegnehmen, die dicken Boote! Wobei vermutlich viele – wie ich auch – gleichzeitig eine zweite, irritierende Stimme im Ohr haben würden, die säuselt: Côte d’Azur von der Wasserseite? Warum eigentlich nicht? Lobster am Beach? Gerne. Und danach Champagnerdusche? Schönes Finale!)
Ich glaube, dass vor dem Urteil immer das Verstehen kommen muss. Und deshalb habe ich mein Boote Exclusiv-Abo schweren Herzens ruhen lassen und mich stattdessen über Listen mit den Namen der reichsten Menschen Deutschlands gebeugt. Ich habe Adressen ausfindig gemacht und ihnen kistenweise persönliche Briefe geschrieben. Denn ich will wissen: Was meinen eigentlich die Menschen, die sich Jachten kaufen (können), zu alldem – Deutschlands Superreiche?
Dies ist ein Buch über so viel Geld, wie es kaum zu begreifen ist. Der Reichtum der Menschen, mit denen ich sprach, beginnt bei Summen, deren Nullen ich in der Recherche zu Beginn immer aufschreiben musste, um nachzusehen, von welchem Betrag mein Gegenüber spricht, wenn er sagt, er sei acht-, neun-, zehn- oder elfstellig unterwegs. Dutzende Millionen Euro. Hunderte Millionen. Tausende Millionen, also Milliarden.
Ich hatte das Gefühl, in ein Schweigekartell einzudringen. Menschen mit so viel Geld sind es nicht gewohnt, sich den Fragen von Nichtbesitzenden zu stellen, leben sie doch in der Regel unter sich – zwischen sich und dem Rest der Welt einen Puffer aus Kommunikationsberatern, Family-Officern und Familienanwälten. Es dauerte Monate. Aber am Ende klappte es. Ich konnte mit denen, die oft nur aus der Distanz beschrieben, bewundert oder verachtet werden, sprechen, konnte mit Reichen reden. Einer, in eine der reichsten Familien des Landes hineingeboren und Mit-Erbe eines Milliardenvermögens, traf sich mit mir über Monate zu intensiven Gesprächen – über alles.
Was denken sie, wenn sie Schlagzeilen lesen wie: »Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten«? Wenn von einem neuen Geldadel, einer Herrschaft der Vermögenden die Rede ist? Trifft sie der Vorwurf, davonzusegeln, »geschützt von der rauen See des Kapitalismus«, während Mitmenschen »um ihr Überleben kämpfen« und der »Planet in einer ökologischen Katastrophe versinkt«? Oder fühlen sie sich zu Unrecht verantwortlich gemacht? Wie erleben sie die gewaltigen Abstände zur Mitte des Landes? Zu Krankenpflegern und Chefärztinnen, zu Kassierern und Lehrerinnen, zu Heizungsinstallateuren und Büroarbeiterinnen, zu den vielen, die sie beraten, bedienen, umhegen? Zu mir? Ist es fair, dass sie so viel mehr haben als wir alle, der Rest, zusammen? Was bedeutet ihnen ihr Geld, macht es sie glücklich? Frei? Mächtig? Oder einsam? Und schließlich die Frage, die besonders schwer zu beantworten ist: Spürt man, wenn aus »viel« »zu viel« wird? Und wieso scheint es fast unmöglich, den Punkt zu finden, an dem man sagt: Danke, ich habe genug! Ich verzichte auf mehr?
2. Wer ist reich?
Keine Antwort auf einfache Fragen 1: Lauwarm oder kochend heiß?
Schreibt man ein Buch über Reichtum, wird es schon gleich am Anfang schwierig, bei der banalsten aller Fragen: Was heißt überhaupt reich? Wen meint man? Wie viel Geld muss man haben, um in Deutschland zur Gruppe der »Reichen« zu gehören?
Auf diese Frage gibt es leider unzählige Antworten. Das Wort »reich« wird unter Bürgerinnen, Politikern, Journalistinnen und Wissenschaftlern für so unterschiedliche Lebenslagen und Euro-Summen benutzt, dass man im Prinzip immer eine Fußnote dazuliefern müsste, um zu erklären, welches »reich« man meint. Es ist so, als würde man mit dem Wort »heiß« den gesamten Bereich zwischen 25 und 100 Grad Celsius Lufttemperatur abdecken müssen. Jeder weiß, dass zwischen diesen Werten Welten liegen, vom angenehmen T-Shirt-Wetter bis zu einer Hitze, in der der menschliche Organismus nur bei trockener Luft und auch dann nur einige Zeit überlebt.
Genauso weit klaffen aber die Lebenslagen auseinander, die allesamt mit dem Wort »reich« gemeint sein sollen. Der Versuch einer Ordnung: Zunächst muss man unterscheiden, ob es um das Geld geht, das man monatlich verdient, oder um jenes, das man insgesamt besitzt, also um Einkommens- oder Vermögensreichtum. Lange konzentrierte sich die Diskussion auf das Erstere. Die Bundesregierung beschreibt in ihrem jüngsten Armuts- und Reichtumsbericht zum Beispiel all diejenigen als »reich«, die, je nach Definition, mehr als das Zweifache oder Dreifache des mittleren Einkommens verdienen.
Zuletzt hatte ein durchschnittlicher Single, 2000 Euro netto im Monat zur Verfügung. »Reich« wären demnach Alleinstehende schon ab 3940 Euro im Monat (das wäre das Doppelte) oder, die strengere Definition, ab 5910 Euro (das Dreifache). Manche sehen die Reichtumsschwelle sogar schon bei all denen überschritten, die zu den oberen 10 Prozent der Einkommen gehören. Das wären für einen Single 3700 Euro netto. Weit weniger als die Summe, die die meisten Menschen nennen, wenn sie gefragt werden, ab welchem Einkommen jemand reich sei. Die Schätzungen bewegen sich um die 10 000 Euro.
Um die Verwirrung komplett zu machen: Die »Reichensteuer« bezahlt man erst ab einem zu versteuernden Brutto-Einkommen von über 22 000 Euro im Monat. Und all das bezieht sich, wie gesagt, auf das Geld, das man verdient. Aber ist das überhaupt ein tauglicher Maßstab für Reichtum? Demnach wäre jemand, der eine Villa am Starnberger See besitzt und bewohnt, dazu ein Ferienhaus und ein paar gute Autos hat, vielleicht auch ein Boot, aber eben mit, sagen wir, einer halben Stelle auf 1500 Euro netto kommt, nicht reich. Und ein Unternehmer, der in einem Jahr Verluste macht, aber in Summe ein Vermögen von mehreren Millionen aufgebaut hat, auch nicht. »Reichtum anhand der Höhe des Einkommens zu definieren, ist ein anfälliges Vorgehen«, urteilt der Vermögenssoziologe Wolfgang Lauterbach von der Universität Potsdam.[2]
Allein das Bruttogehalt zu betrachten, reiche nicht, sagt Markus Grabka vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.[3] Reiche misst man vor allem am Vermögen. Aber auch da unterscheiden sich die Summen extrem, mit denen die Frage »Ab wann ist man reich?« beantwortet werden soll.
Ab rund 750 000 Euro Haushaltsvermögen gehört man, nach den Daten der Bundesbank, zu den oberen 10 Prozent. Viele Forscher setzen die Grenze allerdings höher: Reich sei, wer allein aus seinem Vermögen heraus so viel Ertrag erziele, dass er davon auch ohne Erwerbsarbeit gut leben könne. Je nach Zinslage liegt die Schwelle dafür bei zwei, vielleicht drei Millionen.
Das halte auch ich für eine taugliche Definition einer Reichtumsgrenze. Wer allein aus seinem Besitz heraus leben könnte, ist sicher reich. Die Vermögenselite beginne darüber, bei rund zehn Millionen Euro, sagt Markus Grabka und endet bei den Reichsten, die mehrere Tausend Millionen besitzen. Finanzdienstleister taxieren die sogenannten Ultra-high-net-worth individuals, was wohl am ehesten mit »superreich« oder »höchstvermögend« zu übersetzen wäre, auf mindestens 30 Millionen US-Dollar anlegbaren Vermögens. Damit hätten wir nun eine Reichtumsskala aufgespannt, die von 3700 Euro netto im Monat bis zu unzähligen Millionen Euro reicht.
Das Problem an dieser mangelnden Begriffsschärfe ist unter anderem das folgende: Debatten über Reichtum gelingen kaum, auch weil jeder mit dem Wort etwas vollkommen anderes meint. »Bei Einschätzungen zum Thema Reichtum gehen Daten und Wahrnehmung besonders weit auseinander«, sagt Judith Niehues, Verteilungsexpertin am Institut der deutschen Wirtschaft. »Kaum jemand empfindet sich selbst als reich, gleichzeitig glauben viele, dass sehr große Teile der Bevölkerung reich sind.« Auch das Ungleichheitsbarometer, das Forschende der Universität Konstanz mittels Befragungen erstellen, kommt zu dem Ergebnis, dass die allermeisten Menschen sich selbst in der Mitte der Gesellschaft einsortieren, relativ unbeeinträchtigt davon, welcher Schicht sie tatsächlich angehören.
»Diese verzerrte Wahrnehmung ist besonders stark bei reichen und sehr wohlhabenden Menschen zu beobachten«, sagt Marius Busemeyer, der das Forschungsprojekt leitet. »Sie ordnen sich der Mittelschicht zu, obwohl sie zu den obersten Prozent gehören.« Ähnliches fanden österreichische Forscher heraus: Auch bei ihrer Befragung stuften sich nur wenige reiche Menschen in der Gruppe der vermögendsten 10 Prozent ein.
2020 wurde Olaf Scholz, damals noch nicht Kanzler, sondern Kandidat und Finanzminister, in der ARD gefragt, wie reich er sei. Seine Antwort: Er verdiene »ganz gut«, als »reich würde ich mich nicht empfinden«. Gewagt. Kamen Scholz und seine Frau Britta Ernst, das lässt sich nachsehen, damals schon auf ein monatliches Bruttoeinkommen von etwa 30 000 Euro. Unwahrscheinlich, dass sich damit so gar nichts ansparen ließ.
Getoppt wurde Olaf Scholz’ verzerrte Selbsteinschätzung zwei Jahre zuvor von Friedrich Merz, der damals noch beim Vermögensverwalter Blackrock und in zahlreichen Aufsichtsräten beschäftigt war. Als Bild-Leser ihn zu seinem Reichtum befragten, antwortete er mit dem inzwischen geflügelten Wort: »Also, ich würde mich zu der gehobenen Mittelschicht zählen.« Zur Oberschicht in Deutschland gehöre er »mit Sicherheit nicht«. Dabei gab er später selbst an, rund eine Million Euro brutto pro Jahr verdient zu haben. Er fliegt gern privat, im eigenen Jet. Und so spottete Oliver Welke in der Heute-Show zu Merz’ Mittelschichtszugehörigkeit: »Faustregel: Wer mehr als ein Flugzeug besitzt, ist wahrscheinlich nicht Mittelschicht. So merk’ ich’s mir immer.«
Eine gute Faustregel, die allein aber noch nicht weiterhilft, wie jüngst Kollegen des Reportageformats STRG_F erfahren haben. Sie veröffentlichten eine Dokumentation mit dem Titel: »Privatjets, Yachten, Kaviar: Wie beeinflussen Superreiche das Klima?« Die Grundthese war solide recherchiert. Es ging darum, dass reichere Menschen durch ihren Lebensstil überdurchschnittlich viele Tonnen CO2 ausstoßen. Ein Thema, das auch in diesem Buch ein Kapitel füllen wird.
Die »Superreichen« in dieser Dokumentation waren den Journalisten aufgefallen, weil sie auf ihren Social-Media-Kanälen Bilder von sich in Privatjets gepostet hatten. Nun ist, wie Welke sagt, jemand, der ein Flugzeug besitzt, sicher nicht Mittelschicht, aber, Variation der Faustregel, jemand, der sich mit Privatjetbildern promotet, auch nicht zwingend superreich.
Einer der Kronzeugen war der 18-jährige Theo Stratmann, der behauptete, Kaviar als Geschmacksteaser im Restaurant nur anzuknabbern, bevor er ihn wegwerfe. Er haue lieber auf die Kacke, statt sich auf die Straße zu kleben, sagte er. Oder: Das CO2, das er zu viel verbrauche, könnten ja die Armen für ihn einsparen. Nach Sylt müsse man einfach standesgemäß mit dem Privatjet fliegen, ginge nicht anders. Nach jedem Spruch linste Stratmann, Mittelscheitel, Ralph-Lauren-Hemd, ein Bilderbuch-Schnösel, triumphierend zu seinen Kumpels. Reich an Meinung war der Junge fraglos. Aber auch an Geld?
Darum rankte sich später eine hitzige Diskussion – um Stratmann, aber auch um die Frage: Was bedeutet überhaupt »superreich«? Stratmann sei nichts als ein Poser, der mal behaupte, mit einer Agentur gut zu verdienen, mal mit Immobilien oder E-Commerce, schreiben Journalisten des Business Insider. Auch sein Vater, ein Ex-Landesminister, der aber schon lange keinen Kontakt zur Familie mehr hat, will vom vermeintlich vielen Geld des Sohnes nichts wissen. Der NDR, der den Film verantwortete, reagierte auf die Kritik unter anderem damit, dass man klarstellte, dass der Begriff »superreich« nicht eindeutig definiert sei. Man meine damit »Menschen mit extrem hohen Einkommen«, schließlich würde in der Doku »die These behandelt, dass Menschen mit hohem Einkommen einen höheren CO2-Fußabdruck als Menschen mit geringerem Einkommen haben«. Man schrieb aber auch: »Nicht alle Protagonisten im Film können als ›superreich‹ gelten. Das gilt auch für Theo Stratmann.« Man habe aber in der Recherche den Eindruck gehabt, dass er einen »reichen Lebensstil« führe. Das sei für das Thema ausschlaggebend gewesen, »sein Kontostand oder der seiner Familie sind dabei unerheblich«.
Damit wären wir bei so etwas wie »gefühltem Reichtum« oder Reichtums-Lifestyle angekommen, was den Begriff für jede Debatte gänzlich untauglich machen würde. Inzwischen hat die Redaktion reagiert und das Adjektiv »superreich« aus dem Titel der Doku entfernt. Es geht nun, korrekterweise, nur noch um einen »luxuriösen Lebensstil«, der das Klima gefährde.
Zielführend und innovativ sind neue Forschungsansätze, die versuchen, möglichst viele Kategorien zusammenzudenken: Einkommen, Vermögen, die Frage, ob jemand zur Miete wohnt oder im Eigentum und wie viele Personen er oder sie miternähren muss. Ein Team um den Bremer Soziologen Olaf Groh-Samberg hat ein solches Modell einer lebensnahen Schichtung der Gesellschaft entwickelt. Zeit Online hat daraus einen Simulator gebaut, den jeder mit seinen Daten füttern und so eine realistische Einschätzung über die eigene ökonomische Lage bekommen kann. Allerdings weist das Modell nur Armut aus, keinen Reichtum. Ganz oben findet sich die Kategorie »Wohlstand« und darüber »Wohlhabenheit«.
Die Lücke füllt eine Studie, die die Soziologin Katharina Hecht gemeinsam mit britischen Forschern, unter anderem von der London School of Economics, erstellt hat. Im Vorwort stellen auch sie den Bedarf an einer greifbareren Definition von »reich« fest: »Der öffentliche Diskurs wird dadurch eingeschränkt, dass es keinen einheitlichen Maßstab dafür gibt, wer ›reich‹ ist«, heißt es. »Die Entwicklung eines solchen Maßstabs ist nicht einfach.«[4] Man habe sich trotzdem mit dieser Pilotstudie daran versucht. Die Forscher ließen Menschen aus verschiedenen Einkommensgruppen beraten: Ab welchem Lebensstandard ist man reich? Heraus kam eine plastische Schichtung der Gesellschaft, eingeteilt in die Level A – an der Armutsgrenze – bis Level E – extremer Reichtum. Besonders präzise beschrieben die Befragten den Unterschied zwischen der komfortablen Mittelschicht (Level C) und den Wohlhabenden (Level D).
Das Leben in der komfortablen Mittelschicht sähe ungefähr so aus: Man lebt in einer Wohnung oder einem kleinen Haus, das über einen Kredit finanziert ist. Dazu gibt es etwas Erspartes, vielleicht auch Aktien. Man könne es sich leisten, einmal in der Woche auswärts essen zu gehen, nicht in Imbissketten, sondern in Restaurants. Zu Hause stünde ein breites Angebot an Streaming-Diensten bereit. Auch ein Haustier wäre möglich, dazu alle paar Jahre ein neues Auto, zwei Urlaube im Jahr, bei Bedarf eine Putzkraft oder ein Gärtner. Beim Shoppen würde man mischen, mal im Supermarkt, mal in höherpreisigen Bio-Läden, mal in der Fußgängerzone, mal im Design-Laden. Man hätte, äußerten die Befragten, die finanziellen Mittel für ein angenehmes Leben. Nicht jeder Lebensbereich wäre High End, aber man könnte sich hier und da doch auch etwas Besonderes gönnen.
Über diesem Lebensstandard beginne Reichtum, so die einhellige Einschätzung der Befragten. Reiche hätten typischerweise ein abbezahltes Haus mit, wie einer es formulierte, »mehr Zimmern, als man braucht«, oder ein Ferienhaus. Man hätte Erspartes in verschiedensten Anlageformen und bedeutende Kapitalerträge, die das Einkommen ergänzen oder ersetzen, vielleicht sogar einen privaten Vermögensverwalter. Man könnte sich teure Essen in Restaurants leisten, kostspieligere Hobbys wie Reiten, Segeln oder das Sammeln von Antiquitäten. Ferien wären mehr als fünf Mal im Jahr möglich, mal mit, mal ohne Kinder. Man hätte zusätzliche Autos, zum Vergnügen oder für den Nachwuchs. Festes Hauspersonal wäre möglich, auch ein persönlicher Fitnesscoach, falls gewünscht. Habe man Level D erreicht, »kann man sich vermutlich so ziemlich in jeder Kategorie aussuchen, wie man leben möchte«, fasste es einer der Befragten zusammen.
Trotzdem, auch da waren sich die Studienteilnehmer einig, gebe es noch Menschen darüber, die Superreichen. Hier wurden die Beschreibungen vager, diffuser. Zu weit weg scheinen diese Leben, vermuten die Forscher. Superreiche, so die Befragten, hätten nicht einen Lebensmittelpunkt, sondern viele, vielleicht Immobilien in mehreren Ländern. Sie könnten sich Privatjets leisten (da ist die Faustregel wieder), Jachten oder Sportwagen. Sie hätten umfangreiches Personal, wenn gewünscht, einen Chauffeur, vielleicht einen Hundesitter, Hauspersonal, jemanden für die Sicherheit, persönliche Assistenten. Ihr Vermögen wäre breit angelegt, auch offshore, steuerschonend. Manche Befragten beschrieben diesen Lebensstandard als exzessiv, ungehörig, andere als erstrebenswert.
Natürlich ist auch diese Studie keine letztgültige Beschreibung der gesellschaftlichen Schichtung. Aber sie ist, wie ich finde, ein guter Impuls, ein Ansporn, darüber nachzudenken, auf welchem Wege wir uns auf eine alltagstaugliche Definition des recht dehnbaren Wortes »reich« einigen könnten.
In diesem Buch geht es auf jeden Fall um Menschen, die extrem reich sind, hochvermögend oder superreich, ganz wie man will, Level E, nicht D. Keine lauwarmen 25 Grad, sondern näher an der 100, Hunderte Millionen Euro. Crazy Rich eben. Das macht es aber nicht einfacher.
Keine Antwort auf einfache Fragen 2: How much is the fish?
Berlin, Französische Straße. Ein paar Meter vom Gendarmenmarkt entfernt hat die Robert-Bosch-Stiftung in einem mehr als hundert Jahre alten Bau ihre »Academy« errichtet. Das Atrium, in dem ich gerade auf meinem Konferenzstuhl sitze, wird von einer fantastischen Glasdecke überspannt. Sehr schick. Aber eigentlich auch egal. Denn dieses Buch ist schließlich keines über Architektur, sondern eines über großen Reichtum. Wenden wir also den Blick Richtung Bühne: Dort sprechen einige der renommiertesten Ungleichheitsforscher der Welt.
Dennis Snower zum Beispiel, der mal das Kieler Institut für Weltwirtschaft geleitet hat, oder Branko Milanović, der einmal leitender Ökonom der Weltbank war. Milanović spricht gerade darüber, dass Kapitaleinkünfte in einer Gesellschaft mit hoher Vermögensungleichheit wichtiger würden; dass sich diese aber bei einer kleinen, meist auch aus Arbeit gut verdienenden Gruppe ballen. Wer 10 000 Dollar an Kapitaleinkommen hat, gehöre in den USA auch in der Kategorie Arbeitseinkommen im Schnitt zu den oberen 6 Prozent. »Capital income is heavily concentrated among the rich«, sagt Milanović. Und nur, wer größere Summen investieren kann, bekomme die besten Berater, die beste Rendite. Ich male einen Schneeball auf meinen Block, der dicker und dicker wird.
Ein Thinktank hat zu dieser Konferenz über Vermögen geladen. Und ich verbringe den Tag, den Block auf dem Schoß, unter der schönen Glasdecke, um – wieder einmal – danach zu fahnden, ob es inzwischen neue Datenfetzen gibt, die helfen könnten, den deutschen Reichtum zu vermessen, ein paar neue Steinchen, die Lücken in dem Mosaik füllen könnten, das irgendwann einmal ein ganzes Bild ergeben soll.
Dieses Unterfangen hat mich schon wer weiß wohin getrieben: auf Konferenzen wie diese; in die Büros von Ökonomen; zu Tausenden Seiten von Büchern und wissenschaftlichen Studien; in eine uralte Kneipe am Kölner Eigelstein (warum, werde ich gleich erklären). Und immer wieder auch in die Verzweiflung. Denn ich kann nicht fassen, dass wir, wenn es um großen Reichtum geht, die banalsten Fragen nicht sicher beantworten können. Wie viel besitzen Deutschlands Superreiche genau, wie viele Billionen Euro? Wie viel Prozent des gesamten Vermögens? Sind es Firmen, Aktien, Immobilien? Und wer zählt zu diesem Kreis? Wie viele Milliardäre gibt es? Wie viele Multimillionäre?
Die kurze, frustrierende Antwort lautet so: Wir wissen es nicht genau. Es gibt in Deutschland keine offizielle Vermögensstatistik. In einem Land, das zwar präzise über die Zahl der Übernachtungen auf seinen Campingplätzen oder die Hundesteuer, aufgeschlüsselt nach Bundesland, Auskunft geben kann, werden diese Zahlen von Amts wegen nicht erhoben. Ein Zustand, den auch Monika Schnitzer, die Vorsitzende der sogenannten Wirtschaftsweisen, jüngst beklagt hat: »Wir haben (…) die Daten schlichtweg nicht. Wir sprechen das in jedem Gespräch im Finanzministerium an, wir sprechen es jedes Mal im Bundeskanzleramt an. An der Stelle scheitern wir einfach an den Daten.«[5]
Die längere, komplizierte Antwort ist, dass wir uns stattdessen an die Antworten heranschätzen, dass wir forschen und sammeln müssen. Puzzleteil für Puzzleteil. Das ist unbefriedigend, mühsam und der Relevanz dieser Frage nicht angemessen. Aber es ist so. Spätestens seit das Bundesverfassungsgericht die Vermögenssteuer in den 1990er-Jahren ausgesetzt hat, befindet sich das Land, was amtliche Vermögensdaten angeht, im Blindflug. »Analysen zur Vermögensungleichheit sind auf Stichprobenbefragungen angewiesen«, heißt es im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Diese Befragungen sind meist freiwillig und beruhen auf Selbsteinschätzungen. Beides nicht gerade optimale Bedingungen, um verlässliche Informationen über sehr große Vermögen zu erhalten. Extrem reiche Menschen füllen solche Fragebögen extrem ungern aus.
Die Einkommens- und Verbraucherstichprobe (EVS), einer der umfangreichsten Datensätze zum Budget der Deutschen, spart Superreiche deshalb von vornherein ganz aus. Die EVS liefere »keine Angaben für Haushalte mit einem regelmäßigen monatlichen Haushaltseinkommen von 18 000 Euro und mehr«, heißt es. Der Grund: Menschen mit mehr Geld würden »nicht in so ausreichender Zahl an der Erhebung teilnehmen, dass gesicherte Aussagen über ihre Lebensverhältnisse getroffen werden können«. Und auch der zweite große Datensatz, das sozio-ökonomische Panel (SOEP), endete lange bei Vermögen »in niedriger einstelliger Millionenhöhe«.
Es gibt aber, das ist die erfreuliche Nachricht, inzwischen immer mehr Forscherinnen und Rechercheure, deren akribische Kleinarbeit hilft, die Daten-Dunkelheit auszuleuchten. Am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ist es gelungen, das SOEP mit einer Zusatzstichprobe um die Gruppe der Menschen zu erweitern, die ein Vermögen von drei bis 250 Millionen Euro haben. Auch im Datensatz der Langzeitstudie »Private Haushalte und ihre Finanzen«, den die Deutsche Bundesbank erhebt, tauchen immer mehr Millionäre auf. Die drei Ökonomen Charlotte Bartels, Thilo Albers und Moritz Schularick haben Steuerdaten, Befragungen und Erkenntnisse aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zusammengebunden und damit viel über Distribution of Wealth, die Verteilung des Reichtums in den Jahren 1895 bis 2018 herausgefunden.
Im Ergebnis lässt sich feststellen: Mehr als 99 Prozent des Bildes sind dank dieser Arbeit ziemlich gut erkennbar. Ein Bild, das auf den ersten Blick sehr golden aussieht. Die Bundesbank schätzt das private Geldvermögen auf acht Billionen Euro. Dazu kommen Immobilien im Wert von neun Billionen und Unternehmen.
Eine ganze Menge. Aber der Besitz, auch diese Diagnose ist dank der neuen Daten robust, ist äußerst ungleich verteilt. Egal, welches der drei gängigen Ungleichheitsmaße man anlegt. Zum einen ist da der naheliegendste Maßstab, die prozentuale Verteilung, sozusagen die Kuchenstück-Variante. Wäre das gesamte Vermögen ein Kuchen, würden sich die Reichsten 10 Prozent davon knapp zwei Drittel auf den Teller laden (wovon wiederum ein großer Teil, 29 Prozent des gesamten Vermögens, allein beim reichsten Prozent der Bevölkerung landen würde). Das restliche Drittel des Kuchens würde fast ganz und gar an die nächsten 40 Prozent gehen, die obere Mittelschicht. Für die ärmere Hälfte der Deutschen bleiben ein paar Krümel, auf sie entfallen, je nach Statistik, gerade einmal 1 bis 3 Prozent der Vermögen.
Das zweite übliche Ungleichheitsmaß ist der Gini-Koeffizient, erfunden von dem italienischen Statistiker Corrado Gini. Der Gini schwankt zwischen zwei Extremen: 0 und 1. Ein Wert von 0 bedeutet, dass der Besitz komplett gleich verteilt wäre, jeder und jede Deutsche also ein identisches Kuchenstück bekäme. Ist der Gini bei 1, hat eine Person alles, und alle anderen nichts. Schauen wir auf die verfügbaren Einkommen, liegt der Gini in Deutschland bei rund 0,30. Ein unauffälliger Wert und ein Beweis dafür, dass der Steuer- und Sozialstaat beim Einkommen durchaus massiv umverteilt. Denn ohne Umverteilung durch Abgaben für Gutverdiener und Hilfen für Ärmere läge der Wert bei 0,5. Beim Vermögen aber erreicht der Gini den spektakulären Wert von 0,8, einen der höchsten Werte Europas und in Reichweite der in unseren Augen fast maximal ungleichen USA übrigens.
Das dritte Ungleichheitsmaß ist in meinen Augen das aussagekräftigste, auf jeden Fall das für den Zusammenhalt der Gesellschaft relevanteste: das Abstandsmaß. Auch das misst eine extrem große und stark gewachsene Ungleichheit. Anfang der 1990er-Jahre war das mittlere Vermögen der reichsten 10 Prozent 50 Mal höher als das der ärmeren Hälfte, mittlerweile ist es das 100-Fache. Was vor allem daran liegt, dass das Vermögen der Ärmeren trotz aller Wohlstandsgewinne, trotz einer über viele Jahre boomenden Wirtschaft so gut wie gar nicht gewachsen ist. Wie gesagt, das Bild der deutschen Vermögen lässt sich heute zu über 99 Prozent relativ präzise zeichnen. Aber am oberen Rand, wenn wir auf Multimillionäre, gar Milliardäre blicken, bleiben blinde Flecken. Mit teilweise kuriosen Folgen.
Noch einmal zurück unter die Glasdecke, auf die Konferenz: Vorne spricht inzwischen die Ökonomin Charlotte Bartels, eine Expertin, die sich wie wenige andere mit dem deutschen Reichtum und seiner Verteilung in den letzten hundert Jahren auskennt. Drei Jahre hat sie gemeinsam mit Timm Bönke an einem »Vermögenssimulator« gearbeitet. Ihr Ziel war es, zu berechnen, wie sich die Verteilung des Reichtums in den nächsten Jahren verändern wird und welchen Einfluss bestimmte politische Maßnahmen darauf hätten.
Es gibt spannende Ergebnisse: zum einen, dass die Ungleichheit der Vermögen voraussichtlich wächst und wächst, wenn nicht gegengesteuert werden sollte, der Schneeball eben, von dem Milanović sprach. Fast 70 Prozent des Reichtums, so die Prognose von Bartels und Bönke, würden sich ohne ein politisches Eingreifen im Jahr 2030 bei den oberen 10 Prozent ballen. Der Anteil der ärmeren Hälfte bliebe kaum messbar, die Mitte, vor allem die ohne Kapitaleinkommen, würde verlieren. Zum anderen haben die Forscher berechnet, dass nur sehr drastisch wirkende Maßnahmen die Ungleichheit auf dem heutigen Level halten könnten. Eine davon: eine Art Startkapital für jeden 20-Jährigen. Damit würde es gelingen, den Anteil der Reichsten »stabil« zu halten und den der ärmeren Hälfte auf 5 Prozent des Vermögens zu steigern.
Die Grenze des Simulators zeigt sich aber spätestens, wenn man ihn mit Zahlen zur Erbschaftssteuer »füttert«. In Deutschland werden jedes Jahr rund 250 bis 400 Milliarden Euro vererbt. Es gibt großzügige Freibeträge am unteren Ende, bis 400 000 Euro pro Kind, und noch großzügigere Ausnahmen für Erben der höchsten Vermögen, sodass vor allem mittelreiche Erben und Beschenkte Steuern zahlen, zuletzt rund elf Milliarden im Jahr.
Weist man den Simulator an auszurechnen, wie hoch die Einnahmen bei einem (natürlich weder gewollten noch ernsthaft debattierten) Steuersatz von 100 Prozent wären, kommt er auf im Vergleich zur vererbten Gesamtsumme kümmerliche 26 Milliarden Euro pro Jahr. Das liegt an den großzügigen Freibeträgen, aber eben auch daran, dass auch der Vermögenssimulator bei den größten Vermögen des Landes von nur »einigen« Millionen Euro ausgeht. Extremer Reichtum, Menschen mit Hunderten Millionen, Milliardenvermögen fehlen zum Bedauern der Forscherinnen und Forscher auch in diesem Datensatz.
Ein Abend im Kölner Eigelstein-Viertel, in einer dieser wenigen Gassen, wo die Stadt dank Backsteinfassaden und Kopfsteinpflaster urplötzlich malerisch wirkt, nicht nachkriegsverbaut. Wir sitzen im Anno Pief, einer Kölsch-Kneipe, die dem dauerbenutzten Adjektiv »urig« endlich mal alle Ehre macht. Der Schankraum ist winzig, die Wände holzvertäfelt, die Stufen zur Toilette auf halber Treppe krumm und schief. Draußen in der Gasse hat einst Willy Millowitsch als Kommissar Klefisch ermittelt. Unten im Keller soll in den 1980ern angeblich Herbert Grönemeyer mit seiner Band geprobt haben. An diesem Abend könnte man immerhin Galatasaray Istanbul zuschauen, die sich in der Champions League vergeblich an glücklichen Bayern abmühen, oder – in Köln immer problemlos – mit einem der Stammgäste ins Plaudern kommen. Beides reizvoll, normalerweise. Heute aber nicht. Zu faszinierend ist das, was der, der mir am Bierfass-Tisch gegenübersitzt, erzählt. Wieder einmal. Andreas Bornefeld, ein schmaler, glatzköpfiger Mann, ist ein Nerd im allerbesten Sinne. Ein manischer Sammler. Ein akribischer, ein kenntnisreicher Freak, der seit 35 Jahren eine Leidenschaft hat: Er sammelt Daten über Superreiche und ist inzwischen mit seiner Ein-Mann-Firma »Netstudien« so etwas wie ein inoffizielles Statistikamt, wenn es um die Menschen geht, über die die Forscher mangels offizieller Daten so wenig sagen können. Menschen mit einem Vermögen von vielen Millionen, Milliarden Euro.
Angefangen hat alles im Jahr 1988, da war Andreas Student; und weil ihn die Uni zu wenig forderte, suchte er sich ein Hobby oder, besser gesagt, baute das Hobby aus, das er schon von klein auf hatte. »Ich habe immer schon Daten gesammelt«, sagt er. »Als Kind schon.« In der Grundschule waren es Fußballstatistiken, in der weiterführenden Schule Informationen zum Nationalsozialismus. Und im Studium bekam er dann zufällig eine Ausgabe des US-amerikanischen Magazins Fortune in die Hände. In dem Heft ging es um die 25 reichsten Männer der Welt. »Ich kannte keinen«, sagt Andreas. »Und da dachte ich: ›Versuchst du mal, so viel rauszubekommen wie möglich.‹ Das Thema hat mich fasziniert. Ich wollte alles wissen, bin immer tiefer und tiefer gegangen. Und dann hat sich das verselbstständigt, irgendwann.«
Mittlerweile hat Andreas Bornefeld in seiner Excel-Liste Informationen zu den 7000 reichsten deutschen Familien. Er weiß, wessen Reichtum schon seit Generationen hält, weil die Namen schon in den Jahrbüchern der Millionäre vor dem Ersten Weltkrieg auftauchten (knapp 10 Prozent der deutschen Superreichen waren schon damals dabei, hat eine Forscherin des Max-Planck-Instituts gerade auf der Basis von Andreas’ Daten berechnet) oder wer zu den erstaunlichsten Newcomern zählt. (Zum Beispiel die Firma denkapparat. Die Gründer, deren Vermögen inzwischen auf 1,7 Milliarden Euro taxiert wird, hatten eine so einfache wie lukrative Idee: Sie entwickelten eine Software, die aus Excel-Tabellen schicke PowerPoint-Präsentationen zaubert, vertrieben im Lizenz-System an Großkunden wie die Deutsche Post und hatten eine traumhafte Gewinnmarge, die Experten auf 90 Prozent schätzten.)
Er kennt die Unternehmen, die hinter den Vermögen stecken, die Branchen, die Bilanzzahlen, die Zukäufe und die Pleiten, weil er immer wieder alle zugänglichen Datenbanken durchkämmt, aber auch – was für eine Fleißarbeit – für die Vor-Internet-Zeit die sogenannten Hoppenstedt-Handbücher der Jahre 1964 bis 1994 ausgewertet hat, Nachschlagewerke über die größten deutschen Unternehmen. Er weiß, dass mindestens 550 der reichsten Familien ein eigenes Büro, ein Family-Office haben, das ihr Geld betreut, dass 275 eigene Hotels oder Hotelketten besitzen und mindestens 100 ein Weingut ihr Eigen nennen. Und er weiß auch, welche reichen Familien sich über die Ehen ihrer Kinder verbunden haben. (Zum Beispiel die Knaufs und die Werhahns oder die Familien Dyckerhoff und Boehringer.) Fragt man ihn, welche vermögenden Menschen Jachten besitzen, schickt er eine lange Liste. Erzählt man von Gesprächen, in denen es um eine der Leidenschaften vieler reicher Menschen ging, nämlich aufwendige Sammlungen, sendet er zahllose Beispiele.
Da ist, Klassiker, der 2010 verstorbene Chemieunternehmer Schnabel, der eine der weltweit größten Briefmarkensammlungen besaß. Von 850 000 Marken in 1200 Alben ist die Rede, darunter, na klar, auch eine Blaue Mauritius, angeblich ersteigert für eine gute Million DM. Da ist die Mörsersammlung eines Vermögenden und die aus Buddha-Statuen eines anderen. Da ist der Gründer einer Bäckerei-Kette, der einen Hangar mit Kampffliegern füllte und schließlich mit einem seiner Exponate aus den 1950er-Jahren abstürzte. Da sind die unzähligen, viele Millionen Euro schweren Sammlungen von Oldtimern, teilweise in mehrstöckigen Tiefgaragen mit meterdicken Betondecken gelagert. Und Kunst, natürlich, immer wieder Kunst. Da ist das Museum Ritter, ein Neubau aus Beton und Glas und vor allem eine Homage to the Square, wie es heißt, eine Verbeugung vor dem Quadrat. Marli Hoppe-Ritter, Miteigentümerin von Ritter Sport, zeigt hier ihre Sammlung aus 1200 Bildern und Skulpturen, die eines gemeinsam haben: Sie sind alle quadratisch, wie die Schokolade. Da ist der ehemalige McKinsey-Berater und heutige Finanzinvestor, der sozialistische Plakatkunst sammelt, oder, ein besonderes Schmankerl in Andreas’ Listen, der Vermögende, der in seiner Firmenzentrale seine Sammlung von Aktfotografien mit dem Schwerpunkt »Achselhaare« ausstellte.
Ich kann, wie an diesem Abend in der Kölsch-Kneipe, nicht genug bekommen von all den Storys, die sich in Andreas’ Tabellen verbergen. Aber am Ende erfüllen seine Daten natürlich einen Zweck, der weit über den Nutzen eines Kneipengesprächs hinausragt: Sie helfen, die Lücke zu füllen, die die Forschenden mangels offizieller Daten nicht selbst schließen können. Sie beziffern die Top-Vermögen. Andreas ist Co-Autor der sogenannten Reichenliste des Manager Magazins, ein Ranking der 500 reichsten Deutschen. Gerade hat er außerdem einen Vertrag mit Forbes unterschrieben, dem US-Magazin, das die berühmten weltweiten Milliardärscharts erstellt.
Man kann die Arbeit von Nerds wie Andreas und den Journalisten, die die Reichenhefte des Manager Magazins verantworten, gar nicht hoch genug schätzen. Es ist ein mühsamer, ein aufreibender Job. Denn vor allem in den Anfangsjahren hagelte es Beschwerden von Vermögenden, die die genannten Summen zu hoch oder zu niedrig fanden, vor allem aber von Familien, die gar nicht wollten, dass mittels einer solchen Liste ihr Reichtum bekannt wurde. Berühmt geworden ist der Prozess des Bofrost-Gründers Josef Boquoi, der 2011 gegen die Reichenliste vor Gericht zog. Sein Vermögen sei allein seine Angelegenheit, sagte er, Privatsphäre. »Ein Privatmann muss es nicht dulden, in so einer öffentlichen Hitparade aufzutauchen«, argumentierte sein Anwalt. Das Landgericht München sah das anders. Es gebe ein berechtigtes öffentliches Interesse an Vermögen, die mehrere Hundert oder gar Milliarden Euro umfassen, entschied das Gericht. Die Gesellschaft brauche diese Daten, um zu wissen und zu diskutieren: »Wo sind die großen Vermögen? Wie wurden sie geschaffen? Wie geht jemand damit um?«
Noch mal: Dass das Manager Magazin seit Jahren diese Rankings zusammenstellt, ist ehrenvoll. Diese Listen sind aktuell die Hauptquelle auch für Forschende, die sich mit ganz großen Vermögen befassen. Aber es bleibt eine Frage: Wenn es, wie das Gericht in seiner Entscheidung ja klargestellt hat, für eine Gesellschaft wichtig ist, zu wissen, wer die ganz großen Vermögen in einem Land besitzt – nicht fünf, nicht zehn Millionen, sondern Hunderte, Tausende Millionen Euro –, wenn das also wichtig ist, allein um Debatten über Verdienst, über Macht und Einfluss führen zu können, warum schiebt der Staat diese Aufgabe dann Menschen wie Andreas und dem Team hinter den Reichenheften des Manager Magazins zu? Läge es nicht in seiner Verantwortung, der Gesellschaft diese Informationen über ein transparentes Vermögensregister zur Verfügung zu stellen, zugänglich vor allem für alle Wissenschaftler, die doch wieder und wieder beklagen, dass ihnen diese Daten fehlen, anders als zum Beispiel in Dänemark, Norwegen oder den USA?
Denn bei aller Akribie: Die Liste des Manager Magazins ist zwar der aktuelle Goldstandard, sie liegt den allermeisten Forschungsarbeiten zu Superreichen zugrunde, aber sie ist eben keine offizielle Vermögensstatistik, sondern das journalistische Produkt eines privaten Medienhauses – und auch sie hat Lücken, fehlende Puzzleteile im Bild des deutschen Reichtums.
Im Jahr 2023 hat ein Team des Netzwerks Steuergerechtigkeit über Monate alle verfügbaren Daten über Deutschlands Milliardäre ausgewertet und gemeinsam mit der Hans-Böckler-Stiftung in einer Studie veröffentlicht. Andreas’ Tabellen flossen ein, aber auch öffentlich zugängliche Informationen aus Datenbanken und Unternehmensbilanzen. Was sie herausfanden, war erstaunlich: Die Milliardenvermögen seien in den Rankings »untererfasst«, schreiben sie, tatsächlich also wesentlich größer als bisher angenommen. Die deutschen Milliardäre hätten mindestens 500 Milliarden Euro mehr, insgesamt 1400 Milliarden statt 900.
Außerdem fand das Team in den Daten mindestens elf zusätzliche Milliardärsvermögen. Einige Namen fehlten in den Reichen-Rankings von Forbes oder dem Manager Magazin ganz, auch – das ist das Überraschende – auf den vordersten Rängen. So schätzt das Netzwerk Steuergerechtigkeit das Vermögen der Familie hinter dem Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim auf mindestens 50 Milliarden Euro. Das wäre auf der aktuellen Reichenliste des Manager Magazins der Spitzenplatz, die Familie somit die reichste des Landes.
Auf Nachfrage schreibt mir das Manager Magazin, dass in der Tat einzelne Namen auf der Liste fehlen. In den Anfangsjahren habe man sich, als einige reiche Familien juristisch gegen die Veröffentlichung vorgegangen seien, verpflichtet, diese nicht zu nennen. Heute würden solche Zugeständnisse nicht mehr gemacht. »Zugleich bemühen wir uns im Rahmen des rechtlich Möglichen, bestehende Lücken zu schließen.«
Ganz ähnlich hat sich die Geschichte schon einmal zugetragen, und zwar vor 113 Jahren. Schon damals, beim ersten Versuch, sie in einem Jahrbuch der Millionäre in Preußen sichtbar zu machen, haben sich die Superreichen dagegen gewehrt, wie die Historikerin Eva-Maria Gajek beschreibt.
Am 10. März 1911 durchsuchten Polizisten unter dem Kommando von Kriminalkommissar Hans von Treschkow mehr als drei Stunden lang die Wohnung und das Büro von Rudolf Martin, einem ehemaligen Regierungsrat im Kaiserlichen Statistischen Amt. Auch eine Druckerei wurde von der Polizei durchkämmt. Was sie suchten, waren die Unterlagen, mit deren Hilfe Martin den Urahn der Reichenliste des Manager Magazins erstellt hatte, sein Jahrbuch des Vermögens und Einkommens der Millionäre in Preußen, das kurz vor Drucklegung stand. 8300 Namen hatte er aufgelistet und viele der Superreichen vor der Veröffentlichung, wie es sich gehört, informiert. Die zogen damals nicht vor Gericht, sondern wählten den direkten Weg und schrieben Beschwerdebriefe an den Finanzminister, den Innenminister und den Justizminister. Der Vorwurf: Martin könne nur auf unrechtmäßigem Wege an die Daten gelangt sein. Außerdem missachte er ihre Privatsphäre. Der Druck wurde gestoppt. Martin wehrte sich: Er habe, genau wie heute die Autoren des Manager Magazins, nur Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen genutzt.
Da ihm, allen Durchsuchungen zum Trotz, nichts anderes nachgewiesen werden konnte, erschien das Jahrbuch ein gutes halbes Jahr später dann doch. In diesem Buch und in den weiteren Jahrbüchern der Millionäre für die anderen Gebiete des Deutschen Kaiserreichs, die er in den Folgejahren veröffentlichte, finden sich übrigens schon etliche Namen, die sich bis heute in den Rankings der Superreichen halten. Die Fürsten von Thurn und Taxis waren damals schon dabei, die Sedlmayrs, einst Inhaber der Brauereien Spaten und Franziskaner, die Werhahns oder die von Siemens. Im Vorwort der Ausgabe zum Königreich Sachsen schrieb Martin: »Die bisherige Geheimhaltung des Vermögens und Einkommens ist ein Rest der Unwissenheit und des Aberglaubens des Mittelalters. Wer für den Fortschritt der Wissenschaft ist, der muss auch für Aufklärung auf dem Gebiet des Vermögens und Einkommens sein.«[6]
Ganz und gar haben wir das dunkle Mittelalter bis heute nicht hinter uns gelassen. Aber immerhin: Dank Andreas’ Arbeit und der Auswertung des Netzwerks Steuergerechtigkeit hat man nun einen präziseren Blick auf die Milliardärsfamilien, rund 4000 Haushalte, die ein Vermögen von geschätzten 1,4 Billionen Euro haben, rund dreimal so viel wie der gesamte Bundeshaushalt.
Für einen ersten »Reichtumsbericht« würden die Forscher gern ihre Analysen auf die 1000 größten Vermögen ausdehnen. Dann hätte man immerhin einen guten Überblick über die Summen, die auf die obersten 40 000 Haushalte entfallen, und wüsste mehr über das Penthouse der Gesellschaft, die reichsten 0,1 Prozent – die Menschen, die in den Statistiken, den Vermögensschätzungen, den vielen akribischen Arbeiten von Forschenden in der Regel fehlen. Die Superreichen. Die Menschen, von denen dieses Buch handelt, die Menschen, mit denen ich sprechen will.
Wäre dieser Text ein Tagebuch, würden nun viele Seiten Tristesse folgen. Die Mühen der Ebene, die Wochen, in denen ich nicht viel mehr mache, als Biografien sehr reicher Menschen zu lesen, ihre Adressen ausfindig zu machen, persönliche Briefe zu schreiben, nachzuhaken, Vor- und Zwischen- und Nachgespräche mit Beratern zu führen und vor allem Absagen zu sammeln – das Schweigekartell, das ich schon im Prolog beschrieben habe. Blättern wir lieber vor zu einem wesentlich spannenderen Kalendereintrag.
3. 11 a. m.: Meet-up Mr. Superrich oder Der Vormittag, an dem sich Tausende Millionen Euro auf meinen Küchenstuhl setzten
Am Morgen, bevor er mich besucht, benehme ich mich wie eine Filmfigur vor der Stippvisite der Eltern in der ersten eigenen Wohnung. Ich schließe die Türen zu den Zimmern, die mir zu unaufgeräumt scheinen, und versuche den Hauptraum, in dem wir reden werden, auf Hochglanz zu bringen. Ich sauge den Boden, wische die Flächen, bringe das Altpapier zur Tonne, klopfe die Kissen auf. Und während ich all das eilig erledige, wird mein Zuhause, das ich doch eigentlich so mag, unter meinen Händen immer kleiner, immer gewöhnlicher, ja mickriger, weil ich mich nicht dagegen wehren kann, mich zu fragen, wie er, der in einer großen Villa mit Personal und Pool aufgewachsen ist, es wohl sehen wird.