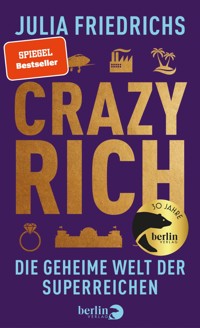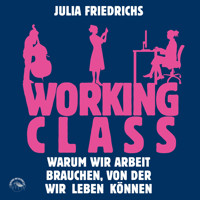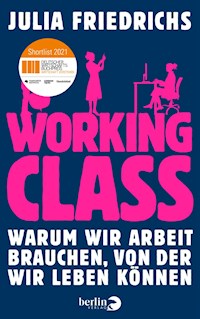9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sie leben mitten unter uns und doch im Verborgenen. Wir kennen sie, und doch wissen wir nichts von ihnen. Julia Friedrichs begibt sich in eine nahezu unsichtbare Parallelgesellschaft und erzählt die Geschichten von Menschen, deren Leben durch ein Erbe bestimmt wird. Wie lebt man, wenn man schon durch den Namen als Spross einer Dynastie zu erkennen ist – als Neckermann, Mohn oder Grupp? Was bewegt einen Patriarchen, seine Kinder zu enterben, und wie entsteht die Versuchung, für ein Erbe zu töten? Die Autorin zeichnet ein sensibles Psychogramm Deutschlands. Sie entdeckt ein Land, das wie kaum ein anderes Erbe begünstigt und Arbeit belastet. Warum gibt es kaum Debatten um diese Ungleichheit? Und was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn vor allem der ein sorgenfreies Leben führt, der in die richtige Familie hineingeboren wird, und nicht der, der Engagement und Ideen einsetzt? Auf der Suche nach Antworten gelingt der Autorin ein ebenso lebendiges wie vielschichtiges Porträt der Menschen, die Deutschland künftig prägen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wie alles. Für Tom.
ISBN 978-3-492-96419-7 Oktober 2016 © Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin 2015 Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München Covermotiv: FinePic®, München Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Wir wollten nie wie unsere Eltern werden Und sind es ja auch nicht geworden Unsere Eltern sind ja älter Und ziemlich provinziell Irgendwann werden die sterben Wenn sie nicht schon gestorben sind Wir werden ihre Häuser erben Aber keine neuen bauen Rainald Grebe
PROLOG
Eigentlich ist es ungehörig, diesen Text zu schreiben. Denn dem Erben geht meist das Sterben voran. Und wenig ist so intim wie der Tod. Wenn ein Leben mit dem letzten Atemzug erlischt – weil das Herz aussetzt; weil der Krebs gefräßig ist; das Auto zu schnell. Dann ist das privat, geht nur die an, die den Toten kannten, liebten, hassten; die schreien, weinen oder beschämt aufatmen: die Frauen, Kinder, Enkel. Die Erben. Warum also darüber schreiben?
Weil selbst ein intimer Akt wie der Tod das Leben aller verändern kann. Zumindest, wenn er sich tausendfach wiederholt. Das nächste Jahrzehnt wird die Dekade der Erben werden. Die Nachkriegsgeneration, in der alten Bundesrepublik zu Wohlstand gekommen, ist alt geworden. Sie gibt ihren Besitz nun weiter. Ein Vermögenstransfer, wie er noch nicht stattgefunden hat: 250Milliarden – eine Zahl mit neun Nullen. Das ist die Summe, die Jahr für Jahr vererbt werden wird. 2,5Billionen Euro in einem Jahrzehnt, über ein Drittel des Nettovermögens aller Privathaushalte.
Das Land verändert sich: Eine Erbengesellschaft entsteht. Und deren Geschichte ist noch ungeschrieben.
STAUNEN
Das Erbe sickerte langsam in mein Leben. Am Anfang waren da nicht mehr als kurze Irritationen – wie ein Flirren, das das gewohnte Bild stört, wie ein Buckel, der den Fahrer auf gerader, glatter Straße aus dem Trott reißt. Es begann, als alle um mich herum erwachsen wurden, Jobs hatten, Kinder zur Welt brachten und für ihre Zukunft festere Rahmen zimmerten. Bis dahin schienen sich meine Freunde alle ähnlich zu sein. Es ging uns gut, aber übermäßig wohlhabend wirkte keiner. Die meisten waren aus der Provinz in die große Stadt gezogen, fingen dort neu an, als urbane Nomaden. Die Kindheit, die Herkunft, das Elternhaus – all das diente lediglich als Material für Anekdoten und war weit weg. Wir hatten studiert und danach alle Facetten der modernen Arbeitswelt kennengelernt: Zeitverträge, Werkverträge, feste Stellen. Gratisarbeit, Ausbeuterlöhne, gutes Gehalt. Wir wohnten zur Miete, allein oder mit anderen, mit Dielenboden im Hinterhaus oder mit Teppich im Neubau, aber doch irgendwie alle gleich. Dachte ich zumindest.
Der Erste, der mein festes Bild ins Wanken brachte, war ein Freund, der mit seinem Gehalt immer gerade so über die Runden kam. Und trotzdem zog er plötzlich aus der kleinen Studentenwohnung mit Kohleheizung in sein eigenes Townhaus in einer der besten Gegenden der Stadt. Da war ein anderer, der immer umherreiste, nirgendwo Fuß fasste und immer bescheiden lebte, auch weil sein Einkommen manchmal nur knapp für den Monat reichte. Und auf einmal durchkämmte er die Immobilienangebote nach Dachgeschosswohnungen im Halbmillionensegment. Der eine besaß von heute auf morgen eine eigene Bürowohnung, die andere ein Ferienhaus in Frankreich, der Dritte eines in der Schweiz.
Eines Abends saß ich mit einem meiner besten Freunde an einem IKEA-Tisch in seiner Küche, zehn Straßenbahnminuten vom Stadtzentrum entfernt – und erfuhr, dass ich nicht die Einzige war, die sich wunderte. »Alle um mich herum kaufen plötzlich Wohnungen, Häuser«, sagte er. »Aber wie nur?« Er war stolz auf die Küche, in der wir redeten, den breiten Flur, die vier Zimmer. Über ein halbes Jahr lang hatte er nach einer größeren Wohnung gesucht und mit viel Glück diese hier gefunden. Aber nun zahlten er und seine Frau über ein Drittel ihres guten Einkommens für die vier Räume, in denen bald auch ihr Baby wohnen sollte. Der Freund ist einer, der oft 60-Stunden-Wochen macht, der fleißig ist und fähig in dem, was er tut. Er dachte an sein Konto. Und er staunte – wie ich. »Die kaufen für 400 000Euro, für 600 000«, sagte er an diesem Abend. »Egal, wie viel wir arbeiten, wir könnten uns hier nie etwas leisten. Wie machen die das?«
Von da an begann ich die anderen zu fragen. Manche wollten gar nicht über die Quellen ihres plötzlichen Wohlstands reden, andere sprachen einsilbig von »Eltern«, »vorgezogenem Erbe« oder »Schenkung«. Andere erzählten knapp, dass ihr neuer Lebensstandard in erheblichem Maße von Eltern und Großeltern finanziert wurde. Langsam ahnte ich, dass wir uns vielleicht doch viel weniger glichen, als ich gedacht hatte, dass nun, wo wir erwachsen waren, plötzlich doch wesentlich wurde, was die Eltern, die man nur von flüchtigen Verwandtschaftsbesuchen kannte, in der fernen Provinz eigentlich so machten. Und was deren Eltern getan hatten. Konnte es sein, dass es einen Faktor gab, der für uns, alle um die dreißig, die Frage »Wie wirst du leben?« mitentscheiden würde? Einen Faktor, an den ich bis dato nie gedacht hatte? Die Antwort auf die Frage: »Bist du Erbe oder nicht?«
Monate später. Mein Regal hat sich gefüllt: der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung; der Branchenreport Erbschaften; der soziologische Sammelband Erben und Vererben; die Monographie Erben in der Leistungsgesellschaft. Der neue Stern am Forschungshimmel: das Buch Capital in the Twenty-First Century des französischen Ökonomen Thomas Piketty, für das er umfangreiche Daten zu Erbschaften ausgewertet hat.
In allen findet sich eine Botschaft: Das Flirren, das mein gewohntes Bild trübte, war keine Fata Morgana. Die vielen Freunde, die sich plötzlich mit ihrem Erbe mehr oder weniger verschämt Immobilien leisteten, die ihr Monatsbudget ohne diese Hilfe vernichtet hätten, keine Zufallshäufung. Zum zweiten Mal in der Geschichte des Landes sprechen Soziologen von einer »Erbengesellschaft«. Die erste datieren sie auf die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Nun, ein Jahrhundert später, gibt es eine neue goldene Erbengeneration – zu der sich aber längst nicht jeder zählen kann.
Mein Notizblock füllt sich mit Zahlen und Statistiken. Ich schreibe Zitat um Zitat in meinen Zettelkasten. Ganz oben steht noch immer die imposante Ziffer vom Anfang, eingekreist, mit Ausrufezeichen: 250Milliarden Euro! Die jährliche Erbsumme. Die Zahl mit neun Nullen. Der Wert beruht auf einer Schätzung des Instituts für Altersvorsorge und einer Metastudie einer Elite-Universität. Es ist nicht die einzige Zahl. Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung überrascht Mitte 2014 mit der Aussage, dass es nur gut 60Milliarden seien. Andere rechnen mit 140Milliarden Euro, manche mit 300Milliarden, ein Branchendienst, der die Banken mit Daten beliefert, mit etwa 360Milliarden.
Auch bei den beiden Regierungsfraktionen herrscht beim Thema jährliches Erbschaftsvolumen keine innerkoalitionäre Einigkeit: 74Milliarden, sagt mir die Sprecherin der CDU. 250Milliarden, vermutet der Kollege der SPD. In einem Land, dessen Statistisches Jahrbuch zuletzt 689Seiten umfasste und fast zweieinhalb Kilogramm wog, gibt es keine behördlichen Zahlen zur Gesamtsumme der Erbschaften und Schenkungen.
»Deutschland weiß zwar fast alles über seine Armen, die statistisch gründlich durchleuchtet werden, über seine Reichen wissen wir jedoch so gut wie nichts«, schreibt Jens Berger, Autor des Bestsellers Wem gehört Deutschland?. Und Ulrike Herrmann, erfahrene Wirtschaftsredakteurin der tageszeitung, schreibt: »Die Reichen haben viel Lobbyarbeit investiert, um eine verlässliche Statistik zu verhindern. Sie wissen genau, dass eine Verteilungsdiskussion nicht geführt werden kann, wenn die Daten fehlen.«
»Die enorme Spreizung der Schätzungen entspricht einer offenkundig prekären Datenlage«, teilte mir ein Team von Forschern der Freien Universität Berlin mit, die gerade an einer Studie zu den deutschen Erben arbeiten.
Ich brüte lange über den Zahlen, checke die Quellen, vergleiche die Datenbasis. Und am Ende scheint mir ein Wert, der um die 250Milliarden Euro pendelt, plausibel. Warum? Die einfache, bei dieser Datenlage aber nicht völlig abwegige Antwort lautet: Die Zahl liegt in der Mitte der vielfältigen Schätzungen. Die ausführliche, aber solidere Begründung ist diese: Der Wissenschaftler Christoph Schinke hat im Juli 2012 an der Pariser Ecole d'économie genau das getan, was auch mich jetzt umtreibt: Er hat die verfügbaren Studien verglichen und die Zahlen Plausibilitätschecks unterzogen. Das heißt, er hat die Daten zu Sterbefällen mit den Vermögenssummen verschnitten. Er hat berechnet, wie hoch vermutlich der Erbanteil am Bruttoinlandsprodukt ist. Er hat überlegt, wie lange eine Generation im Schnitt das Vermögen hält – und wie viele Jahre es braucht, bis das Gesamtvermögen einmal »umgeschlagen« wurde.
Folgt man seinen Überlegungen, so landet man bei etwas über 250Milliarden Euro im Jahr 2013. Das ist weniger, als die Studien errechnen, die nur mit Befragungen und mit einer Analyse der Sterbe- und Vermögensdaten arbeiten – und weitaus mehr, als in der löchrigen Steuerstatistik auftaucht.
250Milliarden Euro also. Das ist fast so viel wie der gesamte Bundeshaushalt des Jahres 2014; mehr als das Doppelte der Kosten aller Kindergärten, Schulen und Universitäten des Landes; fünfmal so viel wie die Gesamtausgaben für alle Hartz-IV-Empfänger und die sie versorgende Verwaltung. Insgesamt, so schätzen Soziologen, werden bis zum Jahr 2020 zwischen zwei und vier Billionen Euro vererbt worden sein. Es ist das Vermögen der Wirtschaftswundergeneration, begründet in den Jahren nach dem Krieg, vermehrt in den Hochkonjunktur-Jahrzehnten der alten Bundesrepublik, explodiert in den Jahren um die Jahrtausendwende. Eine »gewaltige Erbschaftswelle«, die mächtigste, die es je gab, lese ich immer wieder.
Und eigentlich sind das ja erfreuliche Nachrichten: Den Menschen in diesem Land ging es offensichtlich so gut, dass sie mehr Vermögen anhäufen konnten als je zuvor: Die Bundesbank schätzt, dass die Deutschen im Jahr 2011 gut sieben Billionen Euro besaßen. Geld. Immobilien. Aktien. Das ist mehr als das Doppelte der jährlichen Wirtschaftsleistung des Landes – und dreimal so viel wie die gesamte Staatsverschuldung. »Europa redet darüber, dass wir unseren Kindern so viele Schulden hinterlassen. Aber die Wahrheit ist, dass wir ihnen mehr Vermögen hinterlassen als jede andere Generation zuvor«, sagt der französische Star-Ökonom Thomas Piketty im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.
Und in der Studie Erbschaften 2011 lese ich: »Die Wirtschaftswunderkinder der Nachkriegszeit konnten eine ungestörte Vermögensbildung betreiben. Es ist die einkommensstärkste und vermögendste Erbengeneration, die Deutschland je gesehen hat.« Gut sieben Billionen. Rein rechnerisch sind das knapp 90 000Euro für jeden Deutschen. Das klingt nach einem gesunden Startkapital. Allein: Diese letzte Ziffer auf meinem Block ist nichtig, nicht mehr als Zahlenspielerei. Denn das gewaltige Vermögen verteilt sich nicht gleichmäßig auf alle Bürger. Und auch das mit der Erbschaftswelle ist eine schiefe Metapher. Klingt es doch so, als würden alle von einem warmen Geldstrom getränkt werden. Doch dem ist nicht so.
Korrekt müsste es eigentlich heißen: Einigen Menschen in diesem Land ging es so gut, dass sie mehr Vermögen anhäufen konnten als je zuvor. Der Gesamtbesitz der Deutschen hat zwar historische Spitzenwerte erreicht, aber davon merken die meisten gar nichts. Die ärmere Hälfte der Bevölkerung besitzt zusammen ein mickriges Prozent des Vermögens, die reichere Hälfte satte 99Prozent. Aber auch dieser Wert sagt noch nicht so viel aus. Denn der größte Anteil des Vermögens ballt sich bei den oberen zehn Prozent. Je nach Rechenmodell besitzen sie zwischen mehr als der Hälfte und zwei Dritteln der gesamten privaten Reichtümer des Landes.
Ein Buch auf meinem Stapel trägt den Titel Silver Spoon Kids. Zwar färbt das deutsche Sprichwort die Löffel im Munde des Nachwuchses golden, aber in beiden Sprachen meint es dasselbe: Kinder, die reich geboren wurden. Silver Spoon Kids kam per Post aus den USA, dort war es ein großer Erfolg. Es ist eine Erziehungsfibel, geschrieben für reiche Eltern. Statt: Wie schläft das Kind durch?, Was tun bei Trotzanfällen?, oder: Ab wann ist Alkohol erlaubt?, lehrt Silver Spoon Kids Kapitel für Kapitel den Umgang mit dem Reichtum der Eltern. Wie sag ich meinem Zweijährigen, wie viel wir wirklich haben? Gibt es zur Einschulung die erste Kreditkarte? Wie erkläre ich dem Teenager, dass sein erstes Auto kein Neuwagen sein wird, obwohl Millionen in den Familiendepots liegen? Ein pragmatischer Erziehungsplan für spätere Erben.
Kapitel 7 ermuntert Eltern, den Kindern schon früh zu erklären, wie verdammt reich die eigene Familie im Verhältnis zum Rest des Landes ist. Die Autoren, das Ehepaar Gallo aus Santa Monica, rät, doch einmal die Freunde des fünfjährigen Nachwuchses zu einer Keks-Party einzuladen. Die Party sei einfach geplant, heißt es: Man brauche nicht mehr als Papierlose mit den Zahlen eins bis zehn, weiche Weizenmehlkekse, einen Tisch, das eigene Kind und neun kleine Gäste.
Und so geht es: Stellen Sie einen Teller mit zehn Keksen in die Mitte des Tisches! Lassen Sie jedes Kind ein Los ziehen! Weisen Sie die Kinder an, sich den Zahlen entsprechend in eine Reihe zu stellen! Erklären Sie ihnen, dass jedes Kind nun zehn Prozent der Menschen im Lande repräsentiert und die Kekse auf dem Tisch das Gesamtvermögen! Nun sagen Sie dem ersten Kind: Nimm dir sieben Kekse! Denn den reichsten zehn Prozent des Landes gehören mehr als zwei Drittel des Wohlstands. Zerstückeln Sie die restlichen drei Kekse in jeweils zehn Teile! Sie haben jetzt dreißig Keksstücke. Brechen Sie von einem ein Fünftel ab, und geben Sie diesen winzigen Anteil den Kindern, die die Lose mit den Zahlen sieben bis zehn gezogen haben! Sagen Sie Ihnen: So ist der Reichtum in diesem Land verteilt. Die unteren 40Prozent der Bevölkerung haben zusammen nicht mehr als einen Krümel.
Ich frage mich, was los wäre, wenn Eltern auf die Idee kämen, solch ein Party-Spiel bei einem Kindergeburtstag in Blankenese zu veranstalten. Aber wenn doch, sähe die deutsche Keksverteilung ganz ähnlich aus: Das Kind mit der Nummer eins dürfte fünf bis sechs Kekse futtern, fünf müssten sich ein Zehntel des letzten Kekses teilen. Nicht mehr als ein Bröckchen.
Auch wenn wenig gesicherte Daten über die Reichen vorliegen, geht das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung davon aus, dass die Vermögensungleichheit in Deutschland größer ist als in den meisten anderen Ländern der Welt. Innerhalb der Eurozone ist Deutschland unrühmlicher Spitzenreiter, unter den OECD-Staaten ist die Kluft wohl nur in zwei Ländern tiefer: in den USA und der Schweiz. In Deutschland wohnen nach Schätzungen der Beratungsfirma Capgemini, die den jährlichen World Wealth Report verfasst, mehr als eine Million Millionäre mit einem Gesamtvermögen von 2,7Billionen Euro.
Das Erbe schreibt diese Ungleichheit in die nächste Generation fort. Über die Hälfte der Menschen wird nichts oder Schulden erben. Aber acht Prozent der Erben, so schätzt der Branchendienst BBE Media in seiner Studie Erbschaften 2011, werden 40Prozent des Vermögens erhalten.
»Der Unterschied zwischen Arm und Reich entscheidet sich also meist beim Spermalotto«, urteilt Jens Berger in Wem gehört Deutschland?. »Auch wenn dies in der öffentlichen Diskussion gerne unter den Tisch gekehrt wird: Vermögen werden in der Regel nicht erarbeitet oder erspart, sondern ererbt.« Und Jens Beckert, Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, schreibt im akademischen Duktus des Soziologen: »Die Institution der Vermögensvererbung spielt eine zentrale Rolle für die intergenerationelle Reproduktion sozialer Ungleichheit.«
Bei Götz Hamann, Redakteur der Zeit, klingt die Botschaft griffiger: »Nie besaßen so viele Menschen so viel, und zugleich erreicht die Ungleichheit, die von einer Generation auf die nächste übertragen wird, historische Dimensionen.« Vereinfacht, so schreiben Erbschaftsforscher, könne man sagen: Westdeutsche Akademiker werden größere Summen erben. Ostdeutsche und Kinder von Arbeitern, von kleinen Angestellten oder Arbeitslosen im Normalfall nicht oder kaum. Und da die Heiratsmärkte von Soziologen als hochgradig homogen beschrieben werden, da also Reiche in der Regel Reiche heiraten, Arbeitertöchter fast immer Arbeitersöhne (hier liegt die Trefferquote bei 80Prozent) und Adelige noch häufiger andere Adelige, da die Menschen also noch immer brav nach sozialer Herkunft geordnet miteinander schlafen und Familien gründen, wird sich diese Kluft in der Erbengeneration nicht schließen, sondern vertiefen.
Dies gilt – in vielleicht noch stärkerem Maße – für die Reichsten der Reichen. Ise Bosch, über hundert Jahre nach Bosch-Gründer Robert geboren, sagt: »Es gibt so etwas wie eine unsichtbare Parallelgesellschaft von uns reichen Erben.« Als der Spiegel-Autor Christian Rickens sich die jährliche Liste des Manager Magazins vornahm, die die hundert reichsten Deutschen führt, zählte er nur noch 34, die ihre Vermögen in erster Linie selbst erarbeitet hatten, 76 hatten den Wohlstand geerbt. Selbst manche Unternehmer sprechen mit einigem Unbehagen von Anfängen eines »feudalistischen Kapitalismus«.
Das bedeutet, schreibt die Zeit, »dass ein wachsender Teil des Wohlstands nach einem Prinzip umverteilt wird, das weder den Leistungsidealen der Marktwirtschaft entspricht noch den Gerechtigkeitspostulaten des Sozialstaates – es ist das Prinzip der Abstammung. Reich wird, wer in die richtige Familie geboren wird.«
Ich lese, dass meine Generation, die Nach-Babyboomer, also die in den 1970er und 1980er Jahren Geborenen, die erste sei, in deren Leben Erbschaften und Schenkungen im Vergleich zu erarbeitetem Einkommen wieder so wichtig würden, dass die Menschen in ihrem Alltag deutlich spüren, wer Erbe sei und wer nicht. Fast 60Prozent der Zwanzig- bis Neunundzwanzigjährigen erwarten laut einer Studie der Marktforschungsgesellschaft Innofact in Zukunft zu erben. Fast doppelt so viele wie unter früheren Kohorten. »Was sich bisher am Beispiel an den Lebensläufen einzelner Erben vorerst nur schemenhaft abzeichnet, sind erste Vorboten eines sozioökonomischen Wandels«, lese ich.
Für meine Freunde und mich, so heißt es, seien Erbschaften erstmals wieder mitentscheidend für die Frage, wie jemand lebt, welchen Beruf er wählt und wann und unter welchen Umständen er eine Familie gründet. Solch ein Zustand sei schwer erträglich, sagt der Franzose Thomas Piketty im Gespräch mit dem Spiegel: »Der Demokratie liegt der Glaube an eine Gesellschaft zugrunde, in der die soziale Ungleichheit vor allem auf Leistung und Arbeit beruht«, sagt er, »nicht auf Abstammung, Erbe und Kapital.«
Stopp, denke ich, Pause. Das stimmt alles. Aber was bedeuten all diese Zahlen und Sätze tatsächlich? Werden mir noch mehr Statistiken, noch mehr starke Thesen helfen, zu verstehen, was wirklich um mich herum geschieht? 250Milliarden Euro im Jahr – ich schaue noch einmal auf die Zahl, die über meinen Notizen thront; ich starre auf das große Wort, das ich neben meine Aufzeichnungen schrieb: Erbengesellschaft und auf all die Fragen, die ich mir daneben notierte:
Wie verändert sich ein Land, wenn die Antwort auf die Frage »Bist du Erbe?« Dutzende Antworten gleich mitliefert? Wenn das Geld der Eltern mitentscheidet, ob du dir ein Haus leisten kannst, den Job, den du willst, die Kinder, die du erhoffst – oder eben nicht?
Warum wird um die Sache mit dem Erbe nicht gestritten, debattiert und gerungen in diesem Land, das in Sachen Empörung doch ansonsten nicht gerade zimperlich ist? Widerspricht es nicht unserer Grundüberzeugung, wonach es vor allem demjenigen gutgehen soll, der Fleiß und Ideen einsetzt, nicht dem, der in die richtige Familie hineingeboren wird?
Wäre solch eine Erbengesellschaft also grundsätzlich ungerecht, undemokratisch und unmodern? Oder völlig in Ordnung, weil es ein Urtrieb des Menschen ist, seinen Kindern etwas weiterzugeben? Weil es ihn seit jeher dazu gebracht hat, sich anzustrengen, etwas aufzubauen, etwas, das das eigene Leben überdauern soll?
Kann sich ein Land wie Deutschland glücklich schätzen, weil die Alten so viel Wohlstand weitergeben können? Oder trifft eher das zu, was der Soziologe Heinz Bude behauptet: »Nichts«, so schreibt er, »ist ungünstiger und unangenehmer für den Bewegungscharakter einer Gesellschaft als die Herrschaft gebildeter Rentiers«?
Plötzlich finde ich diese Vorgehensweise absurd. Ich lese. Ich schreibe. Ich lese weiter. Und die Fragen, die durch meinen Kopf jagen, werden nicht weniger, sondern ständig mehr. Längst weiß ich, dass das Papier allein mir keine Antworten liefern wird. Was mir fehlt im Schwarz und Weiß der Zahlen und Zitate, der Thesen und Behauptungen, ist das Grau der Wirklichkeit.
Eigentlich wäre es doch ein Leichtes: Einige derer, die sich hinter den Statistiken verbergen, sind meine Freunde. Ich könnte sie anrufen, auf ein Glas Wein treffen und all meine Fragen stellen. Aber ich traue mich nicht. Wir reden über erfüllte Kinderwünsche und gescheiterte Ehen, über gelungenen Sex und misslungene Tage im Büro. Aber über das Geld unserer Eltern? Niemals. Na ja, so gut wie nie. Und wenn doch: dann kurz und knapp. Ich wage nicht, weiterzufragen. Und ich bin sicher, sie würden ungern erzählen. Ich scheue mich ja sogar, mit ihnen über den Inhalt dieses Buches zu sprechen. Dabei würde ich ihnen gerne so viele Fragen stellen. Auch die grundsätzlichen nach dem Land, seinen Reichtümern, der Verteilungsfrage. Aber vor allem die, in denen es um das Leben geht.
Wie fühlt ihr euch eigentlich mit dem Geld?, würde ich sagen, wenn ich mehr Mut hätte. Wie ist das, wenn das eigene angenehme Leben von der Vorgeneration mitfinanziert wird? Macht das Geld frei? Oder abhängig von den Eltern? Dürfen die sich jetzt einmischen in euer Leben?
Stattdessen sitze ich weiter stumm an meinem Schreibtisch. Und lese. Aber je mehr ich lese, desto mehr habe ich den Eindruck, dass nicht nur ich einen weiten Bogen um die mache, um die es eigentlich geht. Fast alle Texte in meinem Zeitungsarchiv, die allermeisten Abhandlungen auf meinem Bücherstapel haben ein entscheidendes Manko: Die Erben fehlen. Echte lebendige Erben. Reiche Erben. Firmenerben. Glückliche Erben. Zerstrittene Erben. Enterbte Erben. Verzweifelte Erben. Ich lege das Kursbuch zur Erbengesellschaft beiseite, räume den Armuts- und Reichtumsbericht ins Regal, die 500Seiten starke Erbschaftsstudie, all die anderen Standardwerke. Und ich beschließe, nach Erben zu suchen, nach Erben, die nicht meine Freunde sind. Erben, mit denen ich im Schutze der Fremdheit über alles reden kann. Um tatsächlich zu verstehen, was es mit dieser Erbengeneration auf sich hat. In der Hoffnung, zu begreifen, wie sie das Land verändern wird.
So weit der Plan.
Sechs Wochen später
Was für eine wahnwitzige Idee. Mit Erben sprechen? Genauso gut hätte ich mir vornehmen können, mit einem Baum zu plaudern oder mit dem grauen Kopfsteinpflaster vor meinem Bürofenster. In meinem Ordner »Anfragen Erbe« häufen sich die Absagen. Kleine Erben und große. Unternehmenserben. Wohlhabende Familien. Immer wieder dieselben Textbausteine, die höflich das »Lassen Sie uns in Ruhe!« umschreiben: »Ein Gespräch entspricht nicht der Familienphilosophie.« »Wir wollen Sie bitten, unserem Wunsch um Diskretion nachzukommen.« »Wir wünschen so wenig Öffentlichkeit wie möglich.«
Tatanga Mani, weiser Häuptling eines Indianerstammes, behauptet, dass jeder, der sich ausreichend müht, mit den Bäumen wird reden können. Ich versuche es also weiter. Brief um Brief. Mail um Mail. Anruf um Anruf. Und siehe da: Der schlaue Häuptling irrte nicht. Nach weiteren Wochen des Fragens und Wartens die erste Zusage. Es wird noch Monate dauern. Aber nach und nach werden sie alle reden wollen: echte lebendige Erben. Reiche Erben. Firmenerben. Glückliche Erben. Zerstrittene Erben. Enterbte Erben. Verzweifelte Erben.
Wie schön. Die Reise zur deutschen Erbengeneration kann beginnen.
1. FUCKING HELL – WIR HABEN EINFACH NUR GLÜCK
Etwas muss ich noch erledigen, bevor es tatsächlich losgehen kann: Ich muss das Medley, das seit meinen Lesewochen in meinem Kopf spielt, zum Schweigen bringen. All die Zahlen, die von großer Ungerechtigkeit erzählen, beiseitelegen. All die Zitate, die eine tiefe Kluft der Gesellschaft beschwören, erst mal vergessen. Denn ich glaube: Mit solch grobem Strich ließe sich kein Bild der neuen Erbengeneration zeichnen. Hier die reichen Nachkommen, dort die armen Habenichtse, hier die satten Abkömmlinge, dort die hungrigen Emporkömmlinge, hier die per Geburt Glücklichen, dort die von Beginn an Abgehängten. Das ist zu simpel, die moderne Gesellschaft zu divers, zu zerfasert, zu kompliziert. Will man der Wirklichkeit gerecht werden, müsste man versuchen, ein Mosaik zu legen – zusammengesetzt aus Hunderten Steinchen, geformt aus Dutzenden Geschichten, Wahrheiten und Widersprüchen.
Das erste Steinchen soll Lars sein. 41Jahre alt. Komponist.
Lars redet. Atemlos. Seit eineinhalb Stunden. Seit die Tür hinter uns ins Schloss gefallen ist. Er hatte mich kurz durch seine neue Wohnung geführt. 165Quadratmeter, ein Prachtstück. Perfekt sah sie aus, Wohnzeitschriftenatmosphäre, auch wenn ein Großteil der Möbel von IKEA war. Am Eingang hing eine Kreidetafel mit den Namen und Terminen der drei Kinder. Dahinter: eine offene Wohnküche, in der die älteste Tochter, ein Teenager mit langem blonden Haar, an einem gemütlichen Holztisch saß. Direkt daneben dann das helle Wohnzimmer, im Mittelpunkt: ein riesiges Sofa, schick, aber schlicht. Darauf lag das mittlere Kind, der Sohn, gerade etwas bockig. Vom langen Flur zweigten die Zimmer ab: drei Kinderzimmer – ganz hinten das der Jüngsten, die gerade Besuch hatte und nicht gestört werden wollte–, das Schlafzimmer und Lars' Büro. Hier hatte er eine zweite Ebene einziehen lassen, die gemauerte Decke und die Rundbögen des Backsteinbaus waren freigelegt und alte Türen aus einem Bauelementelager eingesetzt. »Unsere Angst war, dass es zu sehr nach Neubau aussieht«, hatte Lars gesagt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!