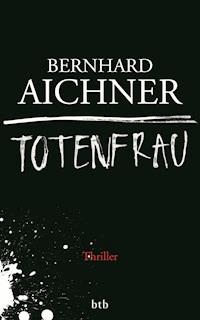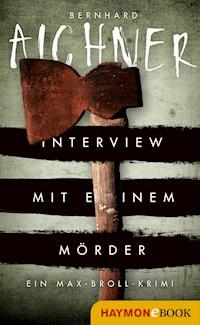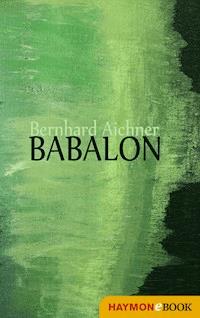0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Spannende Leseproben über Verbrechen und deren Hintergründe
Sie mögen Nervenkitzel? Gänsehaut im Lesesessel? Eiskalte Spannung im Kerzenschein? Dann entdecken Sie jetzt dunkle Geheimnisse und ungesühnte Verbrechen! Begegnen Sie charmanten Serienkillern zwischen True Crime und Fiction. Lesen Sie rein!
Alle Leseproben zum Crime Day 2021 von:
Bernhard Aichner, Jan Beck, Alex Beer, Christa von Bernuth, Cilla, Rolf & Molly Börjlind, Claire Douglas, Karsten Dusse, Horst Eckert, Marc Elsberg, Lucy Foley, Ragnar Jónasson, Charlotte Link, Karen M. McManus, Håkan Nesser und Alex Pohl.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: © Marie Rödel unter Verwendung eines Motivs von Gruner + Jahr
ISBN 978-3-641-28438-1 V001
Besuchen Sie uns auch auf www.crimeday.de
www.penguinrandomhouse.de
Herzlich willkommen in der Welt des CRIME DAY! Wenn Sie sich für wahre Verbrechen oder für fiktive Fälle im Kriminalroman interessieren, für die Psychologie von Tätern und Opfern, ihre Motive und Vorgeschichte, wenn Sie wissen wollen, warum es zu den Verbrechen kam und wie sie aufgeklärt wurden, dann sind Sie auf dem CRIME DAY genau richtig. Wir laden Sie ein, einen ganzen Tag lang in diese Welt des Verbrechens in all ihren Facetten einzutauchen. Von True Crime bis Fiction – unser Programm spiegelt die gesamte Bandbreite der Spannung wider und schlägt einen Bogen zwischen den Genres, was den besonderen Reiz dieses Tages ausmacht.
Bei der ersten online-Ausgabe des CRIME DAY am 21. März 2021 erwartet die Zuschauer ein vielfältiges Programm aus spannenden Talks mit True-Crime-Experten und deutschen wie internationalen Krimi-Autoren. Ihre Beteiligung ist dabei erwünscht. Bei den meisten Talks können Sie den Autoren und True-Crime-Experten Fragen stellen, bei mehreren interaktiven Formaten können Sie sich direkt einbringen und mit raten.
In den Talk-Runden des CRIME DAY diskutieren Bestsellerautoren und True-Crime-Experten kriminalistische
Fragestellungen aus unterschiedlichen Perspektiven:
Unsere Krimi-Autoren geben im Gespräch spannende Einblicke in ihr Leben als Schriftsteller, verraten, wo sie die Ideen und Inspiration zu ihren Büchern finden oder wo ungeahnte Hindernisse beim Schreiben lauern können. Ehrlich, schonungslos und auch sehr kurzweilig gewähren sie dem Publikum einen Blick hinter die Kulissen ihres Schreiballtags, egal ob sich dieser in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Schweden, Island oder den USA abspielt.
Tauchen Sie ab die in die Welt der eiskalten Spannung mit Leseproben von Bernhard Aichner, Jan Beck, Alex Beer, Christa von Bernuth, Cilla Börjlind, Rolf Börjlind, Molly Börjlind, Claire Douglas, Karsten Dusse, Horst Eckert, Marc Elsberg, Lucy Foley, Ragnar Jónasson, Charlotte Link, Karen M. McManus, Håkan Nesser und Alex Pohl.
Unsere Empfehlungen für Sie…
Zum Buch
Es ist Winter in Innsbruck. Ein Obdachloser rettet sich in eine seit langem leerstehende Wohnung am Waldrand. Im Schlafzimmer findet er eine Leiche, die dort seit zwanzig Jahren unentdeckt geblieben war. Ein gefundenes Fressen für Pressefotograf David Bronski. Gemeinsam mit seiner Journalistenkollegin Svenja Spielmann soll er vom Tatort berichten und die Geschichte der Toten recherchieren. Dass dieser Fall jenseits des Spektakulären aber auch etwas mit ihm zu tun hat, verschweigt er.
Seit er denken kann, fotografiert Bronski das Unglück. Richtet seinen Blick auf das Dunkle in der Welt. Dort wo Menschen sterben, taucht er auf. Er hält das Unheil fest, ist fasziniert von der Stille des Todes. Es ist wie eine Sucht. Bronski ist dem Tod näher als allem anderen, er lebt nur noch für seine Arbeit und seine geheime Leidenschaft. Das Fotografieren, analog. Dafür zieht er sich zurück in seine Dunkelkammer. Es sind Kunstwerke, die er hier schafft. Porträts von toten Menschen. Es ist sein Versuch, wieder Sinn zu finden nach einem schweren Schicksalsschlag.
Zum Autor
BERNHARD AICHNER (1972) schreibt Romane, Hörspiele und Theaterstücke, er ist einer der erfolgreichsten Autoren Österreichs – aber er ist auch Fotograf. Bevor er sich der Werbefotografie zuwandte, war er jahrelang als Pressefotograf für den KURIER tätig. Bei der zweitgrößten Tageszeitung Österreichs erlernte er das journalistische Handwerk. Seine Aufgabengebiete waren vielfältig, im Besonderen war er von der Polizeifotografie fasziniert. Hier ging es um Unfälle, Mord und Naturkatastrophen. Aus diesem Grund siedelt Aichner nun seine neue Buchreihe genau in diesem Milieu an, in dem er sich jahrelang bewegt hat. Er weiß also aus erster Hand, worüber er schreibt. Für seine Kriminalromane wurde Aichner mit mehreren Literaturpreisen und Stipendien ausgezeichnet, zuletzt mit dem Burgdorfer Krimipreis 2014, dem Crime Cologne Award 2015 und dem Friedrich-Glauser-Preis 2017.
BERNHARD AICHNER
DUNKELKAMMER
EIN BRONSKI KRIMI
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © Bernhard Aichner by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: semper smile, München, nach einem Entwurf von Thomas Raab
Umschlagmotiv: © www.fotowerk.at, Ursula Aichner
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-22503-2V004
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
EINS
Er wäre beinahe erfroren in dieser Nacht.
Keine Stunde länger hätte er die Kälte ertragen, sie hätte sich ganz tief in ihn hineingeschlichen, ihn langsam und leise kaputt gemacht.
Der Schnaps wäre seine vermeintliche Rettung gewesen. Er hätte so lange weitergetrunken, bis er nichts mehr gespürt hätte. Er wäre für immer eingeschlafen. Ein Spaziergänger hätte ihn am nächsten Tag in seinem Zelt gefunden.
Am Boden festgefroren.
Nur noch ein Klumpen kaltes Fleisch.
Ein stilles Ende wäre es gewesen.
Kurt Langer.
Verstorben am 21. Jänner 2021.
Ein obdachloser Spinner, der eineinhalb Wochen am Waldrand in einem Zelt geschlafen hatte. Kurt Langer war überzeugt davon gewesen, dass ihm der Winter nichts anhaben konnte. Doch die Minustemperaturen hatten ihm wehgetan, er war den Steilhang hinuntergerutscht und schließlich über die Brüstung geklettert. Er zweifelte nicht daran, dass es der einzige Weg war, die Pechsträhne in seinem Leben zu beenden. Er tat endlich, wozu er sich seit Tagen zu überreden versuchte. Kurt traf die Entscheidung gerade noch rechtzeitig, bevor er erfror.
Er nahm einen Stein und schlug das Fenster ein.
Wenig später wäre er bereits zu betrunken dafür gewesen, sich aufzuraffen und in dieses Penthouse einzubrechen.
Das Timing war perfekt.
Seit er sein Zelt nahe des Hangs aufgestellt hatte, war niemand in dieser Wohnung gewesen. Kurt hatte immer wieder hinübergeschaut, an keinem der zehn Tage hatte Licht gebrannt. Der Wohnblock schmiegte sich an den Hang, von der Straße konnte man die oberste Terrasse nicht einsehen. Ohne Blicke auf sich zu ziehen, schaffte Kurt es über die Brüstung. Ohne zu zögern, schlug er die Scheibe ein.
Das Glas brach.
Er war in Sicherheit.
Endlich hatte er ein Dach über dem Kopf.
Kein Wind, kein Schnee.
Doch es war kühl.
Mehrere Fenster waren gekippt, ein eisiger Luftzug wehte.
Schnell schloss Kurt die Fenster. Er bewegte sich beinahe lautlos. Obwohl er betrunken war, gelang es ihm, bedacht und vorsichtig vorzugehen. Das Adrenalin steuerte ihn. Er zog seine Schuhe aus, um keine Spuren zu hinterlassen. Er behielt seine Handschuhe an, nahm ein Kissen vom Sofa und schloss das Loch, durch das er seine Hand gestreckt hatte, um die Terrassentür von innen zu öffnen. Er klemmte das Kissen zwischen Scheibe und eine Stuhllehne.
Kurt machte alles richtig.
Er stand im Dunklen.
Nur ein bisschen Mondlicht erhellte den großen Raum.
Er drehte an den Reglern der Heizkörper, hörte das Wasser in den Leitungen, spürte, wie sie sich langsam erwärmten, dann setzte er sich. Holte die Schnapsflasche aus seinem Rucksack und trank. Für den Moment war er einfach nur zufrieden, weil er die Nacht im Warmen verbringen durfte. Er breitete sich einfach auf dem herrlich weichen Sofa aus und deckte sich mit einer Decke zu.
Trank die Flasche leer und schlief ein.
Vierzehn Stunden lang rührte er sich nicht.
Die Sonne schien ihm ins Gesicht, als er aufwachte. Ihm war heiß, er hatte immer noch die Handschuhe an, seine Winterjacke, er schwitzte, zog sich aus. Er brauchte einen kurzen Moment, um sich zu erinnern, wie er in diese Wohnung gekommen war. Der Einbruch, der Schnaps, dieses schöne Gefühl, endlich wieder einmal in Geborgenheit schlafen zu können.
Kurt schaute sich um.
Alles, was in der Nacht in Schwarz getaucht war, zeigte sich jetzt im Licht. Die cremefarbene Ledercouch, auf der er lag, der große Esstisch, eine Jugendstilkommode, ein imposanter Gläserschrank, alle Möbel schauten so aus, als wären sie von Wert. Genauso wie die Bilder an den Wänden. Antiquitäten und Kunst. Kurt ließ sich Zeit, studierte alles im Detail. Seine Blicke blieben an der Silberkaraffe und den Bechern auf der Kommode hängen, er überlegte, wem er all die Dinge verkaufen könnte, die er gleich in seinen Rucksack packen würde. Er schätzte den Wert der Halskette, die auf dem Couchtisch lag, und er malte sich aus, was er noch alles finden würde in dieser Wohnung. In Schubladen und Schränken.
Kurt freute sich.
Er sah es nicht sofort.
Dass irgendetwas nicht stimmte an diesem Ort. Es war ihm zuerst nicht aufgefallen. Dass da überall Staub war. Zentimeterhoch.
Der gedeckte Frühstückstisch. Vertrocknetes Essen.
Ein verdorrter Strauß Rosen.
Kurt versuchte es zu begreifen. Das unnatürliche Bild, das sich ihm bot, zu verarbeiten. Er nahm es wie in Zeitlupe in sich auf. Schüttelte den Kopf. Leckte sich mit der Zunge die Lippen ab. Im ersten Moment schob er es auf den Alkohol, machte seine Kopfschmerzen dafür verantwortlich, er schlug sich sogar ins Gesicht. Dann beugte er sich über die Titelseite der Zeitung, die vor ihm lag. Kurt schloss die Augen. Öffnete sie wieder.
Er fragte sich, ob er verrückt geworden war.
Es war das Datum.
Es waren die Fotos.
Ein Politiker, der schon lange nicht mehr im Amt war, schaute betroffen in die Kamera. Er stand zwischen Trümmern und sprach mit Journalisten. Kurt konnte sich noch an alles ganz genau erinnern. Diese Bilder hatten sich in seinem Kopf eingebrannt. Das Lawinenunglück in Galtür.
Die Zeitung war vom 27.02.1999.
Vier Tage vorher waren in einem Tiroler Bergdorf einunddreißig Menschen gestorben. Schneemassen hatten alles unter sich begraben, Häuser wurden zerstört, Familien auseinandergerissen, das Urlaubsparadies war über Nacht zum Inferno geworden. Überall nur Zerstörung und Schmerz. Die ganze Welt hatte damals darüber berichtet.
Reporter, Kameraleute und Fotografen.
Und Kurt war einer von ihnen.
Mit den ersten Journalisten war er ins Tal geflogen. Wie die Geier waren sie über das Dorf hergefallen, hatten gefilmt, Fotos gemacht, die Angehörigen der Toten vor die Linse gezerrt.
Kurt zitterte.
Der Blick auf die Zeitung katapultierte ihn zurück.
Damals war er ein erfolgreicher Pressefotograf gewesen.
Jetzt war er kaputt. Betäubte sich mit Alkohol. Gierte danach.
Er ging in die Küche.
Öffnete Vorratsschränke, suchte nach Schnaps.
Aber da war keiner.
Nur Frauenkleider, die am Boden lagen.
Ein Rock.
Eine Bluse.
Unterwäsche.
Fallen gelassen vor einundzwanzig Jahren und fünf Tagen.
Niemand hatte die Kleider aufgehoben. Keiner hatte den Tisch abgeräumt. Tassen und Teller abgespült. Unheimlich war es. Am liebsten wäre er davongelaufen, doch er blieb. Er hasste sich dafür, dass er sich auf all das eingelassen hatte. Hektisch riss er die restlichen Schränke auf, suchte weiter nach Schnaps, doch da waren nur abgelaufene Lebensmittel.
Nudeln. Thunfisch. Cornflakes.
Nüsse. Haltbar bis 12/1999.
Das kann doch alles nicht sein, flüsterte er.
Bis zum Schluss wollte er es nicht wahrhaben.
Es nicht sehen. Dass vermutlich außer ihm noch jemand in der Wohnung war.
Ganz in seiner Nähe.
Kurt betrat das Schlafzimmer.
Er setzte einen Schritt vor den anderen.
Ging auf das Bett zu.
Er sah die vielen braunen Flecken auf den Laken.
Blut.
Ein Massaker musste es gewesen sein.
Kurt starrte den Körper an. Die ledrig braune Haut, die hervorstehenden Knochen. Für einen Moment vergaß er den Alkohol, er stand da, über der Leiche, und würgte. Zum zweiten Mal innerhalb einer halben Stunde wurde er in seine Vergangenheit zurückgeworfen. Es war so, als würde ihn das Schicksal mit Gewalt daran erinnern wollen, dass er früher ein besseres Leben geführt hatte.
Da waren glückliche Tage, die Fotografie, ein gefülltes Bankkonto, der Journalismus, für den er einmal brannte. Alles war wieder da. Denn der Anblick war ihm vertraut.
Anfang der neunziger Jahre in den Ötztaler Alpen.
Ein deutsches Ehepaar war beim Wandern über die Mumie gestolpert. Kurt war einer der Ersten, der von dem über fünftausend Jahre alten Körper Bilder machte. Ötzi. Die wohl bekannteste Leiche aller Zeiten. Kurt war hautnah dabei, verdiente ein Vermögen damit, seine Aufnahmen gingen um die ganze Welt.
Die Mumie von damals war gut für ihn.
Die Mumie, die jetzt vor ihm lag, war es nicht.
Sie hatte keinen Kopf mehr.
Jemand hatte ihn abgeschnitten.
Kurt verfluchte sich. Diese Nummer war eindeutig zu groß für ihn. Man würde zuerst die Wohnung auseinandernehmen und dann ihn, man würde ihn wegen Einbruchs belangen, ihm endlos Fragen stellen und ihn am Ende auf die Anklagebank zerren.
Kein Schnaps mehr, Gefängnis vielleicht.
Damit hatte er nicht gerechnet. Er geriet in Panik. Verzweifelt versuchte er ein paar klare Gedanken zu fassen.
Da waren nur Fragen.
Keine Antworten.
Wer war diese Frau?
Was war mit ihr passiert?
Warum war ihr Körper nicht verwest?
Warum hatte niemand sie vermisst?
Warum hatte sie in all den Jahren niemand gefunden?
Wer schneidet jemandem einfach den Kopf ab?
Wie war das alles nur möglich?
Kurt erinnerte sich daran, wie gut er einmal darin gewesen war, Schlüsse zu ziehen, den richtigen Antworten hinterherzujagen. Jetzt aber war er nur noch ein versoffener alter Sack. Träge und leer, er hatte keine Energie mehr, der Wunsch zu trinken war stärker als alles andere. Er stahl, log und betrog, wenn es nötig war, er hatte jedes Gespür für sich und die Welt verloren. Was früher für ihn ein Volltreffer gewesen wäre, bedrohte ihn jetzt.
Diese Leiche, die vor ihm lag.
Eine Mumie.
Er musste eine Entscheidung treffen. Abwägen, was klüger war. Bleiben oder abbrechen. Die Polizei rufen, oder einfach tun, wozu er hier war. Fieberhaft überlegte er, beinahe panisch lief er durch die Wohnung, suchte weiter nach Schnaps. Kurt war gerade dabei durchzudrehen, als er den Einkaufskorb in der Vorratskammer fand. Er stand in einem Regal neben Konservendosen.
Kurt hätte beinahe alles übersehen.
Eine Geldtasche.
Schokolade und Wein. Sechs Flaschen.
Er suchte einen Öffner, zog den Korken aus der ersten Flasche.
Kurt setzte an und trank. Einen langen Schluck.
Dann noch einen.
Langsam beruhigte er sich.
Dann öffnete er die Geldtasche.
Da waren Kreditkarten, ein paar Scheine und ein Ausweis.
Langsam hörte er auf zu zittern.
Eine Stunde noch dachte er nach. Trank.
Dann wählte er Bronskis Nummer.
ZWEI
KURT LANGER & DAVID BRONSKI
– War gar nicht so leicht, deine Nummer rauszubekommen.
– Wer spricht da?
– Ganz schön teuer so ein Gespräch nach Deutschland. Hab nur so ein billiges Wertkartentelefon. Außerdem ist es nass geworden letzte Nacht.
– Was soll das? Wer ist da?
– Ein Kollege von früher. Du erinnerst dich doch noch hoffentlich an mich.
– Kurt?
– Gut, deine Stimme zu hören, Bronski.
– Was willst du, Kurt?
– Was ich will? Mich mal wieder melden. Hab eben an dich gedacht. Ein bisschen über die alten Zeiten plaudern. Über die Arbeit. Und vielleicht habe ich einen Job für dich.
– Ich habe jetzt keine Zeit. Bin in der Dunkelkammer.
– Dunkelkammer? Du entwickelst immer noch selber?
– Ja. Und deshalb muss ich jetzt auflegen, die Negative müssen gleich aus dem Entwickler.
– Du sitzt also tatsächlich immer noch bei Rotlicht in deinem Kämmerchen und vergrößerst deine Bilder? Du bist echt ein Spinner, Bronski. Wofür du drei Stunden brauchst, braucht man bei Photoshop drei Minuten. Warum tust du dir das an?
– Ist mein Hobby. Aber jetzt sag mir bitte einfach, was du willst, Kurt.
– Und was fotografierst du so? Hobbymäßig. Nackte Frauen?
– Sprich oder schweig, Kurt.
– Warum denn so abweisend? Wir haben uns doch immer gut verstanden, oder? Du und ich, Bronski. Wir waren ein gutes Team. Deshalb rufe ich dich auch an. Weil ich dir vertrauen kann. Und weil ich denke, dass du genau der richtige Mann bist für das hier.
– Wofür?
– Ich bin da auf etwas gestoßen. Eine große Nummer, Bronski. Das bringt ordentlich was ein. Du hast die Kontakte, du kannst das zu Geld machen.
– Nett von dir, Kurt, dass du an mich denkst, aber ich habe wirklich genug zu tun. Es ist besser, wenn du jemand anderen anrufst.
– Wenn du diese Bilder machst, kannst du ein paar Monate lang die Beine hochlegen. Das bringt richtig Kohle.
– Und warum erledigst du es dann nicht selber? Mach deine Bilder und verkauf sie. Dafür brauchst du mich nicht, Kurt.
– Doch, Bronski. Ich brauche dich.
– Sag mir wofür, oder ich lege jetzt auf.
– Ich bin leider nicht mehr im Geschäft. Du aber schon, wie ich gehört habe. Läuft prima bei dir, du scheinst Berlin ganz gut im Griff zu haben. Arbeitest jetzt für die ganz Großen. Wirst es mir nicht glauben, aber wegen dir hole ich mir immer wieder mal die Zeitung am Kiosk. Und wenn ich dann ein Foto von dir sehe, freue ich mich. Bronski hat es geschafft, sage ich mir dann. Er fotografiert jetzt für eine seriöse, große deutsche Tageszeitung. Respekt, mein Lieber.
– Klingt besser, als es ist. Am Ende mache ich denselben Mist wie vor zwanzig Jahren. Aber jetzt sag schon. Was ist los mit dir? Warum fotografierst du nicht mehr?
– Bin ziemlich am Ende, Bronski.
– Soll heißen?
– Ich bin obdachlos. Seit über drei Jahren schon.
– Das ist nicht dein Ernst, oder?
– Doch. Und ich saufe. Spätestens in einer Stunde werde ich wieder so betrunken sein, dass ich mich nicht mehr daran erinnern werde, dass wir überhaupt miteinander telefoniert haben.
– Das tut mir leid, Kurt.
– Muss es nicht. Es ist nur wichtig, dass du jetzt nicht auflegst.
– Ich lege nicht auf.
– Ich hatte doch immer einen guten Riecher, oder?
– Ja, den hattest du.
– Ich wusste immer, wenn eine Geschichte etwas wert war. Und ich weiß es auch jetzt noch. Deshalb musst du nach Tirol kommen, Bronski. So schnell es geht. Ich weiß nämlich nicht, wie lange die Sache hier noch unentdeckt bleibt.
– Tirol? Was soll ich da? Das ist nicht mein Revier, Kurt. Das sollen die Jungs vor Ort machen, rentiert sich nicht.
– Doch, es rentiert sich.
– Sag mir, was du hast.
– Nein. Ich gebe dir die Adresse, und du setzt dich ins Auto. Wenn du da bist, bezahlst du mich, ich verschwinde, und du kannst deine Fotos machen.
– Ich soll die Katze im Sack kaufen?
– Keine Katze.
– Was dann?
– Erinnerst du dich an die deutsche Milliardärin, die vor zwanzig Jahren verschwunden ist? War eine Belohnung auf sie ausgesetzt. Wir haben damals davon geträumt, das Kopfgeld abzugreifen. Eine Million Mark.
– Ja, ich erinnere mich. Aber was hat das mit dir zu tun?
– Ich habe sie gefunden, Bronski, ich habe sie gefunden.
DREI
Es war das Einzige, was ich wirklich wollte.
Meine Bilder entwickeln. Die Negativstreifen im Dunklen aus dem Gehäuse holen, sie auf eine Spule wickeln und in die Entwicklerdose legen. Chemie einfüllen, warten, fixieren, spülen. Nichts machte ich lieber.
Weit weg sein von der Welt. In meiner rot beleuchteten Kammer darauf warten, bis die Bilder, die ich aufgenommen hatte, zum Leben erwachten. Etwas Schönes auf Papier gebannt, behutsam belichtet, es war jedes Mal wie ein Wunder. Zuzusehen, wie aus dem Nichts etwas entstand. Mein Glück in Schwarz und Weiß.
Altmodisch und längst überholt.
Ich war ein analoger Spinner, wie Kurt sagte.
Einer, der einfach stehengeblieben war, den digitalen Weg nur zum Teil beschritt. Alles, was ich beruflich fotografierte, landete natürlich auf einer Speicherkarte, das musste schnell gehen, noch am Unfallort saß ich in meinem Wagen und schickte die Bilder von meinem Notebook in die Redaktion. Wenn es noch schneller gehen musste, jagte ich sie ohne Bearbeitung direkt von der Kamera ins Netz. Ohne Liebe fürs Detail, ohne Anspruch, ich fotografierte einfach nur das Unglück der anderen, ich dokumentierte es. Wie ein Arzt vielleicht, der am Operationstisch steht, ein Rettungssanitäter, ein Feuerwehrmann. Ich war bei den Ersten am Unfallort. Am Tatort. Ich ging dorthin, wo Menschen starben. Wo es brannte, wo eingebrochen wurde, wo geraubt und geprügelt wurde, wo die Natur gegen den Menschen gewann. Katastrophen, Unruhen, Ausschreitungen. Ich machte Fotos.
Zuerst die, die ich machen musste.
Dann die anderen.
Meine Fotos.
Analog. Nur für mich. Mit einer alten Olympus 10, meiner allerersten Kamera und einem Ilford Film, 400 Iso. So hatte ich es vor einer Ewigkeit gelernt, so machte ich es immer noch. Auch wenn man mich auslachte. Kollegen, die mich fragten, was ich mit dem alten Ding wollte, warum um Himmels willen ich analog fotografierte. Sie verstanden es nicht. Und ich erklärte mich auch nicht. Für sie war ich ein Freak. Anfangs sprachen sie noch darüber, irgendwann ließen sie mich aber einfach in Ruhe, es interessierte niemanden, warum ich zusätzliche Bilder machte.
Es blieb mein Geheimnis.
Alles, was in meiner Dunkelkammer passierte.
Niemand wusste davon. Der Einzige, der vielleicht hätte ahnen können, was ich dort machte, war Kurt. Er kannte mich noch von früher. Mit ihm hatte ich darübergeredet vor vielen Jahren, er hatte mich nicht verurteilt, er hatte nur gegrinst. Gesagt, dass wohl jeder auf seine Art ein bisschen durchgeknallt sei. Er wunderte sich, aber er mischte sich nicht ein.
Kurt Langer.
Nach so vielen Jahren rief er mich an.
Was er sagte, schockierte mich. Machte mich neugierig. Er wusste, welche Tasten er drücken musste, damit ich zu laufen begann. Kurt kannte mich. Und ich kannte ihn. Es war ein Anruf aus einer anderen Welt, aber ich erinnerte mich. Kurt war kein Freund, aber er war immer einer von den Guten gewesen. Wir hatten viel zusammen erlebt, über zehn Jahre lang hatten wir uns gemeinsam auf der Straße herumgetrieben, er war so etwas wie mein Mentor gewesen, als ich damals ganz neu im Geschäft war. Kurt war immer kollegial, nicht so neidzerfressen und egoistisch wie andere Kollegen, ihm ging es immer nur um den Nervenkitzel, darum, dieses Gefühl mit jemandem teilen zu können.
Meistens war ich das.
Wir hatten Spaß an der Arbeit, wir tranken zusammen. Kurt mehr als ich. Er hatte immer schon einen Hang zum Übertreiben. Wo es hinführen sollte, interessierte ihn nicht, er wollte leben, aus dem Vollen schöpfen, solange es ging. Ein Leben im Rausch. Dass es irgendwann so enden musste, wusste er. Trotzdem berührte es mich.
Dass er jetzt obdachlos war.
Ich hörte es an seiner Stimme, dass er tatsächlich ganz unten angekommen war. Keine Arbeit mehr, keine Wohnung, da war nur noch dieser Spürsinn, für den er bekannt gewesen war. Sein Händchen für die ganz großen Geschichten und ein letzter klarer Blick, bevor er sich ins Delirium soff. Kurt hatte meine Nummer gewählt. Wahrscheinlich weil er wusste, dass ich ihm glauben würde. Auch wenn es noch so verrückt klang, was er sagte. Ich wusste, dass er mich nicht umsonst nach Innsbruck holen würde. In die Stadt, in der ich aufgewachsen war, in der ich mich verliebt hatte. Obwohl ich alle Brücken abgebrochen hatte, trieb es mich dorthin.
Zurück in die Vergangenheit.
Mein Leben spielte sich in Berlin ab, es gab nichts mehr, das mich mit früher verband. Da war nichts mehr, worüber ich hätte reden müssen. Ich hatte alles verloren und nicht wiedergefunden. Hatte mir erfolgreich eingeredet, dass ich es aufgearbeitet hatte, dass alles Bestimmung war, was geschehen ist. Ich hatte mich damit abgefunden, dass so etwas wie Glück auf Dauer für mich nicht vorgesehen war.
Tirol gab es für mich bis zu diesem Moment nicht mehr.
Doch dann stieß Kurt diese Türe wieder auf.
Mit seinem Anruf riss er mich aus meiner Welt dumpfer Behaglichkeit. Die Milliardärin, die damals verschwunden war, das Kopfgeld, das auf sie ausgesetzt war. Es war alles wieder da, Kurt hatte auf die richtige Taste gedrückt.
Meine Anfänge fielen mir wieder ein.
Mitte der neunziger Jahre.
Vom Kunststudenten wurde ich zum Bluthund.
Von jetzt auf nachher verdiente ich mein Geld mit dem Unheil von anderen. Ich machte Bilder davon. Rund um die Uhr war ich im Einsatz, immer wartete ich darauf, dass etwas passierte. Wenn andere weinten, freute ich mich. Wenn sie entsetzt waren, verdiente ich Geld. Ich war der Geier, der über den Toten kreiste. Mehr als zwanzig Jahre später war ich es immer noch.
Fotos: David Bronski.
Ich hatte irgendwann damit begonnen und konnte nicht mehr aufhören. Wie eine Sucht war es. Ganz harmlos fing es an, dann wurde ich von diesem Gefühl verschluckt. Ich hatte alles vergessen, was vorher gewesen war. Die Finsternis zog mich an, mehr als das Licht. Ich war wie ferngesteuert. Alles passierte einfach.
Am Ende des vierten Studienjahrs begann es. Ich musste Geld verdienen im Sommer, arbeitete als Aushilfe im Büro einer großen Zeitung in Innsbruck. Es war ein Job in der Bildredaktion, ich scannte Fotos ein, beschriftete und archivierte sie, es war ein langweiliger Sekretariatsjob, aber ich mochte, was ich tat. Es war schön, wieder eine Zeit lang in meiner Heimat zu verbringen, ein paar Wochen lang Wien den Rücken zu kehren. Die Stadt, in der ich studierte. Die Stadt, die im Sommer unerträglich war.
Ich freute mich, die Berge wiederzusehen.
Und Mona.
So lange war ich schon verliebt in sie gewesen, doch es hatte sich nie ergeben, dass wir uns näherkamen. Ich war nach Wien gegangen, sie war in Innsbruck geblieben. Nur in den Ferien sahen wir uns hin und wieder. Bis sie mir diesen Job vermittelte. Mit dem Chefredakteur sprach und sich für mich einsetzte. Mona nahm das Ruder in die Hand und steuerte. Obwohl sie erst fünfundzwanzig war, hatte ihr Wort Gewicht, insgeheim war sie die Seele der Redaktion, alle konnten sich auf sie verlassen, sie war die Sonne, die jeden Morgen aufging. Zumindest für mich.
Für so lange Zeit war es mein größter Wunsch gewesen, sie in die Arme zu nehmen, sie zu berühren, sie zu küssen. Ich wollte es. So wie Mona auch. Deshalb bin ich nicht in mein Studentenleben zurückgekehrt, als der Sommer vorbei war. Ich brach meine Zelte in Wien ab, nahm die Einladung zu bleiben, an. Alles ergab sich einfach so, ich hatte eine Chance bekommen und sie genutzt. Der damals fest angestellte Pressefotograf war schwer erkrankt, von heute auf morgen nicht mehr aufgetaucht, ein Loch wurde in die Redaktion gerissen, das ich füllen sollte.
Der Chefredakteur hatte mich gefragt, ob ich Freude daran hätte, einzuspringen. Ich hatte plötzlich ein Jobangebot, einen Grund zu bleiben. Dass man es mir zutraute, freute mich. Alle wussten, dass ich Kunst studierte, Schwerpunkt Fotografie, ich hatte die Ausrüstung, war technisch versiert, alles sprach dafür, dass es funktionieren konnte. Sie motivierten mich, verführten mich, obwohl ich damals noch absolut keine Ahnung von diesem Geschäft hatte, traute man es mir zu.
Ich sprang ins kalte Wasser.
Und ich genoss es.
Vom ersten Tag an war ich begeistert. Ich war plötzlich im ganzen Land unterwegs, ich fotografierte bei Pressekonferenzen, Eröffnungen, Verleihungen, ich machte Bilder von Unfällen, Polizei- und Rettungseinsätzen. Da waren keine leeren Worte mehr, alles, was ich auf Film bannte, passierte wirklich, aus Theorie wurde Praxis. Ich schrieb keine Arbeiten mehr, ich belichtete Filme und entwickelte sie, ich fühlte mich zuhause im Redaktionslabor, die Universität vermisste ich nicht. Den Wunsch, Künstler zu werden, verwarf ich. Das schnelle Geld lockte mich, ich verdiente plötzlich in einer Woche mehr, als ich als Redaktionsassistent in einem Monat verdient hatte. Ich hatte einer künstlichen Welt den Rücken gekehrt und war in der Realität angekommen. Und ich hatte Freude daran.
Da war das Lächeln von Mona bei der Redaktionskonferenz.
Die neuen Aufträge, die ich jeden Morgen bekam.
Die Wertschätzung der Kollegen.
Ich fühlte mich wie ein Cowboy, der gut bewaffnet durch die Gegend ritt, ich fotografierte alles, ich füllte das Archiv mit Landschaftsaufnahmen, Architekturfotos, ich machte Portraits von Menschen, die es irgendwann garantiert in die Zeitung schaffen würden, Wirtschaftstreibende, Kulturschaffende, Politiker aus allen Reihen, irgendwann wurden all diese Bilder gebraucht. Jeder Schuss ein Treffer. Landeshauptleute und Minister in unvorteilhaften Posen, Fotos von Gerichtsprozessen, Angeklagte, Richter und Staatsanwälte. Ich war richtig gut in meinem Job. Wenn jemand mit dem Auto verunglückte, wenn es brannte, wenn eine Tankstelle überfallen wurde, wenn ein Reisebus eine Schlucht hinunterstürzte, ich fotografierte es. Alles, was irgendwann gedruckt werden konnte. Ich machte jeden Moment zu Geld, der wichtig zu sein schien, ich dokumentierte jedes Unglück, jeden Tropfen Blut.
Ich gierte danach.
Der Chefredakteur sprach von einem Glücksfall. Regelmäßig hob er bei den Sitzungen die Zeitung hoch und schwärmte von meinen Bildern. Er streute mir Rosen, motivierte mich, immer noch mehr zu geben, ich schlief neben dem Polizeifunk, vierundzwanzig Stunden am Tag war ich auf Abruf, bis der Sommer vorbei war, war ich unabkömmlich geworden. Ich verdiente jede Menge Geld, Mona und ich kamen uns näher. Wir waren unzertrennlich, wir arbeiteten zusammen, wir schliefen im selben Bett, wir liebten uns. Weil wir uns tatsächlich geküsst hatten irgendwann. Alles, was ich mir gewünscht hatte, war in diesem Sommer in Erfüllung gegangen.
Ich stellte mir vor, dass ich mit Mona bei der Zeitung alt werden würde. Ich wollte unbedingt daran glauben. Die Zwischenrufe meines Professors aus Wien ignorierte ich, seine Versuche, mich dazu zu bringen, meine Entscheidung noch einmal zu überdenken. Ich überhörte seine gut gemeinten Ratschläge, widersprach ihm in Gedanken, als er sagte, ich würde mein Talent verschwenden, meine Gabe nicht richtig nutzen. Ich wollte nicht, dass er an meiner Entscheidung rüttelte, alles sollte so bleiben, wie es war. Es fühlte sich gut und richtig an. Der neue Job. Das neue Leben mit Mona.
Fünf Jahre lang war ich der König der Welt.
Zufrieden mit allem.
Wunschlos, weil ich alles hatte.
Bis mir irgendwann alles genommen wurde.
Mein Glück.
Das Leben in Tirol.
Plötzlich war es zu Ende.
Aus der Traum.
Nachdem das Entsetzliche passiert war, fanden wir nicht zu einer gemeinsamen Sprache zurück. Mona und ich. Wir verdrängten es. Liefen einfach davon. Nach Berlin.
Ein Anfang in einer neuen Stadt hatte es sein sollen. Wir wollten es beide. Wir taten alles dafür, damit wir es schaffen. Neue Jobs, neue Wohnung, neue Landschaft. Aber es funktionierte nicht. Wir hatten es uns leichter vorgestellt. Hofften, dass sich die dunklen Wolken über uns verziehen würden, aber so kam es nicht.
Wir scheiterten.
Und Berlin blieb mir fremd.
Obwohl ich mittlerweile schon seit vierzehn Jahren dort lebte, war ich immer noch nicht zuhause an diesem Ort. Obwohl ich mich wahrscheinlich besser in dieser Stadt auskannte als viele, die dort geboren wurden, fand ich keinen Zugang zu ihr. Ich kannte jeden Stadtteil in- und auswendig, in den ersten Wochen war ich jeden Meter mit dem Rad abgefahren. Mit dem Stadtplan in der Hand erarbeitete ich mir jeden Winkel, ich lernte die Straßennamen. Prägte mir alles ein. Ämter, Behörden, alle öffentlichen Gebäude, schnelle Wege, Parks, Rotlichtviertel, Touristenhotspots, ich las Bücher über diese Stadt, besuchte Museen.
Ich lernte Berlin auswendig.
Ich sollte für eine von Deutschlands erfolgreichsten Zeitungen arbeiten, man hatte mich zum Vorstellungsgespräch geladen. Ich war perfekt vorbereitet, als ich zum ersten Mal das Büro der Chefredakteurin betrat. Regina hieß sie. Coole Frau, mein Alter, Beine am Schreibtisch, ich mochte sie. Und sie mochte mich. Regina brauchte keine zwei Minuten, um mich einzustellen, sie sagte, dass sie sich darüber freue, einen so erfahrenen Fotografen an Bord begrüßen zu dürfen. Sofort bot sie mir das Du an, wir tranken ein Glas von dem Tiroler Schnaps, den ich ihr mitgebracht hatte, dann schüttelte sie meine Hand und stellte mich der Redaktion vor. Alles war ganz einfach. Dieser Moment, vor dem Mona und ich uns so gefürchtet hatten. Neue Menschen. Neue Namen. Neues Leben.
Ich fotografierte.
Mona arbeitete in einer Kneipe in Berlin Mitte.
Wir gaben uns Mühe.
Doch am Ende scheiterten wir.
Die Arbeit blieb die einzige Konstante. Der Tresen, hinter dem Mona stand. Und die Bilder, die ich machte. Alltag war es, der uns Sicherheit gab. Beinahe fühlte es sich an wie früher. Wir waren abgelenkt, schoben das eigentliche Problem zur Seite, verdrängten es. Wir wollten beide nicht wahrhaben, dass unsere Beziehung wie ein Buch war, das wir zu Ende gelesen hatten.
Wir vermieden es, darüber zu reden.
Judith. Unser Schmerz. Die Leere, die laut war.
Mona schenkte Bier aus, ich drückte auf den Auslöser.
Tat, was ich am besten konnte.
Fotos machen. Jahrelang.
Bis Kurt anrief.
VIER
DAVID BRONSKI & REGINA MASEN
– Und?
– Was soll das, Bronski?
– Du hast die vielen schönen Bilder also bekommen.
– Natürlich habe ich sie bekommen. Aber ich frage mich, was verdammt noch mal du mir da geschickt hast?
– Du bekommst die Fotos exklusiv. Musst nur ein bisschen tiefer in die Tasche greifen als sonst.
– Langsam, Bronski. Du sagst mir jetzt zuerst, wo du bist. Wer das ist auf den Bildern. Und warum ich noch nichts davon gehört habe. Unsere Polizeireporter wissen nichts über diese Leiche.
– Niemand weiß davon. Noch nicht. Wir sind mehr oder weniger die Einzigen, die wissen, dass diese Frau tot ist. Dass sie umgebracht wurde. Und wo sie abgeblieben ist.
– Sprich nicht in Rätseln. Sag endlich, um was es da geht.
...Ende der LeseprobeJAN BECK, 1975 geboren, ist das Pseudonym eines erfolgreichen deutschsprachigen Autors. Bevor er sich dem Schreiben widmete, arbeitete Jan Beck als Jurist. In seinem rasanten Thrillerdebüt Das Spiel lässt Beck seine Leser tief in die Abgründe der menschlichen Seele blicken. Wenn Jan Beck nicht gerade schreibt, verbringt er seine Zeit in der Natur, besonders gerne im Wald.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Jan Beck
Das Spiel
Thriller
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2020 by Penguin Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Vermittelt durch die Literarische Agentur Kossack
Cover: Favoritbüro
Covermotiv: Gettyimages/Mike Kuipers
Redaktion: Kristina Lake-Zapp
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-25190-1V006
www.penguin-verlag.de
Freitag, 21. August
1Im Wald
Sie lief und wollte ihr Glück in alle Welt hinausschreien. Sie hatte es geschafft. Endlich war es vorbei.
Endlich war sie frei.
Nie wieder würde sie den Menschen gegenübertreten müssen, die ihr die letzten Jahre zur Hölle gemacht hatten. Diese Scheusale. Aber am Ende hatten sie bezahlen müssen. Und zwar teuer.
Man erntet, was man sät.
Sie lief schneller.
Die Genugtuung, die sie empfand, brannte stark wie ein Feuer in ihr. Vor wenigen Stunden erst war das Urteil im Prozess gegen ihren Arbeitgeber verkündet worden. Aufhebung der Kündigung und volle Wiedergutmachung des ihr entstandenen Schadens. Ersatz aller Behandlungskosten und Nachzahlung des Gehalts seit ihrem Rauswurf. Und: Strafanzeige gegen unbekannt.
Sie würde das Gesicht ihres Chefs niemals vergessen.
Ich habe gewonnen.
Sie bog in die große Waldschleife ab.
Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die Klägerin an ihrem Arbeitsplatz erheblichem, systematischem Druck ausgesetzt war. Als dies nicht zu ihrem freiwilligen Ausscheiden führte, wurde ihre Arbeit nachweislich manipuliert, um eine außerordentliche Kündigung aus wichtigen Gründen zu rechtfertigen. Da diese Gründe nicht vorlagen, war der Klage stattzugeben.
Sie lief und lief. Wie jeden Abend würde sie erst anhalten, wenn sie keine Kraft mehr hatte. Aber gerade fühlte sie sich, als könnte sie die ganze Welt umrunden.
Sie wollen Krieg? Den können Sie haben!
Und wie sie Krieg bekommen hatte. Nach allen Regeln hatte die Firma Krieg gegen sie geführt. Tarnen und Täuschen inklusive. Man wusste erst, was systematisches Mobbing hieß, wenn man es am eigenen Leib erlebte. Wenn sich jeder distanzierte, wenn das Opfer zum Täter gemacht wurde, zum Störfaktor, zum Spinner, der sich das alles nur einbildete, bis sogar die eigene Familie sich abwandte. Aber sie hatte durchgehalten. Hatte sich von niemandem unterkriegen lassen. Und hatte diesen Krieg, den sie nie wollte, am Ende gewonnen.
Ohne Mark hätte ich das nie geschafft.
Mark hatte vor Glück geweint, als sie ihn vorhin am Telefon erreicht und ihm alles erzählt hatte. Er kam erst am nächsten Tag aus London zurück. Sie hätte ihn so gerne bei der Urteilsverkündung an ihrer Seite gehabt. Damit er höchstpersönlich mitbekam, dass sein Vertrauen in sie gerechtfertigt war.
Ich war nicht verrückt. Die waren es. Und du hast immer an mich geglaubt. Ich liebe dich, Mark!
Tränen stiegen ihr in die Augen, als ihr klar wurde, dass für sie nun ein neues Leben begann. Mit der Entschädigung konnten sie eine Weltreise machen, wenn sie wollten. Oder eine riesige Hochzeit feiern. Vorausgesetzt, Mark fragte sie endlich. Sogar Kinder konnte sie sich jetzt vorstellen, ein Gedanke, der in den letzten Wochen und Monaten ganz weit in die Ferne gerückt war.
Warmer Sommerwind umstrich ihre Beine. Wie lange hatte sie nicht mehr so befreit laufen können? Wie lange hatte sie sich selbst jede Freude verboten, hatte das Ritual der täglichen Joggingrunde mit verbissener Disziplin durchgezogen, den Blick starr nach vorne gerichtet, aus der irrationalen Überlegung heraus, jeder Genuss vor der Urteilsverkündung könnte böses Karma geben? Wie lange hatte sie sich tief im Innern schuldig gefühlt und fast schon selbst zu glauben begonnen, was die anderen behaupteten? Der eigene Kopf spielte einem die schlimmsten Streiche.
Vorbei, vorbei.
Sie erreichte die Lichtung mit dem kleinen Waldsee. Über ihr leuchteten die Sterne. Die Vorhersage behielt recht: Es würde eine klare Nacht werden. Das war auch nicht schwer zu erraten. Seit Wochen brachte ein riesiges Hochdruckgebiet ganz Europa zum Schwitzen, nur die Nachtstunden waren halbwegs erträglich. Aber sie würde sich niemals darüber beklagen. Kalt wurde es noch früh genug.
In ein paar Tagen war Vollmond. Schon jetzt leuchtete er hell, spiegelte sich im Wasser und tauchte die ganze Umgebung in weißbläuliches Licht. Sie schaltete ihre Stirnlampe aus und konnte trotzdem jede Unebenheit des Weges erkennen. Sie fühlte sich, als würde sie schweben.
Dann blieb sie stehen. Einfach so. Weil sie konnte. Weil sie durfte. Sie war frei. Nichts hielt sie mehr davon ab, ihr Leben zu genießen. Ihr Kopf war leer. Sie atmete ein, sie atmete aus. Was jetzt folgte, war ihre Entscheidung, nicht mehr die eines Anwalts oder eines Richters. Sie bestimmte wieder selbst über sich und ihre Zukunft.
Da kam ihr ein Gedanke.
Soll ich es wagen? Einfach … reinspringen? Nackt?
Es war zu verrückt. Und gerade deshalb perfekt. Perfekt wie dieser ganze Tag. Sie lächelte, zog sich das Top über den Kopf und spürte, wie sie dabei die Stirnlampe abstreifte. Achtlos ließ sie beides ins hohe Gras fallen und schlüpfte aus den Joggingschuhen.
Plötzlich hörte sie etwas und hielt inne. Ein kurzes Rascheln nur, aus der Richtung, aus der sie gekommen war. Sie horchte. Angst hatte sie keine. Im Wald gab es die verschiedensten Geräusche, und sie kannte sie alle. War es ein Vogel, der durchs Unterholz streifte? Zu leise. Außerdem zu dunkel. Ein Reh? Zu laut für das, was sie gehört hatte. Vermutlich war ein Eichhörnchen von einem Baum zum anderen gesprungen.
Sie kannte diesen Wald wie ihre Westentasche. Sie war hier aufgewachsen und hatte einen guten Teil ihrer Kindheit unter den Bäumen verbracht. »Eine Halbwilde« hatten ihre Eltern sie scherzhaft genannt, wenn Leute zu Besuch waren. Es hatte ihr stets ein tierisches Vergnügen bereitet, Kindern aus der Stadt den »dunklen, bösen« Wald zu zeigen.
Der Wald ist mein Freund.
Eine Weile blieb sie ganz ruhig stehen und lauschte, aber das Geräusch wiederholte sich nicht. Schließlich zog sie sich aus, zögerte noch einmal kurz, dann gab sie sich einen Ruck und rannte nackt ins Wasser hinein. Der Kies am Ufer bohrte sich schmerzhaft in ihre Fußsohlen. Das Wasser war kalt, aber angenehm, und wurde schnell tiefer. Eine Sekunde später stürzte sie sich vornüber ins kühle Nass.
Als sie wieder auftauchte, musste sie lachen vor Glück. Was für ein tolles Geschenk, das die Natur ihr da machte! Alles war Sommer, alles war Leben.
Mit ein paar Zügen gelangte sie in die Mitte des Sees, ließ die Füße sinken und bewegte ihre Arme gerade genug, um ihren Kopf über Wasser zu halten. Sie staunte über das Konzert der Grillen um sie herum. Die Vögel waren schon seit Einbruch der Dunkelheit still, aber die Klangwolke, die über der Lichtung aufstieg, aus allen Richtungen zugleich, suchte ihresgleichen. Außer dem Zirpen hörte sie nur ihren Atem und die Geräusche, die ihre Schwimmbewegungen auslösten: weiches, sanftes Wasserplätschern.
Sie atmete tief ein, brachte ihre Beine an die Wasseroberfläche und streckte sich. Ließ sich mit offenen Augen auf dem Rücken treiben. Wieder sah sie Sterne, Sterne, Sterne. Der Mond war zu hell, als dass sie die Milchstraße hätte erkennen können, und doch waren da oben mehr Lichtpunkte, als sie zählen konnte.
Nach einer Minute völliger Harmonie zwischen sich und dem Universum beschloss sie, dass sie Frieden schließen wollte mit der Welt und allem, was war.
»Ich vergebe euch«, sagte sie laut. »Alles ist wieder gut.«
Dann drehte sie sich auf den Bauch zurück und schwamm ans andere Ufer. Dort setzte sie sich auf, vom Bauchnabel abwärts im Wasser, mit den Händen im Kies abgestützt. Immer noch war ihr nicht kalt.
Plötzlich sah sie aus dem Augenwinkel ein Licht aufblitzen. Ganz kurz nur, in etwa dort, wo sie in den See gelaufen war. Vielleicht ein Glühwürmchen.
Zu hell für ein Glühwürmchen.
Sie kniff die Augenlider zusammen. Ihre leichte Kurzsichtigkeit war bei dem schlechten Licht doch hinderlich. Nein, da war nichts. Bestimmt hatte sie sich getäuscht. Vielleicht hatte eine Welle den Mond im Wasser reflektiert.
Welche Welle? Der See war spiegelglatt.
Sie ging in die Hocke, stieß sich vom Ufer ab und schwamm zurück, schneller, als sie ursprünglich wollte. Auch wenn sie es sich niemals eingestanden hätte, war da jetzt noch etwas anderes als Glück und Harmonie in ihr.
Angsthase.
Das mit dem Schwimmen war wohl doch zu verrückt gewesen. Selbst als Kind – als Halbwilde – hätte sie sich das nie getraut. Ihre Mutter hatte sie immer vor dem See gewarnt. Und nun war sie mittendrin, und ihre Sinne spielten ihr Streiche. Zum Beispiel, dass da eine Gestalt im Gras kauerte, keine fünf Meter von ihr entfernt.
Sie spürte den Uferkies an ihren Fingerspitzen. Kniete sich hinein. Kniff die Lider noch schmaler zusammen.
Doch, da war etwas. Aber was? Ein Reh? Ein Hund? Jedenfalls etwas, das vorhin nicht dort gewesen war. Etwas Lebendiges. Sie kannte jeden Wurzelstock und jeden größeren Stein in der Gegend. Das da kannte sie nicht.
»Hey!«, rief sie.
Nichts passierte. Sie griff sich eine Handvoll Kies und warf ihn ans Ufer. Die Gestalt wuchs in die Höhe.
Die Silhouette eines Menschen.
Ihr Herz fing an zu rasen, adrenalinbefeuert. »Hau ab, du verdammter Spanner!«, schrie sie mit sich überschlagender Stimme, nahm eine neue Ladung Kies vom Grund und schleuderte ihn der Gestalt mit aller Kraft entgegen. Dann zog sie sich rückwärts ins Wasser zurück, den Blick starr nach vorn gerichtet.
Die Gestalt ließ sich weder von ihrem Geschrei noch dem Kies aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil, jetzt kam sie auf sie zu, ganz langsam.
»Hau ab! Hau ab!«
Konnte das ein Scherz sein? Nichts hätte sie lieber geglaubt. Aber sie kannte niemanden, der sich Späße dieser Art erlaubte. Und wenn doch, dann konnte er was erleben. Sie mochte keine unheimlichen Scherze.
Sie glitt ins tiefere Wasser zurück, schwamm vom Ufer weg und überlegte panisch, was sie tun konnte. Rundum lag dichter Wald. Nur vorne gab es diesen einen Trampelpfad, überall sonst wuchsen dichtes Gras und stacheliges Strauchwerk, auch am anderen Ufer gab es viele Pflanzen, denen man besser nicht mit nackten Beinen begegnete.
Sie paddelte im tiefen Wasser auf der Stelle, drehte sich um sich selbst und suchte einen Ausweg, fand aber keinen. Wollte sie entkommen, musste sie direkt an der Gestalt vorbei.
Wie lange kann ich hier durchhalten?
Langsam wurde ihr nun doch kalt. Sie überlegte, laut um Hilfe zu rufen, aber es wäre reines Glück gewesen, hätte sie jemand gehört. Hier war schon tagsüber kaum etwas los und um diese Uhrzeit gar nichts mehr. Das Zirpen rundum klang jetzt fast spöttisch.
Stark sein, erinnerte sie sich an die Empfehlung im Selbstverteidigungskurs. Die meisten Vergewaltiger wurden von Frauen, die in die Opferrolle verfielen, nur noch angespornt. Man sollte sich stattdessen so ordinär wie möglich verhalten. Nichts törnte einen Vergewaltiger mehr ab als eine Frau, die so tat, als wollte sie es.
Das sagt sich so leicht.
Die Gestalt stand da, am Ufer des Sees, und konnte noch stundenlang durchhalten. Sie selbst würde definitiv früher aufgeben müssen. Und was dann?
Sie zitterte, hatte Gänsehaut am ganzen Körper, klapperte mit den Zähnen. Aber innerlich loderte die nackte Angst.
Eine weitere Minute verging. Dann, von einem Moment auf den anderen, drehte sich die Gestalt um und entfernte sich in aller Seelenruhe, bog links ab und nahm den Weg, der weiter in den Wald hineinführte.
Der Rückweg war frei. Aber wie lange? Jetzt musste sie schnell sein. Mit wenigen kräftigen Zügen schwamm sie ans Ufer und eilte mit großen Schritten aus dem Wasser. Zweimal verlor sie fast die Balance im feinen Kies, aber dann hatte sie Gras unter den Füßen und lief zu der Stelle, an der sie sich ausgezogen hatte. Ihr Blick schweifte über den Boden auf der Suche nach ihren Sachen, sie überlegte, suchte weiter – aber ihr Zeug war weg. Ihre Kleidung, die Stirnlampe, das Täschchen mit dem Handy …
Nichts, was sich nicht ersetzen ließ.
Der Schlüsselbund. Verdammt!
Wenn der Dieb wusste, wo sie wohnte, hatte er jetzt freien Zutritt zu ihrem Haus. Sie musste sofort einen Schlosser rufen, wenn sie zu Hause war.
Und wie komm ich ohne Schlüssel rein? Sie hatte keine Ersatzschlüssel deponiert, da sie das für ein Sicherheitsrisiko hielt.
Zu den Nachbarn. Notfalls nackt.
Sie lief los. Ohne ihre Joggingschuhe wurde jeder Schritt zur Qual. Aber sie konnte, sie durfte nicht zögern. Tempo war das Einzige, was jetzt zählte. Sie lief zum Weg und rechts weiter auf den Joggingpfad, der aus dem Wald herausführte.
Da raschelte etwas hinter ihr. Ein winziges Ästchen brach. Rhythmische Schritte ertönten. Die andere Person folgte ihr. Sie war getäuscht worden!
Sie öffnete den Mund zu einem Schrei, doch sie brachte keinen Ton heraus. Schneller, lauf schneller! Sie ignorierte alles – Steine, Wurzeln, Dornen, Brennnesseln –, nichts war wichtig, außer dass sie rannte. Noch konnte sie entkommen. Sie war gut im Laufen. Wochen- und monatelang war sie wie eine Besessene gelaufen. Ihre Kondition war besser denn je, ihre Muskulatur gestählt.
Wenn ich nur meine Schuhe hätte …
Sie streckte die Hand aus, als sie den dicken Zweig eines Strauchs erkannte, der in den Pfad hereinragte. Sie kannte ihn, wie so viele Details dieser Strecke. Wieso machte sich eigentlich niemand die Mühe, ihn abzuschneiden? Sie bog ihn von sich weg und ließ ihn zurückpeitschen, lief weiter, so schnell sie konnte.
Gleich darauf hörte sie, wie der Zweig ihren Verfolger traf, der einen erstickten Fluch ausstieß. Die Schritte wurden langsamer, aber höchstens für eine Sekunde. Von einem Zweig würde er sich nicht aufhalten lassen.
Sie erreichte dichter bewachsenes Gelände. Hinter ihr leuchtete etwas auf. Eine Taschenlampe. Ihr Verfolger gab sich also keine Mühe mehr, unentdeckt zu bleiben. Der Lichtkegel zitterte aufgeregt. Sie sah, wie sich ihre Silhouette auf dem Waldboden vor ihr abzeichnete. Die Schritte hinter ihr wurden lauter.
Er holt auf.
Aber noch konnte sie entkommen. Gleich gelangte sie an einen ihrer vielen Geheimplätze. Wenn sie nur schnell genug hinter der nächsten Biegung verschwand, sich fallen ließ und dann gleich links im Dickicht verkroch, würde er sie niemals finden. In der Kindheit war das ihr bestes Versteck gewesen.
Ob ich überhaupt noch reinpasse? Vielleicht ist es längst zugewachsen!
Sie verbot sich jeden Zweifel und lief, so schnell sie konnte. Noch zehn Meter … noch fünf …
Geschafft!, dachte sie noch.
Und dann ging alles ganz schnell. Sie wusste, dass sie eben noch gerannt war und jetzt ausgestreckt dalag, dass sie mit dem Gesicht voran auf dem Waldboden aufgeschlagen war, ohne sich mit den Händen schützen zu können. Nur das Dazwischen fehlte. War sie gestolpert? Aber worüber? Hier gab es keine hohen Wurzeln. Was konnte sonst noch so scharf, so unnachgiebig, so unvorhersehbar gemein sein?
Ein gespannter Draht?
Was immer es gewesen war, es hatte sie ihrem Verfolger ausgeliefert. Sie wurde gepackt und brutal in die Höhe gerissen, schmeckte das Blut, das warm über ihr Gesicht lief. Sie wollte es mit der Hand abwischen, aber ihre Hände gehorchten ihr nicht. Völlig benommen spürte sie, wie sie ins Unterholz gezerrt wurde, weiter und weiter. Gestrüpp streifte an ihrem nackten Körper entlang. Der Wald war hier so dicht, dass man selbst bei Tageslicht kaum zwei Meter weit sehen konnte, das wusste sie. Ein Dornenzweig verhakte sich in ihrer Seite und riss ihr die Haut auf. Sie stöhnte.
»Hier!«, zischte jemand.
Sie spürte die spröde Rinde eines Baums an ihrem Rücken. Ihre Arme wurden nach hinten gezogen und mit schnellen, kräftigen Bewegungen zusammengebunden.
»Bitte nicht«, flehte sie. Die eigenen Worte klangen merkwürdig verwaschen. Da war Blut in ihrem Mund. Etwas stimmte nicht mit ihren Zähnen. Sie fuhr mit der Zunge darüber. Mehrere Schneidezähne waren ausgeschlagen. Sie hatte es gar nicht gespürt.
»Bitte nicht«, wiederholte sie, schloss die Augen und fing an zu weinen. Was mochte ihr Verfolger wollen? War er ein Sexualstraftäter, ein Perverser, der sie beim Nacktbaden beobachtet hatte? Und warum war da noch jemand? Wollten sie etwa gemeinsam über sie herfallen? Aber so zugerichtet, wie sie war, musste ihnen doch jede Lust vergehen.
Als sie eine Hand an ihrer Schulter fühlte, beschloss sie, dass sie sich nicht wehren würde. Sollten sie ihren Körper nehmen. Ihren Geist bekämen sie nicht. Sie würde das hier überleben, so schlimm es auch werden mochte. Und eines Tages würde sie die Gelegenheit haben, sich an ihnen zu rächen. Ja, das würde sie. Sie würde sie finden und sich rächen. Der Gedanke gab ihr Kraft.
»Da ist es«, hörte sie eine Männerstimme mit italienischem Akzent sagen. »Das Mal. Siehst du?«
Das Mal?
»Ja!«, antwortete eine Frau.
Die beiden gaben sich keine Mühe, ihre Stimmen zu verstellen. Sie ahnte, dass das kein gutes Zeichen war.
Sie zwang sich, die Augen zu öffnen. Blut und Tränen machten es ihr fast unmöglich, etwas zu erkennen. Dennoch sah sie die Umrisse zweier Gestalten, direkt vor ihr, in bläuliches Licht getaucht, anders als das der Taschenlampe, beinahe violett. Oder spielten ihr die Sinne einen Streich?
»Also, was sollen wir tun?«, fragte die Frau nahezu gleichgültig.
»Warte …«
Sie fühlte eine Hand an ihrem Bauch. Die Finger drückten und zogen, fuhren über die Haut rund um ihren Nabel.
»In der Mitte durch.«
»Quer durch? Lass sehen … Mist, du hast recht.«
Sie verstand nicht, wovon die zwei sprachen. Als sie den Kopf senkte, sah sie nichts als das seltsame blaue Licht. Und dann noch etwas: ein Leuchten. An ihrem Bauch. Sie erkannte nicht, was es darstellen sollte.
Malen die mich gerade an? Ist das vielleicht doch alles nur ein … ein verdammt schlechter Scherz?
Sie durfte sich nicht wehren. Musste das, was auch immer da passierte, über sich ergehen lassen. Konnte sich später rächen.
»Los jetzt!«
Eine rasiermesserscharfe Klinge drang in ihren Bauch ein. Der Schmerz raubte ihr den Atem. Sofort rann warmes Blut aus der Wunde, über den Unterbauch, über ihre Scham, die Beine hinunter.
Die wollen mich schlachten.
Die Erkenntnis traf sie wie ein Hammerschlag. Sich nicht zu wehren, würde ihren sicheren Tod bedeuten. Sie riss an ihren Fesseln, scheuerte daran, wehrte sich, zog ein Bein in die Höhe und trat aus, traf jemanden, wiederholte die Bewegung, aber dieses Mal fuhr ihr Fuß ins Leere.
»Dämliche Bitch!«, hörte sie die Frau schreien.
Jemand riss an ihren Haaren und drückte ihren Kopf mit Gewalt gegen den Baum.
Sie spürte das Messer, links an ihrem Hals, spürte, wie es gegen ihre Haut drückte, bevor es tief durch ihre Kehle schnitt.
Mark, dachte sie noch.
Samstag, 22. August
2Wien, 18.11 Uhr
Christian Brand, Einsatzkommando (EKO) Cobra
Brand kauerte hinter einer halbhohen Sitzbank aus Beton. Neben ihm lag die Tragetasche mit dem Geschenk, das er eben für die Hochzeit seiner Schwester Sylvia besorgt hatte, die in einer Woche stattfinden sollte.
Er hörte Sirenen in den Seitenstraßen. Dazu nervös klingende, von Megafonen verstärkte Durchsagen: Bleiben Sie in den Häusern! Verlassen Sie die Straße! Die Kollegen waren gerade dabei, die Gegend weiträumig abzusperren.
In der Mariahilfer Straße selbst herrschte angespannte Stille, immer wieder von Schüssen unterbrochen, die ein Amokläufer in alle Richtungen abfeuerte. Das Geräusch erinnerte an Peitschenhiebe und schmerzte in den Ohren. Jemand schrie. Eine Frau ächzte.
Brand wusste, dass er eingreifen musste. Er wusste auch, dass er sich damit über sämtliche Dienstvorschriften hinwegsetzte, nach denen er als Mitglied des österreichischen Einsatzkommandos Cobra zu handeln hatte. Doch es war die Lösung mit der höchsten Erfolgswahrscheinlichkeit. Zugegeben, auch die mit dem höchsten Risiko. Aber es gab keine andere Option. Außerdem hatte er Feierabend. Und in seiner Freizeit konnte er tun, was er wollte.
Ein Beamter ist immer im Dienst.
Brand verzog den Mund, als ihm die Worte seines Ausbilders in den Sinn kamen. Ein Polizeibeamter, ein Elite-Polizist wie er, hatte Vorbild zu sein. Und moderne Vorbilder hielten sich an Regeln.
Regeln retten keinen hier.
Er machte sich bereit. Er wusste, dass der Mann, der hier in der Fußgängerzone auf Höhe der Zollergasse Angst und Schrecken verbreitete, mit seinem Leben abgeschlossen hatte. Und er wusste, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit des Kerls auch im gegenteiligen Fall unter fünfzig Prozent lag. Entweder erschoss er sich am Ende selbst, oder ein anderer tat ihm den Gefallen. Aber einen Wahnsinnigen mit gezielten Schüssen auszuschalten, war schwerer, als es in der Grundausbildung der österreichischen Polizei aussah. Wenn, dann musste man es so machen, dass der andere garantiert nicht mehr aufstand. Und die Skrupellosigkeit, die man brauchte, um auf den Kopf eines Menschen zu zielen und abzudrücken, besaßen Streifenpolizisten bestimmt nicht.
Brand rannte los, gut zehn Meter, ohne ein Geräusch zu machen, und ließ sich hinter den nächsten großen Blumentrog aus Beton fallen, bevor der andere auch nur die geringste Chance hatte, ihn zu bemerken.
Er spähte am Blumentrog vorbei. Der Amokläufer war schwer bewaffnet: zwei Pistolen, eine Automatikwaffe und jede Menge Magazine. Dazu trug er schusssichere Kleidung an Oberkörper und Beinen sowie einen gepanzerten Helm. Er sah aus, als wäre er auf direktem Weg in den Krieg.
Bestimmt stand er unter Drogen. Brand tippte auf Methamphetamin. Crystal Meth. Das war das Zeug, das Menschen dazu bringen konnte, sich die eigenen Genitalien abzuschneiden, weil sie sie im Rausch für Fremdkörper hielten. Oder – was zum Glück viel öfter vorkam und sozial weitaus verträglicher war – drei Tage und Nächte lang durchzuvögeln. Unter Meth konnte ein Mensch zum Pitbull werden, der im Blutrausch so lange kämpfte, bis gar nichts mehr ging. Eine Kugel würde ihn nicht aufhalten können, es sei denn, sie drang ihm direkt in den Schädel und verquirlte sein Gehirn. Und genau deshalb war die Situation so gefährlich. Es war nur natürlich, dass die Kollegen diesem Pitbull hier lieber in die Beine schossen als in den Kopf. So natürlich wie tödlich.
Vier Menschen lagen im Umkreis von geschätzt dreißig Metern am Boden. Der Mann im Anzug war tot. Eine Kugel hatte seine Halsschlagader erwischt. Ein Taxifahrer hing halb im Gurt seines Mercedes-SUV. Auch er war tödlich verwundet. Der Motor lief, die Fahrertür stand offen, die Füße des Toten hingen raus. Ob er vergessen hatte, sich abzuschnallen, bevor er die Flucht antrat, war schwer zu sagen. So oder so musste der Mann wahnsinniges Pech gehabt haben. Wie alle hier. Falsche Zeit, falscher Ort. Die beiden anderen Opfer – eine Frau mit Stock und eine weitere, wesentlich jüngere, die mit dem Fahrrad unterwegs gewesen war, das jetzt unter ihr lag – waren vielleicht noch zu retten. Brand sah, dass sie atmeten. Aber sie brauchten Hilfe, und zwar so schnell es ging.
Brand war unbewaffnet und würde es auch bleiben. Bis er den Kollegen erklärt hätte, wer er war und was er vorhatte, wäre es vielleicht zu spät. Außerdem würde keiner von ihnen so leichtsinnig sein, ihm seine Glock auszuhändigen. Die eigene Waffe lieh man niemandem.
Brand hörte neue Einsatzwagen kommen. Das Blaulichtmeer, das gegen die Häuserwände der Seitenstraßen brandete, wurde greller. Nichts deutete auf ein schnelles Ende hin. Vielmehr war das hier erst der Anfang. Garantiert warteten alle in sicherem Abstand auf das Eintreffen der Kollegen von der Cobra. Schließlich waren sie für kritische Situationen wie diese ausgebildet und ausgerüstet. Aber selbst unter besten Verhältnissen brauchte die Bereitschaft noch mindestens fünf Minuten. Fünf Minuten zu viel. Und dann musste zuerst ein Überblick gewonnen, der Einsatz abgewogen und koordiniert werden …
Brand hatte diesen Überblick bereits. Und abzuwägen und zu koordinieren hatte er bloß mit sich selbst. Eine Win-win-Situation für alle, ihn vielleicht ausgenommen. Das klang doch rational.
Als sich der Amokläufer umdrehte und mit ausgestreckter Schusshand auf ihn zukam, duckte sich Brand schnell hinter den Blumentrog. Er hörte Schüsse. Kugeln schlugen in Häusermauern ein oder trafen auf Glas. Worauf der Dummkopf gerade zielte, konnte sich Brand nicht erklären. Vielleicht halluzinierte er? Egal. Bestimmt würde er gleich wieder abbiegen und auf ein anderes Ziel zusteuern. Er bewegte sich wie einer dieser Staubsauger-Roboter, die nach dem Zufallsprinzip arbeiteten. War unberechenbar. Irrational. Und genau das war seine Schwäche. Früher oder später lief dieser Roboter in sein Verderben.
Brand wartete fünf Sekunden, dann spähte er wieder über seine Deckung. Wie erwartet, bewegte sich der Attentäter von ihm fort.
Jetzt!, sagte er sich, stand auf und lief die letzten Meter zum Taxi, so schnell und so leise er konnte. Er beugte sich über den toten Fahrer hinweg ins Fahrzeuginnere des Geländewagens, löste den Gurt und zog den Mann heraus. Nur einen Moment später saß er hinterm Steuer und stellte den Wählhebel der Automatik auf Drive.
Der Amokläufer bewegte sich immer noch von Brand weg. Jetzt zielte er auf einen Mann, der sich viel zu auffällig hinter einer Litfaßsäule versteckte. Gleich gab es hier Opfer Nummer fünf.
Jetzt oder nie.
Brand drückte das Gaspedal durch. Der Mercedes beschleunigte. Brand überfuhr den Anzugträger mit der zerfetzten Halsschlagader, der das Pech hatte, genau zwischen dem Wagen und dem Ende dieses Amoklaufs zu liegen. Ein kurzer Hopser, mehr nicht.
Er hätte es bestimmt verstanden.
Viel zu spät bemerkte der Attentäter, dass etwas auf ihn zukam. Er drehte sich um. Legte an und zielte.
Brand duckte sich nicht. Er nahm bloß die Hände vom Lenkrad, um sie vor der Explosion des Airbags zu schützen.
Einen Augenblick darauf erfasste der Geländewagen den Amokläufer und zermalmte ihn an der Litfaßsäule.
Als Christian Brand gegen einundzwanzig Uhr in seiner Wohnung in der Neubaugasse ankam, hatte seine Mutter schon dreimal angerufen. Er wusste, dass sie Angst bekam, wenn sie zu lange nichts von ihm hörte. Beim letzten Besuch in Hallstatt hatte sie – seine Mutter! – ihm eines dieser modernen Handys schenken wollen, damit er sich bei WhatsApp registrieren und ihr texten