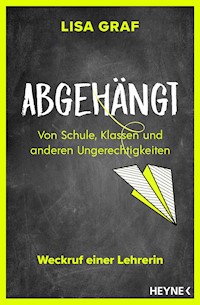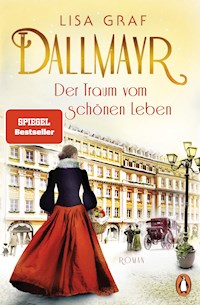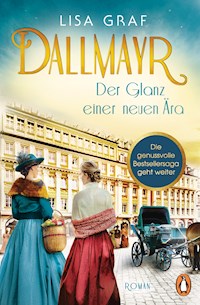
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Dallmayr-Saga
- Sprache: Deutsch
Zum Schwelgen und Genießen: Die erfolgreiche Saga um den legendären Aufstieg des Feinkostladens Dallmayr geht weiter!
Der Nr.-1-Bestseller erstmals im Taschenbuch
München 1905. Mit ihrem Gespür für Delikatessen hat Therese Randlkofer Köstlichkeiten aus aller Welt nach Deutschland gebracht. Handverlesene Früchte von den Kanaren, feinster Blätterkrokant aus der Schweiz und goldgelber französischer Lavendelhonig zieren die Auslage des Dallmayr. Doch ihr missgünstiger Schwager und größter Kontrahent Max versteht sich darin, Zwietracht in der Familie zu säen – besonders bei ihren eigenen erwachsenen Kindern. Dabei bräuchte Therese deren Hilfe dringender denn je. Denn um das Unternehmen in die Zukunft zu führen, hat sie einen folgenschweren Entschluss gefasst. Einen Entschluss, der sie alles kosten könnte …
Akribisch recherchiert und mitreißend geschrieben – auch mit dem 2. Band der Reihe rund um den Feinkostladen Dallmayr entführt uns Bestsellerautorin Lisa Graf ins München der Jahrhundertwende.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 717
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Lisa Graf ist in Passau geboren. Nach Stationen in München und Südspanien schlägt sie gerade Wurzeln im Berchtesgadener Land. Als Hobbybäckerin hat sie eine Schwäche für Trüffelpralinen und liebt Zitronensorbet mit Champagner. Mit ihrem grandiosen Familiensaga-Auftakt Dallmayr. Der Traum vom schönen Leben eroberte sie sowohl die Herzen ihrer Leserinnen als auch die Bestsellerliste. Auch mit dem zweiten Band der Reihe entführt sie ihre Leserinnen ins München der Jahrhundertwende und verzaubert mit einer wunderbaren Familiengeschichte rund um den Feinkostladen Dallmayr.
LISA GRAF
DALLMAYR
Der Glanz
einer neuen Ära
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Dies ist ein historischer Roman. Er basiert auf der Unternehmensgeschichte des Hauses Dallmayr. Zahlreiche tatsächliche Abläufe und handelnde Personen sind jedoch so verändert und ergänzt, dass Fakten und Fiktion eine untrennbare künstlerische Einheit bilden.
Eine Zusammenarbeit mit dem Haus Dallmayr gab es nicht, insbesondere besteht keine wie auch immer geartete Lizenzbeziehung. Die Verwendung des Firmennamens erfolgt also ausschließlich aus beschreibenden und nicht aus markenmäßig-kennzeichnenden Gründen.
Copyright © 2022 by Lisa Graf
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022 by Penguin Verlag,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Umschlag: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: Arcangle Images/Lauren Rautenbach/Arcangel Images/
Mary Wethey, Bridgeman Images/The Stapleton Collection, www.buerosued.de
Redaktion: Lisa Wolf
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-27019-3V001
www.penguin-verlag.de
»Es ist doch eigentlich der Hauptinhalt im Leben: Sehnsucht und wieder Sehnsucht.«
Fanny Gräfin zu Reventlow
1905
Paul lag im Bett und starrte in das Halbdunkel des Zimmers. Die bodenlangen Vorhänge waren zugezogen, doch ein schmaler Lichtstrahl verriet, dass es draußen bereits heller Tag war. Das Sonnenlicht schlug eine Schneise in sein Zimmer und teilte es in zwei Hälften. Bis auf die Mitte blieb alles grau. Das Grau passte genau zu der Stimmung, in der er sich seit Tagen befand. Nichts und niemand konnte ihm die Niedergeschlagenheit und Verzweiflung, die sich auf ihn gelegt hatte, nehmen. Selbst der Kitsch, mit dem sein Zimmer vollgestopft war, verblasste mit jedem Tag mehr. Das Porzellanschwein mit dem grünen Kleeblatt im Maul, den grell bemalten Zeppelin und das mit Rosen bestickte Samtdeckchen auf dem Kaminsims. Die Hochzeitsbilder der verwitweten Frau Schleicher, alle grau in grau.
Vor seiner Tür regte sich nun etwas. Es klopfte.
»Herr Randlkofer?« Die Stimme seiner Zimmerwirtin drang durch die Tür. Ihr Ton schwankte zwischen Besorgnis und kaum verborgener Neugier.
Paul zog sich die Decke über den Kopf, wie ein Kind. Er fühlte sich gerade außerstande, mit Frau Schleicher zu sprechen.
»Herr Randlkofer, so machen Sie doch auf. Sind Sie krank? Sie müssten sich doch längst angekleidet haben.«
»Ja, ich bin krank, lassen Sie mich bitte schlafen.« Paul wusste, dass die Chance, sie damit abzuwimmeln, nicht besonders groß war. Doch ins Geschäft würde er heute ganz bestimmt nicht gehen.
»Ich habe hier ein Telegramm für Sie. Von Ihrer Frau Mama, aus München.«
Von Mutter? Paul setzte sich im Bett auf. »Was schreibt sie denn?«
»Na, das ist doch privat.« Frau Schleicher und »privat«, das passte ungefähr so gut zusammen wie Frau Schleicher und elegante Wohnungseinrichtung.
»Wenn Sie wissen, dass das Telegramm von meiner Mutter ist, haben Sie es doch schon gelesen«, behauptete Paul.
»Nun machen Sie doch bitte auf, es ist bestimmt wichtig, wenn Ihre Mutter schon ein Telegramm nach Wiesbaden schickt und keinen Brief.«
»Meine Mutter hat keine Zeit zum Briefeschreiben, sie leitet ein Geschäft. Ein Telegramm kann sie zwischen Tür und Angel unserer Buchhalterin diktieren und muss sich dann um nichts weiter kümmern. Deshalb schickt sie lieber Telegramme.«
»Sie wissen doch gar nicht, was drinsteht.«
»Es ist doch hoffentlich niemand gestorben?«, fragte Paul.
»Nein«, kam es wie aus der Pistole geschossen zurück. So leicht war Frau Schleicher zu überführen.
»Nun lesen Sie schon vor.«
Die Zimmerwirtin zögerte. Ihre Neugierde war jedoch noch größer als ihr Hang zur Wichtigtuerei. Zu gern hätte sie sich selbst ein Bild vom Zustand ihres jungen Zimmerherrn gemacht. Sie hatte doch so etwas wie stellvertretende Mutterpflichten ihrem zahlenden Kostgast gegenüber, solange er sich noch in Ausbildung und weit fort von zu Hause befand.
»Also gut.« Frau Schleicher räusperte sich. »Telegrafenanstalt München, Telegramm. 5. Juli 1905. Dallmayr Dienerstraße München.« Sie legte eine Atempause ein, um die Spannung zu erhöhen. »Paul, mein größter Geburtstagswunsch ist, dass du heimkommst. Mach deine Lehre im Dallmayr fertig. Du bist hier unentbehrlich. Ich rede mit deinem Chef.«
Paul sprang aus dem Bett. Wenn es noch einen Gruß seiner Mutter gegeben hatte, so hörte er ihn nicht mehr. Er musste jetzt auf der Stelle handeln. Nicht wegen des Geburtstags seiner Mutter, den er vergessen hatte, sondern wegen seines Chefs. Er musste sofort zu Hause anrufen und mit ihr reden. Oder lieber mit Rosa, der Buchhalterin, oder seinem Bruder. Paul schlüpfte in seine Kleider und stieß mit Frau Schleicher zusammen, als er aus seinem Zimmer stürmte.
»Herr Randlkofer, was ist denn los? Sie müssen doch nicht auf der Stelle nach München abreisen. Sie denken schon an die vereinbarte Kündigungsfrist für Ihr Zimmer?« Sie betrat den Raum, zog die Vorhänge zurück und sah sich neugierig um.
»Jaja«, rief Paul, »keine Sorge.« Er musste jetzt nur eines tun: verhindern, dass seine Mutter mit seinem Chef sprach.
***
»Die Münchener Meteorologische Zentralstation gibt ziffernmäßig über die Hitze der letzten Tage folgenden Bescheid nach Temperaturmessungen auf Celsius im Schatten: In der Nacht von Montag auf Dienstag (3. bis 4. Juli) wurden 19,2 Grad gezählt, am Dienstag um sieben Uhr früh 23,1 Grad, zwei Uhr mittags 32,2 Grad, neun Uhr abends 26,1 Grad, Maximum 34,3 Grad«, las Therese beim Frühstück in den Münchner Neuesten Nachrichten.
Und auch heute würde es vermutlich nicht abkühlen. Therese nahm noch einen Schluck von ihrem Morgenkaffee, während Anni, das Dienstmädchen, schon dabei war, alle Fenster und Läden in der Wohnung zu schließen, durch die selbst nachts kaum kühle Luft drang. Mitten in der Stadt heizte sich das Pflaster auf wie ein Kachelofen. Die Kinder im Hof mussten Sandalen zum Kästchenhüpfen tragen, denn barfuß hätten sie sich die Füße verbrannt. Und immer wieder kam eine besorgte Mutter angerannt und zerrte sie in den Schatten.
In den Brauereien wurde das Eis knapp, das in Stroh und Sackleinen gehüllt in den Bierkellern die Fässer kühl hielt, damit ihr Inhalt nicht verdarb. Es wurde in den Nordtälern der Alpen aus Eis- und Lawinentrichtern geschlagen, von den Eishändlern wohl verpackt in die Stadt geliefert und dort in den Eiskellern eingelagert.
Sie sah auf den Abreißkalender an der Wand, dann auf das Bild von Anton in seinem schwarzen Rahmen. Acht Jahre führte Therese das Geschäft nun schon allein, ohne ihn. Dallmayr war eines der führenden Delikatessengeschäfte im Herzen der Residenzstadt München. Und »königlich bayerischer Hoflieferant«, wie man auf dem Schild am Eingang lesen konnte. Korbinian Fey, ihr ältester Mitarbeiter, polierte es jeden Morgen mit einem weichen Lappen wie einen Orden. Und das war es ja auch: eine Auszeichnung für höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Wo der bayerische Königshof einkaufen ließ, da tat es ihm das Bürgertum, sobald es wirtschaftlich dazu in der Lage war, mit Eifer und großem Vergnügen nach. Es mussten ja nicht unbedingt immer Austern oder Kaviar sein. Bei Dallmayr gab es schließlich auch Brot und Speck, Schokolade, Kaffee, Tee und Wein, und nicht alles war sündhaft teuer. Doch man konnte sich immer darauf verlassen, dass man beim Dallmayr in der Dienerstraße ein Spitzenprodukt erworben hatte. Dafür verbürgte sich Therese. Sie hatte außerdem dafür gesorgt, dass ein Einkauf bei Dallmayr immer zu einem echten Erlebnis wurde, das allein schon die Menschen glücklich machen konnte. Die Münchnerinnen und Münchner kamen mit hohen Erwartungen in »ihren« Dallmayr. Fast so, wie wenn man in ein Theater oder auf die Wiesn ging. Immer gab es etwas Neues und Besonderes zu entdecken. Und wenn sie wieder hinausgingen, schwebte ein kleines zufriedenes Wölkchen über ihnen, egal, ob das verschnürte Päckchen, das sie so stolz hinaustrugen, nun besonders groß oder doch eher kleiner war. Man kam und staunte, schmeckte, schnupperte, man ließ die Augen über das üppige und aufs Angenehmste präsentierte Angebot an Bekanntem und Seltenem schweifen oder an ganz Neuem, das man anderswo noch nie gesehen oder gekostet hatte. Wenn etwas besonders Exotisches in der Stadt auftauchte, das essbar oder trinkbar war, so konnte man sich darauf verlassen, dass man es beim Dallmayr mit Sicherheit bekam. Man unterhielt sich, tauschte Rezepte und Erfahrungen beim Kochen und an der festlichen Tafel aus. Alle liebten es, wenn sie gut gespeist und einen göttlichen Tropfen getrunken hatten, über dieses Erlebnis in allen Einzelheiten zu berichten. In welcher Soße und mit welcher Beilage es serviert worden war, als wievielter Gang, auf welchen Tellern, in welchen Schüsseln und mit welchem Wein als Begleitung. Und es waren nicht nur die ausgewiesenen Feinschmecker, die mit Therese über die beste Methode fachsimpelten, eine Fischsuppe zuzubereiten, oder wie es ihr gelang, dass die Prinzregententorte mit ihren sieben Biskuitschichten und den Füllungen nicht zu süß wurde.
Therese hatte sich zum Geburtstag genau eine Sache gewünscht: Man sollte sie ihren Morgenkaffee trinken lassen, allein und in aller Ruhe, und vor allem, bevor die große Hitze die Stadt überrollte. Mehr wollte sie gar nicht. Eine große Feier kam schon deshalb nicht infrage, weil ihre Schwiegertochter im Rotkreuzkrankenhaus lag. Sonias zweite Schwangerschaft war schwierig. Die Ärzte empfahlen ihr zu liegen, und alle machten sich Sorgen um sie. Sonias Ehemann Hermann, Thereses ältester Sohn, war oft bei ihr, und er hatte auch den kleinen Johann mit dabei. Er brachte seiner Mutter jeden Tag etwas aus dem Geschäft mit: Pralinen, ein Stück Mortadella, die sie besonders liebte, ein Döschen französische Lavendelbonbons oder eine Mandarine. Johann war ein Schatz. Ihr erster Enkel. Therese ging das Herz auf, wenn sie an ihn dachte. Dass Hermann jetzt fürs Geschäft so oft ausfiel, war dagegen ein schwerer Posten. Sie hätte ihn so dringend gebraucht. Hoffentlich hatte Rosa schon Zeit gehabt, das Telegramm an Paul abzuschicken, mit dem sie ihn dazu bewegen wollte, heimzukommen. Sie brauchte jetzt wirklich jede Unterstützung.
Therese nahm den letzten Schluck des köstlichen Morgenkaffees und faltete die Seiten der Münchner Neuesten Nachrichten zusammen. Beim Aufstehen strich sie sich über den anthrazitfarbenen Baumwollrock. Dazu trug sie eine weiße Leinenbluse mit Lochstickerei, an deren Kragen eine Brosche aus Elfenbein saß. Ein rascher Blick in den Spiegel am Gang. Der Dutt sollte nicht allzu streng sitzen. Ein graues Haar, das sich aufdringlich an der Schläfe kräuselte, riss sie beherzt aus, während sie die, die sich ein bisschen dezenter unter das dunkle Haar mischten, gelernt hatte zu akzeptieren. Schließlich konnte sie auf ein erfülltes Leben zurückblicken. Die Familie, das Geschäft, auf beides war sie gleichermaßen stolz. Sie strich sich noch einmal über den Rock und betrachtete dabei ihre Hände. Damit hatte sie Neugeborene gewiegt, Tränen weggewischt, Wangen gestreichelt. Mit diesen Händen hatte sie Anton in seinen letzten Wochen gepflegt und jeden Morgen das Geschäft aufgesperrt, um ihre Stammkunden zu begrüßen. Eine Handwerkerin war sie, heute wie jeden anderen Tag. Sie hatte viel geschafft, und trotzdem fühlte sie sich noch weit davon entfernt, sich zur Ruhe zu setzen und ihre Kinder ans Ruder zu lassen. Sie hatte noch so viel vor und wollte große Dinge in die Wege leiten, bevor sie sich irgendwann aus dem Geschäft zurückziehen würde. Dass Hermann gerade jetzt so oft ausfiel und Paul immer noch in Wiesbaden war, dazu die Sorge um ihre Schwiegertochter. Das nagte an ihr. Das musste anders werden, sonst ginge sie im alltäglichen Geschäft unter und es bliebe keine Zeit – und Muße – für strategische Überlegungen und Planungen. Und darin sah sie eine ihrer größten Stärken.
Keine Feierlichkeiten. Therese hatte es allen zusammen und jedem Einzelnen eingeschärft, und doch überraschte es sie nicht wirklich, als sie die Treppe zum Geschäft hinunterlief und sah, dass der Puttenbrunnen leer geräumt und stattdessen mit einem großen Blumenbouquet aufgefüllt worden war. Die Blumen sahen aus wie frisch aus einem Bauerngarten gepflückt: rosa und weißer Phlox, Stockmalven von hell- bis dunkellila, Dahlienblüten in Gelb und Orange. Ein Strauß wie zum Erntedank, und das passte sehr gut zu einem Geburtstag, der sich allmählich schon zur sechzig neigte, fand Therese. Korbinian trug ein Tablett mit perlenden Champagnergläsern herein. Wenn Ludwig noch bei ihnen wäre, der Lehrling, den sie am meisten in ihr Herz geschlossen hatte, dann hätte er jetzt selbst gemachte Pralinen kredenzt, dachte Therese. Als hätte sie Thereses Gedanken lesen können, brachte Rosa, die Buchhalterin, ein weiteres Tablett mit zwei Pralinenschachteln aus der Patisserie Planès. Dazu ein kleines Kärtchen. Herzlichen Glückwunsch, Chefin, zum Geburtstag, sendet Ihnen Ihr Ludwig Loibl, Patissier in Bayonne.
»Unser Ludwig, ein Patissier! Ich hab immer gewusst, dass aus ihm noch einmal etwas wird.« Therese war gerührt.
Die rechteckige Schachtel, sie hieß »Coffre No 1« enthielt zwei Reihen mit Pralinen in Würfelform, etwas höher als breit, je zwei mit heller Milchschokolade, zwei mit fast schwarzer Zartbitterschokolade überzogen. »Pralinés noisettes torréfies du Piémont« hießen diese Wunderwerke. Aussprechen konnte Therese es nicht, aber sie verstand so viel Französisch, dass es sich um geröstete Piemont-Haselnusspralinen handeln musste. Die Nüsse waren nicht gehackt, sondern fein gehobelt und geröstet, was sie sehr knusprig machte und die Oberfläche kräuselte wie der Wind die Wellen des Atlantiks. Die zweite Packung war höher und in apricotfarbenes Seidenpapier eingeschlagen. Als sie den Deckel hob, standen darin wie kleine Käselaiber drei Reihen von Macarons in zarten Farben von weiß über gelb, orange, pastellgrün bis dunkelrot.
Es sah so aus, als habe sich jede Mühe, die Anton und sie in die Ausbildung ihres Lehrlings gesteckt hatten, gelohnt. Es war etwas aus ihm geworden, und er hatte seine Dallmayr-Familie nicht vergessen. Im Gegenteil.
»Sollen wir anstoßen, Frau Randlkofer«, fragte Korbinian, »oder wollen Sie noch warten, bis sich die letzte Perle aus dem Champagnerglas verdrückt hat?«
Therese schmunzelte. »Auf die ungehorsamste und trotzdem beste Belegschaft in ganz München! Habe ich nicht gesagt, keine Feier?«
»Wenn ich ehrlich bin, ist es auch keine Feier«, murrte Korbinian, »zumindest keine richtige. Wir sitzen hier im Feinschmeckerparadies, und es gibt für jeden ein Glas Champagner und maximal eine Praline, wenn ich mich nicht verzählt habe.«
»Korbinian, du alter Grantler«, schimpfte Therese. »Sobald mein zweites Enkelkind endlich auf der Welt ist, feiern wir, bis sich die Balken biegen.«
»Versprochen, Chefin?«
»Versprochen. Und jetzt gehen alle wieder an ihre Arbeit, und falls Pralinen übrig sind, bekommen unsere besten Kundinnen auch noch welche, zum Probieren.«
»Die guten französischen vom Ludwig?« Korbinian konnte es nicht fassen. Aber er beruhigte sich gleich wieder bei einem Blick in die beiden Schachteln. Sie waren blitzeblank und bis auf ein, zwei Krümel leer.
Später, als Therese sich eine halbe Stunde Zeit nahm, um auf ihrem Schreibtisch für ein wenig Ordnung zu sorgen, fiel ihr ein Brief ihres Freundes Michael von Poschinger in die Hände. Seltsam, wieso sie gerade jetzt darauf stieß. Der Brief erinnerte sie an die bittersten Stunden, die sie seit dem Tod ihres Mannes erlebt hatte. Sie hatte damals vor einem Abgrund gestanden, und es hatte nicht viel gefehlt und die Leitung des Geschäfts wäre ihr aus den Händen gerissen worden, noch bevor sie auch nur eine einzige Entscheidung getroffen hätte. Ihr Schwager Max, der ewige Widersacher, hatte die Bank gegen sie aufgehetzt, und er hätte fast sein Ziel erreicht, sie aus dem Dallmayr vertrieben, um selbst einen Fuß, oder auch beide, im Geschäft gehabt zu haben. Beinahe hätte er gesiegt, wäre nicht Michael von Poschinger, ihr guter Freund und Mentor, mit einem zinslosen Darlehen in die Bresche gesprungen, mit dem sie ihre Schulden bei der Vereinsbank schließlich tilgen konnte. Damit hatte sie ihren Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen, und seitdem war sie auf der Hut. Sie hatte sich dieses eine wichtige Mal gegen ihren Schwager behauptet, doch sie bildete sich nicht ein, dass er klein beigeben würde. Die Partie mochte eins zu null für sie stehen, ausruhen konnte sie sich auf ihrem Erfolg dennoch nicht. Ihr Vorsprung würde ihn nicht entmutigen, sondern immer ein Ansporn sein aufzuholen.
»Hat Paul sich schon gemeldet?« Therese streckte den Kopf in Rosa Schatzbergers Kontor.
»Noch nicht, aber das Telegramm wird bestimmt bald ausgeliefert. Ich sage Ihnen gleich Bescheid, wenn er anruft. Es ist ja keiner gestorben.« Erschrocken über ihre Taktlosigkeit fügte Rosa noch schnell ein »Glücklicherweise« hinzu.
»Muss einer sterben, damit die Kinder sich auch einmal zu Hause melden?«
Therese wurde immer ungeduldiger. Für ihre Pläne brauchte sie die Unterstützung ihrer Kinder. Oder besser ihrer Söhne, denn Elsa hatte ihr sehr klargemacht, dass eine Arbeit im Familienbetrieb für sie derzeit nicht infrage kam. Sie war mit ihrer »Karriere« in der Schweiz beschäftigt. Daheim hätte sie nichts anderes werden können als Lehrerin oder Erzieherin, und das wollte sie nicht. Für das Geschäft hatte sie sich nie sonderlich interessiert, und die ständige Nähe zur Mutter war vielleicht auch etwas, das sie vermeiden wollte. Vielleicht gerade deshalb, weil sich Mutter und Tochter so ähnlich waren? Aus irgendeinem Grund akzeptierte Therese bei Elsa, was sie ihren Söhnen so niemals durchgehen lassen würde. Wenn sie jetzt auch noch einen Mann in der Schweiz fände, würde Elsa womöglich ganz dortbleiben. Aber im Augenblick war noch keiner in Sicht, zumindest hatte Therese nichts davon mitbekommen. Das Telefon klingelte, und Rosa nahm den Hörer ab.
»Ist das Paul?«, wollte Therese wissen.
Rosa schüttelte den Kopf. »Eine Bestellung«, flüsterte sie und deckte die Sprechmuschel mit der Hand ab. »Sehr wohl, Frau Kommerzienrat«, hörte Therese sie antworten und verließ enttäuscht das Büro. Wenn Paul sich bis Mittag nicht meldete, würde sie bei ihm in der Firma anrufen.
»Wieso nennst du mich Frau Kommerzienrat?«, fragte Paul in seiner Kabine im Telegrafenamt und stellte einen Fuß in die Glastür, um den Schweißgeruch, der in den Holzwänden dieser Zelle hing, erträglicher zu machen. Es war schrecklich heiß und stickig.
»Weil deine Mutter gerade in der Tür gestanden und nach dir gefragt hat. Und weil ich ja deine Antwort durch den Telegrammboten bekommen habe, dass sie auf keinen Fall an deiner Arbeitsstelle anrufen soll. Da hab ich gedacht, ich gebe ihr den Hörer am besten nicht weiter. Richtig so?«
»Danke, Rosa.«
»Was ist denn los bei dir? Hast du was ausgefressen?«
Paul drückte die Tür seiner Kabine noch ein Stück weiter auf. Die Hitze war zum Ersticken.
»Paul? Bist du noch da?«
»Jaja. Kannst du Hermann holen?« Rosa war zwar die Schaltzentrale im Dallmayr, aber seine Beichte hätte Paul lieber bei seinem großen Bruder abgelegt. Dann bliebe es in der Familie.
»Der ist im Krankenhaus, bei seiner Frau.«
»Wieso, was ist denn passiert?« Das schlechte Gewissen packte Paul. Er war so mit sich selbst und seiner Grau-Krankheit beschäftigt gewesen, dass er in letzter Zeit gar nicht mehr mitbekommen hatte, was in der Familie so passierte.
»Sie soll mit dem Baby jetzt vorsichtig sein, sagen die Ärzte, und haben sie ins Krankenhaus eingewiesen. Sie muss liegen, damit das Kind nicht viel zu früh auf die Welt kommt.«
»Ach, und Hermann ist da auch mit dabei?«
»Er besucht sie fast täglich mit dem kleinen Johann.«
Dann hatte Hermann jetzt also andere Sorgen. Sollte er Elsa in der Schweiz anrufen oder Balbina am Bodensee?
»Paul? Wir können das Firmentelefon nicht ewig belegen. Jetzt sag halt einfach, was los ist. Wieso soll deine Mutter nicht an deiner Lehrstelle anrufen?«
»Warte mal.« Paul ließ den Hörer an der Schnur baumeln, riss die Tür auf und zog sein Jackett aus. Er öffnete den obersten Hemdkragen und wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß aus dem Gesicht. Diese Zelle war wie ein Vorgeschmack aufs Gefängnis. »In der Firma gibt es gerade ein größeres Problem«, antwortete er dann. »Und mein Chef ist mit den Nerven am Ende. Es hat wenig Aussicht auf Erfolg, wenn Mutter jetzt mit ihm spricht.«
»Paul?«, fragte Rosa.
»Ja?«
»Willst du mich für dumm verkaufen?«
»Nein, wie kommst du denn dadrauf?«
»Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich kenne dich, seit du zur Volksschule gegangen bist. Und ich habe den Eindruck, dass du mir hier gerade einen ziemlichen Bären aufbindest. Dazu muss ich dich gar nicht sehen, Paul. Das kann ich sogar hören.«
»Blödsinn, Rosa, das bildest du dir ein.«
»Und was hat dieses Problem in der Firma eigentlich mit dir zu tun, hm?«
»Nichts, aber es ist eben ein schlechter Zeitpunkt.«
»Und das soll ich deiner Mutter erzählen? Das glaubt sie nie, genauso wenig wie ich.«
»Dann«, Paul stockte. »Dann denk dir bitte was Überzeugenderes aus. Bitte, Rosa.«
»Also, du hast schon Nerven. Dann bist du eben krank geworden und meldest dich, sobald du wieder gesund bist.«
»Danke.«
»Paul? Wenn du irgendwie in der Klemme steckst …«
»Nein, nein, alles gut. Ich melde mich wieder.«
Paul stürzte aus der heißen Zelle. Draußen die Sommerhitze und von innen her brannte die Scham, dass er Rosa angelogen hatte. Genau so musste das Fegefeuer sich anfühlen.
***
»Hat der Schorsch sich schon erleichtert?«, fragte Max Randlkofer seinen Lehrling. Doch der glotzte ihn nur an. »Ob er sein Geschäft schon gemacht hat, will ich wissen.«
»Ach so, ja, ist erledigt«, antwortete der Lehrbub. Er war dafür verantwortlich, mit dem Schorsch Gassi zu gehen, in den Grünanlagen an der Herzog-Wilhelm-Straße.
Dass seine Freundin Mitzi, bevor sie zur Kur nach Bad Reichenhall gegangen war, den Schorsch bei ihm abgegeben hatte, war für Max schon in Ordnung. Er zeigte sich gern mit dem für München typischen Kurzhaardackel. Er fand, das Hunderl passte zu seinem eleganten, trotzdem patriotischen Auftreten, aber natürlich fand Max es unter seiner Würde, mit ihm Gassi zu gehen. Er sah den Schorsch eher als modisches Accessoire, so wie anständig geputzte Schuhe und ein gedrechselter Spazierstock mit Elfenbeingriff.
Am späteren Vormittag hatte Max sich einen kleinen Spaziergang die Neuhauser und Kaufinger Straße hinunter zum Marienplatz und von dort zum Viktualienmarkt angewöhnt. Den Schorsch nahm er dazu mit. Die Marktfrauen an ihren Ständen und Buden waren ganz verrückt nach dem Viecherl und fütterten es für gewöhnlich mit Leckerbissen. Max holte sich wie üblich eine Portion Nürnberger Bratwürste mit Kraut und viel mittelscharfem Senf, setzte sich damit in einen der Biergärten, bestellte sich eine schöne Maß Bier dazu und blinzelte zufrieden in die Sonne. Woanders hätte er Weißwürste bestellt, aber am Viktualienmarkt mussten es die berühmten Bratwürste aus Nürnberg sein, von dem Stand an der Heiliggeistkirche. Als die Antonia vorbeikam, ein sauberes Frauenzimmer mit viel Holz vor der Hütte, zog er sich eine frische Brezel von dem Metallspieß, auf dem sie das Gebäck feilbot, und war mit sich und der Welt zufrieden.
Eine stattliche Dame mit zwei kleinen Buben kaufte fürs Mittagessen ein, Gemüse, Salat, mäkelte an den Kartoffeln, ließ sich verschiedene Sorten Äpfel zeigen, roch daran. Der eine Bub, der größere, blieb die ganze Zeit bei seiner Mutter stehen, während der kleinere den Markt lieber auf eigene Faust erkundete, zurückblieb, ermahnt werden musste, einmal ganz verschwand und erst später am Zuckerlstand auf wundersame Weise wiederauftauchte. Max beobachtete die Szenerie amüsiert. So war es immer, dachte er. Einer hielt sich brav an die Regeln und war der ganze Stolz seiner Erzeuger. Der andere hatte sich entschieden, die Welt auf eigenen Wegen zu erkunden, und die krummen Wege übten eine ganz besondere Anziehung auf ihn aus. In jeder Familie gab es solche und solche, es würde immer so sein. Indes war nicht ausgemacht, wer von beiden der Erfolgreichere oder gar Glücklichere sein würde. Das Glück war sowieso nur eine Sternschnuppe, und doch jagte jeder ihm nach und hoffte, er könne es erhaschen und dann festhalten.
Max hatte, wie sein Bruder Anton, nicht bei null starten müssen. Ihre Vorfahren waren fleißige Leute gewesen und hatten als Bierbrauer und Gastronomen einen wirtschaftlichen Grundstock geschaffen, der ihren Söhnen den Start ins Berufsleben erleichterte. Sie hatten bereits den wichtigsten Schritt getan und waren vom Land in die Stadt gezogen, wo das Geld zwar nicht auf der Straße lag, aber leichter und vor allem schneller zu verdienen war. Natürlich nur, wenn man sich geschickt anstellte und den richtigen Riecher hatte. Als sein Bruder Anton 1895 den Kolonialwarenladen in der Maffeistraße aufgab und das Delikatess-Haus Alois Dallmayr kaufte, das damals schon einen klingenden Namen trug, da war Max sich sicher gewesen, dass Anton sich übernommen hatte. Er hatte damals schon angenommen, dass er ihm zur Seite springen und ihn unterstützen müsste, wozu er sofort bereit gewesen wäre. Gegen eine angemessene Beteiligung, versteht sich. Stattdessen hatte das Geschäft unter Antons Führung floriert, und das Hilfsangebot von Max war ungenutzt ins Leere gelaufen.
Anton selbst hatte seinen Triumph nicht lange auskosten können, genau genommen zwei Jahre, dann war er überraschend verstorben. Damals hatte Max auf ein größeres Erbe und wenn nicht auf die Übernahme des Geschäfts, so doch auf eine anständige Teilhaberschaft spekuliert. Alle Hebel hatte er in Bewegung gesetzt, um Zugang zum Dallmayr und dessen Erfolg zu bekommen. Doch seine Schwägerin Therese war raffinierter und durchtriebener, als er gedacht hatte. Sie führte das Geschäft jetzt seit acht Jahren alleine, stellte von Jahr zu Jahr mehr Personal ein, erwarb ein weiteres Haus in der Dienerstraße dazu, erweiterte den Laden und baute ihn aufs Modernste aus. Sie raffte einen Hoflieferantentitel nach dem anderen zusammen, band ihren Ältesten mit ins Geschäft ein, den er, Max, ausgebildet hatte, und dazu war sie auch noch stolze Großmutter geworden und eine ernst zu nehmende Geschäftsfrau, der er bislang mit nichts an den Karren fahren konnte, sosehr er es auch versuchte. Sie wurde immer vermögender und einflussreicher, und ihre Geschäfte liefen glänzend. Dieses blasierte Weib, dachte Max. Mit Genugtuung hatte er bemerkt, dass sie im Alter ein kleines Doppelkinn ansetzte, das sie mit den hochgeschlossenen Blusen, die sie immer trug, zu kaschieren versuchte. Wie ein Pinguin lief sie herum, stets im schwarzen langen Rock mit weißer oder cremefarbener Spitzenbluse. Bieder, allen modischen Dingen abgeneigt, in ihrer ganzen Erscheinung ohne jede weibliche Raffinesse.
Am Zuckerlstand gab es jetzt ein großes Geheule, weil die Dame ihrem verschwundenen und wiedergefundenen Buben die Ohrwaschl langzog und wegen seiner Eigenwilligkeiten auf ihn losschimpfte.
Nein, schwor sich Max, er würde nie aufhören, um sein familiäres Anrecht auf das Dallmayr-Vermögen zu kämpfen und seiner Schwägerin genau auf die Finger zu schauen, um ihr, sooft er konnte, in die Suppe zu spucken. Nie würde er sich damit abfinden, dass sie ihn von allem ausschloss, nachdem er immer für seinen Bruder und für sie da gewesen war und ihnen das ein oder andere Mal unter die Arme gegriffen hatte, als es ihnen noch nicht so gut ging. Und kein Mensch konnte ihn von der Überzeugung abbringen, dass ihm mindestens ein angemessener Anteil am Dallmayr zustand. Schon von den familiären Bindungen her. Anton war sein großer Bruder gewesen, sein Held aus Kindertagen. Er hätte nicht gewollt, dass er, Max, leer ausging. Wer weiß, wie Therese seinen schwerkranken Bruder beim Abfassen seines Testaments beeinflusst hatte und wie sehr sie ihm in den Ohren gelegen hatte, bis Anton alles ihr allein, als Sachwalterin für die gemeinsamen Kinder, überschrieben hatte. Rechtens war es wohl gewesen, aber gerecht war es deshalb noch lange nicht. Max knallte seinen Maßkrug auf den Tisch, dass das Bier spritzte. Schorsch kam hektisch unter dem Tisch hervorgesprungen und wedelte mit seinem lächerlichen Rattenschwanz. Vor Aufregung hob er das dünne Hinterbeinchen, und schon prasselten die ersten Tropfen auf das herrlich weiche hellbraune Kalbsleder von Max’ Halbschuhen.
»Mistviech, elendiges«, fauchte Max den Dackel an und gab ihm einen Tritt, der ihn aufjaulen ließ. Ein distinguiertes Ehepaar vom Nebentisch sah Max pikiert an, aber der Schuh war wahrscheinlich ruiniert und seine Laune verdorben.
»Zahlen, Lisbeth«, herrschte Max die Kellnerin an. »Aber heut noch. Ich hab’s eilig!«
***
»Herr Dr. Kronawitter, wie schön, dass Sie auch einmal wieder bei uns vorbeischauen!« Therese trat hinter dem Tresen hervor und ging dem Herrn mit dem schwarzen Schnurrbart und den breiten ergrauten Koteletten entgegen, der etwas unschlüssig an der Tür stand. »Sie waren länger nicht bei uns, oder täusche ich mich?«
Sie streckte ihm freundlich beide Hände entgegen, denn er schien sich ein wenig unwohl zu fühlen. Therese konnte sich auf ihr Personengedächtnis verlassen, das ihr Mann »phänomenal« genannt hatte. Wenn du jemanden einmal siehst, erkennst du ihn auch nach zwanzig Jahren wieder, und meistens fällt dir dann auch gleich noch der Name dazu ein, hatte Anton einmal zu ihr gesagt. Wie machst du das bloß? Sie wusste es selbst nicht. Es war eine Gabe, für die sie sich nicht einmal anstrengen musste. Die Gesichter flogen ihr einfach so zu, ebenso die Namen. In einem anderen Beruf wäre dieses Talent womöglich verschwendet gewesen, als Geschäftsfrau und Ladeninhaberin war es mitunter Gold wert.
»Man kennt sich ja gar nicht mehr aus bei Ihnen«, wunderte sich der Kunde. »Ich habe Ihr Geschäft noch ganz anders in Erinnerung.«
Seine Krawatte saß ein wenig schief, und der hohe Kragen war an einer Seite nach innen geknickt. Therese musste sich beherrschen, ihn nicht darauf aufmerksam zu machen oder gleich selbst hinzufassen und das Malheur in Ordnung zu bringen.
»Wie haben Sie es denn in Erinnerung?«, fragte sie, während er ihre Hand schüttelte.
»Kleiner«, sagte er und sah sich um, »und auch dunkler, die Decke war auch niedriger, oder täusche ich mich?«
»Dann waren Sie aber schon ziemlich lange nicht mehr bei uns. Wir haben gleich am Beginn des neuen Jahrhunderts mit dem Umbau begonnen. Genau am 2. Januar 1900. Und durch das Nebenhaus, das ich dazuerwerben konnte, haben wir etwas erweitern können.«
»Jetzt untertreiben Sie aber, gnädige Frau. Etwas erweitern.« Er grinste. »Ihr Geschäft ist doch jetzt doppelt so groß wie vorher.«
»Ich hoffe, es gefällt Ihnen«, antwortete Therese souverän. Dass sie schon längst Pläne hatte, die anderen beiden Gebäude in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft auch noch zu übernehmen, sobald die Besitzer bereit wären zu verkaufen, davon erwähnte sie nichts. Neider gab es auch so schon genügend.
»Waren diese Marmorsäulen immer schon da?« Kronawitter strich mit den Fingern darüber, wie um zu prüfen, ob es tatsächlich Marmor war.
»Ja, die waren immer da, aber unter dem Verputz versteckt. Darauf hat mich der Architekt Seidl aufmerksam gemacht, dass man sie freilegen sollte.«
»Der Gabriel Seidl hat den Umbau gemacht?«
»Er hat ihn geplant. Ausgeführt hat ihn dann Eugen Hönig, ein junger, aber sehr tüchtiger Münchner Architekt.«
»Und was ist das? Ein Frischwasserbrunnen?«
»Ja, das ist unser Puttenbrunnen, manche sagen auch Krebsbrunnen dazu. Wenn Fangsaison ist, dann dürfen die Flusskrebse in dem Wasserbecken wohnen.«
»Bis sie im Kochtopf landen. Ja, da gratuliere ich zum gelungenen Umbau, Frau Randlkofer. Hoflieferantin sind Sie ja auch, habe ich draußen auf Ihrem Schild gelesen. Ob ich es mir als einfacher Münchner Magistratsbeamter überhaupt noch leisten kann, bei Ihnen einzukaufen?«
Er zwinkerte ihr zu, aber Therese verstand sehr gut, dass er damit eine kleine Spitze gegen sie losließ. Der Magistrat, und mit ihm das ganze bürgerliche München, versäumte keine Gelegenheit, sich vom regierenden Königshaus, den Wittelsbachern, abzugrenzen, die nur einen Sprung vom Marienplatz entfernt residierten. Deshalb war das neue Münchner Rathaus, dessen Flügel in der Dienerstraße dem Dallmayr direkt gegenüberlag, auch nach dem Vorbild des Brüsseler Rathauses im neugotischen Stil erbaut worden. Und gerade nicht nach dem klassizistischen Stil der bayerischen Könige und Regenten. Man war in der Bürgerschaft sehr darauf bedacht, sich von der Monarchie abzugrenzen, was Therese im Prinzip auch richtig fand. Aber als Geschäftsfrau, die eine Delikatessenhandlung führte, zählten der Königshof und der Adel zu ihrer wichtigsten Kundschaft. Denn was der Adel sich leistete, wollten sich auch die Bürger leisten, sobald sie es aufgrund wirtschaftlicher Erfolge konnten. Und die höheren Beamten sowieso. Dr. Kronawitter war eher ein Liberaler mit einer unausgesprochenen Sympathie für die kleine Fraktion der Sozialdemokraten, die Georg von Vollmar im Landtag anführte. Vielleicht war er im Herzen sogar Republikaner. Therese ließ jedem seine Überzeugung. Bei ihr drehte sich alles um das Geschäft, nicht um die große Politik.
»Bei mir kann jeder Münchner Bürger einkaufen«, antwortete sie. »Wir haben ja nicht nur Austern und Kaviar und französischen Champagner im Angebot. Doch selbst den kann man sich leisten, es muss ja nicht jeden Tag oder jede Woche sein. Womit kann ich also dienen, Herr Doktor, was führt Sie zu mir? Oder wollten Sie sich einfach nur umschauen, was sich so tut in der Münchner Geschäftswelt rund um das Neue Rathaus?«
»Um Himmels willen, das hätte ich jetzt in dem Geplauder fast vergessen. Gut, dass Sie nachfragen. Meine Frau und ich feiern heute Hochzeitstag, und da wollte ich ihr etwas Feines mitbringen. Sie hat immer die Ölsardinen vom Dallmayr so gern gegessen, sie sagt, es gibt in ganz München keine besseren.«
»Und damit hat sie ja auch vollkommen recht.« Therese nahm drei Dosen aus dem Regal, dazu ein Päckchen Kaffee. Sie hätte ihm seinen Einkauf gern geschenkt, für die Frau Gattin, aber Kronawitter wollte partout nichts annehmen. Von wegen Bestechlichkeit eines Magistratsbeamten. Worauf Therese sich sofort überlegte, in welcher Angelegenheit sie ihn denn tatsächlich hätte bestechen können. Sie holte noch schnell eine Tafel belgische Schokolade, während Kronawitter an der Kasse seinen Einkauf bezahlte.
»Dann bringen Sie Ihrer verehrten Gattin doch bitte dieses persönliche Präsent von mir mit, das können Sie nicht ablehnen, Herr Dr. Kronawitter. Sie müssen ja selbst nichts davon kosten, wenn Ihnen das gelingt. Und bitte richten Sie beste Grüße aus.«
Der Beamte strich sich über seinen Schnurrbart. Das konnte er jetzt wirklich kaum verweigern. Es war ja nicht einmal für ihn. Therese begleitete ihn zur Tür.
»Wann ist es denn nun so weit, dass auch der dritte Bauabschnitt des Rathauses fertig wird?«, fragte sie. »Viel fehlt ja nicht mehr. Sogar der Turm steht schon, für das Glockenspiel, also ich freu mich ja schon so darauf, wenn alles fertig und die Baustelle endlich weg ist.«
»Ja, nicht, es ist schön geworden. Seit einunddreißig Jahren bauen wir jetzt an dem Komplex. Nicht jedem gefällt er, aber die Leute werden sich schon noch daran gewöhnen, so wie sie sich an alles gewöhnen, auch wenn sie zuerst dagegen sind. Im Dezember soll alles fertig sein und der Schlussstein gesetzt werden.«
»Zur Einweihung im Dezember«, dachte Therese laut nach, »könnten wir da nicht mit einem Bankett aus dem Dallmayr etwas Würdevolles zu den Feierlichkeiten beitragen?« Es war eine spontane Eingebung, und sie sah sofort, wie Kronawitter sich innerlich wand. »Über das Budget ließe sich ja noch reden. Mir ist selbstverständlich bewusst, dass der Neubau am Ende doch um ein Mehrfaches teurer war als geplant. So war es zumindest in der Presse zu lesen. Ich dagegen biete immer einen Festpreis an für meine Dienste und bleibe dann auch dabei. Selbst wenn ich mich verkalkuliert habe.« Sie legte Kronawitter ihre Hand in vertraulicher Geste auf den Arm und öffnete ihm die Tür.
Etwas überrumpelt trat er mit seinem verschnürten Paket mit der goldenen Dallmayr-Schrift auf die Dienerstraße hinaus.
»Ich werde es mit dem Bürgermeister besprechen. Aber versprechen kann ich nichts, Frau Randlkofer.«
»Freilich, es ist ja auch nur ein Angebot. Empfehlen Sie mich Ihrer Gemahlin. Auf Wiedersehen.«
»Auf Wiedersehen.« Er lief Richtung Marienplatz davon, dass die schwarzen Rockschöße flatterten.
Hoffentlich dachte der Herr Dr. Kronawitter daran, die Schokolade kühl zu lagern, nicht dass sie ihm bei der Hitze noch schmolz. Über dem Kopfsteinpflaster flimmerte die Luft. Pferdegetrappel kam näher, eine Kutsche rollte vom Marienplatz her durch die Dienerstraße. Sie würde gleich den Lehrling herausschicken, um die verlorenen Pferdeäpfel aufzusammeln. Nicht dass sich die Damen ihre feinen Schuhe schmutzig machten, wenn sie zum Dallmayr gingen. Wie ein Blitzlicht tauchte eine Erinnerung aus Thereses Gedächtnis auf. Wie sie Ludwig damals, zu Beginn seiner Lehrzeit, anleiten und immer wieder zurechtweisen musste, weil er nicht mit dem gebotenen Ernst an seine Aufgaben, zum Beispiel das Einsammeln von Pferdeäpfeln, gegangen war. Heute musste sie selbst darüber schmunzeln. Wie lange war das her? Acht Jahre, neun? Er musste 1896 zu ihnen gekommen sein, ein halbes Jahr bevor Anton starb. Patissier in Frankreich war er geworden, ihr Lehrling Ludwig aus Haidhausen, einem Arbeiterquartier auf der rechten Isarseite. Alle hatten sie geglaubt, dass Ludwig und Balbina, in die er bis über beide Ohren verliebt gewesen war, einmal zusammenkommen würden. Aber es sollte halt nicht sein. Balbina war am Bodensee geblieben, Ludwig bis nach Südfrankreich gekommen. Die gemeinsamen Zukunftspläne hatten sich in Luft aufgelöst. Den jungen Leuten heutzutage boten sich einfach viel mehr Möglichkeiten als ihnen damals. Von der Oberpfalz in die Stadt München, das war schon ein Riesenschritt gewesen, als sie jung war. Aber jetzt war Europa näher zusammengerückt, Landesgrenzen waren durchlässig geworden, auch fremde Sprachen keine unüberwindbaren Hindernisse mehr. Diese Weltläufigkeit gefiel Therese. Es passte perfekt zu ihrem Geschäft und zu den Waren aus ganz Europa und darüber hinaus, die sie im Sortiment hatte. Wenn die Münchner in der Zeitung von einer besonders feinen exotischen Frucht oder einem rohen Schinken aus eichelgefütterten iberischen Schweinen lasen, dann konnten sie sicher sein, dass man es auch bei Dallmayr gelesen hatte und schon dabei war, Lieferanten und sichere Handelswege ausfindig zu machen. Nach kurzer Zeit war es dann meist so weit. So hatten sie die ersten Bananen von den Kanaren nach München gebracht, auch Mangos kamen von dort, wenn auch noch nicht in der Menge und Regelmäßigkeit, die sie sich wünschten. Aber sie blieben dran. Es war immer ein kleines Abenteuer, Waren mit Schiffen über die Weltmeere oder Gewürze und Tee über die Seidenstraße von Asien über Russland und dann mit der Eisenbahn Richtung Mitteleuropa zu bringen. Dass es die Kinder jetzt fort von München und in andere Städte und Länder zog, war im Grunde ein gutes Zeichen. Also ganz allgemein gesprochen, die engen Ländergrenzen waren durchlässiger geworden. Der engstirnige Nationalismus, wir hier in Bayern, dort die Preußen, die Franzosen und so weiter, war ein Holzweg. Nicht nur fürs Geschäft. Natürlich hätte sie als Mutter schon gern alle näher bei sich gehabt. Die Kinder sowieso, aber auch ihre Mitarbeiter, die sie selbst ausgebildet hatte. Am liebsten hätte sie alle wieder zurückgeholt. Aber sie musste ihnen Zeit geben, sie eigene Erfahrungen sammeln lassen. Eines Tages würde sie ihnen vielleicht ein so gutes Angebot machen, dass sie nicht länger widerstehen konnten. Zumindest die, die noch keine Familie anderswo gegründet hatten. Und Ludwig mit seinen köstlichen Pralinen würde man doch bestimmt als original bayerisch-französischen Patisserie-Lieferanten mit ins Geschäft holen können. Es musste etwas sein, das es so nur in Frankreich gab, nicht bei den heimischen Konditoren, die ja im Grunde auch nicht schlechter waren. Und dann musste man nur noch überlegen, wie man die ludwigschen Kreationen heil und zu annehmbaren Preisen bis nach München brachte. Vielleicht konnte sie einen ihrer Söhne auf Geschäftsreise nach Südfrankreich schicken. Und weil Hermann jetzt Familienvater und seine Kinder noch so klein waren, dachte sie dabei eher an Paul. Aber der musste jetzt erst einmal nach München kommen. Wenn er sich bloß endlich melden würde.
***
Paul hatte sich den halben Tag um die Ohren geschlagen. Erst war er in der Stadt herumgelaufen, ziellos wie ein Streuner. Als es ihm trotz etwas Schatten sogar im Kurpark noch zu heiß war, hatte er sich in das Café gegenüber dem Telegrafenamt geflüchtet und entdeckt, dass es über eine sensationelle technische Neuerung verfügte: einen Deckenventilator, der offenbar mit einem Elektromotor betrieben wurde und tatsächlich für ein wenig Abkühlung sorgte. Er trank Kaffee, dann Wasser, dann wieder Kaffee, und später Limonade. Am Nachmittag wurde das Café voller. Paul raffte sich auf, ging über die Straße ins Telegrafenamt und ließ sich wieder mit dem Anschluss von Dallmayr in München verbinden. Hermann sei aus dem Krankenhaus zurück, aber jetzt mit dem Ausliefern von Bestellungen unterwegs, erklärte ihm Rosa. Paul seufzte. Was sollte er bloß tun? Zurück in sein graues Zimmer bei Frau Schleicher? Nur das nicht.
»Was ist denn los bei dir in der Firma?«, fragte Rosa. »Mir kannst du es doch sagen. Von mir erfährt keiner was.«
Paul zögerte. Konnte er Rosa vertrauen? Sollte er wieder warten, bis er Hermann endlich erreichte? Was würde der ihm sagen? Lange konnte er die Sache nicht mehr für sich behalten. Er musste endlich mit irgendjemandem darüber reden, bevor es ihn noch ganz erdrückte.
»Jemand hat Geld unterschlagen«, sagte er hastig.
»Unterschlagen«, echote Rosa. »Und was hat das mit dir zu tun?«
»Das geht jetzt so, seit ich vom Laden ins Kontor gewechselt bin.«
»Ja und?«
Nun war der Damm gebrochen, und es gab kein Zurück mehr für Paul. Er musste es endlich loswerden. »Deshalb verdächtigen sie mich.«
»Was? Das geht doch nicht«, regte Rosa sich auf. »Hast du denn niemanden dort, der auf deiner Seite steht?«
»Die Angestellten halten alle zusammen. Ich bin der Neue, der aus dem Ausland, wie sie immer sagen. Ein Bayer in Preußen.«
»So ein Schmarrn«, schimpfte Rosa.
»Ich halte immer tapfer dagegen, bin fleißig, pünktlich, aber irgendwie habe ich einen Bayernstempel auf der Stirn. Mit Lederhose und Schuhplattler, das ganze Programm. Manchmal treiben sie es ganz arg. Vor allem einer, der Wilhelm, ist besonders grob zu mir und will immer den Watschentanz von mir lernen, sagt er.«
»Was für ein Depp«, kommentierte Rosa. »So etwas gäbe es bei uns im Dallmayr nicht. Da würde deine Mutter aber einschreiten.«
»Mutter darf auf keinen Fall etwas davon erfahren. Versprichst du es mir?«
»Jaja, keine Sorge«, versprach Rosa. »Aber Paul, um welche Summe geht es denn da eigentlich?«
»Achthundert Mark.« Eine neue Hitzewelle arbeitete sich von Pauls Körpermitte hinauf Richtung Kopf. Ein kleiner Schwindel erfasste ihn.
Rosa pfiff durch die Zähne. »Das ist ja mehr, als ich im ganzen Jahr verdiene«, sagte sie. »Und ich verdiene gar nicht mal so schlecht. Hermann kann so viel Geld bestimmt nicht an deiner Mutter vorbeischleusen. Lass mich mal überlegen. Der Herr von Poschinger vielleicht? Der ist doch wie ein Patenonkel für dich. Und Geld hat er genug.«
»Nein, nicht der Herr von Poschinger! Wie würde ich denn vor ihm dastehen?«, jammerte Paul. »Und dann erfährt es die Mutter bestimmt irgendwann. Die beiden reden doch über alles miteinander, nicht nur übers Geschäft.«
Rosa überlegte. »Genau genommen hast du zwei Probleme«, teilte sie Paul mit. »Das eine ist das fehlende Geld, das andere, dass der Schuldige gefunden und überführt werden muss. Dieser elende Betrüger, der so viel Geld für sich abgezweigt hat. Das bleibt doch sonst an dir kleben wie Hühnerdreck.«
In Wahrheit war es noch viel schlimmer. Pauls Chef hatte gesagt, er würde von einer Anzeige absehen, wenn seine Mutter den Schaden ersetzte. Seine Lehrzeit wäre damit aber vorzeitig beendet. Der Wunsch seiner Mutter, Paul nach München zu holen, kam ihm also gar nicht so ungelegen. Wenn nur das Geld nicht wäre. Und diese Schmach, wie sollte er die je wieder loswerden?
»Du könntest natürlich zur Polizei gehen, aber ob die so schnell den wahren Schuldigen …«
»Nein, bloß keine Polizei.«
»Jetzt lass mich mal überlegen. Ruf mich am Abend wieder an. Ich mache heute Überstunden. Und die Chefin ist bei einer Versammlung des Wirtschaftsvereins in der Altstadt. Am besten meldest du dich so gegen acht.«
Paul bezahlte das Telefonat und tigerte wieder durch Wiesbaden, um weitere öde Stunden totzuschlagen. All seine Hoffnung ruhte jetzt auf Rosa Schatzberger. Wenn ihr nichts einfiele, dann blieb die Welt weiterhin düster und ganz ohne Farben.
***
Elsa beschloss, sich den Nachmittag freizunehmen. Ihr Chef war zu einem Mandanten nach Zürich gefahren. Sie hatte die Schriftsätze ausformuliert, die sie zusammen vorbereitet hatten, aber jetzt war die Hitze im Büro trotz geschlossener Fenster und Läden nicht mehr länger auszuhalten. Ihren Badeanzug und ein Handtuch hatte Elsa am Morgen von zu Hause mitgebracht.
Die Altstadt war wie ausgestorben. Als seien alle Bewohner aus der Stadt geflüchtet. Sie lief an der Stickerei Einstein vorbei. Durch eine zur Seitengasse geöffnete Tür konnte sie das Rauschen der Handstickmaschinen hören und sehen, wie das »Schiffli« hin- und hersauste. In den Schaufenstern hingen Stores mit feinsten Blüten- und Schleifenmustern. Für sie war die Stadt St. Gallen berühmt.
An der Mühleggbahn kaufte Elsa sich für fünfzehn Rappen ein Billett und wartete auf den Wagen der Standseilbahn, der bald aus dem steilen Felstunnel auftauchen würde. Neben Gleis und Tunnel stürzte der Mühlegg-Bach die Schlucht hinunter. Sein Wasser wurde in den Tank des oberen der beiden Wagen gefüllt und sorgte mit seinem Gewicht dafür, dass der Wagen auf den Schienen nach unten fuhr und dabei den zweiten Wagen an einem Stahlseil nach oben zog. Elsa erinnerte sich genau, als ihr Physiklehrer ihnen die Wirkungsweise der hypermodernen Wassergewichtsseilbahn erklärt hatte, die erst vor ein paar Jahren gebaut worden war.
Der Schaffner wünschte einen »guete Tag« und entwertete ihr Billett mit der Lochzange. Von der Bergstation im Villenviertel Sankt Georgen lief Elsa noch weiter den Hügel hinauf bis zu den Drei Weihern. Der erste und größte der drei Badeteiche war der Mannenweiher, zu dem Frauen keinen Zutritt hatten. Der Buebenweiher war kleiner und fast ganz mit Seerosen bedeckt. Dann kam der Frauenweiher, der von allen nur zärtlich »das Frauenbadi« genannt wurde. Elsa verschwand im hölzernen Badehaus und zog ihren nagelneuen Badeanzug an, den sie in einem Geschäft in der Spisergasse gekauft hatte. Er war schwarz mit weißen Paspeln am Ausschnitt und an den Beinrändern, die bis zur Mitte der Oberschenkel reichten. Sie hatte sich für ein Modell mit kurzen Armen entschieden, wie sie es in einer Zeitschrift bei der australischen Weitschwimmerin Annette Kellerman gesehen hatte. Es war eng geschnitten wie ein Trikot und hatte weder einen Matrosenkragen noch Puffärmel oder weite Hosenbeine, die am Knie von Gummilitzen eingeschnürt wurden. Im Mannenweiher hätte sie mit diesem engen Schwimmanzug für Furore gesorgt. Im Frauenbadi dagegen war man unter sich. Sie spürte schon Blicke von anderen Frauen auf sich, aber sie waren diskret bewundernd und respektvoll. So wie Elsa es gewohnt war, denn in Modedingen war sie oft mutiger als ihre Freundinnen und ließ sich in ihrer Wahl nicht von fremden Meinungen und neidischen Blicken beeinflussen.
Elsa stieg die Leiter hinab ins Wasser und durchschwamm den kleinen See in seiner ganzen Länge, während die anderen Badegäste meist im seichten Uferbereich blieben. Die allermeisten konnten nicht schwimmen und kamen nur zum Abkühlen ins Frauenbad. Wenn sie nur wüssten, was ihnen entgeht, dachte Elsa und betrachtete ihre Arme, die unter der Wasseroberfläche matt schimmerten. Wäre sie in der Klosterschule in Nymphenburg geblieben, dann hätte Elsa wahrscheinlich auch nie schwimmen gelernt. Aber hier in St. Gallen war alles etwas freier und moderner, und es herrschte die Meinung, dass es auch für junge Frauen wichtig, vielleicht sogar lebensnotwendig war, schwimmen zu lernen. In der Schweiz durften Frauen überhaupt schon viele Dinge, von denen die Mädchen in München nur träumten. Studieren zum Beispiel oder eine Ausbildung in einem Männerberuf machen, wie Elsa. Sie hatte Jura studiert und war nun Assistentin eines Rechtsassessors. Vielleicht würde sie sogar selbst einer werden, oder eine.
Elsa hielt die Luft an und tauchte mit dem Kopf unter Wasser. Endlich Abkühlung. Seit sie die Haare kürzer trug, musste sie nicht mehr so viel Rücksicht auf ihre Frisur nehmen. Sie fühlte sich frei und ungebunden, ließ sich vom Wasser tragen und konnte sich fast mühelos fortbewegen, als schwebte sie dahin.
Nach einer kurzen Rast am anderen Ufer schwamm sie zurück. Als sie das Badehaus fast erreicht hatte, sah sie eine Frau ins Wasser steigen. Sie hatte dickes schwarzes Haar und trug eine bis zum Knie reichende Hose mit Gummizug, dazu ein schlichtes Unterhemd ohne Corsage. Das Wasser ging ihr schon bis zur Hüfte, doch das schien sie nicht zu stören. Sie hatte ein Lächeln auf den Lippen, und ihr ganzer Körper schien dem Sonnenlicht entgegenzustrahlen, das sich auf der Wasseroberfläche brach. Plötzlich verschwand ihr Kopf für Sekunden von der Wasseroberfläche, um kurz darauf wieder aufzutauchen. Sie schnappte nach Luft und ging wieder unter. Elsa schwamm schneller. Nach einigen harten Zügen war sie bei ihr und bekam ein Stück ihres Unterhemds zu fassen. Sie zog an dem Leinenstoff und spürte, wie eine Hand nach ihr griff und sich mit aller Kraft an sie klammerte. Fast zog sie Elsa mit sich unter Wasser. Elsa hörte, dass ihnen jemand etwas zurief, doch keiner kam ihnen zu Hilfe. Sie kämpfte, um den Kopf über Wasser zu behalten. Es mochten nur drei, vier Züge sein, bis sie wieder stehen konnte. Elsa zog mit Gewalt ihren Arm aus der Umklammerung, griff nach dem dunklen Schopf der Frau und zog sie mit sich. Mit dem anderen Arm ruderte sie mit letzter Kraft Richtung Ufer. So schaffte Elsa zwei Züge, dann spürte sie, wie fremde Hände nach ihr griffen und sie ans Ufer zogen. Sie hustete, schnappte nach Luft, hustete wieder. Erschöpft lagen sie beide auf der Wiese. Jemand legte der Frau mit dem Zopf ein Handtuch um die Schultern, fragte, ob alles in Ordnung sei. »Ja danke, ich lebe noch«, hörte Elsa sie mit einem fremden Akzent sagen, »nur hätte ich jetzt gern etwas anderes zu trinken als Wasser.« Sie drehte sich zu Elsa, rang nach Luft, grinste aber wie nach einem gelungenen Streich.
»Wieso gehen Sie ins tiefe Wasser, wenn Sie nicht schwimmen können?« Auch Elsa japste.
»Oh, ich dachte, vielleicht könnte ich es auf diese Weise endlich lernen.« Ihre Schultern hoben und senkten sich schwer beim Atmen, aber sie lächelte immer noch. Nach einigen Sekunden sagte sie: »Vielen Dank übrigens. Ich heiße Sarah. Sarah Rabinowitz.«
»Elsa Randlkofer.«
»Sie sind keine Schweizerin«, stellte Sarah fest.
»Sie auch nicht«, antwortete Elsa.
»Ich bin Russin.«
»Was machen Sie hier in St. Gallen?«
»Ich bin auf der Durchreise und komme von Bern, wo ich an der Universität eingeschrieben war. Und Sie?«
»Ich arbeite in St. Gallen.«
»Ja? Was machen Sie?«
»Wollen Sie sich nicht lieber umziehen? Ihre Unterwäsche muss ja bleischwer sein. Wahrscheinlich hat sie Sie runtergezogen.« Sarahs Haut war sehr hell, fast durchscheinend.
Sarah stützte sich auf die Ellbogen und drückte sich das Wasser aus dem Haar. »Haben Sie mir gerade das Leben gerettet?«, fragte sie, als käme ihr der Gedanke, dass sie beinahe ertrunken wäre, erst jetzt.
»Sie sind jedenfalls die erste Nichtschwimmerin, die ich am Zopf aus dem Wasser gezogen habe.«
Sarah Rabinowitz lächelte schon wieder und zeigte dabei zwei hübsche Grübchen.
»Dann müsste ich Sie jetzt zumindest zu einem Wodka einladen, aber ich weiß gar nicht, ob es hier so etwas gibt.« Sarah sah sich um. »Sie sind doch noch da, wenn ich mich umgezogen habe?« Sie musterte Elsa. »Einen wunderbaren Badeanzug haben Sie an. Wo bekommt man so etwas?« Noch bevor Elsa antworten konnte, winkte die andere ab. »Ach, ich könnte ihn mir ja doch nicht leisten. So ein Luxus, wo ich noch nicht einmal schwimmen kann.«
»Ich könnte es Ihnen beibringen.«
»Das würden Sie tun?«, fragte Sarah. »Wie schade, dass ich morgen schon in der Eisenbahn nach Wien sitzen werde. Ich hätte gerne bei Ihnen schwimmen gelernt.«
Elsa zuckte die Achseln. »Vielleicht kommen Sie ja irgendwann wieder.«
»Tja, wer weiß. Woher kommen Sie?«
»Aus München.«
»Sind Sie verheiratet?«
»Nein, Sie?«, fragte Elsa zurück.
»Nein, ich habe keinen Mann. Nur einen Freund, der mich hierhergebracht hat, aber ich durfte ja nicht mit ihm in diesen Mannenweiher hinein. Die Schweizer sind schon komisch. Sie lassen uns in die Universitäten, aber zum Baden brauchen wir einen eigenen See.«
»Immerhin haben wir einen. Und das Frauenbadi ist doch sowieso der schönste von den drei Weihern«, meinte Elsa.
»Ich weiß schon, dass es um unsere Haut geht, die man im Badekostüm sehen kann.« Sarahs Grübchen waren wieder da, und sie waren einfach entzückend anzusehen. »Wie lange wird es wohl noch dauern, bis Frauen und Männer in dasselbe Bad steigen dürfen? Und zwar nicht in diesen langen Kleidern, die uns ins Wasser hinunterziehen.«
»Ich finde, zuerst sollten wir alle schwimmen lernen«, meinte Elsa nüchtern.
»Da haben Sie recht. Aber heute habe ich die Gelegenheit verpasst. Sie warten doch, bis ich mich umgezogen habe? Ich möchte meinem Freund Alexej gern meine Retterin vorstellen. Würden Sie mir die Freude machen?«
Wer kann diesen Grübchen schon widerstehen, dachte Elsa und ging mit Sarah zum Badehaus, um sich anzuziehen.
Sie liefen auf dem Panoramaweg zurück. Von hier konnte man die Segelboote auf dem Bodensee erkennen. Sie sahen aus wie weiße Fähnchen, die über das Wasser gezogen wurden. Nach Westen zu nahm der See überhaupt kein Ende. Sie kamen an der Linde vorbei, die sie im Mai hier gepflanzt hatten. Sarah blieb stehen.
»Sehen Sie mal«, sagte sie. »Dieses kleine Stämmchen hat eine mächtige Gedenktafel erhalten. Da muss es sich aber anstrengen, dass es irgendwann ein großer Baum wird, der seiner Tafel würdig ist. Was steht denn da?«
»Schillerlinde – Gepflanzt von der dankbaren Jugend, 9. Mai 1905«, antwortete Elsa, und dazu musste sie nicht einmal hinsehen.
»Ah, Sie waren dabei bei der dankbaren Jugend?«
Elsa nickte. »Wir haben sie zu Schillers hundertstem Todestag gepflanzt.«
»Ach ja, der deutsche Freiheitsdichter«, seufzte Sarah, »und Gegner der Französischen Revolution. Er setzte ganz auf die Vernunft und war gegen Gewalt.«
»Ist daran irgendetwas falsch?«, fragte Elsa.
»Revolutionen sind ohne vorübergehende Gewalt nicht möglich«, antwortete die Russin ernst.
Gewalt? Als Juristin hatte Elsa gelernt, dass sie nur vom Staat und seinen Organen ausgehen durfte.
»Haben Sie vom Petersburger Blutsonntag gehört, hier in Ihrem friedlichen, reichen St. Gallen?«
Elsa nickte. Das musste Anfang des Jahres, irgendwann im Januar gewesen sein. Es hatte in Sankt Petersburg Aufstände und Demonstrationen gegen den Zaren gegeben. »Ich habe es in der Zeitung gelesen.«
»Ich war dabei«, sagte Sarah. »Ich habe gesehen und gehört, wie die Soldaten gegen uns geritten sind und auf uns geschossen haben. Und wir waren alle friedlich und unbewaffnet. Finden Sie nicht, dass so ein gewaltloser Protest möglich sein muss?« Ihre Grübchen verschwanden, wenn es ernst wurde.
»Wieso waren Sie dort, wenn Sie doch in Bern immatrikuliert waren?«
»Ich bin da, wo man mich braucht«, sagte sie, aber Elsa verstand nicht genau, was Sarah meinte. Doch dann gab Sarah sich einen Ruck und nahm Elsas Hand, als seien sie Freundinnen seit Kindertagen.
»Kommen Sie, jetzt laufen wir zu den Mannen, und ich stelle Ihnen Alexej vor. Wehe, er hat keine Räppli in der Tasche für meine Lebensretterin. Und sagen Sie jetzt nicht, dass Sie selbst Geld haben, bitte. Ich stehe in Ihrer Schuld und muss zahlen. Oder Alexej. Jedenfalls wird heute ein Russe bezahlen.«
»Wie alt sind Sie?«, fragte Elsa, die Sarahs Hand in ihrer spürte. Warm fühlte es sich an und fast schon etwas vertraut.
»Dreiundzwanzig. Und Sie?«
»Auch dreiundzwanzig«, antwortete Elsa, aber sie fühlte sich im Vergleich mit Sarah jünger und unerfahrener. Nie hatte sie an irgendetwas Besonderem teilgenommen, das über ihre eigene Person und das persönliche Umfeld hinausging. »War Alexej auch dabei?«, fragte sie.
»Wobei?«
»In Sankt Petersburg, bei den Aufständen.«
»Ja. Wir Russen reisen gerade viel herum in ganz Europa. Wenn die Heimat ruft, dann machen wir uns eben auf den Weg.«
Unter ihnen lag nun der Mannenweiher mit seinem weiß und grün gestrichenen Badehaus und dem Milchhüttli zur Versorgung der Gäste. Sarah hielt nach ihrem Freund Ausschau.
»Und was werden Sie in Russland tun? Sie sagten doch, Sie seien auf der Durchreise.«
Sarahs Grübchen lächelten wieder. »Ich werde Kinder unterrichten, denn ich habe ein Diplom als Lehrerin«, sagte sie, steckte sich dann wie ein Kutscher zwei Finger in den Mund und ließ einen schrillen Pfiff ertönen.
Elsa sah sie entsetzt an.
»Was ist, Lebensretterin?«, fragte Sarah. »Wenn sie uns hier schon nicht reinlassen, weil wir Röcke tragen, dann muss ich meinen Freund ja wohl anders auf uns aufmerksam machen, oder? Sie zwingen mich doch dazu, mich schlecht zu benehmen. Aber das macht mir nichts aus. Obwohl ich natürlich schon lieber dort reingehen und mir diese Mannen aus der Nähe ansehen würde.«
Elsa errötete. Das ganze Mannenbad starrte jetzt zu ihnen herauf, und Sarah warf die Arme in die Luft und winkte. Ein Mann mit kräftiger Statur und muskulösen Oberarmen, verwegen langem Haar und Vollbart winkte zurück und lief zum Badehaus. Elsa wäre am liebsten davongelaufen, so peinlich war ihr die ganze Sache allmählich. Als Alexej schließlich zu ihnen heraufgelaufen kam, musterte er Elsa so unverhohlen, dass sie am liebsten im Erdboden versunken wäre.
»Alexej Droschin.« Er streckte ihr seine Hand entgegen.
»Elsa Randlkofer.« Sie zwang sich, ihm in die Augen zu sehen, die unentschieden braun und blau zugleich waren.
»Sie hat mir das Leben gerettet, Alexej«, sagte Sarah und erzählte ihm, was passiert war.
»Was machst du bloß für Sachen? Sonst so klug, aber manchmal bist du dumm wie Stroh, Sarah. Ich danke Ihnen jedenfalls, Elsa.«
Sie gingen ins Café an der Bergstation der Mühleggbahn und bestellten drei Kräuterbitter, denn Wodka gab es keinen. Als Sarah sich kurz frisch machte, sah Alexej Elsa aus seinen zweifarbigen Augen eindringlich an, dann betrachtete er ihre Hände, bis sie zu kribbeln anfingen.
»Sie sind nicht verheiratet, Fräulein Elsa?«
Elsa schüttelte den Kopf. »Mögen Sie keine Männer?«
»Nicht alle«, erwiderte sie, »aber einige schon. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, welchen ich nehmen soll.«
»Dann nehmen Sie mich«, sagte Alexej, und sein Lächeln und diese Lippen, die sich dabei ganz fein kräuselten, jagten ihr eine Hitzewelle durch den Körper. »Ich liebe starke Frauen. Sie sind eine Heldin, und ein Schnaps ist nicht genug, Ihnen zu danken.«
»Aber mich zu heiraten wäre dann doch ein bisschen zu viel, finden Sie nicht?«
»Du sollst fremde junge Damen nicht so anstarren, Alexej«, bemerkte Sarah, als sie zum Tisch zurückkam. »Du benimmst dich wie ein russischer Bauer.«
»Hoch lebe der russische Bauer«, rief Alexej, »nieder mit dem Zaren!«
Erschrocken sah Elsa sich um, aber es waren nur wenige Tische besetzt, und niemand schien von ihnen Notiz zu nehmen. Sie war froh, als Alexej bezahlte und sie das Lokal verließen.
»Ich befürchte, jetzt müssen wir zu Fuß gehen. Ich habe mein letztes Schweizer Geld ausgegeben«, sagte Alexej, und Elsa war heilfroh, nicht mit den beiden in der Bahn fahren zu müssen. Nicht dass sie noch ehemalige Mitschüler vom Institut am Rosenberg oder Mandanten aus ihrer Kanzlei träfe. Am Ende waren diese beiden, die sich um Konventionen nicht allzu viel scherten, tatsächlich russische Revolutionäre. Wie Spione sahen sie nicht aus, aber was wusste sie schon von Spionen.
»Vielleicht sehen wir uns einmal in München, später irgendwann«, sagte Sarah zum Abschied. »Sie wissen doch, dass wir jetzt auf immer miteinander verbunden sind, Elsa?«
»Wie Blutsschwestern«, sagte Alexej.
Sarah drückte sie an sich und gab ihr einen Kuss auf den Mund. Und bevor Alexej noch auf die Idee kommen konnte, dasselbe zu tun, reichte Elsa ihm die Hand, sagte »Auf Wiedersehen« und ging davon.
Sie hörte, wie Alexej ihr ein »Doswidanja« nachrief, aber sie drehte sich nicht mehr um. Erst als sie schon in sicherer Entfernung war, rief sie den beiden hinterher. »Wenn Sie nach München kommen, meine Mutter hat ein Delikatessengeschäft in der Dienerstraße, gleich hinter dem Marienplatz. Es heißt Dallmayr.«
Elsa winkte noch ein letztes Mal, dann bog sie in die nächste Seitengasse und atmete einmal tief durch.
***
Die Telefonistin mit der Stupsnase und den roten Haaren hatte auch schon am Nachmittag im Telegrafenamt in der Luisenstraße gesessen. Paul erinnerte sich genau an sie, und sie offenbar auch an ihn.
»Immer noch im Dienst?«, begrüßte er sie vielleicht zu sehr wie eine alte Bekannte.
»Und Sie, wieder ein Gespräch nach München?«
Sie erinnerte sich also tatsächlich. Paul nickte.
»Wahrscheinlich wartet dort Ihre Braut schon sehnsüchtig auf Sie, stimmt’s?« Sie grinste.
»Schön wär’s«, meinte Paul. »Es ist aber leider nur die Buchhalterin unserer Firma.«
»Dann ist sie also um diese Uhrzeit auch noch im Dienst, die Arme. Und wenn es Ihre Firma ist, dann sind Sie bestimmt ein Kapitalist und gemeiner Ausbeuter«, behauptete sie und ließ ihm keine Zeit für eine Antwort. »Sie können gleich an den ersten Apparat gehen.«
Ein offener Apparat mit einer Trennwand, glücklicherweise keine Zelle mit abgestandener heißer Luft. Paul ging an die erste Säule mit den beiden Sprechapparaten rechts und links, drehte die Induktionskurbel per Hand und gab, als er dazu aufgefordert wurde, den Namen des Teilnehmers in München und die Telefonnummer an. Dann dauerte es bestimmt zwei, drei Minuten, bis das rothaarige Fräulein die Verbindung hergestellt und die Leitung freigeschaltet hatte. Zwei Minuten nach acht Uhr klingelte bei Rosa im Kontor das Telefon.
»Und, ist dir was eingefallen, Rosa?«, fragte Paul.
»Tja, ich glaube, es reicht nicht, dass wir das Geld auftreiben, das da bei dir in der Firma unterschlagen wurde«, antwortete Rosa.
Paul hörte vor allem dieses tröstliche »Wir« und klammerte sich erst einmal daran.
»Wir müssen den Schuldigen finden. Also brauchen wir noch mehr Geld«, behauptete Rosa.
»Noch mehr? Wieso denn jetzt das?«