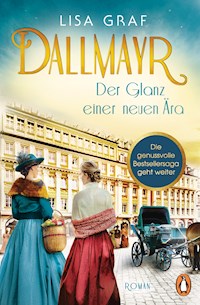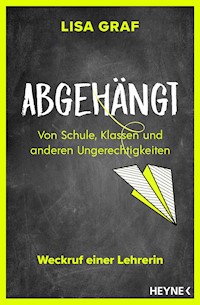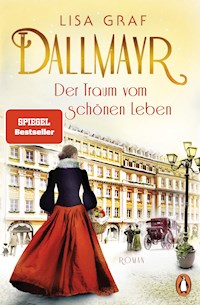5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine Technologie, die alles verändern wird: Der internationale Thriller »Die Bitcoin-Morde« von Lisa Graf und Ottmar Neuburger als eBook bei dotbooks. »Kill Satoshi Nakamoto!« Der Berliner Barkeeper Noah wird bei der Arbeit durch Zufall Zeuge, wie ein schattenhafter Mann einen Mordbefehl an dem legendären Erfinder des Bitcoin-Codes ausspricht. Ohne es zu wollen, wird er in eine Welt von Macht, Spionage und unermesslichem Reichtum gezogen – eine Welt, in der zu viel Wissen mit dem Tod bestraft wird … Eine atemlose Hetzjagd um den Globus beginnt, die den jungen Mann von Berlin über Rom bis nach Jerusalem führt. Wird es Noah gelingen, eine Verschwörung aufzuhalten, die die Grundfesten der internationalen Finanzwelt für immer zerstören könnte – und damit die Fundamente unserer Zivilisation? »Ein atemberaubender Thriller, der nicht nur spannend geschrieben ist, sondern auch viele Denkanstöße gibt.« Journal Lesart Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der rasante Thriller »Die Bitcoin-Morde« von Lisa Graf und Ottmar Neuburger – so brisante Spannung wie von Andreas Eschbach, so geheimnisumwittert wie die Bestseller von Dan Brown! Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
»Kill Satoshi Nakamoto!« Der Berliner Barkeeper Noah wird bei der Arbeit durch Zufall Zeuge, wie ein schattenhafter Mann einen Mordbefehl an dem legendären Erfinder des Bitcoin-Codes ausspricht. Ohne es zu wollen, wird er in eine Welt von Macht, Spionage und unermesslichem Reichtum gezogen – eine Welt, in der zu viel Wissen mit dem Tod bestraft wird … Eine atemlose Hetzjagd um den Globus beginnt, die den jungen Mann von Berlin über Rom bis nach Jerusalem führt. Wird es Noah gelingen, eine Verschwörung aufzuhalten, die die Grundfesten der internationalen Finanzwelt für immer zerstören könnte – und damit die Fundamente unserer Zivilisation?
Über den Autor/Über die Autorin:
Lisa Graf, geboren in Passau, studierte Romanistik und Völkerkunde und ist Reisebuch- und Krimi-Autorin. Mit ihrer historischen Romanreihe über das Feinkost-Haus Dallmayr erreichte sie Spitzenplatzierungen auf der Spiegel-Bestsellerliste.
Ottmar Neuburger, geboren in Simbach am Inn, studierte Physik und Germanistik. Er war Programmierer und Systemberater und ist heute Software-Unternehmer, Spezialist für Kryptowährungen und entwickelte eine Kryptowährung auf Basis einer eigenen Blockchain.
Die beiden Autoren leben im Berchtesgadener Land und haben zusammen den Chiemsee-Krimi »Steckerlfisch« und den Thriller »Die Bitcoin-Morde« verfasst.
Die Website von Lisa Graf: graf-riemann.de/
Der Autor/die Autorin im Internet: www.facebook.com/XXXX
***
eBook-Neuausgabe Februar 2024
Dieses Buch erschien bereits 2018 unter dem Titel »Kill Mr Bitcoin« beim Emons Verlag
Copyright © der Originalausgabe 2018 Emons Verlag GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von AdobeStock/ana und shutterstock/AR Pictures
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-919-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Bitcoin-Morde«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lisa Graf & Ottmar Neuburger
Die Bitcoin-Morde
Thriller
dotbooks.
»Ich glaube, Bitcoin ist die erste [Kryptowährung] mit dem Potenzial, die Welt zu verändern.«
Peter Andreas Thiel,
Investor und Mitbegründer
von Paypal
»[Bitcoin ist] vom libertären Standpunkt aus sehr attraktiv,
wenn wir es nur richtig erklären können.
Aber ich kann besser mit Code
als mit Worten umgehen.«
Satoshi Nakamoto
(Pseudonym des Bitcoin-Erfinders),
14.11.2008
»Wenn du mir nicht glaubst oder es nicht verstehst,
dann habe ich leider keine Zeit, dich zu überzeugen.«
»Selbstzufriedener Sack.«
Satoshi Nakamotos Posting auf bitcointalk.org vom 29.7.2010 und die Antwort eines anderen Teilnehmers darauf
»Your old road is rapidly aging
Please get out of the new one if you can’t lend your hand
For the times they are a-changin’.«
Bob Dylan
Kapitel 1
Jerusalem, 30. Mai
Vor fünf Wochen hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich heute hier am Rabinovich Square stehen würde. Von der schwarzen Kuppel der al-Aqsa-Moschee bis zur großen Goldkuppel des Felsendoms erstreckt sich der Tempelberg in östlicher Richtung. Eine Etage über mir wird in einem Glasschrein ein riesiger siebenarmiger Leuchter verwahrt, der für den dritten Tempel in Jerusalem bestimmt ist. Einen Tempel, der wahrscheinlich niemals gebaut wird. Es gibt einen orthodoxen Rabbiner, der behauptet, dass gläubige Juden erst dann ihren Mund mit Gelächter füllen dürfen, wenn der dritte Tempel steht. Also nie. Das alles geht mir durch den Kopf, kriecht und stolpert in mich hinein, während ein Schuss den lauen Frühlingsabend zerfetzt und mein Freund, der eben noch neben mir saß, von der Bank rutscht und hart auf das Pflaster schlägt.
Morgen ist Sabbat, in Jerusalem werden keine Busse fahren, mit Ausnahme der arabischen, und die Aufzüge werden in jedem Stockwerk halten, damit gläubige Juden keinen Knopf drücken müssen, denn das ist am Sabbat verboten. Die orthodoxen Juden werden in Männergruppen oder Familienclans schwatzend durch das arabische Viertel der Altstadt zur Klagemauer ziehen, um zu beten. Die Männer mit Schläfenlocken, Bärten, langen schwarzen Mänteln und Fellhüten. Das Haar ihrer Frauen ist unter Perücken verborgen.
Ein Junge steht drei Meter neben mir, auf ein Mäuerchen gestützt, und betrachtet den Platz vor der Klagemauer, auf dem sich rechts die Frauen zum rituellen Händewaschen anstellen, links die Männer, die sich je einen Gebetsriemen um den Arm und um die Stirn binden. Einige junge Männer stehen in Gruppen zusammen um einen Tisch, beten und diskutieren miteinander. Andere berühren mit dem Oberkörper wippend fast die Mauer.
Der Junge kann noch nicht lange da stehen, ich habe sein Kommen nicht bemerkt. Unter seinem Hemd hängen dünne weiße Fransen über die dunkle Hose. Sie haben einen lustigen Namen, aber er fällt mir im Moment nicht ein. Die Bändchen sollen ihre Träger an die sechshundertdreizehn Gebote erinnern, die von den Gläubigen eingehalten werden müssen. Sechshundertdreizehn. Ist das nun zum Lachen oder zum Weinen? Ich weiß es nicht. Mir ist jedenfalls nicht zum Lachen, auch wenn die Situation so womöglich leichter zu ertragen wäre. Wobei, es gibt nichts mehr zu ertragen. Für ihn, meinen Freund, hat es sich erledigt. Und wie ich damit fertigwerden soll, weiß ich jetzt nicht. Es ist so viel passiert in den letzten Wochen.
Der Junge dreht langsam den Kopf, seine Kippa wandert von mir weg. Ich nehme lieber keinen Blickkontakt zu ihm auf. Ich will nicht, dass er auf mich aufmerksam wird, auf uns. Es ist so schon schlimm genug.
Wir saßen ganz nah zusammen auf dieser Bank und sahen uns in die Augen. So viele Jahre waren wir Freunde. Ich lebte in Kreuzberg, er in Friedrichshain, nur ein paar Straßen trennten uns, nicht mehr. Wenn mir vor fünf Wochen einer gesagt hätte, du wirst deine Liebe finden und sie wird dir wieder genommen werden. Du wirst einen Freund verlieren, zwei Mal. Erst durch Verrat und schließlich noch einmal, dann aber endgültig. Wenn mir vor fünf Wochen, als ich noch Barmann in Berlin war, einer gesagt hätte, ich werde nach Jerusalem gehen, um am Rabinovich Square einen Freund zu treffen, und während ich ihm in die Augen sehe, wird ein roter Punkt von einem Laserpointer auf seine Stirn flattern, nicht zwischen die Augen, sondern ein wenig darüber, ich hätte es für kompletten Schwachsinn gehalten. Nie und niemandem hätte ich geglaubt, dass mir passieren würde, was mir passiert ist, seit ich weg bin aus Berlin.
Kapitel 2
Berlin-Köpenick, 27 Tage zuvor
Dave sah durch die schmale Fensterluke im vorderen Turm der ehemaligen Fotochemie-Fabrik. Ihre roten Klinkergebäude standen auf der Landzunge zwischen Alter Spree und Müggelspree. Backsteinbauten und mehr als hundert Jahre alt. Das Besondere an dieser Industriebrache war ihre Lage. Die reichen Berliner waren verrückt nach Wohnungen am Wasser. Fluss- oder Seegrundstücke waren die Bestseller. Köpenick lag bis vor einigen Jahren noch jwd – janz weit draußen, dort, wo keiner hinwollte. Ehemaliger Osten. Aber jetzt war der Großteil der geplanten Wohnungen schon verkauft, obwohl der erste Bagger frühestens im kommenden Jahr anrücken würde.
Bis dahin mussten sie sich nach etwas Neuem umsehen. Noch krähte kein Hahn nach den paar Import-Export-Firmen, die hier ihren dubiosen, halblegalen oder illegalen Geschäften nachgingen. Das würde sowieso bald aufhören und sich von selbst erledigen, da lohnte der Aufwand nicht.
Daves Handy klingelte. Das war Ira.
»Na, wie ist die Lage?«, fragte sie.
»Er ist auf jeden Fall der Falsche. Wir können ihn wieder laufen lassen«, antwortete Dave.
»Moment«, sagte Ira. »Ich rufe den Major an und frage, was nun aus ihm werden soll.«
Dave wartete. Der zweite Anruf von Ira kam exakt eine Minute später.
»Bleib dort«, sagte sie. »Ich komme.«
»Wieso?«, fragte Dave. »Du wirst auch nichts anderes aus ihm herausbekommen als ich. Er ist nicht der, den wir suchen.«
»Jetzt warte doch mal ab. Du kennst meine Methoden.«
Dave ging nicht auf ihre »Methoden« ein. »Was hat der Major gesagt?«, fragte er stattdessen.
»Warte auf mich«, antwortete sie. »Ich bin gleich da.«
Dave wartete und sah zum Fenster hinaus. Es war immer noch Nacht, kein Streifen Morgenlicht am Horizont. Der Parkplatz wurde durch die Lampe über der Eingangstür des Gebäudes nur schwach beleuchtet. Das Außenlicht flackerte unruhig und fiel für Sekundenbruchteile ganz aus. Wann war ihm hier zum letzten Mal ein Bulle unter die Augen gekommen? Es war bestimmt schon sehr lange her. Da fiel auch Iras Porsche 911 Targa in Kackbraun, Baujahr 1975, niemandem auf. Bis vor einigen Jahren war sie tatsächlich in einer alten Pontiac-Bonneville-Limousine herumgekurvt, doch das hatten sie ihr irgendwann verboten. Zu auffällig. Aber der alte Porsche war durchgewinkt worden, als wäre er ganz und gar diskret.
Dave sah zu, wie der Wagen heranrollte, die kugelrunden Scheinwerfer ausgingen, die Wagentür geöffnet wurde und Ira mit ihren elend langen Beinen aus dem Auto sprang. Sie war groß und knabenhaft schmal. Ihr Gang dynamisch, fast zackig und irgendwie militärisch. Eine von diesen superfitten Joggerinnen, die selbst ohne ihr Sportprogramm nie zunahmen. Ira ging um den Porsche herum, öffnete den Kofferraum und nahm zwei Koffer heraus. Sie enthielten ihr übliches Werkzeug.
Jetzt sah sie nach oben und entdeckte ihn am Fenster. Sie gab sich keine Mühe, ein Lächeln zustande zu bringen oder irgendein anderes Zeichen, das man als Gruß hätte interpretieren können. Und er zeigte ebenfalls keine Reaktion. Wurde auch Zeit, dass sie anrückte. Für die Drecksarbeit war er nicht zuständig. Verhöre ja, aber damit hatte es sich. Gewalt war nicht sein Metier. Bei Ira sah es auf den ersten Blick auch so aus, als mache sie sich nichts aus Gewalt. Aber das täuschte. Auf Ira war Verlass. Sie war durch und durch Profi, kannte kein Zaudern und hatte sich noch nie vor einer Anweisung gedrückt oder es in Erwägung gezogen.
Insgeheim beneidete er Menschen wie Ira, die einfach funktionierten und sich keinen Kopf machten. Sie hatten es in seinen Augen leichter im Leben. Und doch hatte er Ira in Verdacht, dass es ihr Spaß machte, Leute zu quälen, auch wenn sie so tat, als wäre sie hier nur der Klempner, der kam, um die Heizung zu reparieren. Sobald Ira oben war, würde er abhauen. Genau wie immer.
Er schlüpfte in seinen Trenchcoat. Während er darauf wartete, dass Ira mit ihren beiden Koffern heraufkam, warf er noch einen Blick auf den Gefangenen. Trotz seiner Kapuze, mit der er aussah wie einer dieser Iraker in Abu Ghraib, obwohl sonst alles mit ihm in Ordnung war – kein Dreck, kein Blut, Gott bewahre –, warf er jetzt den Kopf unruhig hin und her. »Mister«, flüsterte er. »Mister.« Doch Dave gab ihm keine Antwort. Der schmächtige Japaner tat ihm leid. Aber Daves Mitleid würde ihm auch nichts helfen. Er hatte getan, was man von ihm verlangte. Jetzt war Ira an der Reihe.
Tock, tock, Pause, dann folgten weitere Klopfzeichen. Beim vierten öffnete Dave die Stahltür und hob die Hand zu einem wortlosen Gruß, Ira nickte ihm zu, ging zum Tisch und legte die beiden Koffer darauf ab. Sie trug eine schwarze Jeans, Länge sechsunddreißig, und braune Sneakers. Mit ihren kurzen Haaren sah sie von hinten aus wie ein Kerl. Dave fragte sich nicht zum ersten Mal, ob sie in ihrer Freizeit auch so burschikos rumlief und ob sie wohl auf Frauen stand.
Der Gefangene schien zu spüren, dass die eingetretene Veränderung nichts Gutes bedeutete, denn er ruckelte hektisch auf dem Stuhl herum. Sobald Ira den Verschluss des ersten Koffers aufspringen ließ, würde er ganz sicher wieder anfangen zu wimmern und zu betteln, sie sollten ihn gehen lassen.
»Was hat der Major gesagt?«, fragte Dave noch einmal.
»Dass ich übernehmen soll.«
»Aber das ist einfach irgendein Japaner mit einem gar nicht so ungewöhnlichen japanischen Namen«, behauptete Dave.
»Du meinst, er ist nicht unser Mr Bitcoin?«
»Nein, das ist er sicher nicht.«
»Befehl ist Befehl, Dave, das muss ich dir doch nicht erklären. Oder doch?« Ira sah ihn prüfend an.
Da war er wieder, dieser nahtlose Übergang von kaltblütiger Professionalität zu etwas anderem, dachte Dave. Er zog den Gürtel seines Trenchcoats enger und verließ den Raum. Nur keine Sentimentalitäten. Sie konnten ihn teuer zu stehen kommen. Aber ja, eindeutig: Der Kerl tat ihm leid. Und er war definitiv der Falsche.
Die schwere Stahltür und der Widerhall seiner Ledersohlen auf dem Steinboden im Treppenhaus verhinderten, dass er hören konnte, welche Methode Ira heute für den Anfang ausgewählt hatte. Nur wie ganz weit entfernt drang ein gleichmäßig surrendes Geräusch an sein Ohr, das aber auch aus einem anderen Teil der Fabrik, vielleicht sogar aus einem anderen Gebäude auf dem weiten Gelände am Fluss kommen konnte. Es war der Lärm einer Bohrmaschine, die mit maximaler Geschwindigkeit, aber noch ohne Widerstand lief. Schreie, erst recht solche, die Ira mit Hilfe eines Knebels im Keim erstickte, würden im Treppenhaus nicht zu hören sein. Das hier war nicht Bagdad, sondern Berlin-Ost.
Dave trat aus dem Gebäude und blieb einen Moment stehen. Die Tür fiel hinter ihm zu. Die Leuchtstoffröhre in der Außenlampe über dem Eingang setzte alle drei Sekunden für den Bruchteil einer Sekunde aus. Ein beunruhigender Rhythmus. Er schlug den Mantelkragen hoch. Der endlos lange Berliner Winter mit seinem schneidenden Eiswind verzog sich nur widerwillig nach Osten. Vom Frühling lag nicht mehr als eine Ahnung oder nur ein schwacher Wunsch in der Luft. Wieder musste er an den Japaner denken, der nicht der war, nach dem sie fieberhaft suchten. Er hatte sich verboten, »armer Teufel« zu denken, wenn er an ihn dachte, und tat es jetzt doch. Dann gab er sich einen Ruck, stieg die Treppe hinunter und schlenderte an Iras braunem Porsche Targa entlang.
Wieso hatte eigentlich noch nie einer mit dem Schlüssel die Seite ihres Wagens zerkratzt? Weil dieses Auto irgendwie Kult war und sogar den bescheuerten Schlüsselkratzern Respekt einflößte? Er fuhr mit der Daumenkuppe über seinen Hausschlüssel in der Manteltasche. Hin und her. Dann lief er hinauf zur Friedrichshagener Straße. Vielleicht fuhren um diese Zeit die Busse nach Köpenick schon. Wenn nicht, konnte er immer noch ein Taxi nehmen.
Er wartete eine Viertelstunde auf den ersten Bus. Als er kam, setzte er sich auf einen Platz ganz hinten, zog sein russisches Prepaid-Handy aus der Manteltasche und rief die Bullen an.
»In einem der Gebäude der ehemaligen VEB Fotochemische Werke Köpenick an der Müggelspree ...«, sagte er.
Der Beamte in der Telefonleitstelle wartete. »Ja und? Was soll dort sein?«, fragte er schließlich.
Dave zögerte.
»Sprechen Sie doch weiter. Hallo! Wer spricht da? Wo sind Sie denn? Dort draußen in Köpenick, bei diesem Werk?«
Keine Antwort.
»Hallo! Sind Sie noch dran?«
Dann beendete Dave das Gespräch. Er zwang sich, nicht mehr an Ira und den Mann dort oben im Turm zu denken. Als er in Köpenick am S-Bahnhof ausstieg, zählte er seine Schritte auf dem Pflaster. Bei jedem siebten machte er einen Wechselschritt. Dave suchte den Horizont nach dem Schein des Sonnenaufgangs ab, doch die Lichter der Großstadt waren überall, und sie waren stärker als der schwache Schein des neuen Morgens.
Kapitel 3
Berlin-Friedrichshain, 2. Mai
Ständig quietscht der Barhocker, auf dem Joe sitzt. Er schafft es einfach nicht, sich ruhig zu halten. Julia und Joe haben eine hitzige Diskussion. Julia behauptet, dass das Weltall unendlich sei und daher alles ständig und unendlich oft passiere. Denn wegen der im Weltall unendlich vorhandenen Atome gebe es alle möglichen Kombinationen unendlich oft. »Das ist ein mathematisches Gesetz«, sagt sie. Dagegen behauptet Joe, dass es nichts, aber auch gar nichts gebe, zumindest nicht in unserer Welt, und dass wir alle nur Informationen einer perfiden Simulation auf einer gigantischen Festplatte seien. Den ganzen Abend geht das nun schon so, und gerade sieht es danach aus, als könnten sie sich heute wieder einmal nicht einigen, ob sie anschließend lieber zu Julia oder zu Joe gehen. Ich verstehe Julia nicht, denn hier in der Bar weiß jeder, dass Joes Dusche seit vier Wochen kaputt ist.
Ohne zu fragen, stelle ich Joe noch einen Flying Hirsch auf den Tisch. Julia nippt am Glas und schüttelt sich. »Wie du so was trinken kannst.«
Joe hat vor einigen Jahren einen Orden gegründet, den »Orden der heiligen Festplatte«. Natürlich hat er einen Knall, aber ganz von der Hand weisen kann man seine Vorstellung über das Sein auch nicht. Trotzdem vermeide ich es, mit ihm zu diskutieren, denn selbst wenn er recht haben sollte, ist jedes Gespräch mit ihm darüber zu ermüdend. Außerdem bin ich Agnostiker.
Seit ich Julia kenne, ist sie Aktivistin. Womit genau sie ihr Geld verdient, weiß ich nicht. Einige behaupten, sie sei früher Model gewesen, doch davon sieht man gar nichts. Ich finde, sie ist viel zu schön, um als Model gearbeitet zu haben. Zurzeit engagiert sie sich dafür, dass Yoga im Vorschulalter gelehrt und der Dalai-Lama endlich aus chinesischer Haft entlassen wird. Als ich ihr sagte, dass der Dalai-Lama in Indien lebe und gar nicht in chinesischer Haft sei, sah sie mich an, als wäre ich blöd wie zehn Meter Feldweg. »Von dir hätte ich nicht erwartet, dass du auf diese chinesische Propaganda hereinfällst«, sagte sie.
Momentan ist Joe etwas im Vorteil, denn Julia ist kurz eingenickt und hat im Halbschlaf bestätigt, dass es doch sein könnte, dass wir nur dächten, dass wir seien. Denn wenn wir ein Computerprogramm wären, das so programmiert ist, dass es denkt, ein Mensch zu sein und Dinge zu sehen, zu fühlen, zu hören und zu spüren, die in Wirklichkeit nur andere Programme sind, also beispielsweise ein Computerprogramm, das sich für Programme, die sich für Menschen halten, wie ein Tisch verhält, dann gäbe es in unserer Welt überhaupt keine Atome, sondern nur Programme, die sich wie Atome verhalten. Und in Wirklichkeit gäbe es dann unsere Welt gar nicht, sondern nur die Welt, in der wir Informationen auf einer Festplatte sind. Julia kommt wieder zu sich.
»Und was ist dann mit unseren Festplatten?«, fragt sie.
»Das sind natürlich nur Programme, die sich so verhalten, als wären sie Festplatten, ist doch logisch«, sagt Joe.
»Du hast doch einen an der Klatsche.« Julia gibt mir ein Zeichen, dass sie zahlen möchte.
»Kannst du für mich mitbezahlen?«, fragt Joe. »Ich habe mein Geld vergessen.«
Julia bezahlt für Joe mit, zieht dabei jedoch eine Grimasse, um klarzumachen, dass sie das beschissen findet. Keine Ahnung, ob sie nun zu Julia oder zu Joe gehen. Ist mir auch egal. Endlich kann ich den Laden dichtmachen und muss mir nicht noch mehr von diesen abstrusen Theorien anhören. Mich würde wirklich interessieren, woher Julia ihre Kohle hat.
Es beginnt schon, hell zu werden, als ich endlich abschließe und nach Hause gehe. Die Laterne von gegenüber spiegelt sich im regennassen Asphalt. Autos stehen an den Straßenrändern. Ein absolutes Rätsel, wie sie die Abwrackprämie überleben konnten. Eine der Rostlauben verliert Öl, und ein in Blautönen schillerndes Band zieht sich zur Straßenmitte. Von Zeit zu Zeit wird das Blau vom Rot einer flackernden Hotelreklame überlagert, und ich denke, für mich wird es Zeit, etwas ganz anderes zu tun. Es hat nichts mit Joes Festplatte zu tun und auch nicht mit der Geschichte, dass alles, was möglich ist, sowieso passiert. Zumindest denke ich das, denn ich glaube nicht an diese Welterklärungen. Aber selbst das ist falsch. Ich denke nicht einmal darüber nach, ob ich an diese Welterklärungen glaube, ich denke nur, dass es eben Zeit für mich ist, etwas anderes zu tun.
Ich krame in meinen Taschen nach dem Wohnungsschlüssel und merke, dass die Jacke, die ich anhabe, nicht mir gehört. Die Taschen sind leer, nur ein benutztes Papiertaschentuch kann ich ertasten. Reflexartig ziehe ich die Hand aus der Jackentasche. Irgendwann musste es passieren. Joe hat die gleiche Jacke wie ich. Er rennt jetzt mit meiner Jacke durch die Stadt. Noch ein Grund mehr, endlich etwas anderes zu tun.
Meine Wohnung ist im dritten Stock, Licht brennt, und das Fenster ist geöffnet. Dabei schließe ich immer mein Fenster, und das Licht war definitiv aus, als ich in die Bar gegangen bin. Die Haustür ist geschlossen. Ich sehe Schatten in meiner Wohnung und überlege, ob ich klingeln soll. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wer in meiner Wohnung sein könnte. Da höre ich ein Stöhnen. Soll ich die Polizei rufen? Nein, lieber nicht. Man weiß ja nie, ob man nicht zufällig auf irgendeiner Fahndungsliste steht. Seit die Bullen einen Computer halbwegs bedienen können, habe ich immer das Bedürfnis, um alles, was uniformiert ist, einen Bogen zu machen. Klick. Es geht verdammt schnell, dass Handschellen sich um die Gelenke legen und zuschnappen, und dann braucht man eine Ewigkeit, ihnen zu beweisen, dass man nichts ausgefressen hat und in Wirklichkeit nur eine Verwechslung vorliegt. Wenn überhaupt eine Verwechslung vorliegt, denn woher bitte soll man genau wissen, was alles verboten ist?
Wieder höre ich ein Stöhnen. Es beginnt rhythmisch zu werden. Ahh, ahh, ahh. Eine Frauenstimme. Jetzt wird mir klar, was los ist. Joe hat bemerkt, dass es meine Jacke war, die er angezogen hat, und sie konnten sich wie üblich nicht einigen, ob sie zu ihm oder zu ihr gehen sollen. Da kam ihm die Verwechslung gerade recht, besonders, weil in meiner Wohnung die Dusche funktioniert. Ich latsche auf und ab, kann mich aber nicht entschließen, zu klingeln. Ich denke, dass es ja nicht ewig dauern kann, aber immer wieder fängt Julia zu stöhnen an, und ich verstehe langsam, was sie an Joe schätzt.
Endlich sehe ich, wie Joe sich aus dem Fenster lehnt und eine Zigarette anzündet. Ich rufe ihm zu, er soll mich reinlassen. Der Türöffner summt. Aus einer alten Gewohnheit heraus drücke ich auf den Knopf am Aufzug, gehe aber weiter, ohne abzuwarten, ob der Aufzug reagiert, denn er ist seit Wochen kaputt. Es fällt mir nur immer erst dann ein, wenn ich bereits gedrückt habe. Ich bin schon am ersten Treppenabsatz, als ich kapiere, dass das Summen vom Aufzug stammt und er aus einem unerfindlichen Grund wieder läuft. Als ich in meiner Wohnung ankomme, höre ich Duschgeräusche aus dem Badezimmer. Joe steht immer noch am Fenster und raucht seine Zigarette.
»Hallo, Noah, ich habe unsere Jacken verwechselt.«
»Die Wohnungen anscheinend auch, diese hier ist nämlich meine.«
»Ach ja, ich dachte, ich warte hier gleich auf dich, damit ich dir deine Jacke zurückgeben kann.«
»Und weil hier die Dusche funktioniert, stimmt’s?«, frage ich, weil das unverkennbare Geräusch des herabprasselnden Wassers an meine Ohren dringt.
»Ach so, ja, das ist Julia. Ich dusche zu Hause, ist doch klar, oder?«
»Deine Dusche ist doch kaputt.«
»Stimmt, hab ich ganz vergessen. Aber morgen kommt der Klempner.«
Ich bin hundemüde, mein Kopf brummt, und ich habe keine Lust auf Diskussionen, Entschuldigungen, blöde Geschichten. Ich will nur noch meine Zähne putzen und dann ins Bett. Als ich das Bad betrete, schlägt mir eine Dampfwolke entgegen, so als wäre ein türkischer Hamam mein neuer Untermieter.
Es riecht edel, nach einer Mixtur aus Zitronenöl, Maiglöckchen und Melisse, so wie ich mir in etwa den Geruch vorstelle, wenn jemand auf die Idee käme, meine drei teuersten Duschbäder zu mischen, auf die Haut aufzutragen und dann mit dem heißen Wasserstrahl abzuspülen.
Als ich genervt die Tür etwas zu laut hinter mir schließe, höre ich, wie Julia »Joe, komm und besorg’s mir unter der Dusche« ruft.
Mein Blick fällt auf den Fliesenboden, der mir immer noch gut gefällt. Schwarz-weiß, wie ein Schachbrett. Auf den schwarzen Fliesen ist jetzt ein nasser Fußabdruck zu erkennen. Besser gesagt der Abdruck einer Fußspitze. Mit genau sechs Zehen. Ich presse meine Augen zusammen, reiße sie wieder auf. Es bleibt dabei: sechs und keiner mehr oder weniger. Ich denke, vielleicht ist Julia doch kein Model, sondern ein Alien. Mir fällt eine skurrile Tierschau ein, in der ich als Kind gewesen war. Am meisten beeindruckt hatte mich ein Kalb mit sechs Beinen in einem riesigen Aquarium mit Formaldehyd. Ich fand damals, dass das Kalb aussah wie der Agip-Hund. Julia ist wahrscheinlich zwischendurch mal aus der Dusche rausgegangen aufs Klo, ohne sich abzutrocknen. Ganz sicher sogar, denn nicht nur der Boden, auch die Klobrille ist nass.
»Ich bin nicht Joe, der ist draußen und besorgt es gerade einer Zigarette«, gebe ich mich zu erkennen, bevor es zu weiteren Peinlichkeiten kommt. »Ich bin Noah. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe und noch weniger akzeptiere, stehst du unter meiner Dusche, verbrauchst mein Duschgel und Shampoo, mein heißes Wasser und meine Luft. Ich habe heute achtzehn Stunden gearbeitet und möchte nur noch meine Ruhe und schlafen, verstehst du?« Auf diese Weise versuche ich ihr einzuschärfen, dass sie erstens leise sein und zweitens schnellstmöglich abhauen soll.
Einem völlig unangebrachten Anstandsgefühl folgend, starre ich beim Zähneputzen ins Waschbecken. Erst als mir in vollem Umfang bewusst wird, dass Julia einfach in meine Wohnung eingedrungen ist und sich einen Scheißdreck um meine Privatsphäre kümmert, höre ich damit auf und sehe sie direkt an. Besser gesagt das, was ich von ihr durch das geriffelte Glas der Duschabtrennung sehen kann. Für mich ein ziemlich erregender Anblick, wie sie sich in der Dusche dreht und streckt und das Duschgel auf ihrem Körper verteilt.
»Hey, was glotzt du so? Bist du ein Spanner, oder was?«, schreit sie mich plötzlich an.
Sofort fühle ich mich wieder schuldig, aber nur für einen kurzen Augenblick. »Spiel hier bloß nicht die empörte Diva. Hab ich dich vielleicht zu einer Duschparty eingeladen? Ich kann mich nicht erinnern«, versuche ich mich zu rechtfertigen. Trotzdem fühle ich mich ertappt und verschwinde in mein Schlafzimmer, das die beiden aus Anstand oder weil es ihnen im Wohnzimmer besser gefallen hat, wenigstens in Ruhe gelassen haben.
»Es ist mir egal, was ihr macht«, sage ich im Vorbeigehen zu Joe. »Aber wenn ihr dabei laut seid, erschieße ich euch. Ich schwör’s dir. Ich habe eine Pistole aus NVA-Beständen, und ich werde einfach abdrücken.«
Ich liege schon im Bett, als ich höre, wie Julia zu Joe sagt: »Ey, was ist denn mit Noah los? Kommt einfach ins Badezimmer, während ich dusche.«
Joe macht »Pst!«, dann höre ich nur noch leises Getuschel und schlafe ein.
Am nächsten Morgen werde ich von Telefonklingeln geweckt.
Es ist neun Uhr, eine Zeit, zu der es mein Wecker nur ein Mal wagen könnte, zu klingeln. Er steht in Griffweite, seine Flugkurve wäre eher eine Gerade und würde an der Nord- oder Ostwand meines Schlafzimmers ihr Ende finden.
»Joe vom Orden der heiligen Festplatte«, kann ich hören. Dann ist das Gespräch zu Ende.
»Wer war denn dran?«, fragt Julia, und ich denke mir: Sind die denn immer noch da? Haben sie den Rest der Nacht einfach im Wohnzimmer auf der Couch geschlafen oder mit Kochen und Trinkgelage meine Küche versaut? Wieder klingelt das Telefon. Jetzt geht Julia ran.
»Hier bei Noah Franzen. ... Der schläft noch, vielleicht rufen Sie in einer Stunde noch einmal an.«
»Wer war’s denn?«, schreit nun Joe wieder.
»Noahs Mutti«, antwortet Julia.
Nun halte ich es nicht mehr aus und schleppe mich in die Küche. Joe und Julia haben meinen Kühlschrank leergeräumt und sitzen am fett gedeckten Tisch. Sogar Schampus und Kaviar, die ich im Kühlschrank hatte für den Fall, dass es eines Tages mal etwas zu feiern gibt, haben sie aufgemacht.
»Wer hat angerufen?«, frage ich Julia.
»Jetzt schrei nicht so ungemütlich rum. Du könntest zumindest Danke sagen für das tolle Frühstück, das wir für dich gemacht haben.« Julia macht schon wieder ihr empörtes Gesicht.
Der Schampus ist fast leer, und Kaviar zum Frühstück schmeckt mir nicht. In Gedanken führe ich ein Selbstgespräch. Du bist friedlich, ganz friedlich, sage ich zu mir, trotzdem steigt mein Blutdruck, und meine Birne läuft wahrscheinlich krebsrot an. Ganz ruhig. Einatmen, ausatmen. Es hilft, meine Lautstärke unter Kontrolle zu halten, aber ich fühle mich mies dabei. Bestimmt wäre es gesünder, einen ganz normalen cholerischen Anfall zu kriegen.
»Wer hat angerufen?«, frage ich noch einmal.
»Deine Marni war’s«, behauptet Julia.
»Meine Mutter spricht seit zehn Jahren nicht mehr mit mir, außerdem hat sie nicht einmal meine Telefonnummer.«
»Hab ich mir gleich gedacht, dass mich die Tussi anlügt. Ihre Stimme war ja auch viel zu jung, als dass es deine Mutter hätte sein können.«
»Was hat sie denn gesagt?«, frage ich.
»Sie hat sich mit Gianna Mutti gemeldet. Ich hab mir gedacht, wer meldet sich denn mit Gianna Mutti? Ist doch blöd, oder? Und dann hat sie mich noch gefragt, ob ich deine Freundin bin. Da hab ich natürlich Ja gesagt, und dann war sie weg. Aber das ist doch jetzt Nebensache. Wir wollten dir was sagen. Es gibt nämlich was zu feiern.«
Ich habe sofort die Szene aus »Metropolis« vor Augen, in der die riesige Dampfmaschine explodiert und sich in ein menschenverzehrendes Ungeheuer verwandelt. Trotzdem gelingt es mir, nicht zu explodieren. Es wäre genauso sinnlos, sarkastisch zu werden, doch darauf zu verzichten, dazu reicht meine Selbstbeherrschung nicht aus.
»Was gibt es zu feiern? Dass sich das blödeste Paar in Berlin bei mir in der Wohnung einnistet und der Frau, in die ich einmal schrecklich verliebt war und die ich wahrscheinlich immer noch liebe und nach deren Anruf ich mich seit Wochen sehne, sagt, dass die eine meine Freundin ist, während ich noch im Bett liege? Ist es das, was es zu feiern gibt, oder feiern wir eine noch größere Katastrophe? Zum Beispiel, dass du von diesem Schwachsinnigen seit etwa acht Stunden schwanger bist?«
»Scheiße«, sagt Julia, »das tut mir leid. Aber wenn sie dich liebt, renkt sich das wieder ein. Außerdem darfst du das nicht so persönlich nehmen. Es passiert sowieso alles, was passieren kann, wegen der Unendlichkeit. Also das, was du gerade erlebst, ist ja nur eine Wirklichkeit. In einer anderen sind wir nicht da, und in einer weiteren bist du tot. Du empfindest das jetzt nur deshalb als schrecklich, weil dir nicht bewusst ist, dass dies nur ein kleiner Teil der Wirklichkeit ist. In einer anderen Wirklichkeit ist dagegen alles in Ordnung.«
Ich spüre, dass sich genau jetzt in meinem Magen ein Geschwür bildet. In dieser Wirklichkeit und in allen anderen.
»Das ist doch Unsinn«, sagt Joe, »wir sind doch nur eine Simulation auf der heiligen Festplatte. Wenn wir herausfänden, wie wir die Variablen der Simulationsprogramme ändern könnten, dann würden wir das alles ungeschehen machen. Wir müssen nur kapieren, dass wir nicht wirklich existent sind und dass das, was wir zu empfinden und zu erleben glauben, nur das Produkt einer Simulation ist. Dann macht uns das nichts mehr aus, und es ist alles gut, verstehst du?«
»Ich verstehe. Ich gehe jetzt in mein Schlafzimmer, öffne die Schublade meines Nachttisches und hole dort die in einen öligen Stofflappen eingewickelte Makarow PM aus Beständen der NVA heraus. Ich werde die Pistole laden und wieder hierher zurückkommen. Wenn ihr dann noch da seid, dann erschieße ich euch, und es ist mir völlig egal, ob ihr das dann als Teil einer oder mehrerer Wirklichkeiten oder als eine Simulation der heiligen Festplatte beschreibt. Ist das klar?«
»Du willst eine Pistole besitzen? Das habe ich dir doch gestern schon nicht geglaubt«, sagt Joe.
»Lass uns abhauen«, schlägt Julia vor. »Wir wissen ja nicht, in welcher Wirklichkeit wir sind, und ich möchte nicht in der Wirklichkeit sein, in der ich gleich erschossen werde.«
»Der blufft doch nur, der hat doch niemals eine Waffe«, sagt Joe.
Ich gehe ins Schlafzimmer, und es ist mir absolut ernst. Hätte ich diese Scheiß-Pistole, ich würde sie abknallen wie Hasen. Ich höre Julia, wie sie Joe anbrüllt, dass er endlich kommen soll, denn das Universum sei unendlich, und dann gebe es klarerweise auch eine Wirklichkeit, in der ich eine Waffe besäße. Joe protestiert immer noch und behauptet, dass es keine so bescheuerte Simulation auf der Festplatte geben könne, in der ausgerechnet ich eine Waffe hätte. Trotzdem zieht er mit Julia Leine. Sie diskutieren noch draußen auf dem Flur über die Festplatte und das Universum. Ich höre, wie sich die Tür des Aufzugs öffnet und wieder schließt. Dann ein Rattern, so als wären dem wichtigsten Zahnrad mit einem Mal die Hälfte der Zähne ausgefallen, gefolgt von einem erbärmlichen Quietschen und Kreischen. Aber von mir aus kann der Aufzug abstürzen oder zwischen dem dritten und zweiten Stock feststecken. Mich interessiert nur, dass ich sofort Gianna anrufen und ihr alles erklären will. Ich muss eine glaubhafte Lüge erfinden, denn wenn ich ihr erzähle, was sich gerade in meiner Wohnung abgespielt hat, wird sie mich für einen Lügner halten und mir niemals verzeihen.
Ich drücke die Rückruftaste, und Gianna geht tatsächlich ran. Ich scheitere damit, ihr die eigentümliche Situation mit Hilfe einer Lüge zu erklären, sodass ich es aus Verzweiflung doch mit der Wahrheit probiere, die sie mir prompt abnimmt.
»Warum sagst du denn nicht gleich, was bei dir los war? Ist doch nicht schlimm.« Wieder einmal wird mir klar, dass ich die Welt und vor allem die Frauen irgendwie nie ganz verstehen werde.
Noch während ich erleichtert auf atme, fragt mich Gianna, ob Julia meine einzige Freundin ist oder ob es mehrere davon gäbe. Ich frage sie nicht, ob es für sie irgendeinen Grund gibt, eifersüchtig zu sein. Aber hinter ihrer schnippischen Frage spüre ich doch ein echtes Gefühl, und es berührt mich.
»Wie geht es dir?«, frage ich. »Bist du glücklich?«
»Ach, das Glück«, antwortet sie, und mit ihrem Akzent klingt es eher wie »Gluck«. »Das Glück habe ich mit dir erlebt, in Berlin und später am Lago di Como, weißt du noch?«
Klar weiß ich das noch, ist ja auch noch nicht so lange her. Zwei Jahre. Damals hatte ich tatsächlich geglaubt, Gianna würde ihren Mann verlassen und zu mir ziehen. Ich dachte, mein Leben würde sich durch die Liebe verändern. Wie im Film, ich Narr.
»Bist du immer noch bei ihm?«, frage ich.
»Ach, weißt du, das ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst.«
Sie sagt noch viel mehr, sie macht unendlich viele Worte um diese simple Geschichte, aber ich kann es schon nicht mehr hören. Ich bin nämlich dabei, mir die Schutzweste wieder anzuziehen, von der sie mir gerade mit ihrem »Gluck« den Reißverschluss aufgezogen hat. Alles beim Alten, denke ich. Wäre ja jetzt auch zu schön gewesen.
»Allo?«, schreit Gianna mir ins Ohr. »Bist du noch da?«
Ja, ich bin immer noch da. Genau da, wo ich vor zwei Jahren auch schon war. Und meine Freundinnen sind es nicht wert, dass du auf sie eifersüchtig bist, könnte ich zu ihr sagen. Aber ich tu’s nicht. Lieber bin ich der strahlende Liebhaber von damals als der frustrierte Antiheld von heute. Dann sagt Gianna mir noch, dass sie mich gern wiedersehen würde und dass sie oft an mich denkt. Etwas in mir wird ganz weich und warm, das muss meine Seele sein. Mein Hirn arbeitet standhaft dagegen. Mit einer verheirateten Frau heimlich ins Bett steigen, ist das der großartige Beginn eines großartigen neuen Lebens? So schlecht kann ich diese Alternative aber auch wieder nicht finden, weshalb der Kampf unentschieden ausgeht. Wir beenden das Gespräch, bevor einer von uns zu sentimental wird.
Der Schampus ist leer und die Butter weich. Ich nehme meinen kalten Kaffee mit ins Wohnzimmer und lümmle mich in den Sessel neben dem Fenster. Plötzlich taucht Hermann, der kastrierte Kater meiner Nachbarin, auf. Seit Längerem vermute ich, dass dieses Tier eine ägyptische Tempelkatze ist, denn offensichtlich kann es durch Mauern und geschlossene Fenster gehen. Jedenfalls taucht Hermann immer wieder aus dem Nichts auf, um dann genauso wieder ins Nichts zu verschwinden. Hermann hat ein Rotschwänzchen im Maul. Allein deshalb kann ich Katzen nicht ausstehen. Was, wenn der Vogel die Grippe hat? Als ich »Hermann!« schreie, öffnet er kurz das Maul, und der Vogel sitzt auf meinem Regal, scheißt auf Proust und Hemingway und macht mit seinem aufgeregt hüpfenden Kehlchen »keck, keck« dazu. Hemingway ist mir egal, aber Proust, das geht zu weit. Ich öffne das Fenster und versuche, den Vogel aus meiner Wohnung zu scheuchen. Er fliegt zweimal gegen die Scheibe, bevor er es endlich trotz seines kleinen Gehirns schafft, in die Freiheit zu entkommen. Hermann sitzt am Fensterbrett und sieht in die Richtung, in der das Rotschwänzchen verschwunden ist. Dabei klappert er vor Frust, dass ihm die sichere Beute entkommen ist, mit den Zähnen.
Ich nehme ihn auf den Schoß und versuche ihn zu beruhigen. Als er sich wieder gefasst hat, erkläre ich ihm lang und breit, dass es absolut verboten ist, Singvögel zu fangen oder gar zu fressen, erzähle ihm von Roten Listen und Naturschutzgesetzen. Als ich fertig bin, gähnt er mit weit aufgerissenem Maul und sieht mich an, als wollte er sagen: »Wir haben schon Singvögel erlegt, da habt ihr noch auf Bäumen gesessen und euch von gegrillten Regenwürmern ernährt, und niemals gab es zu wenige Vögel. Dass man heute so selten ein Vögelchen erwischt, ist ganz allein eure Schuld und hat mit uns nicht das Geringste zu tun.«
Ich weiß nicht recht, was ich davon halten soll. Ich setze Hermann auf den Boden und öffne die Wohnungstür zum Treppenhaus, damit er nicht durch die Wand gehen muss, sondern ganz normal wie jedes andere Tier an der Tür zur Wohnung seines Frauchens scharren kann, bis sie ihm aufmacht oder eben nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Tag schon zu lange dauert, obwohl noch nicht einmal der Frühstückstisch abgeräumt ist. Als Konsequenz meiner Überlegung räume ich den Tisch ab und ärgere mich dabei, dass Joe und Julia sich einfach so verkrümelt haben. Wahrscheinlich sind sie jetzt bei Julia, wegen der Dusche.
Ich sollte Horvath anrufen und ihm sagen, dass es nun ernst wird und er sich endlich einen neuen Barmann suchen muss. Außerdem brauche ich das Geld, das er mir noch schuldet. Dreitausend Euro immerhin, ohne die vereinbarte Umsatzbeteiligung. Die macht noch einmal tausendfünfhundert aus. Mein Entschluss steht fest. Entweder er rückt die Kohle raus, oder ich kassiere an einem der nächsten Abende den Umsatz. Da kann er jammern, wie er will.
»Ich bin es, Noah. Wie geht’s? Hast du schon einen neuen Barmann?«
»Wieso einen neuen Barmann? Du bist der Beste, den ich je hatte. Dich gebe ich nicht mehr her.«
Ich weiß genau, warum er das sagt. Er ist zu faul, um sich einen anderen zu suchen, außerdem gefällt ihm an mir, dass ich nicht so hinter der Kohle her hechle wie all die anderen.
»Danke für das Kompliment, aber spätestens in einer Woche bin ich weg, und dann stehst du selbst in der Kneipe, oder sie ist zu. Außerdem brauche ich die Kohle, die du mir schuldest, mindestens die Hälfte davon. Und zwar sofort.«
»Ey, Noah, das kannst du nicht machen. Mindestens zwei Wochen, ich brauche dich mindestens noch zwei Wochen, denk daran. Ich habe dich schließlich auch nie hängen lassen.«
»Was soll denn das heißen? Wann hast du mich nicht hängen lassen?«
»Na ja, wenn du mal Geld brauchtest oder ein Auto oder so.«
»Wenn ich Geld gebraucht habe, dann immer deshalb, weil du meinen Lohn nicht bezahlt hast. Weißt du, dass es Firmen gibt, die ihre Angestellten zum Ersten eines Monats einfach so bezahlen, per Überweisung? Das Geld haben die dann auf dem Konto, ohne dass sie dreimal vorbeifahren, jammern und drohen müssen. Kannst du dir das vorstellen?«
»Spießer«, sagt Horvath. »Seien wir ehrlich, du würdest doch niemals für so einen arbeiten wollen.«
»Ich liebe Spießer, und ich sag dir noch etwas: Ich werde in Zukunft nur noch für Spießer arbeiten, und wenn alles glattgeht, dann werde ich selbst bald Spießer sein, so mit allem Drum und Dran. Der größte Spießer, den du jemals gesehen hast. Und weil wir schon dabei sind: Ich bekomme viertausendfünfhundert Euro von dir, und zwar sofort und mit Zinsen, denn dieses Lotterleben ist jetzt vorbei.«
»Du kleiner Spießer, du, ich hatte schon immer so ein Gefühl, dass mit dir irgendetwas nicht stimmt. Sagen wir, fünfhundert Euro sofort, also am Abend. Du kannst auf mich zählen, wenn du Geld brauchst, kein Problem. Also fünfhundert Euro, das sind tausend Mark, den Rest später, das ist doch okay.«
»Horvath, du bist ein Träumer. Fünfhundert Euro, das ist nichts. Davon kann ich grade mal meine Miete bezahlen. Ich brauche mindestens zweitausend Euro und nicht Mark, die gibt es nämlich schon seit ungefähr 1984 nicht mehr. Abgeschafft, kapierst du? Zweitausend Euro heute Abend, klar?«
»Das kannst du nicht von mir verlangen. Ich brauch das Geld! Mein Auto steht in der Werkstatt, und die Spießer geben es mir nur zurück, wenn ich die Rechnung sofort bezahle. Außerdem, Miete zahlen, warum denn? Deine Vermieterin hat genug Geld, die braucht doch deine paar Hunderter gar nicht. Da gehst du morgen einfach hin, trinkst mit ihr gemütlich Kaffee und erzählst ihr eine Geschichte. Die gibt dir Kredit bis nächstes Jahr. Die ist doch froh, wenn sie wieder mal jemanden zum Quasseln hat.«
»Horvath, hör zu, ich brauche keinen Kredit. Ich habe genug Geld. Du musst mir nur geben, was mir zusteht.«
»Okay, nimm dir siebenhundert aus dem Tresor. Oder nein, nimm dir gleich siebenhundertfünfzig, aber dann kannst du mich auch nicht im Stich lassen und machst mir den Barmann, bis ich einen neuen gefunden habe, okay? Das ist doch mehr als okay. Und bestimmt mehr, als du erwartet hast.«
»Okay, einverstanden«, sage ich.
Ich weiß nun ganz genau, was ich zu tun habe. Ich nehme mir das Geld, und zwar dann, wann es mir passt. Vielleicht schon heute Abend. Dieser Idiot meint doch tatsächlich, dass es mich interessiert, ob er seine Karre wieder zurückkriegt. Nicht die Bohne interessiert mich das.
Ich habe genug von meiner Wohnung, dem Telefon und dem Aufzug sowieso. Ich muss sofort raus, sonst fällt mir die Decke auf den Kopf. Immer noch regnet es, und zwar Hunde und Katzen.
Am Abend ist die Bar wie üblich voll. Ahmed ist da, ein Gast, den ich ewig nicht gesehen habe. Er sieht ziemlich desolat aus.
»Weißt du, schuld ist nur diese linke Bazille von Gerichtsvollzieher«, versucht er mir gerade zu erklären. Ahmed ist ziemlich säkular, deshalb stelle ich ihm noch einen Tequila Sunrise vor die Nase.
»Geht auf mich«, sage ich.
»Weißt du«, fängt er wieder an.
»Ja, ich weiß«, sage ich. »Die linke Bazille, der Gerichtsvollzieher, ist schuld.«
»Nein, ich selbst bin schuld. Ich hätte merken müssen, dass dieser Bazillus nur so getan hat, als wären wir die besten Freunde. Verstehst du, einem Gerichtsvollzieher darfst du niemals trauen, das ist ganz wichtig.«
»Klar«, sage ich. »Ich hab noch nie einem Gerichtsvollzieher getraut.«
»Sehr gut. Du machst das richtig. Ich habe es falsch gemacht, und jetzt kann ich mich eigentlich gleich erschießen«, sagt Ahmed.
»Aber nicht bei mir«, sage ich. »Bei mir wird nicht geschossen, klar?«
»Natürlich, Noah, bei dir würde ich mich nie erschießen.«
»Okay. Also, was war denn los?«
»Na, dieser Gerichtsvollzieher trinkt meinen Tee, redet mit mir über Autoreifen und wie teuer das Heizen ist, und dann fragt er so ganz nebenbei: ›Hast du sonst noch ein Konto?‹, und da leg ich ihm meine Kontokarte hin. Sag ihm aber, da geht nur die Stütze rauf.«
»Ja und?«, will ich wissen.
»Gestern wollte ich das Zugticket bezahlen, damit ich am Wochenende nach München zu meiner Freundin fahren kann, und nichts geht mehr. Dieser Scheißer hat doch glatt mein Konto mit den fünfhundert Euro von meinem Hartz IV pfänden lassen. Das darf der gar nicht, dieses Schwein. Und jetzt kann ich nicht nach München, obwohl ich meiner Freundin versprochen habe, dass diesmal ganz sicher nichts dazwischenkommt. Die macht garantiert Schluss mit mir.« Ahmed schüttet den Tequila Sunrise in sich hinein.
»Quatsch, erstens macht deine Freundin nicht Schluss«, verspreche ich ihm, »und zweitens fährst du doch nach München, das habe ich gerade beschlossen.« Ich kann es kaum glauben, aber zehn Sekunden später stehe ich auf meinem Tresen.
Ich schlage zwei Gläser zusammen, damit es still wird. Alle sehen zu mir hoch. Einmal noch durchatmen. Ich spüre, wie mein Puls steigt und eine Wut in mir hochkocht, die mir fast den Schädel sprengt und raus muss, bevor etwas passiert. Es gibt Menschen, die es hassen, sich vor Leuten hinstellen zu müssen, um zu reden. Sie bekommen Schweißausbrüche, ihre Hemden sind unter den Achseln nass, und Schweißperlen stehen ihnen auf der Stirn. Es gibt sogar Leute, denen versagt die Stimme, der Mund geht auf und zu, und doch kommt kein Laut heraus. Ich dagegen mag es, wenn die Menschen ihre Augen auf mich richten, wenn sie still werden, um mir zuzuhören, wenn sie neugierig sind, was jetzt kommt, ob es etwas ist, dem sie zustimmen oder das sie ablehnen werden.
Ich mag es, wenn ich etwas mit meinen Zuhörern machen kann. Ich spüre, was ich tun muss, damit sie lachen oder sie das Gefühl beschleicht, etwas falsch gemacht zu haben. Ich kann ihnen das Gefühl vermitteln, dass sie genau jetzt handeln müssen, wenn sie zu den Guten gehören wollen, und ich weiß, dass alle, sogar die schlimmsten Schurken, zu den Guten gehören wollen. Was gut ist, das bestimme ich. Wenn ich wollte, dann würden sie mir glauben, dass nur derjenige, der jetzt noch ein Bier bestellt, zu den Guten gehört und alle, die Tee trinken, verirrte Seelen sind. Oder umgekehrt.
Ich steige mit einer Pause ein. Es ist nicht schlecht, wenn sie denken, dass ich unsicher geworden bin oder meinen Mut erst noch sammeln muss. Wenn sie denken, ich sei ihnen unterlegen, gelingt es mir noch besser, die Knöpfe zu drücken, die sie lachen oder weinen lassen, sie dazu bringen, vor Wut und Zorn auf die Barrikaden zu steigen oder Mitleid zu empfinden.
Dann beginne ich ganz leise, als würde ich nur mit meinem Tischnachbarn sprechen. Als hätte ich vergessen, dass da unten drei Dutzend Leute sitzen, die mich verstehen wollen. Sie spitzen die Ohren, das Gemurmel verstummt, denn alle möchten hören, was ich zu sagen habe.
»Wer ist der Feind?«, frage ich. Das kann mir natürlich keiner sagen. Ich sehe es ihnen an, wie sie überlegen. Die Amerikaner, die Russen, Monsanto, die Bundesbahn oder die Telekom? Jeder findet schnell seinen persönlichen Feind, doch würde er ihn nicht herausrufen. Es könnte ja sein, dass sein Nachbar ein Russe oder Amerikaner ist, bei der Telekom oder der Bahn arbeitet. Selbst wollte man ja auch nicht gern für seinen Job oder die eigene Herkunft blöd angemacht werden.
Und trotzdem sind alle neugierig geworden. Sie wollen wissen, ob ich auf der richtigen Seite stehe und die Unverschämtheiten der gleichen Partei dicke habe und sie daher zum Feind erkläre oder ob sie sich darauf gefasst machen müssen, im nächsten Augenblick zu denen zu gehören, die ich zu Feinden erkläre.
»Menschen sind nie unsere Feinde«, nehme ich wieder ein wenig Druck aus der Sache. »Die Umstände sind unsere Feinde. Die Umstände und die Gerichtsvollzieher.« Ein erstes befreites Lachen. Umstände und Gerichtsvollzieher, da kann jeder zustimmen.
»Ist euch aufgefallen, wie traurig Ahmed – das ist der, der hier unter mir an der Bar sitzt – heute schon den ganzen Abend aussieht? Oder seid ihr so herzlos, dass es euch nicht nur völlig kaltlässt, sondern nicht einmal mehr auffällt, wenn einer eurer Nachbarn nicht hierhergekommen ist, um Spaß zu haben, sondern nur, um seinen Kummer zu ertränken? Seid ihr schon so abgebrüht? Habt ihr wirklich das verloren, von dem man sagt, dass es Menschen von Hyänen unterscheidet, nämlich dass sie Mitgefühl zeigen und auch dann ihrem Nächsten helfen, wenn sie dadurch keinen Vorteil erlangen?«
Nach einer solchen Frage muss man eine Pause einlegen, damit sie einsickern kann. Manche gucken auf ihre eigenen Füße, während sie ihre Antwort abwägen. Den anderen schaue ich nacheinander ins Gesicht. Erst dann rede ich weiter: »Es ist eine grobe Fehleinschätzung, Hyänen für herzlos zu halten, denn sie helfen einem Gefährten in Not. Und euch schätze ich auch so ein, dass ihr nicht Party machen wollt, wenn mitten unter euch einer traurig ist, dem ihr mit einer Kleinigkeit aus der Patsche helfen könntet. Es hat mit den Umständen zu tun und mit dem Gerichtsvollzieher, mehr brauche ich euch nicht zu sagen. Doch, eines noch: Seine Freundin wartet auf Ahmed, und zwar in München, einer Stadt, in der keiner von uns alleine zurückgelassen werden möchte. Aber sie weiß noch nicht, dass sie vergeblich warten wird, denn Ahmed kommt nicht mehr an das Geld ran, das er sich für das Ticket zusammengespart hat.«
Ich kann zwar auf Knöpfe drücken, aber die jeweiligen Reaktionen setzen unterschiedlich schnell ein. Deshalb muss ich wieder kurz warten, bis alle das Gleiche fühlen.
»Weil ich euch kenne, habe ich ihm versprochen, dass er nicht traurig sein muss, denn er wird von euch nicht nur das Geld für ein Ticket bekommen, sondern auch noch so viel, dass er seine Liebste in München zu einem schicken Abendessen ausführen kann. Jeder so viel er mag und kann. Wenn jeder fünf Euro gibt, dann retten wir Ahmeds Arsch, und ich würde sagen, ein paar von uns sollten auch einige Euro mehr spenden und das ausgleichen, was andere sich gerade nicht leisten können. Wir sind ja hier nicht in Schwabing, sondern in Friedrichshain.«
Fast reißen sie mir den Sektkübel aus der Hand, den ich jetzt nach unten gebe. Die Erste, die ihr Portemonnaie öffnet und tatsächlich einen dieser seltenen gelben Zweihunderter in den Topf wirft, ist Julia. Nicht ohne ihn vorher noch herumzuzeigen. Kein Mensch weiß, woher sie ihre Kohle hat, denke ich wieder. Mir wird fast schwindelig, als ich den Kübel zurückbekomme, so viel Geld liegt darin. Die Gäste grölen, als ich alles in eine Plastiktüte schütte, sie Ahmed in die Hand drücke und von ihm verlange, dass er jetzt auf der Stelle abhaut und uns gefälligst ein Foto von seiner Braut beim Dinner schicken soll.
Natürlich heult er, und wenn er noch länger so weitermacht, fange ich auch noch damit an. Also schiebe ich ihn zum Ausgang und schreie ihm nach, er soll jetzt nach München fahren und dann nach Berlin zurückkommen, aber nicht alleine.
Später sitzt Joe auf Ahmeds Hocker herum und hört nicht auf, mich zu belabern. Dass er ja schon öfter Kostproben von meinem rhetorischen Talent mitbekommen habe, aber dass ich mich heute selbst übertroffen hätte und dass er wirklich beeindruckt sei.
»Weißt du, dass wir so jemanden wie dich brauchen werden?«, fragt er.
»Wann? Heute noch?«
»Nicht heute, aber vielleicht schon bald.«
»Und wer ist überhaupt ›wir‹?«
»Na wir, die vom Orden der heiligen Festplatte«, sagt Joe ungerührt.
»Du hast sie doch nicht mehr alle«, sage ich, um das Gespräch zu beenden.
»Wieso klingt das so verrückt für die meisten Menschen?«, fragt Joe. »Aber dass die Zehn Gebote in Stein gemeißelt auf dem Berg Sinai auftauchen, das ist okay, oder?«
»Die Geschichte kennt halt jeder«, sage ich, »aber den Orden der heiligen Festplatte eben nicht.«
»Noch nicht«, sagt Joe. »Aber das wird sich ändern.«
»Ich will gerade gar nicht mehr wissen, nimm’s nicht persönlich.«
»Okay«, sagt Joe, »dann bist du eben noch nicht so weit. Aber glaub bloß nicht, dass ich die Flinte ins Korn werfe. Für heute gebe ich Ruhe, aber irgendwann kriegen wir dich.«
Ich schüttle den Kopf. Was so viel heißen soll wie: Vergiss es!
»Du wirst sehen«, redet er leise auf mich ein. »Es wird dich glücklich machen.«
So sehen also meine letzten Stunden in der Uberbar aus. Gegen vier Uhr schließe ich die Vordertür ab, nachdem der Ami, der für die Uberbar viel zu alt aussieht, als letzter Gast gegangen ist. Die Gläser sind gespült, der Tresen ist abgewischt. Ich will nicht, dass man mir nachsagt, ich hätte einen Saustall hinterlassen. Am Ende bleibt mir nur noch, das Licht zu löschen und abzusperren. Zum Abschied sage ich nichts, weder leise noch laut. Und ganz bestimmt nicht »Servus«. Ich lege einen Zettel für meinen Chef in den Tresor. Ich könnte ihn auch auf den Tresor legen, um ihm den Anblick des geplünderten Safes zu ersparen. Aber es gibt keinen Grund mehr für mich, ihn zu schonen.
»Horvath!«, schreibe ich. »Du hast noch Lohnschulden bei mir, deshalb ist der Tresor leer. Denk lieber nicht daran, die Polizei zu rufen, denn damit handelst du dir nur noch mehr Schwierigkeiten ein. Abgesehen von dem leeren Safe ist alles in Ordnung. Ich habe meinen Arbeitsplatz sauber hinterlassen. Die Schlüssel werfe ich dir in den Briefkasten. Ja, dann bin ich also weg. Wie du das mit der Bar regelst, ist mir jetzt schnuppe, und wenn ich dich in diesem Leben nicht mehr wiedersehen muss, so ist das für mich echt okay. Im Nächsten werden wir uns eher nicht treffen, denn ich vermute, dein Karma-Konto ist ungefähr so leer wie der Tresor der Uberbar.«
Kapitel 4
Das war es also. Jetzt frage ich mich, wieso ich so lange gebraucht habe für diesen Schritt. In diesem Moment habe ich jedenfalls nicht das Gefühl, dass mir etwas fehlen wird, was mit dieser Bar zu tun hat. Licht aus, Tür zu und absperren. Den Schlüssel in den Briefkasten. Jetzt ist es vorbei, selbst wenn ich wollte, den Schlüssel könnte ich nicht wieder herausfischen.
Ich fühle mich noch einsamer als sonst, wenn ich um diese Zeit nach Hause gehe. Hoffe, wenigstens einer Katze zu begegnen, die vor einer der fetten Ratten flieht, die vom Fluss einen kleinen Ausflug hierherauf gemacht hat. Aber nichts, keine Katze, keine Ratte. Nicht einmal das Flackern irgendeiner defekten Leuchtreklame. Da nehme ich eine Bewegung in einem unbeleuchteten Hauseingang neben mir wahr und höre eine Männerstimme etwas sagen. Es ist nur ein Satz, und er klingt auf jeden Fall englisch. Drei Wörter, und wenn ich es richtig verstanden habe, dann waren es diese drei: »Kill Satoshi Nakamoto.« Ein Witz, denke ich und bleibe kurz stehen. Ich kneife die Augen zusammen und versuche in dem Dunkel irgendetwas zu erkennen. Da schaltet sich die Beleuchtung im Hauseingang an, und ich sehe durch die Milchglasscheiben der Eingangstür meinen letzten Gast, den zu alten und zu dicken Amerikaner, wie er sein altmodisches Handy zuklappt. Vielleicht doch kein Witz.
Sein rundes Gesicht mit der kleinen Nase und den fleischigen Lippen erinnert mich an Orson Welles. Und die Szenerie an »Der dritte Mann«. Das Licht geht aus, und der Mann mit dem Handy versinkt wieder in der Dunkelheit. Ich renne weg und höre hinter mir Schritte, die schneller sind als meine.
Als ich jünger war und Radrennen gefahren bin, habe ich gelernt, niemals den Kopf zu wenden, wenn man von einem Konkurrenten verfolgt wird. Man riskiert sonst, das Rennen zu verlieren. Sich umzusehen gilt als Zeichen von Schwäche. Der Verfolger spürt, dass der Vorausfahrende an seiner eigenen Kondition zweifelt. Er versucht abzuschätzen, ob der Verfolger näherkommt und ob es nun wirklich notwendig ist, alle Kraftreserven zu mobilisieren. Für den Verfolger ist dieser Augenblick wie eine Aufforderung: »Los, noch ein bisschen schneller, gleich hast du ihn.« Diese Aussicht lässt ihn vergessen, dass seine Lunge bei jedem Atemzug brennt wie Feuer. Dass sein Herzschlag bis in den Kopf hinein zu spüren ist. Er vergisst alles, die schmerzenden Oberschenkel, die Waden, den Rücken. Er sieht nur noch das ihm zugewandte Gesicht des Vordermanns und sagt sich: »Der sieht doch verdammt müde aus.«
Ich muss mich gar nicht umdrehen. Muss nicht sehen, ob er zwanzig oder bereits fünfzehn Meter hinter mir ist. Ich muss einfach nur ein bisschen schneller werden. Der Ami wird mir nicht allzu lange folgen können. Viel zu dick, zu alt und zu unsportlich. Immer noch höre ich seine Schritte. Sie werden weder lauter noch leiser. Vielleicht ist es gar nicht der Ami, der hinter mir her ist, sondern ein jüngerer Komplize? Aber den hätte ich doch sehen müssen. Nein, ich werde mich nicht umsehen. Ich werde einfach schneller, noch ein bisschen schneller. Ich beginne zu joggen, biege ab, laufe nicht direkt zu mir nach Hause, sondern mache einen Umweg einmal um den Block herum. Ich denke, es ist besser, mein Verfolger weiß nicht, wo ich wohne. Trotzdem krame ich während des Laufens schon in meiner Tasche nach dem Schlüssel. Ich halte ihn in meiner rechten Faust, es fühlt sich an, als hätte ich einen Schlagring zwischen meinen Fingern.
Jetzt wird sein Laufen ungleichmäßig, fast stolpert er vor sich hin. Gleich wird es leiser werden, und da höre ich auch schon, wie er stehen bleibt. Keine Schritte mehr, trotzdem blicke ich nicht zurück.
Ein Klicken oder Klacken, kaum zu hören. Mein Atem ist laut, übertönt alles. Trotzdem das Klacken. Ich weiß, wo ich dieses Geräusch zuletzt gehört habe. Es war im Kino.
»Der Malteser Falke« mit Humphrey Bogart. Ich weiß nicht mehr, wer mir gesagt hat, dass ich diesen Film unbedingt sehen müsste. Ich habe mich tödlich gelangweilt. Aber jetzt weiß ich, dass ich in ebendiesem Film dieses Klacken gehört habe, genau wie jetzt. Klack, und dann hat es geknallt.
Mir ist klar, es ist dieser Scheißer, zu fett, um mich einzuholen. Immer noch drehe ich mich nicht um, versuche, zickzack zu laufen. Ich mache es ihm nicht leicht. Ohne mich umsehen zu müssen, habe ich ein Bild vor Augen: Er steht da, außer Atem, viel erschöpfter als ich. Steht da mit ausgestreckten Armen. Mit beiden Händen hält er einen silberfarbenen Revolver, einen Colt oder eine Smith & Wesson Model 60 Boar Hunter, so genau kann ich das in meiner Phantasie nicht erkennen. Es ist dunkel, und ich weiß, so leicht ist es nicht, jemanden, der im Dunkeln steht, zu erschießen. Besonders wenn man den Herzschlag wegen Überanstrengung bis in den Scheitel spürt und das Ziel außerdem in Schlangenlinien läuft. Und das Ziel bin ich! Es knallt. Der Schuss peitscht durch die Nacht, und mein Herzschlag setzt aus. Panisch renne ich weiter.
Rechts in einen Durchgang zum Hinterhof, noch mal rechts, ich kenne diesen Hof. Ein schmaler Weg führt von hier zur Parallelstraße, kein Licht. Ich bemühe mich, so leise wie möglich zu sein. Manchmal ist es wichtiger, leise zu sein als schnell, denke ich. Ich versuche die Luft anzuhalten, aber es geht nicht. Vielleicht würde ich die Polizei ja doch anrufen, wenn mein Handy-Akku noch nicht leer wäre, ist er aber schon seit fünf Stunden.
Ich bin zu schnell gelaufen. Zu viel Stress, zu viel Angst habe ich. Meine Brust bewegt sich heftig auf und ab, und am liebsten würde ich laut vor mich hin keuchen. Ob es auch einen anderen Zugang zum Hinterhof gibt? Hat er Komplizen? Hat er ihnen schon gesagt, wie ich aussehe und wo ich ihm entkommen bin? Und wie verdammt bin ich in diese beschissen schlechte Filmszene geraten? Das darf doch alles nicht wahr sein.
Zuerst strecke ich meinen Kopf aus der Deckung und linse um die Ecke. Die Parallelstraße ist frei. Kein Auto, keine Katze und keine Ratte. Auch der Ami ist nicht zu sehen. Ich laufe über die Straße und verschwinde gleich im nächsten Durchgang. Das einzig Gute an der Situation ist, dass ich sicher sein kann, mir das alles nicht nur einzubilden. Dieser Kerl ist öfter bei mir in der Kneipe gewesen. Irgendeiner hat mal spekuliert, der Typ wäre vom Geheimdienst und hinter Snowden her.
»Snowden, der ist doch bei Putin«, hab ich gesagt, daran kann ich mich noch erinnern.
»Das glaubst du«, hat der- oder diejenige gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war.