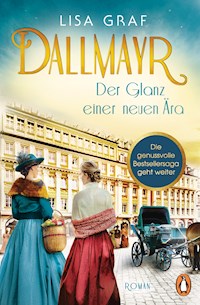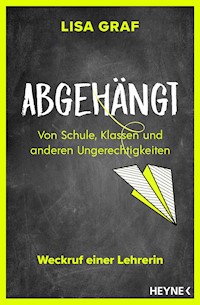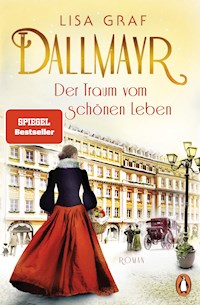12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Lindt & Sprüngli-Saga
- Sprache: Deutsch
Gönnen Sie sich eine Auszeit mit dem Auftakt der genussvollen Schokoladen-Trilogie
Zürich 1826: Voller Verzweiflung bringt der kleine Rudolf Sprüngli seiner Mutter eine Tafel Schokolade ans Krankenbett. Sein letztes Taschengeld und all seine Hoffnung legt er in dieses kleine Mysterium, das sich Schokolade nennt. Wie durch ein Wunder wird sein Wunsch erhört und seine Mutter wieder gesund. Ab diesem Tag ist für Rudolf klar, dass er Schokolade herstellen möchte. Jahre später ist aus dem Kind ein Mann geworden, doch der Traum ist geblieben. Eine »Confiserie Sprüngli« soll es bald in Zürich geben, in der feinstes Backwerk, edle Pralinen und zarte Schokolade serviert werden. Schokolade, die im Mund zergeht wie Butter und die Herzen höher schlagen lässt. Sein eigenes Herz hat Rudolf bereits an eine junge Frau verloren. Doch in wenigen Tagen wird Katharina einen anderen heiraten. Reicht Rudolfs unerbittlicher Eifer und unermüdlicher Fleiß, um seine Träume wahr werden zu lassen? Und was, wenn noch jemand den gleichen Traum hegt?
Opulent, dramatisch und akribisch recherchiert – die unvergessliche Familiensaga rund um die weltberühmten Schweizer Chocolatiersfamilien Sprüngli & Lindt. Ein liebevoll gestaltetes Paperback rundet dieses einzigartige Lesevergnügen ab!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Lisa Graf ist in Passau geboren. Nach Stationen in München und Südspanien schlägt sie gerade Wurzeln im Berchtesgadener Land. Sie hat nicht viele Schwächen, aber zu Lindt-Schokolade konnte sie noch nie nein sagen. Mit ihrer grandiosen Familiensaga Dallmayr eroberte sie sowohl die Herzen ihrer Leserinnen als auch die Bestsellerliste und schaffte es bis an die Spitze der SPIEGEL-Bestsellerliste. Nun erscheint die mit Spannung erwartete neue Saga Lindt & Sprüngli, in der sie die bewegte Geschichte rund um die weltberühmten Schweizer Chocolatiersfamilien erzählt.
Außerdem von Lisa Graf lieferbar:
Dallmayr. Der Traum vom schönen Leben. Roman.
Dallmayr. Der Glanz einer neuen Ära. Roman.
Dallmayr. Das Erbe einer Dynastie. Roman.
www.penguin-verlag.de
LISA GRAF
ROMAN
Dies ist ein historischer Roman. Er basiert auf der Unternehmensgeschichte von Lindt&Sprüngli. Zahlreiche tatsächliche Abläufe und handelnde Personen sind jedoch so verändert und ergänzt, dass Fakten und Fiktion eine untrennbare künstlerische Einheit bilden.
Eine Zusammenarbeit mit Lindt&Sprüngli gab es nicht, insbesondere besteht keine wie auch immer geartete Lizenzbeziehung. Die Verwendung des Firmennamens erfolgt also ausschließlich aus beschreibenden und nicht aus markenmäßig-kennzeichnenden Gründen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Redaktion: Lisa Wolf
Umschlaggestaltung: bürosüd
Umschlagabbildungen: Arcangel: AA12568418, AA11653667, Confiserie_Sprüngli_2010
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-30174-3V002
www.penguin-verlag.de
Die Zeit geht nicht
»Die Zeit geht nicht, sie stehet still,Wir ziehen durch sie hin;[…]Es blitzt ein Tropfen MorgentauIm Strahl des Sonnenlichts;Ein Tag kann eine Perle seinUnd ein Jahrhundert nichts.«Gottfried Keller
Prolog
Der Duft nach Schokolade, Vanille, Nuss, Zimt und Zucker begleitete Katharina auf Schritt und Tritt. Sie war umgeben von Goldhasen und Schokoladenkugeln. Die Folien, in die sie verpackt waren, schimmerten in Gold und Silber und allen Farben des Regenbogens. Schokoladentafeln standen aufgereiht im Regal. Pralinenschachteln, große, kleinere, rechteckige, quadratische, elegant in Weiß oder frech bunt, lagen daneben. Jeder darf sich noch etwas aussuchen, hatte ihre Mami versprochen. Doch Katharinas Korb war noch vollkommen leer. Sie konnte sich unmöglich entscheiden. Hier schmeckte doch einfach alles, und jedes einzelne Stück war so hübsch verpackt.
Doch wo waren denn jetzt die anderen? Katharina blieb stehen und sah sich um. Ihre Mutter wartete immer noch an diesem Stand mitten im Shop, hinter dem ein Maître Chocolatier und eine Maîtresse Chocolatière – sagte man so? – mit Zuckerguss Namen auf Schokoladetafeln spritzten, die ihnen zugerufen wurden. »Für Oma Fanny« schrieb er, »Für Tante Sybille« sie. Der Maître trug wie seine Kollegin eine hohe Haube und eine weiße Schürze, beides mit dem aufgestickten goldenen Schriftzug der Firma. Und Mami passte auf, dass Fanny mit y und Sybille vorne mit y und hinten mit i geschrieben wurde.
Und wo waren eigentlich ihre Brüder? Die zwei standen immer noch bei dem großen Brunnen herum, der sie schon zu Beginn der Führung durch das Schokoladenmuseum fasziniert hatte. Wie viele Meter war er noch mal hoch, fünf vielleicht oder sechs? Zähflüssig tropfte die helle Milchschokolade von einem riesigen Rührbesen. Bestimmt war es der größte, jedenfalls höchste Schokoladenbrunnen der Welt. Katharina hörte, wie ihre Brüder darüber rätselten, wie diese Schokolade wohl schmeckte und ob man sie überhaupt essen konnte. Ob sie nach dem Herunterlaufen wieder nach oben gepumpt wurde, wie das Wasser eines Springbrunnens. Wie viele Kilos Schokolade das waren, ob man sie erwärmen musste, damit sie flüssig blieb, und ob man den Brunnen am Ende des Tages, wenn das Museum schloss, abschaltete, und was dann mit dieser riesigen Tagesration Schokolade geschah.
Katharina wunderte sich, dass sie immer noch so verrückt nach Schokolade waren. Sie selbst hatte an den einzelnen Stationen in der Ausstellung schon viel zu viel davon probiert: die dunkle Schokolade mit dem höchsten Anteil an Kakao, die helle Schokolade mit mehr Milch und weniger Kakao und die weiße Schokolade, die ganz ohne Kakao gemacht wurde. Nur Kakaobutter und Zucker brauchte man dafür und Nüsse, Gewürze oder andere feine Sachen. Katharina winkte ihren Brüdern, dann ging sie zurück in den Shop und wartete, bis die Geschenke für Oma und Tante Sybille fertig beschriftet und verpackt waren. An einer freien Wand hingen einige gerahmte Porträts, alte Ansichten der Schokoladenfabrik und Werbeplakate für Katzenzungen und Schokoladentafeln.
»Was hast du denn hier entdeckt?«, fragte ihre Mutter, deren Einkaufskorb bereits gut gefüllt war. Auch Onkel Anton und Tante Mila würden Schokolade mit ihren Namen bekommen und wahrscheinlich auch die Kolleginnen ihrer Mami im Büro.
Katharina zeigte zu den Porträts an der Wand. Es dauerte ein wenig, bis es ihrer Mutter auffiel.
»Die heißen ja alle wie deine Brüder«, stellte sie fest. »Ach, da sind die beiden ja wieder.«
Die beiden Jungs hatten sich endlich von dem Schokoladenbrunnen losmachen können. David hing das Hemd aus der Hose, der Jüngere, Rudy, war mit dem Kopf in irgendeine Flüssigkeit geraten. Hoffentlich keine Schokolade aus dem Brunnen. Die Strähnen an der Stirn waren ganz verklebt.
»Du bist doch nicht in den Brunnen gefallen?«, fragte sie. Aber Rudy grinste nur und schüttelte den Kopf.
»Mir war nur so warm«, sagte er, »da habe ich den Kopf unter die Wasserleitung gesteckt.« Er zeigte zu den Toiletten.
»Schaut doch mal, ihr zwei.« Katharina zeigte zu den Porträts an der Wand. »Fällt euch was auf?«
»Alles alte Männer«, sagte Rudy. »Leben die noch?«
»Quatsch«, sagte David, »schau, da steht es doch. Die Bilder sind schon voll alt.«
»Und sonst?«, fragte Katharina.
»Der Erste dort oben heißt David«, sagte Rudy, »und der daneben Rudolf. Wie wir.« Er grinste seinen Bruder an.
»Ach, guck«, sagte sein Bruder, »und der daneben heißt wieder Rudolf.«
»Und die beiden darunter, die aussehen wie Zwillinge, heißen, warte mal, der eine Johann Rudolf und der andere David Robert.« Die beiden sahen sich an.
»Nur eine Katharina gibt es nicht«, stellte David fest und sah seine Schwester achselzuckend an. »Pech gehabt!«
»Da ist überhaupt keine Frau abgebildet«, sagte Katharina.
»Hat es eben in der Familie nicht gegeben«, meinte Rudy. »Nur Jungs.«
»Und wo kommen die Jungs dann her, du Schlauberger?« Katharina sah ihren Bruder an. »Wenn diese beiden da, die Zwillinge, Söhne von einem der mittleren sind, dann muss es ja wohl eine Mutter gegeben haben.«
»Und bestimmt hatten sie auch Schwestern«, meinte die Mutter.
»Und wo sind die?« Rudy sah seinen Bruder an.
»Zu Hause«, sagte David. »Sie waren eben nicht wichtig. Also, für die Schokoladenfabrik.«
»Woher willst du das wissen?«, fragte Katharina.
»Sonst hätten sie doch auch so einen Rahmen bekommen«, behauptete David.
Reni, ihr Guide, kam auf dem Weg zu einer neuen Gruppe gerade an ihnen vorbeigelaufen, und die Mutter hielt sie auf.
»Reni, bitte«, rief die Mutter. »Meine Tochter hat noch eine kurze Frage.«
»Ja, bitte? Wenn ich sie beantworten kann, gerne.«
Katharina fühlte sich überrumpelt. »Was ist denn mit den Frauen?«, fragte sie. »Hier sind nur die Männer aus der Familie zu sehen, und sie heißen alle wie meine beiden Brüder.«
»Ach, tatsächlich? Das hatten wir ja noch nie, wie lustig. Es sind tatsächlich zwei Familien. Aber der eine von den beiden Rudolfs war nie verheiratet und hatte auch keine Kinder, soweit ich weiß.«
»Und der andere Rudolf?«, fragte Katharina.
»Der war schon verheiratet, er hatte ja die beiden Söhne hier, Rudolf und David.«
»Keine Tochter?«, fragte Katharina.
»Davon ist mir nichts bekannt.«
»Und seine Frau?«, fragte Katharinas Mutter.
»Ich weiß leider nicht, wie sie hieß. Von ihr gibt es auch kein Porträt, tut mir leid.«
Katharina wollte gerade etwas sagen, da kam ihr Rudy mit seiner Sturmfrisur zuvor. »Sie hieß bestimmt Katharina«, sagte er.
»Die Frau von Rudolf eins oder die Schwester von Rudolf zwei?«, fragte Katharina.
»Alle beide«, behauptete Rudy. »Die haben sich nicht groß was ausgedacht, sondern einfach immer wieder dieselben Vornamen verwendet. Bei den Mädchen bestimmt genauso.«
»Ich werde das einmal nachlesen«, versprach Reni. »Vielleicht finde ich sogar irgendwo ein Porträt von Katharina eins oder zwei, damit ich es meinen Besuchergruppen zeigen kann. Aber jetzt muss ich los, die Nächsten warten schon auf mich. Adieu!«
»Adieu!«, rief Katharinas Mutter. »Nächstes Jahr kommen wir wieder, und Sie erzählen uns, was Sie herausgefunden haben.«
»Mindestens eine Katharina«, sagte Rudy und zog geräuschvoll die Nase hoch. »Oder zwei.«
Mit drei Goldhasen, einem Dutzend Tafeln ihrer Lieblingsschokolade und je einer Handvoll roter, blauer und grüner Schokoladenkugeln verließen Sie den Shop.
»Tschüss, Schokoladenbrunnen!« Rudy drehte sich noch einmal um, bevor er durch die Tür nach draußen trat.
Es war schon fast dunkel und ein kühler Wind blies ihnen vom See her ins Gesicht. Sie mussten laufen, um den Bus zurück nach Zürich noch zu erwischen, der gerade die Haltestelle Kilchberg anfuhr.
1826
Rudolf
Es war Anfang Mai, die frisch ausgetriebenen Lindenblätter hatten Tupfer aus hellem Grün zwischen die Häuser gemalt, als Rudolf von der Schule nach Hause lief, als sei der Teufel hinter ihm her. Er ließ sich nicht treiben, wie er es sonst immer tat. Er machte keinen Abstecher hinunter zum Sonnenquai an der Limmat, um den Schiffsleuten zuzusehen, die auf ihren langen schmalen Holzkähnen, den »Weidlingen«, wie sie in Zürich hießen, Fässer, Kisten, Stroh und Tuchballen transportierten. Normalerweise konnte er sich Stunden am Quai aufhalten, und nie wurde es ihm langweilig. Doch heute hatte er es eilig, nach Hause zu kommen. Mit den Augen folgte er dem Flug eines Entenpaares über der Mitte des Flusses. Als sie zum Landen ansetzten, war er schon in die Marktgasse abgebogen, hatte die Ladentür zur Confiserie Vogel aufgerissen, dass die Glocken sich beim Schellen überschlugen. Aber da stand nur Bertha mit ihrem runden, rosigen Gesicht und den Händen, die nicht viel größer waren als seine eigenen, dafür aber doppelt so dick. Sie war dabei, ein Blech mit Zürcher Leckerli auf einer Tortenplatte aus weißem Porzellan mit feinem Goldrand anzurichten.
»Grüezi, Ruedi, hast du heute die letzte Stunde geschwänzt?«, begrüßte ihn Bertha. »Du hast es doch sonst nicht so eilig mit dem Heimkommen.«
Rudolf ließ sich seine Enttäuschung nicht anmerken. Statt Bertha, die mit ihren Patschehänden Leckerli sortierte, hatte er gehofft, seine Mutter würde heute endlich wieder im Laden stehen. Er hatte die Klinke zur Hintertür schon in der Hand, als Bertha ihm nachrief: »Das wird schon wieder, wirst sehen. Bald kann deine Mami wieder aufstehen und ist ganz die Alte«, plapperte Bertha dahin. »Musst nur besonders lieb sein zu ihr.«
Rudolf lief über den Hinterhof und die Treppe hoch zur Wohnung. War er in letzter Zeit immer lieb gewesen zu seiner Mami? Seit sie krank war, verging kein Tag, an dem er sich das nicht mehrfach gefragt hatte. Aber er konnte nichts finden, außer vielleicht, dass er immer so lang für den Nachhauseweg von der Schule brauchte. Vielleicht hatte sie sich deshalb Sorgen um ihn gemacht und war krank geworden? Aber geschimpft hatte sie nicht mit ihm. Nur der Vater. Seine Mami nie.
In der Küche stand ein Topf mit einem Rest Suppe und zwei Scheiben Brot auf dem Tisch. Doch Rudolf hatte gar keinen Hunger. Er öffnete vorsichtig die Tür zum Schlafzimmer, die nur angelehnt war. Die Haut seiner Mami war fast so weiß wie das Kissen, auf dem sie lag, und fast so durchsichtig wie feines Papier. Er konnte ihr Blut in den Äderchen fließen sehen. Auf ihrer Stirn standen Schweißperlen, sie hatte die Augen geschlossen, doch ihre Lider flatterten, als wüssten sie, dass jemand im Zimmer war. Das Fläschchen mit der Thymian-Tinktur auf dem Nachttisch war leer. Rudolf öffnete den Schrank, wo seine Mutter ihre selbst angesetzten Kräuterauszüge aufbewahrte, aber er fand kein volles Glas mehr. Die Schranktür knarzte, als er sie wieder zudrückte. Erschrocken wandte Rudolf den Kopf, aber seine Mami war davon nicht aufgewacht. Ein leises Rasseln war zu hören, wenn sie ausatmete. Wann würde sie denn endlich wieder gesund werden? Sie würde doch wieder gesund werden, seine Mami, und ihm das Mittagessen richten, die Suppe wärmen und hören, was Rudolf in der Schule und auf dem Nachhauseweg durch die Stadt alles erlebt hatte. Einen Silberreiher hatte er im Stadtgraben stehen sehen, der sich zwischen den Wasserpflanzen einen dicken Frosch mit seinem langen Schnabel herausgepickt hatte. Und an der Schipfe hatten die Schiffer einen Weidling so überladen, dass das Wasser auf einer Seite über den Rand schwappte. Sie warfen eine Kiste zurück an Land, doch sie zerbrach, und ein braun geflecktes Schwein mit eingerissenem Ohr lief quiekend in Richtung Werdmühle davon. Wem hätte er das alles erzählen können? Es war, als hätte er es ganz umsonst erlebt. Niemand interessierte sich heute dafür, wie auch in den vergangenen Tagen nicht, seit die Mutter krank war. Der Vater stand in der Backstube. Rudolfs Bruder David war auf der Baustelle am Sihlquai, und einer Bertha wollte er gar nichts erzählen. Eigentlich gab es nur seine Mami und sonst niemanden.
Rudolf nahm einen Löffel kalter Suppe und biss in ein Stück Brot. Dann lief er in seine Kammer und holte das seifengroße Blechkästchen unter seinem Bett hervor, blies den Staub vom Deckel und steckte es sich in die Tasche. Bevor er die Wohnung verließ, sah er noch einmal zu seiner Mami ins Zimmer. Sie schlief und machte weiter dieses Geräusch beim Atmen, das jetzt etwas leiser war, für ihn aber immer noch bedrohlich klang. Er lief die Treppe hinunter und über den Hof, betrat den Laden durch die Hintertür, grüßte die Frau Redaktor Hurther, die mit Bertha plauderte, während sie vier Stückli Buttercremetorte in Papier einschlug und der Kundin noch eine Handvoll Leckerli und frische Hüppen einpackte.
»Schon fertig mit dem Essen, Ruedi?«, rief Bertha ihm nach. »Wohin läufst du denn?«
»Muss noch etwas besorgen, für die Mami«, rief Rudolf und ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen.
Eigentlich hätte er nur quer über die Gasse laufen müssen, aber er wollte nicht, dass ihn jemand dabei beobachtete. Also lief er die Marktgasse hinauf zur Münstergasse und die Krebsgasse gleich wieder hinunter.
Er betrat die Elephanten-Apotheke durch den Hintereingang und hatte sofort diesen eigenartigen Geruch in der Nase nach altem Holz und getrockneten Kräutern, die in den ordentlich beschrifteten Schubfächern der umlaufenden Schrankwand und in braun glasierten Keramikbehältern mit Deckeln aufbewahrt wurden. Obwohl die Apotheke nach den Elefanten hieß, hingen über dem Verkaufstresen rechts ein großer braun getupfter Hecht und links ein ausgestopftes Krokodil, das nicht viel größer war als der Hecht, aber noch viel mehr Zähne hatte als der Raubfisch. Apotheker Flückiger stand mit einem Rezept in der Hand auf der Leiter und kramte in einer der Schubladen.
»Grüezi, Meister Flückiger«, grüßte Rudolf.
Der Apotheker schob die runde Lesebrille Richtung Nasenspitze und musterte ihn über die Gläser hinweg. »Das ist doch ein kleiner Sprüngli. Was führt dich denn her? Du wirst doch nicht krank sein?«
»Nicht ich, sondern die Mami«, sagte Rudolf. »Und sie hat keine Tinktur von Thymian mehr und braucht sie doch unbedingt für ihren Husten.« Das Krokodil baumelte leicht hin und her, als der Apotheker von der Leiter stieg. Es konnte gut schwimmen und war doch kein Fisch, hatte Meister Flückiger erklärt, als er mit der Mutter hier gewesen war. Da war er noch kleiner gewesen und hatte lange an der Limmat gesessen und darauf gewartet, ein Krokodil im Fluss aufzuspüren. Sein Bruder hatte ihn noch Wochen später damit aufgezogen. Er dachte, es wäre eine Ausrede und Rudolf hätte einfach Angst vorm Wasser.
»Husten, hat deine Mutter, sagst du? Wie lange denn schon?«, fragte der Apotheker.
»Schon zwei Wochen. Sie schläft immerzu und ist ganz weiß und sie macht so Geräusche beim Atmen.«
»Hat sie Fieber?«, fragte der Apotheker. »Ist die Stirn heiß, wenn man sie berührt?«
Das wusste Rudolf nicht. »Papi sagt, das Fieber ist zurückgegangen, aber sie ist immer noch schwach und kann nicht aufstehen.«
Der Apotheker holte eine große braune Flasche aus dem Hinterzimmer, ließ die Kräutertinktur durch ein feines Haarsieb laufen und füllte es in ein kleineres Fläschchen um.
»Schwach, sagst du, ist sie, hm? Erschöpft wahrscheinlich. Die gute Frau hat ja auch alle Hände voll zu tun mit dem Geschäft, dem Haushalt, euch Kindern, und als ob das nicht längst schon reichen würde, hilft sie auch noch den Nachbarn, wenn irgendwo Not herrscht. Ein Engel ist deine Mami und kennt sich mit den Heilkräutern fast so gut aus wie ich.« Er wischte die kleine Flasche mit einem weichen Lappen ab.
Rudolf nahm das Blechkästchen aus der Hosentasche und stellte es scheppernd auf den Tresen.
»Warte noch. Sie ist stark erschöpft, sagst du?« Der Apotheker ging zu einem Tischchen, auf dem ein großer Mörser aus Messing stand. Er winkte Rudolf zu sich.
»Schau, da bin ich gerade am Experimentieren.«
Weil Rudolf nicht in den Behälter hineinsehen konnte, stellte der Apotheker ihm eine Trittleiter an den Arbeitstisch. Er kletterte hinauf und sah ein feines braunes Pulver auf dem Grund des Mörsers. Es roch ein wenig streng, bitter.
»Welche Arznei ist das?«, fragte Rudolf.
»Kakao«, sagte Flückiger. »Er wird aus gerösteten Kakaobohnen gewonnen. Ich mache hier so meine Experimente damit. Ich reibe ihn ganz fein im Mörser, gebe Zucker dazu, reibe die Mischung wieder, und dann rühre ich sie mit heißem Wasser an. Das schmeckt gut, ein wenig eigen am Anfang, aber man gewöhnt sich daran.«
»Und das könnte meiner Mami wieder Kraft geben?«, fragte Rudolf.
Der Apotheker nickte. »Mit Wasser vermischt wird der Kakao aber sehr verdünnt. Verstehst du?«
Rudolf nickte. »Kann man das Pulver nicht auch so einnehmen, mit dem Löffel?«
Der Apotheker nickte. »Schon«, sagte er. »Aber das schmeckt nicht und man bekommt Hustenreiz davon. Da habe ich etwas versucht.«
Er gab Rudolf ein Zeichen, dass er ihm ins Hinterzimmer folgen sollte. Hier mischte der Apotheker die Arzneien, rührte seine Salben an und stellte die Kräuterauszüge her. Über einer Feuerstelle brodelte eine Flüssigkeit in einem Tiegel. Rudolf kannte den bitteren Geruch, das musste Wermut sein, den seine Mutter als Tee verabreichte, wenn jemand Magenkrämpfe oder Blähungen hatte. Der Apotheker nahm den Topf vom Feuer und stellte einen Tiegel darauf, in dem sich Butter befand, die aber gar nicht nach Butter roch. Er nahm etwas von der Kakao-Zucker-Mischung aus dem Mörser, gab einen Stich von der angeschmolzenen Buttermasse dazu und verrührte rasch alles mit einem Holzspatel. Dann drückte er die klumpende Masse in eine Holzform.
»Schau, die hier sind schon abgekühlt.« Der Apotheker klopfte die Kakaotaler aus der Form, nahm einen in die Hand, brach ihn auseinander und gab ihn Rudolf zum Kosten. Der Kakaotaler schmeckte trotz des Zuckers immer noch recht bitter. Als Rudolf ein kleines Stück abbiss, hatte er Brösel im Mund, die sich wie Sandkörner anfühlten.
»Was sagst du dazu?«, fragte der Apotheker.
Rudolf überlegte. »Für ein Gebäck schmeckt es zu wenig süß und zu sandig«, antwortete er. Schließlich war er der Sohn eines Zuckerbäckers.
»Und für eine Medizin?«, fragte der Apotheker.
»Für eine Medizin geht es. Nicht so schlimm wie Wermut, den man nur trinken mag, wenn man wirklich arge Bauchschmerzen hat.«
»Ich sehe schon, du bist bei deinem Vater wie bei deiner Mutter in die Lehre gegangen«, schmunzelte Flückiger.
»Aber wenn Ihr diese Taler macht, Meister Flückiger, dann muss es doch Medizin sein. Wogegen hilft sie?«
»Gegen Schwäche und Erschöpfung. Sie soll die Kraft und den Lebensmut zurückbringen. Und dabei noch gut schmecken.«
»Dann nehme ich gleich alle Taler mit, die Ihr habt, damit meine Mami wieder gesund und kräftig wird.«
»Hoho, du Knopf, da müsstest du aber sehr viele echte Taler in deiner Büchse haben. Kakao ist sehr teuer und meine Mixtur mit Kakaobutter nur sehr aufwendig herzustellen. Ich fürchte, das kann sich ein einzelner Mensch gar nicht leisten. Außerdem bin ich noch nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Viel zu grob und sandig.«
»Aber wenn es doch meiner Mami helfen könnte.«
Rudolf war enttäuscht. Der Apotheker konnte ihm doch nicht alles zeigen und kosten lassen und ihn dann mit leeren Händen wieder nach Hause schicken, wo die Mutter krank im Bett lag. Rudolf schluckte. Er holte sein Blechkästchen und leerte den Inhalt auf den Tresen. Der größte Schatz, der sich in dem Häuflein befand, waren zwei Zwanziger Rappen, alles andere waren noch kleinere Münzen. Er bemerkte den mitleidigen Blick des Apothekers und biss sich auf die Lippen. Flückiger seufzte.
»Bloß gut, dass meine Gertraud heute nicht im Geschäft ist. Sie würde mich bestimmt ausschimpfen.« Er nahm die beiden Zwanziger und ließ die übrigen Münzen liegen. Dann stellte er das Fläschchen mit der Thymiantinktur auf den Tresen und wickelte zwei von den Schokoladentalern in ein Stück Papier.
»Hier, nimm. Meine Gertraud kommt bestimmt gleich zurück. Und alles Gute für deine Mutter! Ich hoffe, sie ist bald wieder auf der Gasse und in der Konditorei zu sehen.«
Rudolf schniefte und packte die Schokoladentaler ein, dann die braune Flasche und schließlich seine Geldbüchse.
»Das wird schon! Komm wieder vorbei und sag mir, ob meine Taler geholfen haben«, verabschiedete ihn der Apotheker.
Rudolf nickte. Als er die Tür schon in der Hand hatte, presste er ein »Danke« hervor, und als er draußen auf der Krebsgasse stand, wischte er sich ganz schnell eine Träne aus dem Augenwinkel. So teuer waren diese Schokoladentaler, dachte er auf dem Heimweg, und so schlecht gemischt, die ganze Masse. Als hätte man Erde zwischen den Zähnen. Wenn sein Vater die nötigen Zutaten bekäme, dann würde er so lange daran arbeiten, bis die Masse geschmeidiger wäre und sich leichter formen ließe. Er würde vielleicht noch das ein oder andere Gewürz dazutun, damit es angenehmer für den Gaumen wäre. Dem Papa würde da schon etwas einfallen. Bei den alten Mexikanern war die wertvolle Schokolade ein Getränk für die Könige und Priester gewesen, hatte Meister Flückiger ihm erzählt. In Zürich gab es aber überhaupt keinen König und die Pfarrer machten keinen sehr wohlhabenden Eindruck. Aber die Zürcher Fabrikbesitzer mit ihren Spinnereien und Webereien, die hatten doch Geld wie Heu, behauptete zumindest sein Freund Heini. Das müsste doch ein Geschäft sein!
* * *
Katharina
Jetzt kam die Mutter schon zum zweiten Mal in die Stube und raunte Katharina zu, dass am Abend bestimmt noch ein Unwetter aufziehen würde. Katharina hörte es wohl, aber sie antwortete nicht. Die beiden Holzklöppel flogen über das trapezförmige Hackbrett, die quer gespannten Saiten hinauf und hinunter, als spiele sich das Stück von selbst, ganz ohne Katharinas Zutun. Eigentlich konnte sie es auswendig, nur an einer Stelle blieb sie manchmal hängen oder sie traf die Saiten nicht ganz rein. Die Leute würden es nicht merken, aber der Vater schon. Also lieber noch mehr üben, damit es wirklich sicher saß.
»Ein Gewitter? Glaubst du wirklich?«, fragte Katharina schließlich. »Es ist doch so warm und nicht das kleinste Lüftchen regt sich. Wo soll denn an diesem feinen Sommertag noch ein Gewitter herkommen?«
Ihre Mutter hörte wirklich manchmal das Gras wachsen. Immerzu machte sie sich Sorgen, vor allem um den Papi und um sie. Ein Gewitter, jetzt? Katharina sah zum Stubenfenster hinaus. Nicht eine einzige Wolke am Himmel.
»Wirst schon sehen, da kommt noch was.«
Katharina hielt die Klöppel in der Luft. »Wie kommst du denn gerade jetzt darauf?«, fragte sie verärgert.
»Ich spür’s einfach. Ich hab so eine Unruhe in mir.«
»Ach!« Katharina tat es mit einer Handbewegung ab und bearbeitete weiter die Saiten mit den beiden Klöppeln, schneller und schneller. Doch die Mutter gab einfach keine Ruhe mehr.
»Chatrina, sei so gut. Wer weiß, wie lange der Vater heute noch auf dem Turm ausharren muss, wenn das Gewitter kommt. Bring ihm doch das Essen hinauf, er hat heute kaum etwas mitgenommen.«
Daher wehte also der Wind. »Aber ich muss doch das Lied lernen bis zum Sonntag, sonst gibt es Ärger mit dem Vater, wenn ich danebenhaue.«
»Später übst du weiter, Kind. Geh rechtzeitig los, damit du wieder zu Hause bist, wenn das Gewitter losbricht. Beeil dich und nimm eine Jacke mit.«
»Eine Jacke, bei der Hitze?« Die Mutter übertrieb es manchmal wirklich mit ihren »Ahnungen«. Andererseits fiel es ihr heute besonders schwer, sich auf das Stück zu konzentrieren. Weil sie immer wieder an ihn denken musste. Den Studenten. Seit zwei Jahren ging sie nun täglich zur Arbeit in die Schneiderei Wyss, zuerst als Gehilfin und seit Kurzem als Lehrling. Und als sie heute am Feierabend vom Haus am Neumarkt auf die Gasse getreten war, hatte er sie angesprochen. Er trug ihr das Nadelkissen nach, das ihr vom Rockbund gerutscht war, weil sich das Samtband gelöst hatte. Er machte einen Kratzfuß, als er zu ihr aufschloss.
»Ist die Jungfer selbst auch so stachelig wie die Distel, mit der ihr Nadelkissen bestickt ist?«, fragte er mit belegter Stimme und rosa Öhrchen.
Katharina bedankte sich mit einem Knicks, nahm das Nadelkissen entgegen und knüpfte das grüne Seidenband wieder an ihren Schürzenbund. Wenn sie gewusst hätte, dass sie heute einem jungen Mann begegnen würde, dann hätte sie ihre Schürze schon in der Werkstatt abgelegt und sich jetzt nicht genieren müssen. Der dünne Kerl mit den engen gestreiften Hosen und dem taillierten Rock lüftete noch einmal seinen nicht mehr ganz neuen Zylinder. »Salomon Fehr«, stellte er sich vor, »Student der Jurisprudenz.« Seine Stimme war nicht kräftiger als seine Beine.
»Katharina Ammann«, sagte sie lächelnd. »Oder Chatrina, wie mich alle nennen.«
»Und was macht Ihr hier?« Der Student sah an der Hausfassade nach oben.
»Ich lerne hier im Haus, bei Frau Wyss, das Schneiderhandwerk.« Und dann sagte sie ihm, dass sie jetzt nach Hause müsste, weil die Mutter schon auf sie wartete. »Ade«, rief sie und lief mit dem hüpfenden Nadelkissen an ihrem Schürzenbund davon. Erst als sie am Haus zum Rech in die Spiegelgasse abbog, warf sie einen schnellen Blick zurück. Der Student war ein Stück hinter ihr und sah ihr nach. Schon wollte Katharina die Hand heben und winken, doch dann fiel ihr ein, dass sich das bestimmt nicht schickte. Normalerweise wäre sie noch an den Auslagen der Schaufenster in der Spiegelgasse stehen geblieben, doch heute pochte ihr Herz dafür zu laut. Sie lief die Gasse hinauf und war viel schneller zu Hause als sonst. Und völlig außer Atem.
* * *
Rudolf
Rudolf rannte die Krebsgasse hinauf und die Marktgasse wieder hinunter, riss die Ladentür zur Konditorei Vogel auf, dass sie wie zum Feueralarm bimmelte, und grüßte die Kundinnen, die sich hier zum Nachmittagsplausch eingefunden hatten. Auch Frau Vogel war unter ihnen. Ihr und ihrem Mann gehörte das Haus in der Marktgasse 5 und die Konditorei, in der Rudolfs Vater Geselle war.
»Wie geht es deiner Mutter, Ruedi?«, fragte ihn Frau Vogel.
»Ich habe Medizin für sie geholt.« Rudolf zog die Tinktur aus der Tasche und hielt sie den Damen hin. Von den Talern sagte er nichts. Sie blieben sein Geheimnis und das des Apothekers.
Rudolf nahm immer zwei Stufen auf einmal, die Hand fest auf das Fläschchen in seiner Tasche gepresst, damit es nicht herausfiel und am Boden zerschellte. Schon als er die Wohnungstür öffnete, wusste er, dass sich etwas verändert hatte. Da waren leise Geräusche von draußen zu vernehmen, wenn man die Ohren spitzte. Das müde Klappern von Pferdehufen in einer der Nachbargassen, ein Teppich, den eine Hausfrau oder ein Dienstmädchen in einem der Hinterhöfe ausklopfte, und etwas weiter den Hügel hinauf Richtung Neumarkt ein sich drehender Wetzstein, an dem einer von den Jenischen Messer und Scheren schliff. Er konnte das alles nur hören, weil jemand das Fenster in der Kammer seiner Mutter geöffnet hatte. Vielleicht sogar sie selbst. Als Rudolf den Kopf zur Tür hineinstreckte, lag sie wach in ihrem Bett unter dem angelehnten Fenster. Sie lächelte, als sie ihn sah.
»Mami«, sagte Rudolf, nahm das braune Fläschchen aus der Tasche und stellte es auf ihren Nachttisch. »Ich habe Medizin für dich aus der Apotheke geholt.«
»Hast du anschreiben lassen bei Meister Flückiger?« Sie streckte die Hand nach ihm aus.
»Ich hab’s bezahlt«, antwortete er, »aus meiner Spardose.« Dann holte er sein kleines Paket aus der anderen Tasche, wickelte einen Taler aus dem Papier, brach ein Stück davon ab und hielt es seiner Mami an die Lippen.
»Was ist das?«, fragte sie.
»Medizin. Probier doch mal.«
Sie öffnete den Mund, und er legte ihr das Stück auf die Zunge. Vorsichtig kaute sie darauf herum.
»Das ist ja einmal eine Medizin, die schmeckt«, sagte sie, »nicht wie mein scharfer Thymianauszug. Und das soll mich gesund machen?«
»Ganz sicher«, behauptete Rudolf. »Der Apotheker hat’s versprochen. Thymian hilft gegen den Husten, aber diese Taler machen, dass du wieder stark wirst und Freude am Leben hast.«
»Sagt Flückiger.«
»Glaubst du ihm etwa nicht?«, fragte Rudolf.
»Natürlich glaube ich ihm. Er ist doch ein Studierter und hat eine Prüfung an der Universität abgelegt. Wenn er es sagt, dann muss es stimmen. Und wie heißt diese Medizin?«
»Schokolade, sagte Meister Flückiger.«
»Schokolade, zum Essen«, murmelte sie. »Nicht zum Trinken. Aber für mich? Ich bin doch keine Prinzessin, Ruedi, sondern nur die Frau eines Konditorgesellen.«
»Du bist meine Mami.« Rudolf zog die Nase hoch. »Und du sollst endlich wieder gesund werden.«
Die Mutter nahm Rudolfs Hand und streichelte sie. »Dank dir schön, Bub. Ich glaube, ich merke jetzt schon, wie die neue Medizin wirkt. Aber hoffentlich nicht gleich auf der Stelle.«
Rudolf sah sie ungläubig an. Wollte sie denn noch länger im Bett liegen bleiben?
»Damit ich vielleicht auch noch das zweite Stück bekomme«, sagte sie und kniff Rudolf in die Backe.
Sie hatte schon wieder ziemlich viel Kraft in den Fingern. Er strich sich über die schmerzende Wange und grinste.
Und dann stellte sie endlich die Frage, auf die er jetzt schon so viele Tage gewartet hatte: »Wie war’s denn heute in der Schule?« Und Rudolf erzählte ihr die Geschichte von der Kiste in der Schipfe, aus der ein Schwein gesprungen und quiekend davongelaufen war.
»Jetzt schwindelst du mich aber an«, meinte seine Mami. »Das hast du dir doch gerade ausgedacht.«
»Nein, nein, ich schwöre, dass es genauso war!«
»Was du auf dem Heimweg von der Schule immer alles erlebst. Kein Wunder, dass du so lange brauchst für die kurze Strecke«, sagte sie. »Kannst du die Suppe noch einmal auf den Ofen stellen? Ich habe ein bisschen Hunger.«
»Ich auch.« Wie der Blitz sauste Rudolf in die Küche und stellte den Topf auf den Herd. Es war ein gutes Zeichen, dass sie endlich wieder Appetit bekam.
Als er mit einem Teller Suppe und einem Stück Brot zurückkam, war der erste Taler schon verputzt.
»Da kann man ja gar nicht mehr aufhören«, sagte seine Mami. »Ich kann kaum glauben, dass das wirklich Medizin ist. Aber sie macht mich richtig froh.«
Vorsichtig hielt Rudolf den Teller, damit seine Mutter daraus essen konnte.
»Diese Schokolade aus der Elephanten-Apotheke ist bestimmt sündhaft teuer, oder?«, fragte sie.
»Wenn ich ein bisschen größer bin, mache ich selbst welche«, behauptete Rudolf.
»Du willst Apotheker werden? Bisher dachte ich immer, du gehst bei deinem Vater in die Lehre und wirst Zuckerbäcker.«
Rudolf nickte. »Natürlich. Aber Schokolade ist immerhin eine Süßspeise. Und das können wir doch besser als der Apotheker Flückiger.«
»Wir?«, fragte die Mutter.
»Ich und mein Papi.«
»Weiß er denn schon von deinen Plänen?«
»Noch nicht«, gab Rudolf zu.
»Es hat ja auch noch ein paar Jahre Zeit, bis du mit der Schule fertig bist und bei ihm in die Lehre gehst. Dann hast du immerhin schon einen Plan. Aber, Ruedi, wenn der Papi da nicht mitmacht? Was machst du dann?«
Rudolf hielt den Teller schräg, damit er auch noch den letzten Rest Suppe für seine Mami herauslöffeln konnte. »Dann mache ich die Schokolade eben allein«, sagte er. »Aber ich werde sie machen, du wirst schon sehen!«
* * *
Katharina
Vierundzwanzig, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig. Katharinas Augen gewöhnten sich schnell an das düstere Zwischenlicht des Turms. Die Luft war stickig, und die Mauern waren so feucht, als schwitzten sie. Bis zum ersten Treppenabsatz waren es siebenundzwanzig Stufen, nicht sechsundzwanzig. Sie hatte sich wieder einmal verzählt. Ihr Vater meinte, sie müsse sich einfach nur besser konzentrieren beim Zählen und nicht den Kopf voller Flausen haben. Doch jetzt war es das Essen im Topf, auf das Katharina aufpassen musste. Und so sicher war sie nicht bei den höheren Zahlen. In den vier Jahren, die sie die Schule besucht hatte, waren sie nie so weit gekommen. Und dabei war sie sogar im Sommer wie im Winter zur Schule gegangen. Nicht wie die Fabriklerkinder in der Stadt, die oft nur zur Sonntagsschule kamen, oder die Bauernkinder, die nur im Winter hingingen. Denn im Sommer mussten sie auf den Feldern und in den Ställen mithelfen. Das Rechnen hatte Katharina erst später bei ihrem Vater gelernt. Auch das Schreiben hatte sie hier oben in der Türmerstube geübt, denn in der Schule war dafür immer zu wenig Zeit gewesen. Es genügt, wenn ihr ein wenig lesen und euren Namen schreiben könnt, hatte der Lehrer gesagt. Wem würdet ihr auch Briefe schreiben? Jedes Christenkind sollte halbwegs die Bibel lesen können, andere Bücher schien der Lehrer nicht zu kennen. Doch hier oben, in der Stube ihres Vaters, gab es Bücher, fromme und weniger fromme, soweit Katharina das beim Durchblättern festgestellt hatte. Es war immer etwas Besonderes, einen der dicken Ledereinbände aufzuschlagen und raschelnd die Vorsatzblätter, wie der Vater die Seiten nannte, die noch nicht ganz beschrieben waren, zu wenden, um an den Anfang einer Geschichte zu gelangen. Was ich von der Geschichte des armen Werther nur habe auffinden können, habe ich mit Fleiß gesammelt und lege es euch hier vor, und weiß, dass ihr mir’s danken werdet. Ihr könnt seinem Geist und seinem Charakter eure Bewunderung und Liebe, seinem Schicksale eure Tränen nicht versagen. Diese zwei langen Sätze hatte Katharina mittlerweile so oft gelesen, dass sie sie im Kopf aufsagen konnte.
Siebenundvierzig, achtundvierzig, neunundvierzig. Am nächsten Absatz waren es auf einmal zwei Stufen zu viel, und Katharina gab das Zählen auf. Gelesen hatte sie das ganze Buch des Herrn Goethe immer noch nicht. Wenn schon die ersten Sätze so lang und schwer waren, würde es ihr vielleicht nie gelingen. Aber irgendwann hätte sie schon gern erfahren, was es denn nun mit diesem Werther auf sich hatte und warum er so arm dran war.
Ihr wurde immer heißer in der Jacke, die die Mutter ihr aufgeschwatzt hatte. Sie setzte den Topf ab, zog die Jacke aus und hängte sie sich über den Arm. Sie war jetzt im Läutboden angekommen, von dem aus die fünf Glocken der Kirche St. Peter geläutet wurden. Doch vor der Glockenstube kam auf der nächsten Etage erst noch die Uhrenstube. Herr Hüttinger, der Uhrenrichter, kam mehrmals am Tag herauf, um die Gewichte der Uhr mithilfe eines Flaschenzugs aufzuziehen. Die Uhr von St. Peter war nämlich die allerwichtigste in der Stadt. Nach der Zeit, die sie angab, mussten sich alle anderen Uhren der Stadt richten. Der Vater sagte, das Ziffernblatt des Turms von St. Peter sei das größte auf der ganzen Welt. Es maß über acht Meter in der Länge und Breite. Der Stunden- und der Minutenzeiger waren aneinandergelegt so lang wie einer der Weidlinge auf der Limmat, nämlich über zehn Meter. Als der Vater Katharina zum Schuleintritt mit einem Zollstock maß, hatte er gerufen: »Nun bist du endlich so groß wie eine der römischen Ziffern an der Uhr von St. Peter.«
Nach dem Läutboden und der Uhrenstube durchstieg Katharina die Glockenstube mit den fünf Glocken, von denen die größte die Totenglocke und die kleinste die Taufglocke war. In vierzig Metern Höhe hatte sie endlich das Wächtergeschoss erreicht. Hier endete das Mauerwerk. Der aufgesetzte Spitzturm war mit vielen Tausend Holzschindeln aus dem Engadin gedeckt. Und in der Türmerstube saß ihr Vater, der Feuerwächter von St. Peter war, seit Katharina denken konnte. Eigentlich seit sie auf der Welt war. Hier hatte der Papi sein Bett, seinen Tisch und Stuhl stehen und das Regal mit den Büchern. Am wichtigsten aber waren das Feuerhorn, das der Wächter blasen musste, wenn er irgendwo eine Flamme lodern sah, und die rote Fahne, mit der er aus einem der vier Fenster die Richtung anzeigen musste, aus der das Feuer kam. Nachts benutzte er anstelle der Fahne eine rote Laterne und gab mit ihr Zeichen.
Ihr Vater hatte sie wie immer schon an ihren Schritten und dem keuchenden Atem erkannt. Sonst ließ sich hier auch selten einer blicken. Die Mutter, die ihn früher öfter besucht hatte, schickte inzwischen lieber Katharina zu ihm hinauf.
»Chatrina, was machst du denn hier? Ich hab doch alles dabei, was ich brauche.« Der Vater trug wie immer seine dunkle Lederhose, die bis übers Knie reichte, ein Leinenhemd, helle Strümpfe und Schuhe aus Wildleder. Erst wenn er sich an den Wochenenden ein rotes Tuch um den Hals band, wurde ein Musikant aus ihm. Hier oben versah er seinen Dienst als Feuerwächter der Stadt, und bei jedem Glockenschlag zur Viertelstunde machte er seine Runde im Turm, öffnete nacheinander jedes der vier Fenster und ließ den Blick über die Stadt und die Landschaft schweifen. Wenn ihm etwas verdächtig vorkam, nahm er das Fernrohr zur Hand. Dazwischen baute, sägte und schliff er an seinen Instrumenten.
»Mami sagt, dass heute noch ein Gewitter kommt«, keuchte Katharina.
»Heute noch, sagt sie?« Kaspar Ammann stand auf und sah zum Fenster hinaus, hinüber zu den beiden Türmen des Grossmünsters. Blauer Himmel. Er trat zum gegenüberliegenden Fenster, das zum Albis hinausging. Dort türmten sich ein paar harmlose Wolken über dem Bergzug, der im Uetliberg über der Stadt endete.
»Hört sie mal wieder die Flöhe husten, unsere Babette«, sagte der Türmer und ging zurück an seinen Arbeitstisch.
Er hatte den Korpus eines Hackbretts mit einem Stück Leinen poliert, auf das Sandkörner aufgebracht waren. Die Lappen zum Schleifen der Instrumente stellte er selbst her. Doch den Geruch des Knochenleims, den er zum Aufkleben der Sandkörner verwendete, konnte Katharina nicht ausstehen. Sie öffnete deshalb ein Fenster.
Sie betrachtete das kleine Brett, an dem der Vater gerade arbeitete, mit einem einzigen Schallloch. Als Nächstes würde er die Stege aufleimen und dann die Saiten darüber spannen, immer drei an einem Chor.
»Du kannst schon bald darauf spielen«, meinte der Vater.
Katharina war immer die Erste, die die neuen Instrumente bespielen durfte. Während sie die Klöppel über die Saiten bewegte, lauschte ihr Vater aufmerksam, ob der Klang sauber war oder einzelne Saiten schnarrten. Dabei bemerkte er auch jede kleinste Unsicherheit in ihrem Spiel, jeden nicht ganz sauber getroffenen Ton. Doch sagen musste er nichts, denn sie hörte es selbst ebenso gut.
»Was gibt es Neues aus der Schneiderstube Wyss?«, fragte ihr Vater.
»Nichts Besonderes«, antwortete Katharina.
Ihr Vater öffnete den Deckel des Suppentopfs, steckte einen Finger hinein und leckte ihn ab. »Mhm, die Bündner Gerstensuppe gelingt deiner Mutter wirklich immer.«
Katharina sah ihm zu, wie er einen Löffel aus der Schublade nahm und begann, die Suppe aus dem Topf zu löffeln. Sollte sie es ihrem Papi erzählen? Warum eigentlich nicht? Sie erzählte ihm ja sonst auch alles. Und sie war schließlich vor Kurzem vierzehn geworden. »Ich habe heute einen jungen Mann kennengelernt«, sagte Katharina. »Am Neumarkt. Einen Studenten.«
»Einen Studenten? Soso.« Er tat, als wäre es gar nichts Besonderes, und löffelte weiter, ohne sie auch nur anzusehen. »Und? Hat er dir gefallen?«
Katharina errötete und nahm einen Schluck Wasser. Sie sah den jungen Mann mit der Streifenhose und dem engen taillierten Rock vor sich, den fadenscheinigen Zylinder in den Händen drehend. »Er war sehr dünn und hatte ganz rote Ohren«, sagte sie. »Und sein Zylinder war nicht mehr ganz neu.«
»Aha. Eine Bohnenstange ist er also, eine verhungerte«, sagte er und schlürfte die Bündner Suppe. »Und noch nicht einmal einen anständigen Hut kann er sich leisten. Dann ist er nichts für dich, wenn er nicht einmal genug für sich selbst hat.«
»Vater«, regte Katharina sich auf, »er hat mir doch nur mein gesticktes Nadelkissen nachgetragen, das mir runtergefallen ist. Du tust geradeso, als hätte er mir einen Antrag gemacht.«
»Das wäre ja auch noch schöner«, meinte Kaspar Ammann. »Meine schöne Tochter mit dem dunklen Haar.«
»Wie eine Jenische, sagen manche Leute.«
»Ach, lass sie nur reden. Sie sind doch nur neidisch.«
Die Glocke unter ihnen schlug das erste Viertel nach der vollen Stunde. Der Vater ging zuerst an das Südfenster, und Katharina übernahm ganz automatisch den Kontrollblick aus dem nördlichen Turmfenster. Der Himmel war jetzt auf einmal dunkel, fast schwarz. Da braute sich wirklich etwas zusammen über der Limmat, dicke graue Wolken schoben sich übereinander. Als sie in der Mitte des Flusses angekommen waren, schoss ein Blitz daraus hervor und ging auf der Limmat-Insel nieder.
»Papi!«, schrie Katharina. Sie hatte den Fensterflügel noch in der Hand. »Auf der Papierwerd hat der Blitz eingeschlagen.«
Mit einem Satz war ihr Vater hinter ihr. Mein Gott, das Gedeckte Brüggli, die Holzbrücke, die zur Werd hinüberführte, würde doch hoffentlich nicht in Flammen aufgehen. Offenbar hatte der Einschlag eines der Mühlengebäude getroffen. Ihr Vater blies bereits das Feuerhorn über die feierabendliche Ruhe der Stadt. Die meisten Zürcher würden gerade beim Abendbrot sitzen. Katharina schwenkte die Fahne, während der Vater die rote Laterne entzündete. Die Werdinsel war auf allen Seiten von Wasser umgeben. Es würde eine Weile dauern, bis die Flammen auf die Ufer übergreifen konnten. Wenn die Brandwachen sofort ausrückten, ließe sich vielleicht das Schlimmste verhindern.
»Hat die Mami doch recht gehabt«, rief ihr der Vater zu. »Gut, dass sie dich zu mir heraufgeschickt hat! Lauf geschwind hinunter zum Brandmeister in der Stegengasse. Du kennst doch den Weg?«
Katharina nickte und lief los. Während sie die Glockenstube durchquerte, hörte sie ihren Vater oben erneut das Feuerhorn blasen. Auf der St. Peterhofstatt, vor der Kirche, liefen die ersten Männer zusammen, und Katharina schrie so laut sie konnte: »Fürio, Fürio!«, und lief zum Haus des Brandmeisters.
* * *
Rudolf
Der See sah an diesem Morgen ganz anders aus als sonst. Die Sonne war gerade aufgegangen, und über dem östlichen Ufer stand ein schmaler Streifen Himmel, blau wie Vergissmeinnicht. Darüber zog sich ein lachsrosa Wolkenband wie ein über den Strand geworfenes Fischernetz.
Während die Gesellen und Helfer aus der Confiserie Vogel, unter ihnen Rudolfs Vater, ihre sorgfältig in Kisten verpackten Torten immer zu zweit auf hölzernen Tragen zum See trugen, blieb Rudolf erst einmal staunend stehen und betrachtete den Himmel.
»Jetzt schau doch nur, David, wie dein Bub andächtig dasteht, wie am Sonntag in der Kirche«, rief Ueli Rudolfs Vater zu. »Als würde er den See heute zum ersten Mal sehen.«
Rudolf hatte gar nicht bemerkt, dass er seine beiden Körbe abgestellt hatte. Schnell nahm er zuerst den Korb mit den Erdbeertörtli und dann den zweiten mit den Gugelhöpfli mit Zuckerguss wieder auf und lief auf das Boot zu, das von den Gesellen und den beiden Schiffsleuten bereits beladen wurde. Der flache Kahn hatte in der Mitte ein Dach aus Stroh, um Fahrgäste und Frachten vor der Sonne zu schützen. Bis nach Küsnacht mussten die Schiffer die Kisten aus der Confiserie Vogel bringen. Sie war am ganzen Zürichsee für ihre Torten und das Gebäck bekannt und wurde bei großen Hochzeitsfeiern gern für die Süßspeisen angefragt.
»Los, los jetzt!« Rudolfs Vater mahnte zur Eile, nachdem er selbst noch einmal kontrolliert hatte, ob die Fracht auch sicher verstaut war. Es konnte ihm gar nicht schnell genug gehen, die kostbaren Waren aus der Backstube heil nach Küsnacht zu bringen. Der Weg über den See war sicherer als das Geholpere im Fuhrwerk auf den Straßen.
»Ihr habt doch bestimmt alles sorgfältig verpackt, wie immer. Ihr seid doch ein Hunderprozentiger, Sprüngli, oder? Wär ja auch nicht das erste Mal, dass wir Euer Zuckerwerk heil übers Wasser bringen.«
»Verpackt sind sie jedenfalls ordentlich. Daran liegt es nicht, wenn etwas passiert«, antwortete David Sprüngli und setzte sich inmitten der Körbe und Kisten, damit er im Notfall alles mit den Händen erreichen und festhalten konnte. »Eher schon daran, wie lange ihr braucht und wann ihr endlich losfahrt. Ich wäre jedenfalls so weit.«
»Ein lustiger Mann ist dein Vater.« Einer der Ruderer zwinkerte Rudolf zu. »Und so umgänglich und gesellig.«
Für seinen Humor war sein Vater nicht gerade bekannt. Eher für seinen Fleiß und seine ständige Betriebsamkeit. Er arbeitete von früh bis spät und war immer auf den Beinen. »Was der Sprüngli schafft, mit seinen fünfzig Jahren«, hatte vor Kurzem Ratsherr und Konditor Vogel, sein Chef, gesagt, »das gelingt zwei jungen Gesellen zusammen nicht.« Nur lachen sah man den alten Sprüngli mit seiner breiten Stirn, dem immer noch dichten, dunklen Haar und dem kurzen Hals, der seiner Gestalt etwas Gedrungenes, Bulliges verlieh, selten. Für den Humor war im Hause Sprüngli eher die Mutter zuständig.
»Also los! Wir sind ja schließlich auch nicht zum Vergnügen da.« Der Schiffer sprang aufs Boot und nahm seinen Platz links im Heck ein, während vorne schon sein Kollege stand und das lange Ruder nach rechts über den Bug hinausstreckte. »Nicht wie die da drüben«, fügte er hinzu und zeigte mit dem Kopf hinüber zu einem zweiten Boot etwas weiter draußen auf dem See, das gerade von zwei ebenfalls stehenden Ruderern an ihnen vorbeigesteuert wurde.
Auch Rudolf sah wie alle anderen hinüber. Zwei Passagiere saßen in dem Weidling, ein Mann mit dem Rücken zur Fahrtrichtung und ihm gegenüber ein hübsches Mädchen, das vielleicht seine Tochter war. Er trug ein weißes Hemd unter dem dunklen Wams und um den Hals ein rotes Tuch. Neben ihm lag ein Akkordeon auf der Sitzbank. Auch das Mädchen hatte ein Instrument bei sich, das in ein Tuch geschlagen war. Der Form nach musste es ein Hackbrett sein. Auch sie trug ein rotes Tüchlein um den Hals, über das ihre zu Korkenziehern gedrehten schwarzen Locken fielen. Ihr Strohhut war mit einer rosa Seidenschleife unter dem Kinn gebunden und ihr Gesicht hinter einem papiernen Fächer verborgen, der mit Musiknoten bemalt war. Wenn sie von einer Seite zur anderen nacheinander gesungen oder gespielt wurden, mussten sie wohl eine Melodie ergeben. Rudolf hätte sie nur zu gern gehört. Und am liebsten mit der Stimme dieses Mädchens vorgetragen, von dem er nur das Haar und ein Paar ebenso dunkler Augen sah. Rudolf spürte ein seltsames Kribbeln im Bauch, als kitzelte ihn etwas von innen. Es musste etwas mit dem Mädchen zu tun haben, das ihr Gesicht immer noch hinter dem Fächer verbarg. Sie war bestimmt so schön wie das Schneewittchen aus dem alten Märchenbuch. Oder noch schöner.
Die Schiffer hängten ihre Rudernägel in die Seite des Kahns, damit die Ruder eine Führung hatten.
»Ist das nicht der Feuerwächter zu St. Peter mit seiner Tochter?«, rief der Kollege vom Bug.
Das Mädchen bemerkte, dass die Schiffer und die Gehilfen an Land zu ihr hinübersahen, und winkte ihnen freundlich zu. Ihr Vater nahm das Akkordeon zur Hand und spielte einen fröhlichen Ländler an.
»Darf ich mit nach Küsnacht fahren, Vater?«, rief Rudolf schnell, während der Kahn schon fast ablegte.
»Wolltest du nicht mit Heini an den Platzspitz zum Fischen?«, fragte sein Vater.
»Das schöne Meitli hat ihm den Kopf verdreht«, zog der Schiffer ihn auf. »Er möchte halt auch einmal bei der Hochzeit mit ihr tanzen, gell, Ruedi?«
»Kannst du denn schon tanzen?«, fragte Ueli. »Bei deinem Vater kannst du es jedenfalls nicht gelernt haben. Den habe ich noch nie bei einem Tanz gesehen.«
»Dann steig ein«, rief sein Vater, »aber schnell, wir müssen los.« Dass die anderen sich über ihn lustig machten, schien ihn nicht zu kümmern.
Rudolf sprang ins Boot und es kam ein wenig ins Schaukeln, aber die beiden Schiffer hatten das Gleichgewicht mit ihren langen Rudern schnell wiederhergestellt.
»Dann wollen wir mal sehen, wer zuerst in Küsnacht ankommt«, rief der Ruderer im Heck und fand schnell einen gemeinsamen Rhythmus mit seinem Kollegen vorne.
Der Himmel klarte auf und die beiden Boote lagen fast gleichauf. Rudolf betrachtete das Mädchen immer so lange, bis sie seine Blicke bemerkte und ihn angrinste. Erst dann sah er weg. Rudolf hätte sie so gern spielen gehört. Aber sie waren ja nur Lieferanten der Confiserie Vogel und keine Hochzeitsgäste. Ab dem Ausladen waren die Wirtsleute für die Torten zuständig und der Vater würde gleich wieder zurückfahren.
In Küsnacht half Rudolf beim Ausladen. Die Musikanten waren schon auf dem Weg hinauf zum Gasthof davongeeilt.
»Eine Stange Bier, Sprüngli? Ihr müsst doch durstig sein nach Eurer Fahrt über den See.« Die Wirtin schenkte dem Vater ein Glas Bier ein, und Rudolf nutzte die Gelegenheit, um sich davonzustehlen und nach dem Festsaal zu suchen. Dort fand er das Akkordeon, einen Kontrabass, der an der Wand lehnte, und an der Stirnseite des langen, festlich eingedeckten Tisches saß das Mädchen. Ihr Haar war schwarz wie Ebenholz, und sie lächelte, als sie Rudolf entdeckte und ihn wiedererkannte.
»Ah, du bist das«, sagte sie. »Der Bursche aus dem anderen Boot.«
»Ich heiße Rudolf«, sagte er. »Und du?«
»Katharina«, antwortete sie. »Aber die meisten nennen mich Chatrina. Kannst du auch ein Instrument spielen?«
Rudolf schüttelte den Kopf. »Spielst du mir etwas vor?«
Sie zögerte nur kurz. »Na gut. Ich muss sowieso das Hackbrett einspielen und nach der Seefahrt noch einmal stimmen.« Sie zog zwei dünne Stöcke aus einem Stoffbeutel und schlug damit die Saiten an, zart und zugleich fest. Rudolf spürte wieder, wie es in seinem Bauch und auf der Haut zu kribbeln begann, bis hinauf zum Kopf. Eine Gänsehaut lief ihm über den Rücken, und plötzlich erschien ihm die Weise, die sie spielte, nicht mehr nur süß, sondern zugleich traurig. So traurig, dass ihm fast zum Weinen war.
»Was hast du denn?«, fragte sie und hörte auf zu spielen. »Du machst so ein komisches Gesicht. Gefällt dir das Lied nicht?«
»Doch, doch«, beteuerte Rudolf und presste die Lippen zusammen.
Sie sah ihn misstrauisch an. »Du hast doch irgendwas. Jetzt heraus mit der Sprache.«
»Ich … ich möchte dich heiraten«, stammelte Rudolf und wurde rot.
»Was, jetzt auf der Stelle?« Sie lachte.
»Nicht jetzt«, sagte Rudolf. »Wenn ich groß bin.«
»Wenn du groß bist, Rudolf, bin ich doch schon eine alte Jungfer.« Sie grinste. »Ich bin ja schon vierzehn. So lange kann ich nicht warten, bis du erwachsen bist.«
»Du musst aber.« Am liebsten hätte Rudolf Katharinas Hände genommen und ihr einen Kuss auf den Mund gedrückt. So ernst war ihm die Sache.
»Aber warum denn?« Sie legte die beiden feinen Klöppel zur Seite und sah ihn an.
»Weil ich nur dich will und keine andere.«
»Ja, Moment«, sagte sie. »Und ich werde gar nicht gefragt?«
»Willst du mich denn nicht?«
»Ich kenne dich doch gar nicht. Und ich bin älter als du. Das passt nicht zusammen.«
»Doch, doch, das passt, du wirst schon sehen. Wenn ich erwachsen bin, werde ich auch viel größer sein. Größer als du bestimmt. Und ich werde als Konditor und als Schokoladenmacher mein eigenes Geld verdienen. Ich werde gut verdienen. Und du wirst noch schöner sein als jetzt.«
»So?«, fragte sie grinsend. »Woher willst du das wissen, kannst du vielleicht in die Zukunft sehen?«
»Ich weiß es einfach«, behauptete Rudolf. »Nur warten musst du auf mich.«
Katharina lächelte. Sie schien ihn nicht ernst zu nehmen, doch Rudolf meinte es genau so, wie er es sagte.
Zusammen mit Katharinas Vater trat David Sprüngli in den Saal, mit diesem mürrischen Ausdruck im Gesicht, der die meisten Menschen einschüchterte, auch Rudolf. Mit gesenktem Kopf sah er von dem Mädchen zu Rudolf, dann wandte er sich zur Tür.
»Wir fahren!«, sagte er. Es war ein Befehl.
»Ade«, sagte Rudolf und folgte seinem Vater. Ein letztes Mal sah er zu Katharina, und sie schenkte ihm ein unbeschreiblich süßes Lächeln, das sich auch in ihren Augen spiegelte, die dunkel glänzten wie reife Kirschen.
* * *
»Ruedi!« Rudolf war auf dem Heimweg von der Schule, als der Apotheker ihn auf der Gasse abfing. Er wedelte mit der Zeitung und machte ihm Zeichen, dass er zu ihm kommen sollte.
»Was gibt es denn, Meister Flückiger?«, fragte Rudolf, als er die Elephanten-Apotheke betrat.
»Kennst du einen Herrn Suchard aus Neuenburg?«, fragte Flückiger. Rudolf verneinte.
»Suchard?«, fragte er. »Ist das ein Franzose?«
»Ein Schweizer«, sagte Flückiger. »Hier, pass auf.« Er zeigte mit dem Finger auf eine Textspalte. »Am besten liest du es selbst. Du kannst doch lesen, oder?«
Rudolf nickte. Dabei hatte er eigentlich noch nie Zeitung gelesen, sondern immer nur in der Schule von der Tafel. Es dauerte eine ganze Weile, bis er den Namen dieses Schweizers entziffert hatte, und dann sprach er ihn auch noch falsch aus. Er war noch beim Vornamen, als Flückiger ihm die Zeitung schon wieder entriss.
»Da musst du erst noch Französisch lernen, Ruedi. Aber wenn du ein Mann von Welt oder auch nur ein Mann mit Kultur werden willst, ist das sowieso unerlässlich.«
»Was ist denn jetzt mit diesem Herrn aus Neuenburg?«, fragte Rudolf.
»Also hör zu, was hier über diesen Mann steht: Philippe Suchard lernte bei seinem Bruder in Bern das Konditorhandwerk. Er ist also ein Kollege von deinem Vater sozusagen. Ein junger Kollege. Dann reiste er nach Amerika, um dort Schweizer Uhren und Stickereien zu verkaufen. Zurück von seiner Reise, eröffnete er letztes Jahr ein Süßwarengeschäft in Neuchâtel. Neuchâtel ist dasselbe wie Neuenburg, nur eben auf Französisch«, erklärte Flückiger. »Und jetzt pass auf, Ruedi: In diesem Jahr nun, Anno Domini 1826, gründete er in Serrières bei Neuchâtel die Schokoladenfabrik Suchard.«
Darum las der Apotheker ihm also aus der Zeitung vor. Suchard war ein Schweizer Schokoladenfabrikant!
»In der Fabrik des Herrn Suchard werden Maschinen eingesetzt, die mit Wasserkraft angetrieben werden. Erfunden hat dieser Fabrikant seine Maschinen selbst. Er ist also nicht nur Fabrikant, sondern auch Tüftler und Erfinder«, sagte Flückiger. »Und jetzt hör zu, was dieser Mann erfunden hat. Ah, wenn ich nicht schon einen Beruf hätte, könnte ich mir durchaus vorstellen, auch so herumzutüfteln und etwas zu erfinden.«
»Was hat er denn erfunden, dieser Suchard?«
»Warte, hier steht es: einen Mélangeur.«
»Und was soll das sein?«
»Ein Mélangeur ist ein Mischer. Damit vermengt er Kakao und Zucker, und zwar ein bisschen besser als ich in meinem Mörser, nehme ich an. Hier steht auch, wie dieser Mischer aussieht: Der Mélangeur ist ein flaches Granitbecken, das von unten angewärmt wird. Im Becken werden Granitwalzen hin- und herbewegt. Mit Wasserkraft, nicht mit der Hand. Na, was sagst du dazu?« Der Apotheker sah Rudolf über den Rand seiner Brille an.
»Dann wird er mit dem Mischer auch mehr Ertrag haben als Ihr mit Eurem Mörser«, antwortete Rudolf.
»Mit Sicherheit!«, sagte Flückiger.
»Und wenn er viel Schokolade macht, dann muss er sie auch nicht so teuer verkaufen wie Ihr Eure Ware.«
Der Apotheker sah ihn scharf an. »Heißt das, du findest meine Preise zu hoch?« Flückiger schnaubte. »Dabei habe ich dir einen Spezial-Ruedi-Sprüngli-Preis gemacht, als deine Mami krank war und du mit deiner Büchse mit den kleinen Münzen ankamst.«
War ihm der Apotheker jetzt böse? Rudolf kannte sich nicht mehr aus. »Ich«, er stockte. »Ich habe es doch nicht so gemeint.«
»Ist doch klar.« Flückiger klopfte ihm auf die Schulter. »Ich habe ja auch nur Spaß gemacht.«
Rudolf wollte sich die französischen Wörter alle merken, damit er zu Hause der Mutter davon erzählen konnte. Aber bis er am Mittagstisch saß, hatte er sogar den Namen des Erfinders vergessen, und den seiner Erfindung gleich dazu. Nur wie sein Mischer in etwa funktionierte, das hatte er sich sehr wohl gemerkt.
1830
Rudolf
Während der Nacht hatte Rudolf viele Male aus dem kleinen Fenster in der dunklen Kammer geschaut, ob nicht endlich ein Streifen Tageslicht zu erkennen wäre, aber es blieb schwarz, als hätte jemand ein Tintenfass über die Stadt ausgeschüttet. Vorsichtig drehte er sich wieder zur Wand. Wenn die knarrende Bettstatt seinen Bruder aufweckte, dann würden die Pantoffeln fliegen. Eigentlich konnte er sich auf die Mutter verlassen, dass sie ihn zur rechten Zeit weckte. Doch sobald der Schlaf ihm die Augen verdrehte, schreckte er wieder hoch. Gegen Morgen musste er dann doch irgendwann eingeschlafen sein, denn die Mutter rüttelte eine ganze Weile an seiner Schulter, bis er endlich die schweren Lider hob. Milchig graue Schlieren lagen jetzt auf dem Kammerfenster, und Rudolf war so müde, als sei er die ganze Nacht im Kreis gelaufen.
»Es ist so weit«, flüsterte die Mutter und schlug seine Decke zurück. Rudolf zog die Knie an, umschlang sie mit beiden Händen und machte sich rund. Dann sog er die Luft tief ein, blähte sich auf, um sich Mut zu machen, und schwang endlich die Beine aus dem Bett. Es knarrte, sein Bruder grummelte, wurde aber nicht wach. Heute war tatsächlich er, Rudolf, früher dran als David mit dem Aufstehen. Dass das für lange Zeit, womöglich für die nächsten drei Jahre so bleiben würde, bei diesem Gedanken zog Rudolf die Schultern hoch. Nur nicht daran denken.
»Du gewöhnst dich schon noch dran«, sagte die Mutter, als er durch die Küche hinaus zum Abtritt stolperte. »Der Erste in der Backstube ist sowieso immer dein Vater«, hörte er sie sagen. »Und das wird auch so bleiben.«
Nachdem er sich gewaschen hatte, stand sein Frühstück auf dem Tisch.
»Iss«, sagte die Mutter. »Du wirst es an deinem ersten Tag brauchen. Den Sohn vom Sprüngli werden die Gehilfen und die anderen Gesellen besonders genau im Auge behalten.«
»Aber ich kenne sie doch alle, den Ueli, den Simon und den Christoph. Schon ganz lange.«
»Und sie kennen dich. Aber jetzt bist du nicht mehr der kleine Ruedi. Jetzt bist du der Lehrling und sie alle stehen über dir. Wirst schon noch verstehen, was ich meine. Ab heute bist du der vierte Mann in der Backstube. Und der kleinste. Aber wenn sie es zu arg treiben, dann sagst du es dem Vater. Oder mir.« Sie strich ihm das Haar aus der Stirn.
»Und was ist das?«, fragte Rudolf. Neben ihm auf der Bank stand seine alte Tanse. Der Vater hatte ihm die Rückentrage gebaut, als er vier oder fünf Jahre alt gewesen war. Er hatte sie immer dann angelegt, wenn das Fuhrwerk Zucker und Mehl aus ganz großen Fässern für die Backstube in der Marktgasse lieferte. Woher die Kinder in der Nachbarschaft immer blitzschnell von diesen Lieferungen erfuhren, war ein Rätsel. Aus allen Gassen strömten sie herbei, während die Fässer abgeladen wurden, denn nicht alle Dauben waren zu hundert Prozent dicht und immer rieselte hier und da etwas Zucker heraus und blieb auf dem Pflaster liegen. Darauf stürzten sich die Kinder. Sie hockten sich unter das Fuhrwerk und krochen hervor, sobald die Gehilfen ihre Bütten mit Handschaufeln aus den großen Fässern gefüllt hatten und sie auf den Rücken hoben, um sie ins Haus zu tragen. Meist waren es Christoph oder Simon, die auch Rudolfs Tanse auffüllten und ihm auftrugen, ja nichts von der kostbaren Fracht zu verschütten. Aber weshalb hatte die Mutter sie heute vom Dachboden geholt?
»Schau doch mal rein«, sagte die Mutter.
Obenauf lag eine Jacke aus weißem Leinen, nicht ganz neu, aber frisch gewaschen und geplättet. Darunter eine weiße Bäckermütze und eine Schürze zum Binden.
»Wo kommt das denn alles her?«, fragte Rudolf.
»Wo wird es wohl herkommen?«, antwortete die Mutter. »Genäht habe ich es, und seit dem Frühling frage ich mich, ob du wohl noch hineinpassen wirst im September.«
Rudolf setzte zur Probe die Mütze auf. Ob es noch einen zweiten Konditorlehrling in Zürich gab, der seinen ersten Tag in der Backstube in frisch geplätteter und vollständiger Bäckerkluft antrat? Würden sie ihn nicht gleich dafür hänseln, wenn er so geschniegelt ankam?
»Na los, zieh dich um, und dann runter mit dir in die Backstube.«
* * *
Katharina
Katharina betrat vom Neumarkt aus das Haus mit dem alten Zunftzeichen über dem Eingang – eine aufgeklappte Schere –, lief die Treppe zum ersten Stock hinauf und öffnete wie jeden Tag die geschnitzte Tür zur Schneiderstube. Sie merkte gleich, dass irgendetwas anders war als sonst. Also blieb sie stehen und lauschte. Da war Frau Wyss, die im Anprobezimmer mit einer Kundin plauderte. Die beiden Näherinnen, die im Arbeitszimmer tuschelten, leise, wie immer, wenn Kundschaft im Haus war. Sonst hörte sie nichts, und das fühlte sich seltsam an. Sie musste ein bisschen überlegen, drehte sich einmal im Kreis und dann wusste sie es: Aus der Küche am Ende des Gangs kam nicht ein einziger Laut. Katharina ging der Stille nach. Auf der Anrichte stand wie immer der Vogelbauer aus geflochtenem Draht. Hänsli, der Kanarienvogel, saß auf der obersten Stange, auf der er meistens saß, lebendig und dem Anschein nach gesund, nur völlig stumm.