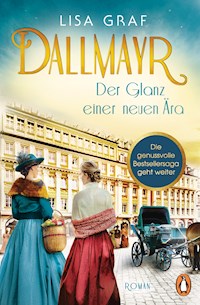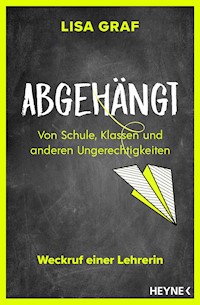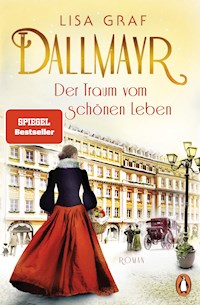1,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Raureif überzieht ihren toten Körper: Der fesselnde Regio-Krimi »Eisprinzessin« von Bestsellerautorin Lisa Graf jetzt als eBook bei dotbooks. Während sich in Ingolstadt und Umgebung die Blätter allmählich golden färben, fällt es Hauptkommissar Meißner alles andere als einfach, den Altweibersommer zu genießen. Ein Vermisstenfall erfordert seine ganze Aufmerksamkeit: Ist der Schuldige vielleicht im Kreis der Familie zu suchen? Immerhin zeigen erste Indizien, dass Charlotte Helmer und ihr Mann nicht glücklich zusammen waren. Doch die Ermittlungen werden durch allerlei Umbrüche auf dem Präsidium erschwert – als in einem Kühlhaus schließlich eine weibliche Leiche gefunden wird, wollen einige den Fall schnell als gelöst abhaken; doch Meißner und seine Kollegin Rosner ahnen, dass dies nur der Auftakt einer Familientragödie sein wird, deren Schatten tief in die Vergangenheit zurückreichen … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende Bayern-Krimi »Eisprinzessin« von Lisa Graf ist der dritte Band ihrer »Mord in Bayern«-Krimireihe um Kommissar Stefan Meißner – ein Lesevergnügen für alle Fans der Bestseller von Klüpfl Kobr und Andreas Föhr. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Während sich in Ingolstadt und Umgebung die Blätter allmählich golden färben, fällt es Hauptkommissar Meißner alles andere als einfach, den Altweibersommer zu genießen. Ein Vermisstenfall erfordert seine ganze Aufmerksamkeit: Ist der Schuldige vielleicht im Kreis der Familie zu suchen? Immerhin zeigen erste Indizien, dass Charlotte Helmer und ihr Mann nicht glücklich zusammen waren. Doch die Ermittlungen werden durch allerlei Umbrüche auf dem Präsidium erschwert – als in einem Kühlhaus schließlich eine weibliche Leiche gefunden wird, wollen einige den Fall schnell als gelöst abhaken; doch Meißner und seine Kollegin Rosner ahnen, dass dies nur der Auftakt einer Familientragödie sein wird, deren Schatten tief in die Vergangenheit zurückreichen …
Über die Autorin:
Lisa Graf, geboren in Passau, studierte Romanistik und Völkerkunde und ist Reisebuch- und Krimi-Autorin. Mit ihrer historischen Romanreihe über das Feinkost-Haus Dallmayr erreichte sie Spitzenplatzierungen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Die Autorin lebt im Berchtesgadener Land.
Die Website der Autorin: www.lisagraf-autorin.de/
Die Autorin bei Facebook: www.facebook.com/lisa.grafriemann/
Die Autorin auf Instagram: www.instagram.com/lisa.grafriemann/
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin ihre »Mord in Bayern«-Krimireihe mit den Bänden »Eine schöne Leich«, »Donaugrab«, »Eisprinzessin« und »Steckerlfisch«, der in Co-Autorschaft mit Ottmar Neuburger entstand.
Lisa Graf und Ottmar Neuburger veröffentlichten bei dotbooks außerdem gemeinsam den Thriller »Die Bitcoin-Morde«.
***
eBook-Neuausgabe Februar 2024
Copyright © der Originalausgabe 2013 Hermann-Josef Emons Verlag
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/KRIT GONNGON, andreashofmann 7777 und AdobeStock/dudlajzov
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98952-049-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Eisprinzessin« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lisa Graf
Eisprinzessin
Regionalkrimi – Mord in Bayern 3
dotbooks.
Der Panther
Im Jardin des Plantes, Paris
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe
so müd geworden, daß er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein großer Wille steht.
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
sich lautlos auf. – Dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder angespannte Stille
– und hört im Herzen auf zu sein.
Rainer Maria Rilke, 1902
Kapitel 1
Er hatte Angst, zu spät zu kommen. Er wusste, es würde heute passieren. Er hatte sie am Telefon belauscht. Obwohl sie nicht gewusst hatte, dass er in der Nähe war, hatte sie geflüstert. Und leise gelacht. Es tat weh, dieses Lachen zu hören. Sein Magen zog sich davon zusammen, und sein Bauch wurde ganz hart. Es war wie ein Krampf. Er zitterte, aber er lauschte weiter, und was er verstand, reichte, um ihn in Panik zu versetzen. Man musste etwas tun, man konnte es doch nicht einfach so geschehen lassen. Es hing von ihm ab. Er musste etwas tun. Kein anderer.
Er fuhr, so schnell er konnte, und war so aufgeregt, dass er nichts von der Kälte merkte, nichts von der Dunkelheit. Hätte man ihn gefragt, ob es draußen fünfzehn Grad plus oder fünf Grad minus hatte, er hätte es nicht sagen können. Auch nicht, ob es noch hell war, dämmerte oder schon dunkel war. Er beeilte sich und brachte die gesamte Fahrt über keinen einzigen klaren Gedanken zustande. Es war, als gehöre sein Kopf nicht mehr ihm, als reagiere sein Hirn nicht mehr auf seine Fragen. Er hatte keine Ahnung, was er tun würde, wenn er dort wäre. Warum er überhaupt hinfuhr, was er dort erleben würde, ob er sich versteckt halten oder zeigen würde, ob er etwas sagen oder schweigen würde. Er war schlecht vorbereitet auf die Aufgabe, die er übernommen hatte. Die Rolle passte nicht zu ihm, oder er passte nicht zu dieser Rolle, wie auch immer, sie war einfach eine Nummer zu groß für ihn. Wer war er schon, gerade er? Was würde er tun? Er hatte keine Ahnung. Aber die ganze Fahrt über, als sein Kopf ihm nicht mehr gehorchte und sein Bauch hart war wie ein Brett, wusste er eines: Er musste einfach dorthin.
Als er an die beschriebene Stelle kam, stellte er fest, dass er der Erste war. Kein Auto, kein Mensch zu sehen. Er nahm den unrhythmischen, aber gleichförmigen Verkehrslärm der Autobahn wahr und schlich sich zur Rückwand der großen Halle, tastete sich am Gebäude entlang, spürte den rauen Verputz, der sich da und dort vom Untergrund löste und wie Sand von seinen tastenden Fingerkuppen bröckelte. Er spürte die leichte Feuchtigkeit des Mörtels an seinen Händen und dann etwas Weiches, Felliges, das seine Beine streifte. Erschrocken sprang er zur Seite und sah eine nachtschwarze Katze mit zuckender weißer Schwanzspitze hinter der Halle in Richtung Brachland verschwinden. Gänsehaut kroch ihm vom Hinterkopf hinauf bis zur Schädeldecke. Die Sinneseindrücke überfielen ihn wie eine plötzliche Krankheit, er konnte sich nicht dagegen wehren. Obwohl niemand da war, spürte er diesen Zwang zu bleiben. Vielleicht hatte das Tier ihn warnen, ihm etwas mitteilen wollen, und er verstand es nicht. Er verstand es einfach nicht.
Also blieb er, wo er war, und zitterte vor Kälte und Angst. Er biss die Zähne zusammen und ertrug es. Und dann war sie plötzlich da. Er hatte weder Motorenlärm gehört noch gesehen, wie sie gekommen war, aber da war sie. Sie näherte sich der Stahltür an der Rückseite des Gebäudes und sah aus wie von einem schwachen Lichtstrahl angeleuchtet. Er konnte sich nicht erklären, woher das Licht kam, kalt wie das des Mondes in einer Vollmondnacht. Im Schatten der Wand stehend beobachtete er, wie sie die Tür mit einem Schlüssel öffnete und hineinschlüpfte. Einem Fächer gleich fiel das Licht auf den Boden vor der Halle. Er schlich näher und sah durch den Spalt in die Halle hinein.
Ein dunkelgrüner Koffer stand da und daneben eine Reisetasche, ebenso hässlich grün, mit braunem Ledergriff und Verstärkungen an den Ecken. Er konnte noch immer keinen vernünftigen Gedanken fassen, aber irgendeine Kraft, die außerhalb seiner selbst lag, stieß ihn in die Halle hinein, und eine fremde, kalte Stimme, die er als seine eigene erkannte, zischte: »Was tust du da?«
Sie erschrak, drehte sich blitzschnell zu ihm um, und er sah, dass sie Angst vor ihm hatte und ihr der Schweiß auf der Stirn stand. Und dabei war es so kalt hier. Ihr Gesicht schimmerte milchig, ihr helles Haar war ganz stumpf. Sie setzte sich auf ihren Koffer und schloss für einen Moment die Augen. Sie atmete heftig. Als sie den Kopf wieder hob und ihn ansah, hatte sie sich wieder in die Frau zurückverwandelt, die er kannte.
»Und du?«, fragte sie ihn und stand auf. »Was machst du hier?«
Er lief zur Tür, knallte sie zu und zog den Schlüssel ab.
»Was soll das?«, fuhr sie ihn an und hob die Hand, als wollte sie ihn schlagen.
Er fing ihre Hand ab, packte sie an beiden Armen, schob sie zurück ins Innere der Halle. Sie schrammte gegen das erste Regal, er hörte einen dumpfen Zusammenprall, dann sah er, wie sie stolperte. Er schob sie weiter, während sie versuchte sich aus seinem Griff zu lösen und ihn in die Hand zu beißen. Da versetzte er ihr einen Stoß, und sie taumelte, schrie wütend auf und knurrte wie eine Raubkatze.
Sie wand sich aus seinen Händen, stürzte rückwärts zu Boden, dann lag sie da und rührte sich nicht mehr. Ihr Kopf war zur Seite gefallen. Als er sich über sie beugte, starrte sie ihn aus weit aufgerissenen Augen an. Auch ihr Mund stand leicht offen, aber sie sagte nichts mehr. Als er ihre Wange berührte, reagierte sie nicht. Ihr Kopf fühlte sich an wie eine Bowlingkugel. Er strich mit der Hand über das schmutzige Eisen, auf das sie mit dem Hinterkopf geschlagen war, spürte feine Holzspäne, Lackreste und dann diese sämige Flüssigkeit. Ihr Blut. Sie lag da, und ihre Augen starrten und sahen nichts mehr. Sie war einfach tot.
Kapitel 2
Die Leuchtanzeige an der Fassade gegenüber gab abwechselnd Uhrzeit und Temperatur an. Sechzehn Uhr dreißig. Fünfzehn Grad. Stefan Meißner zog den Reißverschluss seiner Lederjacke zu. Zu Hause hatte es mindestens zehn Grad weniger, und trotzdem fror er. Sein Temperaturempfinden kümmerte sich nicht um die Anzeige auf dem Thermometer. Im Hotel hatte er lange und heiß geduscht, aber sein Hemd unter der Jacke war einfach zu dünn. Beim Packen war er eher auf Spätsommer eingestellt gewesen.
Der Wind wirbelte die blonden Mähnen von drei jungen Frauen, die ihm entgegenkamen, wie in einem Werbespot einer Haarpflegefirma durcheinander. Er starrte auf ihre hautengen Blusen, in ihre hübschen Gesichter und glaubte, dabei etwas über sich selbst zu erfahren. Sie hingegen nahmen ihn gar nicht wahr. Flüchtig dachte er an einen Apfelbaum voller reifer, rotwangiger Früchte. Er atmete tief ihren Duft nach Jugend und Parfümerieabteilung ein. Da er dem blonden Dreigestirn nicht auswich, löste es sich für die Dauer eines Augenblicks auf, nur so lange, bis er hindurchgeschlüpft war.
Er würde ein paar Aufnahmen mit seinem iPhone machen und sie nach Ingolstadt schicken. Wenn Fischer gut gearbeitet hatte und alles so ausging, wie er jetzt dachte und hoffte. Er stellte sich ihre Gesichter vor. Das Gesicht seines Chefs, das des Neuen, dieses Idioten, der gedacht hatte, den Fall im Handumdrehen gelöst zu haben, und ihn, Meißner, wie den Versager vom Dienst aussehen lassen wollte. Vor allem aber interessierte ihn marlus Gesicht. Dass sie wie alle anderen im Präsidium auf den übereifrigen Supermann hereingefallen war, das hatte ihm einen richtigen Stich versetzt. Schöner wäre es natürlich, er könnte nach seiner Rückkehr einen Packen Polaroids mit Pathos auf den Tisch knallen und keine Pics, die man mit einem Fingerswitch geräuschlos auf dem Display weiterschiebt.
Er spazierte an der »Cristal-Bar« vorbei, auf deren Terrasse es trotz der frischen Temperaturen nicht einen freien Platz gab. Die Heizstrahler reichten nicht für alle Tische, aber den Leuten machte die Kälte anscheinend nichts aus. Als er an einem der Außentische vorbeiging, stand ein Pärchen auf, sie mit einem kurzen Jeansrock, ein winziges Stück ausgewaschenen blauen Stoffs, das eine Handbreit unter dem Po endete, und einer Wollstrumpfhose mit Lochmuster. Dazu Schuhe mit zehn Zentimeter hohen Keilabsätzen. Meißner überlegte, wie lange man trainieren musste, bis man sich darin gefahrlos fortbewegen konnte. Er wusste es nicht, hatte sich in seinem Leben noch nie mit dieser Frage beschäftigt und konnte sich immer nur vorstellen, wie es war, mit solchen hochhackigen Dingern umzuknicken. Höllisch wehtun musste das.
Er setzte sich. Der Tisch stand günstig. Meißner beobachtete das Treiben auf dem Platz, blickt hinüber zum Bahnhof, von dem tagsüber hundert Jahre alte Züge abfuhren. Als der Ober ihm sein Bier servierte, war alles gut. Fast gelang es ihm, sich hier ein wenig zu entspannen, tief im Süden, am Meer, und nicht an den Kollegen zu denken, von dem er annahm, dass er auch in diesem Moment wieder hinter Marlu her war.
Dieser »Alles ist gut«-Zustand dauerte keine zehn Minuten, dann spürte er schon wieder die Unruhe, die sich auch nicht mit einem Schluck Bier bekämpfen ließ.
Er konnte kaum glauben, was er da plötzlich sah, eine Szene wie aus einer Herbstkomödie, trotzdem sprang er automatisch auf, noch während er überlegte, ob es ein Ernstfall war und sich das Aufspringen überhaupt lohnte. Schnell, aber nicht besonders geschickt kam er auf die Füße, stieß mit seinem Oberschenkel gegen den Tisch, sodass das noch halb gefüllte Bierglas kippte, vom Tisch rollte, fiel. Meißner lief los. Keine zehn Meter von ihm entfernt hatte ein Mädchen einem älteren Mann das Herrentäschchen aus der Hand gerissen und wollte damit abhauen. Meißner hatte nie so ein Täschchen besessen, nicht einmal in den Siebzigern oder Achtzigern, als sie modern waren, aber vielleicht auch nur, weil er damals noch zu jung dafür gewesen war. Heute konnte man sich eigentlich nicht mehr damit sehen lassen. Außer vielleicht, man war ein alter Herr mit zu kleinen Manteltaschen.
Sehr gut, dachte Meißner, die kauf ich mir. Die Diebin drehte sich kurz um, sah ihm direkt in die Augen, taxierte seine Fitness, und Meißner glaubte, dass sie eigentlich schon verloren hatte. Er spürte seine Halsschlagader anschwellen, merkte, wie ihm der Schweiß ausbrach. Er würde sie erwischen, da war er sich sicher. Noch einmal drehte sie sich zu ihm um, lachte und beschleunigte. Der Abstand zwischen ihr und ihrem Verfolger wurde eher größer als kleiner, als sie in eine Seitengasse abbog. Es ging bergauf. Meißners Herz raste. Er hatte das Gefühl, als müsse er eine endlose Rolltreppe erklimmen, die abwärtsfuhr statt aufwärts, als müsse er gegen ihre Laufrichtung ansprinten. Die dunklen Locken der Taschendiebin wippten auf und ab. Ihr Kopf wurde immer kleiner. Schweißnass gab er nach fünf-, sechshundert Metern die Verfolgung auf. Er würde sie nicht mehr einholen. Unmöglich. Er sah noch, wie sie am Ende der Gasse nach links abbog, dann war sie verschwunden.
Er strich sich das Haar aus der Stirn, stopfte das weiße Hemd zurück in die Hose und zog sich die in die Schuhe gerutschten Socken wieder hoch. Wenigstens keine Blasen an den Fersen. Ihm blieb nur, in die Bar zurückzugehen. Der alte Herr sah ihm erwartungsvoll entgegen, aber Meißner zuckte die Achseln und konnte ihm nichts als seine leeren Hände zeigen. Der Mann war sichtlich enttäuscht. Der Kellner, der gerade die Glasscherben aufkehrte, fragte, ob er ihm ein neues Bier bringen sollte. Meißner schüttelte den Kopf, legte drei Euro auf den Tisch, nahm eine Serviette aus dem Spender und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
Er ging den breiten Boulevard weiter hinab, vorbei an einer Grünfläche mit Dattelpalmen. Die Häuser wurden niedriger, die Menschen auf den Straßen, der Verkehr und das Licht weniger. Über einer Eckkneipe stand in Leuchtschrift »Bar Europa«. Mit zwanzig Gästen war das Lokal fast voll. Auf dem Flachbildschirm neben der Theke lief ein Fußballspiel, das von Werbung für Waschpulver und Tiefkühlpizza unterbrochen wurde. Plötzlich schrien die Männer »Goool!«, doch der Ball rollte knapp am Tor vorbei ins Aus.
Nur mit einem Fuß betrat Meißner das Lokal, dann blieb er stehen und beobachtete die Szene. Einige der Gäste unterhielten sich, die anderen starrten auf den Bildschirm. Kein Mensch nahm Notiz, als er sein Handy in Position brachte und rasch hintereinander einige Fotos machte. Als ein Hocker an der Bar frei wurde, nahm er Platz.
»Sprechen Sie Deutsch?«, fragte er die Frau hinter dem Tresen.
Sie musterte ihn. »No, sorry«, sagte sie und schüttelte bedauernd den Kopf.
Kapitel 3
Der Herbst fing nicht gut an für Hauptkommissar Stefan Meißner. Sein erstes Unglück in diesem Herbst hatte die Form eines unwiderstehlich gutaussehenden, braun gebrannten und vor Gesundheit strotzenden Schwulen, der sein Kollege bei der Kripo Ingolstadt war und Elmar Fischer hieß, immer frisch gewaschen und gebügelt wirkte und ihm mit seiner übertrieben guten Laune nun schon seit Jahren auf die Nerven ging.
Als Fischer nämlich von seinem Urlaub auf Ibiza zurückkam, strahlend wie ein blank gewienertes Kreuzfahrtschiff auf der Jungfernfahrt, erklärte er, noch ohne dass ihn jemand danach gefragt hatte, er habe sich unsterblich verliebt.
»Was heißt hier unsterblich?«, fuhr Meißner den Kollegen unromantisch an.
»Na, so richtig halt, mit Haut und Haar, volle Kanne eben. Sieht man mir das etwa nicht an?«, antwortete Fischer.
»Doch.« Er sieht wirklich unverschämt gut aus, dachte Meißner, aber genau deshalb passt er, noch dazu mit seinem Superglück und seiner Superlaune, überhaupt nicht hierher. Er sah zu seiner Kollegin Marlu hinüber und stellte fest, dass Fischers Strahlen bereits auf sie abfärbte. Ach, die Liebe machte doch alle glücklich. Sogar als Zuschauer! Ganze Industrien lebten schließlich davon. »Gala«, »Goldenes Blatt«, Hollywood.
Fischer, so stellte sich heraus, hatte sich in einen Friseur verliebt. Allerdings nannte er ihn nicht Friseur, Bader, Haarschneider oder Coiffeur – dass ihm das nicht eingefallen war –, sondern Promifriseur.
»Deutscher?«, fragte Meißner wieder ganz prosaisch.
Fischer schüttelte den Kopf.
»Du wirst dich doch wohl nicht in einen Österreicher verliebt haben?«, fragte Meißner argwöhnisch.
»Quatsch. Spanier natürlich«, prahlte Fischer. »Ein Typ wie Pedro Almodovar, wenn dir der Name etwas sagt. Der Filmemacher, der in Hollywood –«
»Also ein etwas älterer Mann«, unterbrach ihn Meißner.
»Naja, was heißt schon älter? Und was spielt das Alter heutzutage überhaupt noch für eine Rolle?«
»Hallo?«, meldete sich Marlu aus ihrer kurzfristigen Erstarrung zurück. »Elmar hat sich verliebt! Und zwar unsterblich. Du bist doch nicht sein Vater, Stefan, also muss er dir den Mann auch nicht vorstellen und du nicht entscheiden, ob er zu alt für ihn ist. Jetzt freu dich doch einfach mal!«
Aber Stefan Meißner konnte sich kein bisschen freuen. Als hätte er es geahnt, gleich als Fischer mit dieser »Man s-Health«- Bräune im Gesicht und diesem unerschütterlichen Optimismus an seinem ersten Arbeitstag nach dem Urlaub ins Präsidium erschienen war. Als hätte er gewusst, dass es für ihn nichts Gutes bedeuten würde, wenn Fischer vor sich hin strahlte wie ein radioaktives Teilchen mit jahrhundertelanger Halbwertszeit. Als wäre ihm von Anfang an klar gewesen, dass das Glück dieses Götterboten auf ihn bestimmt nicht abstrahlen würde.
Dass es ihm im Gegenteil fast den Dolchstoß versetzen würde, das hatte er jedoch nicht geahnt, und es war von der Natur, dem Universum oder Gott ja auch gut eingerichtet, dass man manchmal Schlimmes ahnt, es aber dann doch nicht ganz so schlimm kommt. Wenn aber das ultimativ Schlimme naht, dann bleibt das Opfer meist so ahnungslos wie ein schlafender Säugling.
»Hast du denn auch ein Foto von deinem Promifriseur?«, fragte Marlu und übernahm gleich den Adelstitel von Elmar Fischers hispanischem Lover.
Natürlich hatte er – und nicht nur eines. Verträumt stöberte er durch die Fotoalben auf seinem Smartphone und suchte nach einem vorteilhaften und vor allem auch vorzeigbaren Foto seines Lovers. Die Nacktfotos am Pool schieden da schon mal aus.
»Jetzt schau doch auch mal«, drängte Marlu Meißner, also ging er zu den beiden hinüber und glotzte auf das Display, von dem ihm ein kahl rasierter Mittfünfziger entgegenlachte, der offensichtlich nicht im Entferntesten daran dachte, seinen Bauchansatz unter einem luftig geschnittenen, offenen Hemd zu verstecken. Ein grünes Krokodil prangte auf dem stahlblauen Poloshirt, aus dem Oberarme wuchsen, die für jeden Fitnesstrainer eine Herausforderung gewesen wären.
Meißner wusste, dass Marlu gleich irgendetwas Nettes über diesen Mann sagen würde. Frauen fiel in solchen Situationen immer etwas Artiges ein. War eine Kollegin beim Friseur gewesen: »Oh, du warst beim Friseur! Der Haarschnitt macht dich glatt zehn Jahre jünger.« Hatte sich Kollege Kellner in die erste Jeans seines Lebens gequetscht: »Hey, andere werden älter, aber was machst du? Hast du eigentlich eine Freundin?«
»Der sieht aber sehr sympathisch aus«, sagte Marlu.
Na also, dachte Meißner befriedigt. So hört sich das an, wenn man eigentlich enttäuscht ist, weil jemand lange nicht so toll aussieht, wie ein anderer es einem glauben machen will. Man lügt nicht wirklich, aber man sagt auch nicht unbedingt die Wahrheit. Sehr elegant. Doch Meißner wollte weder das eine noch das andere. Stattdessen wollte er sich gegen Fischers Bombenlaune zur Wehr setzen. Ein kleines boshaftes Teufelchen ritt ihn und flüsterte ihm ins Ohr: Hau drauf, würg ihm eine rein, jetzt tu’s schon! Deshalb sagte er: »Also, ich finde, der Typ sieht irgendwie aus wie ein Affe.«
Marlu verfiel augenblicklich in Schockstarre. Das Leuchten in ihren Augen war verflogen, sie sah ihn giftig an.
»Lieber Stefan«, sagte Elmar Fischer ziemlich ernst, »ich danke dir für deine Offenheit. Aber weißt du was? Bei Männern scheiße ich auf Schönheit. Schön bin ich schließlich selbst.«
Bravo, dachte Meißner bitter. Ein wirklich toller Typ, mein schwuler Kollege. Mehr Mumm als so manch anderer, der hier täglich ein und aus geht, und mehr Gefühl sowieso. Und abgesehen davon auch noch eine unleugbare Augenweide, schillernd und notorisch positiv.
»Alles, was ein Mann schöner ist als ein Aff, ist Luxus«, zitierte Meißner spontan aus der Weltliteratur.
»Geil! Wer hat das denn gesagt? Oder ist das von dir?« »Leider nein. Friedrich Torberg war’s, ein Österreicher.« »War er schwul?«
Kapitel 4
Mit Fischers Eröffnung war Meißners grandiose Pechsträhne losgegangen. Irgendwie wollte es in diesem Jahr für ihn einfach nicht rundlaufen. Für eine Midlife-Crisis war er eigentlich schon fast zu alt, wobei er ja mit allem ein bisschen spät dran war. Mit Fischers Glück hatte quasi sein Unglück angefangen, und dann kam auch schon der nächste Schlag. Das Schlimmste war der aber immer noch nicht, nur der Auftakt zu etwas noch Schlimmerem.
Manchmal geht es Schlag auf Schlag, da lässt sich das Leben nicht lange bitten, da haut es dann auch auf solche ein, die schon am Boden liegen, gnadenlos ist es dann, das Leben. Christen glauben in einer solchen Situation gern an eine Serie von Prüfungen, Esoteriker meinen, das Universum stelle ihnen Aufgaben, die es gelte, auf dieser Daseinsstufe zu meistern. Denn ohne Lösen der Aufgaben gibt es kein Weiterkommen, dann droht einem die Existenz als Salatkopf oder einsame Schildkröte.
Meißner jedenfalls begann ein bisschen christlich, ein bisschen esoterisch, aber vor allem ängstlich und mit einer guten Portion Selbstmitleid, sich als Hiob zu fühlen und furchtsam auf den nächsten Nackenschlag des Lebens zu warten. Er wusste es irgendwie, ahnte es voraus, obwohl er es weder im Urin noch in der kleinen Zehe spürte, eher ganz tief in den Eingeweiden, wo nach der chinesischen Medizin ja alles Unglück und ebenso alles Glück sitzt.
Der Tag hatte damit begonnen, dass er vor dem Rathaus beinahe über einen Wagen gefallen war. Über ein blaues Fahrzeug, das aussah wie ein Rasenmäher zum Aufsitzen oder einer von den kleinen Traktoren, mit denen im Winter Schnee geräumt wurde. Auf dem unkippbaren Kleintraktor saß ein Mann. Er trug einen beigefarbenen Blouson, hatte eine Halbglatze und rauchte, ohne die Hände dafür zu benutzen. Eigentlich war der Fahrer in seinem Wagen nicht zu übersehen, und doch war Meißner fast über ihn gestolpert. Wo war der jetzt so schnell hergekommen? Hatte er schon dagestanden, als Meißner aus der Altstadt auf den Rathausplatz hinausgetreten war? Seine Zigarette war halb geraucht, die Hände des Mannes steckten in den Taschen des Blousons. Meißner entschuldigte sich, aber der Mann schwieg, sah ihn nur an und sog an seinem dünnen Tabakstängel, der, wie Meißner jetzt sehen konnte, selbst gedreht war, mit zerknittertem Papier, durch das die Tabakbrösel schimmerten wie spitze Knie durch eine dünne Hose. Genau da hatte Carola angerufen und sich für den nächsten Tag, einen Samstag, mit ihm zum Joggen verabreden wollen. »Zum Joggen?«, hatte er sich gewundert. Er hatte gedacht, sie wolle sich vielleicht mit ihm unterhalten.
»Joggen, ja. Kann dir doch nicht schaden, oder?«, hatte sie geantwortet, und er hatte am Telefon unwillkürlich den Bauch eingezogen. Er und Joggen. Er hatte eher an das Stadtcafé gedacht, Cappuccino, dazu ein Stück Johannisbeer-Baiser oder Erdbeersahne, seinetwegen auch eine Bionade, Kombucha Cranberry oder Ingwer-Irgendwas, was Carola so gern bestellte. Gesunde Ernährung und Fitness, das alles war total wichtig für sie. Er war da ja eher der Genusstyp.
»Kann man sich denn beim Joggen überhaupt unterhalten?«, fragte er.
»Natürlich«, sagte sie, »man soll sowieso nur so schnell laufen, dass man, ohne zu schnaufen, noch mühelos reden kann. Bei dem Tempo funktioniert auch die Fettverbrennung am optimalsten.«
Also mussten sie nur noch beim gleichen Tempo Fett verbrennen und er nicht schon nach Luft japsen, während sie noch ganz relaxed dahintrabte, dann wäre alles gut.
***
Am Samstagmorgen kramte er im Schrank nach seinen Sportklamotten, fand, dass das Lauf-T-Shirt an den Hüften etwas spannte und seine Beine immer dünner wurden, was nicht gerade zur Verbesserung des Gesamtbildes beitrug. An den Schuhen, die er nach längerem Suchen endlich im Keller fand, klebten noch Erdbrocken und bräunliches Gras vom letzten Lauf, der vielleicht ein, zwei Jahre – zwei Jahre? – zurücklag. Mein Gott, warum hatte er nicht einfach Nein gesagt und ein Treffen im Café vorgeschlagen? Manchmal war er so langsam im Denken und im Erkennen, was er wollte, und vor allem, was er nicht wollte. Noch langsamer war er allerdings darin, seine späten Erkenntnisse auch noch in Sprache umzusetzen und seinem Gegenüber eine klare Ansage zu machen. Nur im beruflichen Umfeld gelang ihm das mittlerweile meistens, aber das hatte er sich auch wie eine Vernehmungstechnik antrainieren müssen. Privat galt diese erworbene Fähigkeit allerdings nichts. Da war er zu langsam, zu träge, zu wenig auf der Hut. Womöglich hätte er auch Ja gesagt, wenn Carola ihm Thaiboxen oder Pilates vorgeschlagen hätte. Da hatte er mit Joggen womöglich noch Glück gehabt, denn Carola war immer für Überraschungen gut.
Als er um halb zehn seinen Wagen bei der Tennisanlage des RTC abstellte, schien schon halb Ingolstadt entweder zu Fuß oder auf dem Rad draußen am Baggersee oder am Donau-Stausee unterwegs zu sein. Die vierzehn Grad, die das Thermometer in seinem Audi anzeigte, waren zwar nicht besonders verlockend, aber es war Samstag, die knappe Freizeit musste genutzt werden. Weil Meißner im Bett, beim Duschen oder beim Kaffeekochen zu sehr getrödelt hatte, war auch noch das Frühstück ausgefallen. Wahrscheinlich wegen des Kaffeeautomaten. Das Warnlämpchen seiner Saeco hatte ihm signalisiert, dass der Filter bis oben hin voll war. Aber statt ihn einfach zu entleeren, hatte Meißner das ganze Ding einer gründlichen Reinigung unterzogen, das abgestandene Wasser gewechselt und die Milchschaumdüse gründlich mit einer alten Zahnbürste gereinigt, bis er schließlich nicht einmal mehr Zeit hatte, seinen Kaffee auch noch zu trinken, wollte er nicht zu spät zu seiner Verabredung kommen.
Aber anscheinend war es nun Carola, die zu spät kam, denn er konnte sie nirgendwo entdecken. Er widerstand der Idee, auszusteigen und sich warm zu machen oder alternativ vor sich hin zu bibbern, und blieb im Auto sitzen, um weiter sein Klassikradio zu hören. Bayern 4. War ja niemand da, der sich über ihn hätte lustig machen können. Ein Schubert-Lied, gesungen von einem Menschen namens Fischer-Dieskau. Fast konnte er die verdrehten Augen von Kollegin Marlu oder Kollege Fischers ruckartig auf die Ohren gelegte manikürte Hände sehen, wenn er zum leeren Beifahrersitz hinüberschaute. Meißner war ein nicht übermäßig anspruchsvoller Klassikfan, sondern von vielem relativ leicht zu begeistern. Ein Staunender.
Da klopfte es, und als er den Kopf Richtung Seitenfenster drehte, sah er tatsächlich in zwei himmelwärts gedrehte Augen. Sie gehörten Carola. Er hatte das Radio so laut gestellt, dass Fischer-Dieskau wie eine Posaune auf dem Kirchturm sein Kunstlied schmetterte. Wahrscheinlich war es auch außerhalb des Wagens noch laut genug zu hören. Er stellte das Radio aus und sah Carolas Kopfschütteln nur noch aus den Augenwinkeln.
»Los, raus, du Sportler«, sagte sie, während er sich aus dem Sitz schälte.
Carola hatte eine gesunde Gesichtsfarbe und schwitzte bereits. Weit und breit kein Auto, das ihr gehört hätte. Sie war also schon von zu Hause hierhergelaufen, wobei sie den kleinen Konstantin in einem geländegängigen Fahrzeug, das wahrscheinlich so etwas wie einen Kinderwagen darstellen sollte, vor sich hergeschoben hatte. Drei Ballonreifen mit Alufelgen.
»Scheibenbremsen beidseitig und Hinterachsfederung. Das Ding heißt Joggster«, sagte Carola, als sie sein ungläubiges Staunen bemerkte.
Konstantin schlief wie ein kleiner Buddha, ein Fettröllchen zierte ganz ungeniert seinen Babyhals, während er hoffentlich von den schönen Dingen des Lebens träumte. Eine Elster krächzte ihr spottendes Schäck-schäck-schäck, und Meißner setzte sein Skelett in Bewegung und hoffte, dass nur er das unangenehme Knirschen seiner Gelenke hören konnte. Für die fünf Kilometer um den See müsste seine Kondition gerade so reichen.
Carola lief voraus und erzählte, dass Konstantin sich nun schon allein hochziehen und auch stehen könne, aber zur Fortbewegung immer noch alle vier Extremitäten benutze.
»Ich war auch ein Spätzünder beim Laufen«, sagte Meißner. »Das hängt mir wahrscheinlich bis heute noch nach.« Er konnte nicht erkennen, ob Carola das witzig fand, und hatte alle Mühe, mit ihr mitzuhalten. Eigentlich war ihm das Tempo zu schnell, aber das wollte er nicht zugeben. Mit Unterhalten war schon nach ein paar Metern nicht mehr viel, aber das hatte er sich ja schon gedacht.
Als sie am Tiergehege vorbeigelaufen waren, das Konstantin ebenso wie ihre Begrüßung verschlafen hatte, drehte Carola sich zu ihm um. »Ich muss dir was sagen.«
Meißner dachte sich noch nichts dabei. Er war auf nichts gefasst, er ahnte und roch nichts. Wieder einmal war er nicht auf der Hut.
Schwarze Tage haben die Angewohnheit, sich nicht anzukündigen. Man stolpert über sie wie über eine Bordsteinkante und schlägt der Länge nach hin wie ein Idiot. Alle anderen haben das Unglück natürlich längst kommen sehen und schauen einem nun genüsslich dabei zu, wie man sich mit blutigen Knien aus der Horizontalen wieder in eine menschenwürdige Position bringt.
Meißner lief neben Carola her wie ein ergebenes und außerdem hechelndes Hündchen, als sie ohne weitere Umschweife zum Punkt kam.
»Ich habe einen Vaterschaftstest machen lassen«, sagte sie.
Er wollte fragen: »Was, du? Kennst du deinen Vater etwa nicht?«, kapierte dann aber doch, was sie meinte. Und plötzlich wünschte er sich sonst wohin, zur Not sogar an den Start des Ingolstädter Halbmarathons oder in die Box-Fabrik, nur weg von hier. Es ging natürlich darum, wer Konstantins Vater war. Er, Stefan Meißner, langjähriger Ex-Lebensgefährte von Carola, oder Thomas, genannt Tom, ihr derzeitiger Partner. Konstantins Empfängnis hatte in der Zeit des fließenden Übergangs von einem Mann zum nächsten stattgefunden. Meißner war sozusagen der Heimathafen gewesen, während am Horizont, allerdings schon in Sicht- und Fühlweite, bereits der Mast der neuen, schöneren Segeljacht aufgetaucht war.
Weglaufen war zwecklos, eine Herzattacke vortäuschen lächerlich, weshalb ihm nur blieb, die schlichteste aller Fragen zu stellen.
»Und?« Doch er kannte die Antwort schon. Er konnte sie förmlich riechen, er konnte sie an Carolas Augen und an ihrer Körperhaltung ablesen. Sie war erschlafft, drückte Mitleid aus, das er im selben Augenblick, als er es wahrnahm, auch schon hasste.
»Thomas ist der Vater von Konstantin«, sagte sie, und Meißners Herz machte einen raschen Doppelschlag wie ein stolperndes Pferd. »Er freut sich so darüber«, schickte sie noch hinterher, als würde sie ihn mit dem aufgesetzten Bajonett noch einmal kurz piksen.
Ich hätte mich auch so gefreut, schrie es in ihm, aber Carola konnte es natürlich nicht hören, also redete sie einfach weiter.
»Du bist frei, Stefan«, war das Letzte, was er noch hörte, und es dröhnte in seinen Ohren wie der Paukenschlag zu Beginn von Beethovens Fünfter, der sogenannten Schicksalssymphonie. Er warf noch einen Blick in den Rennwagen. Konstantin hatte jetzt ein Auge geöffnet und sah ihn damit an, als habe er verstanden, worum es hier ging. Was er davon hielt, konnte Meißner nicht erkennen, aber er zwinkerte dem Kleinen freundlich zu.
Frei? Oh, süße Freiheit, schmetterte es in ihm. Er hatte ein Kind gewollt auf seine alten Tage, keine Freiheit – und jetzt erkannte er messerscharf, dass es mit dem Wunsch erst einmal vorbei war.
Er konnte nicht anders, als seinem imaginären Pferd die Sporen zu geben und zu laufen, davonzurennen und sich nicht mehr umzudrehen. Er hob die Hand und winkte Carola unbeholfen zu. Er war irgendwie nicht richtig im Kopf, einfach nicht normal, das war nun sonnenklar, aber das hatte er im Grunde schon immer gewusst und Carola wahrscheinlich auch. Warum sonst hatte sie ihn schließlich verlassen und sich von einem anderen ein Kind machen lassen? Andere Männer hätten das anders angepackt, hätten gewusst, wie man mit so einer Situation umging, was das sozial verträglichste Verhalten gewesen wäre. Aber er konnte jetzt einfach nicht anders. Und die Sache zu lösen war sowieso unmöglich. Er musste einfach nur weg. Der Schmerz, der sich in seiner Brust zusammenballte wie ein Tornado, löschte alles andere aus: den Baggersee, die Laufstrecke, halb Ingolstadt, seinen Meniskusschaden, seine zu kurzen Sehnen am Außenknie, die Plattfüße und das perfekte, wenn auch etwas kühle Samstagswetter gleich dazu.
Kapitel 5
Schon Ende September flog Strahlemann Fischer wieder nach Ibiza. Wie viele SMS, Chats, Mails, Skype-Anrufe, Handy- und Festnetztelefonate er in der Zwischenzeit mit seinem Promifriseur geführt beziehungsweise ausgetauscht hatte, das konnte man nur ahnen. Bestimmt Hunderte.
Die Liebe überlebte die ersten vier Wochen mit nicht nachlassender Intensität. Kriminalkommissar Elmar Fischer tat seinen Dienst wie eh und je und trug seine Hemden mit den psychedelischen Mustern in den gewohnten Neonfarben. Von einem dezenten Kleidungsstil hatte er noch nie etwas gehalten. Er pflegte sein Äußeres nun vielleicht noch ein bisschen aufwendiger als früher und wirkte nur manchmal und vorübergehend etwas abwesend und verträumt, aber das meinten seine Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch nur zu sehen, weil sie es eben gern sehen wollten. Insgesamt schien Fischer seine fünf Sinne beieinanderzuhalten und wirkte auch nicht unvernünftiger als sonst.
Umso überraschender kam für Stefan Meißner, der ihn sehr genau beobachtete, seine Ankündigung im Oktober, den Dienst quittieren zu wollen.
»Bist du verrückt geworden?«, war alles, was er zunächst dazu sagte. »Wir sind doch hier nicht im Schlachthaus oder in der Fleischfabrik. Mensch, Elmar, du bist Beamter. Du hast dich jahrelang für diesen Beruf ausbilden lassen. Du hast nichts anderes gelernt als Kriminaler, Beamter, Staatsdienst.« Konnte ein Mensch durch Liebe so schnell derart verblöden?
»Soll ich dir was sagen, Stefan? Ich scheiße auf den Staatsdienst und den Beamten. Ist mir alles nicht mehr wichtig beziehungsweise war es mir noch nie so wichtig wie dir.«
»Ah, ja, alles klar. Davon hab ich bisher aber noch gar nichts mitbekommen. Du hast immer den Eindruck vermittelt, der Job mache dir Spaß und würde dir auch liegen. Auch wenn’s nach außen nicht immer so aussah, habe ich doch das Gefühl gehabt, dass du hierhergehörst.«
Dass er auch für die Farbenpracht, Fischers Unkonventionalität, einfach sein gesamtes Anderssein, das konstant frischen Wind in den alten Backsteinbau brachte, dankbar war und in Zukunft nicht darauf verzichten wollte, sagte Meißner nicht. Das dachte er sich nur.
»Ach, weißt du, bei der Ingolstädter Kripo Bürokram erledigen, ab und zu Verbrecher jagen und ansonsten den Paradiesvogel geben, das hat schon was gehabt. Aber immer muss ich das nicht machen. Jetzt ist eben was anderes wichtiger, und beides zusammen geht nicht.«
»Wieso denn nicht?«, wandte Meißner ein. »Dein Promifriseur hat doch auch einen Beruf, sein eigenes Leben und seine Leute. Der würde doch auch nicht alles hinschmeißen wegen einer Beziehung, die jetzt wie lange geht?«
»Die Zeit spielt dabei überhaupt keine Rolle, Stefan. Ich weiß es einfach, dass das die große Liebe ist und ich mit diesem Mann leben will. Ist dir das denn selbst noch nie passiert?« Eine rhetorische Frage. Fischer starrte Meißner kurz an und redete dann weiter, ohne eine Antwort abzuwarten. »Und jetzt mal ganz ehrlich, Stefan. Wenn du Promifriseur wärst und in Ibiza in einer Sechs-Zimmer-Villa mit Pool, Spa und Hauspersonal leben würdest, würdest du dann tatsächlich in Betracht ziehen, deinen Beruf aufzugeben, deine Villa zu verkaufen und wegen eines Kripobeamten, seiner Stelle auf Lebenszeit und der Beamtenpension nach Ingolstadt überzusiedeln?«
»Vom Mittelmeer an die Donau und dann hier die Promifriseurszene aufmischen«, sagte Meißner, »wär das vielleicht nichts?«
»Njet«, antwortete Fischer und streckte seinen Daumen theatralisch nach unten.
»Das heißt no und nicht njet«, mischte sich jetzt Marlu ein, die an der offenen Tür stehen geblieben war. »Aber was willst du dort machen, ich meine, wovon willst du leben?«
»Er macht ein Detektivbüro für die Damen und Herren der Ibiza-Schickeria auf, die sich betrogen oder hintergangen fühlen oder sich einfach nur wichtigmachen wollen«, sagte Meißner.
»Oh, ja, ich kann mir Elmar echt gut als Privatdetektiv vorstellen. In einem Büro mit Deckenventilator, die Füße lässig auf den Schreibtisch gelegt und dabei gewandt in fremden Zungen parlierend.« Die Phantasie ging mit Marlu durch.
»Auf Ibiza haben bestimmt alle Wohnungen eine Klimaanlage«, vermutete Meißner. »Deckenventilatoren gibt’s in der ›Havana Bar‹ in Ingolstadt, und das wahrscheinlich auch nur wegen Hemingway und der Nostalgie.«
Elmar Fischer versicherte ihnen glaubhaft, dass sie sich um seine Zukunft keine Sorgen machen müssten. Er sei jung, schön und klug, und zur Not würde er eben noch eine Friseurlehre draufsatteln.
Meißner schüttelte den Kopf, konnte ihn aber anschließend dazu überreden, in einem Gespräch mit ihrem Vorgesetzten Czerny die Möglichkeit einer vorläufigen längeren Beurlaubung zu besprechen. Obwohl Fischer die Vorstellung zunächst nicht schmeckte – er war nicht der Typ für Reißleine und doppelten Boden, sondern eher für einen Salto mortale –, versprach er Meißner, um der alten Zeiten willen um den Termin zu bitten und ihn auch wahrzunehmen.
Doch Fischer hatte sich ganz umsonst Sorgen gemacht. Czerny weigerte sich, einer so langen Beurlaubung zur Klärung von Fischers Liebesangelegenheiten zuzustimmen. Es würde für Elmar Fischer also keine Schonzeit geben, in der er sein neues Leben antesten, seine Liebe leben und herausfinden konnte, ob es sich bei ihr wirklich um die eine, die große, die unsterbliche handelte oder doch nur um ein Strohfeuer. Er musste ins kalte Wasser springen, aber genau das hatte er ja von Anfang an gewollt.
***
Auf Fischers Abschiedsfeier wurde ihnen der neue Kollege vorgestellt, Kommissar Axel Brunner aus Nürnberg, Franke wie sein Vorgänger, aber doch aus gänzlich anderem Holz geschnitzt. Und das hatte nicht nur, aber auch etwas mit seiner sexuellen Orientierung zu tun.
Brunner war Ende dreißig, ledig, an der Langhantel groß geworden und scharf auf alles, was zwei X-Chromosomen besaß und unter fünfundvierzig war. Dass er bei den Kollegen gut ankam, das hätte Meißner ihm ja noch gegönnt, aber als er sah, dass Marlu im Handumdrehen seinem Charme zu erliegen drohte, regten sich bei ihm die ersten massiven Ressentiments gegen den Neuen. Dass der Tom-Selleck-Verschnitt ihm in den nächsten Monaten seinen Beruf fast vergällen und ihn selbst zu quälenden Selbstzweifeln und an den Rand der Verzweiflung bringen sollte, das hätte Meißner sich zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht träumen lassen.