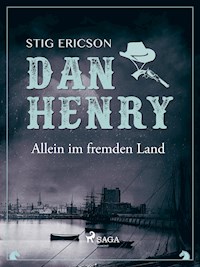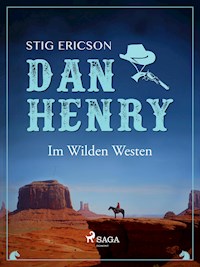Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Dan Henry
- Sprache: Deutsch
Dan Henry, 1874 Klarinettist bei der Königlichen Leibgarde in Stockholm, wird in eine Schlägerei verwickelt. Er meint, dass niemand an seine Unschuld glauben wird und flieht. Nach einer abenteuerlichen Wanderung durch Schweden findet er Unterkunft bei einer Tante. Doch die Welt lockt und Dan Henry folgt dem verwegenen Matrosen Max nach England, um von dort aus nach Amerika zu gelangen.Biografische AnmerkungStig Ericson, 1929-1989, schwedischer Schriftsteller und Jazzmusiker, studierte auf Lehramt und betrieb nebenbei seinen eigenen Verlag "Två Skrivare". 1970 wurde er mit der Nils-Holgersson-Plakette ausgezeichnet. Die meisten seiner Kinder- und Jugendbücher spielen sich im Wilden Westen ab - hier versucht er, dem Leser das Schicksal und Leben der nordamerikanischen Indianer einfühlsam näherzubringen.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stig Ericson
Dan Henrys Flucht
Saga
Erster Teil
Der Aufbruch
1
Die ganze Geschichte, die ich hier erzählen will, fing in Hasselbacken an.
Hasselbacken ist ein großes Sommerrestaurant und liegt auf Djurgarden, einer von Stockholms vielen Inseln. Damals war es angeblich eines der besten Restaurants im ganzen Norden. Im Park standen Tische, lange, fröhlich geschmückte Veranden liefen rings um das Restaurantgebäude, und der Speisezettel hatte mindestens ein Dutzend Gerichte aufzuweisen.
Der Punsch floß in Strömen, die Militärkapelle spielte, man amüsierte sich ...
Und wenn der Wind aus Westen kam, konnte man riechen, daß der Hafen in der Nähe lag — der Gestank von Teer, Rauch und Fäulnis vermischte sich dann mit Zigarrenrauch, Parfüm und Essensgerüchen.
Ich war damals Musiker. Oder genauer gesagt Musikeleve. Ich gehörte dem Musikkorps der Svea Leibgarde an und spielte die zweite Klarinette.
Der Abend, an den ich denke, war ungewöhnlich kalt und feucht. Es muß ungefähr Mitte August gewesen sein, denn die Kutsche wurde in der Nacht zum ersten September überfallen, und das hier war etwa eine Woche vorher.
Ich erinnere mich sehr gut an jenen Abend. Zwischen den weißen Marmortischen glänzte der Kies feucht im Gaslicht. Obwohl es ein Sonntag war, hielten sich nicht besonders viele Leute im Park auf.
Ich hatte steife Finger, und es war beinahe unmöglich, der Klarinette die richtigen Töne zu entlocken. Obwohl ich die Unterlippe gegen das Rohr preßte, bis die Mundmuskeln schmerzten, wurden die meisten Töne zu tief. Eine ordentliche Resonanz hatten sie auch nicht, sie schienen im Mundstück steckenzubleiben.
Aber ich war nicht der einzige, der fror.
»Verflucht nochmal, Schnee in der Luft«, sagte einer der älteren Musiker, während wir zwischen zwei Musikstücken die Notenblätter auswechselten. »Teufel auch, ein alter Feldwebel ist für solche Strapazen nicht gebaut. Regelrechter Winter — und dann noch Tannhäuser. Verdammt!«
Das war die allgemeine Stimmung. Doch auch dieser Abend ging vorüber, die Uhr schlug elf, und wir spielten den Schlußmarsch.
Das war das letzte Mal, daß ich bei der Svea Leibgarde mitspielte, aber das ahnte ich damals natürlich nicht.
Der Musikdirektor — er hieß Rosbeck und war sicher ein ehrenwerter Mann — bedankte sich mit seiner üblichen eleganten Verbeugung für den spärlichen Applaus, dann verschwand er in der wartenden Pferdedroschke.
Es war ungewöhnlich still, während wir die Instrumente zerlegten und zusammenpackten. Wir hatten einen langen, strapaziösen Tag hinter uns, mit Parade, Gottesdienst und anschließend sechs Konzerten.
Gabriel gab eines seiner üblichen Späßchen zum besten:
»Tja, Jungs, wirklich schade, daß wir nicht länger tuten dürfen. Aber das Leben ist hart und voller Prüfungen.«
Gabriel hieß eigentlich ganz anders. Aber wenn er in sein Waldhorn blies, blähten sich seine Backen so, daß er sehr an ein Bild des Erzengels Gabriel erinnerte, das im Offizierskasino unserer Kaserne hing. Er war lang und blond und steckte voller Schabernak. In diesem Sommer war er siebzehn geworden.
»Du kannst ja dein Wursthorn nehmen und in den Wald hinausziehen, wenn du nicht zufrieden bist«, schlug eine freundliche Seele vor. »Aber paß auf, daß du keine Lerchen aufschreckst!«
Gelächter.
Aber Gabriel konnte Gelächter vertragen. Er grinste nur zurück und sagte:
»Was seid ihr für Langweiler! Hat denn keiner von euch Lust auf eine fidele Runde?«
»Draußen im Wald, meinst du wohl?«
»Wenn du eine Halbe spendierst«, sagte der Lange Gustav und hielt das Posaunenmundstück wie ein Schnapsglas hoch. »Oder einen Grog. Nach einem Abend wie heute könnten wir das brauchen.«
Gabriel lud die anderen oft ein. Von uns Jüngeren hatte er am häufigsten Geld. Er wohnte nicht in der Kaserne, sondern bei seiner Mutter, die eine Bügelstube in Skeppargatan hatte.
Ich weiß nicht mehr genau, wie ich eigentlich zu der Ehre kam, aber kurz darauf saßen jedenfalls Gabriel und der Lange Gustav und ich in der »Altmännerkiste«, wie wir das Café damals nannten.
Drinnen im Café war es rauchig, laut und warm. Gabriel bestellte Grog, und wir tranken und fühlten uns wohl, schwatzten und lachten.
Der Lange Gustav redete am meisten. Er war lang und dünn und ungefähr ein Jahr älter als Gabriel. Er hatte dunkles Haar und eine recht kräftige Nase und hätte wirklich gut ausgesehen, wenn er nicht so auffallend schlechte Zähne gehabt hätte.
Als wir unsere Gläser geleert hatten und aufbrechen wollten, kam ein kleiner, berauschter Mann an unseren Tisch. Er sah sehr zufrieden und vergnügt aus. Seine Backen glänzten, er war dick und glatzköpfig und hatte eine weiße Weste an. Er legte seine Hand auf die Schulter des Langen Gustav und sagte:
»Svea Leibgarde, das sind prima Jungs! Und spielen können sie! Ihr spielt königlich, Jungs! Und darum laß ich für jeden eine Halbe springen.«
Ehe jemand von uns sich auch nur äußern konnte, war er schon wieder an seinen Tisch zurückgekehrt, wo mehrere beleibte Männer ihre Gläser zu uns erhoben und winkten und grinsten. Wir winkten zurück.
Der Lange Gustav zwirbelte seinen Schnurrbart und sah zufrieden aus.
»Zu einer Halben Punsch kann man ja schlecht nein sagen.«
Ich fühlte mich allmählich etwas benommen. Der Uniformkragen schabte, der Zigarrenrauch brannte in den Augen. Ich sah die Frauengestalten auf der französischen Stofftapete an und wünschte, daß ich nicht mitgekommen wäre.
Aber wünschte ich das wirklich, damals?
Darüber habe ich viel nachgegrübelt. Ich meine, wenn ich an jenem Abend nicht in das Café mitgekommen wäre, dann hätte sich mein Leben vermutlich völlig anders gestaltet. Dann wäre ich jetzt vielleicht ein pensionierter Musikdirektor — und nicht ein alter Abenteurer oder Reporter oder wie man es nennen soll, reich an Erinnerungen und Erlebnissen, aber arm an allem übrigen.
»Euch geht’s gut«, sagte die Kellnerin, als sie mit dem Punschtablett kam. »Zu so später Stunde noch Punsch spendiert bekommen! Allerdings weiß ich nicht recht, ob einer, der noch nicht trocken hinter den Ohren ist, so etwas überhaupt trinken darf!«
Sie sah mich an und lächelte ein wenig. Sie war ziemlich hübsch. Aber sie sah müde aus, und kleine Schweißtröpfchen standen ihr auf der Stirn.
»Schließlich spielen nicht alle so schön wie wir«, sagte Gabriel.
»Und so gefroren wie wir haben auch nicht alle«, sagte der Lange Gustav. »Wir brauchen ein bißchen Wärme.« Er streckte sich und zwinkerte ihr zu. »Sag mal, könnten wir nicht ...«
Doch sie war schon zwischen den Tischen verschwunden.
Der Punsch war nicht warm, sondern kalt. Aber er schmeckte gut und erfrischend. Wir tranken und fühlten uns sehr wohl. Dann nickten wir den beleibten Männern zu und gingen.
Draußen war es dunkel. Und kalt. Wahrscheinlich waren wir ziemlich wackelig auf den Beinen, als wir die Treppen hinuntergingen. Im Nebel sahen die vereinzelten Straßenlaternen wie gelbliche Wattebäusche aus.
Trotz der späten Stunde waren noch ziemlich viele Leute unterwegs. Ab und zu rollte eine Mietdroschke zur Stadt hinein, und von den Buden hinten auf dem Tiergartenfeld drang Gelächter und betrunkenes Grölen.
»Wollen wir noch hin?« schlug Gabriel vor.
»Da treiben sich jetzt nur noch Trunkenbolde und Gesindel herum«, meinte der Lange Gustav. »Gehen wir lieber in die Stadt.«
»Das finde ich auch«, sagte ich.
Damals war ich noch sehr unselbständig.
Langsam gingen wir auf die Tiergartenbrücke zu. Wir hatten dunkelblaue Uniformen mit gelben Kragen und blanken Knöpfen an.
2
Ich habe viel darüber nachgedacht, was für ein Mensch ich an jenem Abend war, als Gabriel und der Lange Gustav und ich unter den Ahornbäumen des Tiergartens gingen und lachten und herumalberten und Punsch aufstießen.
Ich nahm mich selbst sehr ernst, und das machte meine Lage natürlich noch schwieriger.
Seit ungefähr einem Jahr saß mein Vater im Gefängnis. Ein paar aus dem Regiment erinnerten mich oft daran — besonders ein langer Leutnant mit schmaler Nase und hoher Stirn; ich haßte ihn unsagbar — aber die meisten erwähnten es nie. Ich glaube, daß viele überhaupt nichts davon wußten; ich war ja auch nur ein kleiner Musikus unter vielen anderen.
Aber diese Tatsache hatte mich schweigsam und verklemmt gemacht, und auf andere wirkte ich sicher recht langweilig. Ich hatte das Gefühl, daß sich niemand besonders viel aus mir machte. Aber wenn ich die Möglichkeit hatte, mit den anderen zusammen etwas zu unternehmen, so tat ich es gern. Wie an diesem Abend, als wir da unter den Bäumen herumgrölten und Gabriel plötzlich gegen einen Baumstamm prallte und ausrief:
»Au, zum Teufel!«
Wir blieben stehen.
»Das tat verdammt weh«, sagte Gabriel.
»Viele Sachen tun weh«, sagte der Lange Gustav. »Zu enge Schuhe tun weh. Und Zahnschmerzen tun weh, daß man halb wahnsinnig wird. Und wenn du einen Tritt in den Hintern kriegst, das tut auch weh!«
»Und trotzdem ist das Leben herrlich! Verflucht nochmal, Jungs, wir müssen was singen.«
Schmachtend und hingebungsvoll sangen wir »Im schönsten Wiesengrunde«, dreistimmig. Gabriel hatte einen schönen Tenor und sang die erste Stimme. Ich hatte zwar die Klarinette dabei, holte sie aber nicht aus dem Futteral. Es gelang mir trotz meines Stimmbruchs etwas herauszupressen, was einer Baßstimme ähnelte.
Wir fanden es sehr schön und stimmungsvoll. Als wir fertiggesungen hatten, sagte Gabriel:
»Mir brummt der Schädel immer noch von dem Zusammenstoß.«
Wir gingen weiter auf die Tiergartenbrücke zu. Der Lange Gustav ging voran. Auf einmal blieb er stehen. »Seht mal da vorne«, sagte er. »Sieht mir ganz nach Unannehmlichkeiten aus.«
Etwas weiter vorne waren neben einer Laterne drei Gestalten zu erkennen, zwei große und eine kleinere. Eine rauhe Stimme brüllte:
»Sieh dich vor, wenn du erwachsenen Leuten begegnest, du kleine Rotznase. Ich werd’s dir schon beibringen, du ...«
Wir gingen näher hin und erkannten die roten Kragen.
»Göta Garde«, stellte der Lange Gustav grimmig fest.
»Und der Kleine da scheint einer von den Unsrigen zu sein. Da müssen wir etwas unternehmen.«
Zu jener Zeit gab es drei Leibgarden in Stockholm: Svea, Göta und die Leibgarde zu Pferd. Und zwischen diesen dreien herrschte ständige und bittere Feindschaft.
»Laß mich los!« schrie der kleine Sveagardist, als eigner der anderen seinen Arm packte und ihn zu verdrehen begann.
»Oh nein, Freundchen«, sagte der andere Rotkragen, der seinem Dialekt nach aus Südschweden kam. »Zuerst mußt du schon noch lernen, dich höflich zu benehmen, mein kleiner Kanarienvogel!«
Jetzt trat der Lange Gustav vor.
»Laß den Jungen laufen«, sagte er.
Der Südschwede drehte sich rasch um und erhob die Faust. Zuerst musterte er den Langen Gustav wortlos, doch dann breitete sich ein überlegenes Grinsen auf seinem Gesicht aus.
»Wenn es in meinem Maul so scheußlich aussehen würde, dann hielte ich es lieber geschlossen«, sagte er spöttisch.
»Paß auf, du Bauernlümmel!«
An diese Worte kann ich mich noch klar und deutlich erinnern. Dann ein wildes Handgemenge, Schläge, Ächzen, Flüche, Stiefel, die im Kies nach Halt suchten. Und ich werde nie vergessen, wie der Südschwede aussah, als er unter der Laterne im Kies lag, unbeweglich, das Gesicht voller Blut.
Der Kleine und der andere Götagardist waren im Dunkeln verschwunden.
Der Lange Gustav fuhr sich mit den Fingern durchs Haar und hob seine Uniformmütze vom Boden.
»Der wird so schnell nicht wieder sein Maul aufreißen, das Schwein.«
Gabriel hockte sich neben den regungslos daliegenden Gardisten.
»Ja, jetzt hält er’s Maul, der Hasenfuß. Aber er liegt so still. Hoffentlich ist er nicht ...«
Er zögerte, das Wort auszusprechen. Der Lange Gustav rieb sich das Kinn und spuckte aus. In einem Mundwinkel klebte Blut.
»Blödsinn! So ein Bauernschädel verträgt schon einiges. Jetzt hauen wir ab.«
Im Laternenlicht sah sein schmales Gesicht blaß aus. Es war ihm anzusehen, daß er allmählich Angst bekam. Er vermied es, den Südschweden anzuschauen.
»Jetzt hauen wir ab, habe ich gesagt ...«
Ich saß im Kies und preßte mit den Armen die Knie gegen meinen Leib. Ich hatte einen Schlag gegen den Magen abbekommen, der immer noch höllisch schmerzte. Aber ich hörte deutlich, was die anderen sagten. Und ich sah, wie der Schatten des Langen Gustav länger wurde.
»So kommt doch.« Gabriel war aufgestanden.
»Die Sache gefällt mir nicht. Ich glaube, er braucht ...«
»Dahinten sind sie!« gellte jetzt eine durchdringende Stimme durch die Dunkelheit.
Eilige Schritte näherten sich von der Brücke her, Schritte von vielen Füßen.
»Verflucht«, sagte der Lange Gustav.
Es klang beinahe wie ein Schluchzen. Er begann zu rennen. Gabriel folgte ihm.
»Komm, Dan. Wir verduften.«
Und sie verschwanden im Dunkeln.
»Wartet doch ...«
Mir wurde schwarz vor den Augen, als ich aufstand. Der Südschwede hatte sich noch nicht gerührt. Die rennenden Schritte waren jetzt schon ganz nahe.
»Da ist einer von ihnen! Packt ihn!«
Ich fing an zu rennen. Ich hatte schreckliche Angst. Und das Gefühl, daß der Lange Gustav und Gabriel mich im Stich gelassen hatten, stach mir quälend ins Bewußtsein.
Ich stolperte durch die Dunkelheit vorwärts. Sie waren mir dicht auf den Fersen, ich konnte das Stampfen ihrer Stiefel hören. Ein Gefühl der Panik wollte in mir aufsteigen, schon spürte ich eine Hand auf meiner Schulter ...
Und erst vor kurzem hatten Gabriel und der Lange Gustav und ich herumgealbert und gelacht und gesungen und das Leben herrlich gefunden.
Im Park waren immer noch Leute unterwegs. Dunkle Schatten bewegten sich im Nebel unter den Laternen, für mich Schreckensgestalten, die sich gleich auf mich werfen würden.
Ich überquerte den Fahrweg und stürzte zum Ufer hinunter. Keuchend stand ich auf dem Dampfersteg. Hier unten stand auch eine Laterne, so daß mich meine Verfolger trotz des Nebels erkennen konnten.
»Da ist er ...«
Rufe und Schritte zwischen Bretterzäunen und Schuppen.
Eigentlich wollte ich mich ins Wasser werfen, statt dessen lief ich nach links an der Kaimauer entlang. Unten im Wasser lagen Boote und Schiffe; ich kann mich noch gut an dunkle Schiffsrümpfe, Teergeruch und knarrendes Tauwerk erinnern.
Eine Leine kam mir in den Weg, ich stolperte und fiel nach vorne. Mit den Händen konnte ich den Sturz noch auffangen, aber meine Handflächen brannten wie Feuer. Immer noch waren sie hinter mir her. Sie kamen mir wie böse Geister vor, wie Gestalten aus einem Alptraum, wie ein Wolfsrudel, wie etwas, dem ich nie, nie entrinnen würde ...
Es gelang mir aufzustehen, bevor sie mich erreicht hatten. Einer von ihnen stolperte an derselben Stelle wie ich, ich hörte wilde Flüche hinter mir.
Halbblind vor Angst und Müdigkeit schleppte ich mich weiter. Ich stieß gegen einen Bretterzaun und schaffte es irgendwie, hinüber zu kommen. Als ich keuchend auf der anderen Seite lag, konnte ich sie deutlich hören:
»Wo steckt er jetzt?«
»Dem werden wir’s heimzahlen, dem Saukerl. Aber wo ...«
»Er ist natürlich über den Zaun geklettert!«
Ich richtete mich auf. Unter den Händen spürte ich Rinde und Sägmehl. Wahrscheinlich befand ich mich im Hof eines Holzlagers. Zwei Reihen von dicken Stämmen führten zum Wasser hinunter. Schwach glänzend hoben sie sich vom Nachthimmel ab.
Jetzt machten sich die anderen daran, über den Bretterzaun zu klettern. Ihre Stiefel polterten hart gegen die Bretter, sie fluchten und ächzten.
Ich folgte den Stämmen zum Wasser hinunter — und da lag ein Boot! Ein Ruderboot. Ich löste die Leine, schob das Boot rasch ins Wasser hinaus und zog mich an Bord.
Als ich in den dichten Nebel hinausglitt, wurde alles beinahe noch unwirklicher als zuvor. Gleichzeitig durchströmte mich ein warmes, beruhigendes Glücksgefühl.
Ich brauchte keine Angst mehr zu haben. Ich hörte die Sägespäne unter ihren Füßen knistern, hörte sie suchen und fluchen — aber jetzt war ich sicher.
Ich legte die Ruder aus und machte ein paar Ruderschläge. Meine Verfolger hörten das Geräusch und schrien hinter mir her:
»Komm zurück! Sonst ...«
»Glaub nur nicht, daß du uns entkommst, du Mörder ...«
3
Mörder ... Während das Wort mir langsam ins Bewußtsein drang, fiel mir gleichzeitig ein, daß ich barhäuptig und ohne Klarinette war. Da hinten, unter der Laterne, hatte ich sie liegengelassen ...
Und auf der Innenseite des Futterals standen Nummer und Name schön säuberlich auf einen eingeklebten Zettel geschrieben!
Der Gedanke traf mich wie ein Schlag.
Bisher hatte ich das Gefühl gehabt, daß das Ganze nur etwas Zufälliges sei, daß ich nur vor Schlägen und Mißhandlungen davonlief, daß morgen alles wieder wie immer sein würde.
Es war nicht Dan Henrik Gustafsson, der davonlief — nur ein verängstigter Junge aus der Svea Garde, von dem kein Mensch wußte, wer er war.
Aber jetzt ...
Ich zog die Ruder ein, hockte mich hin und lehnte meine Stirn gegen das Sitzbrett. Und während das Boot sachte durch den Nebel glitt, versetzte ich mich in eine neue Rolle.
Das tat ich oft zu jener Zeit. Nicht mit Absicht — es war einfach so gekommen. Im Anfang vielleicht, um besser mit der Einsamkeit fertig zu werden. Oder es war Selbstverteidigung, um für alle Fälle gewappnet zu sein und die Antworten parat zu haben.
Und dann natürlich meine Phantasie: Schon immer habe ich eine ausgesprochen lebhafte Phantasie gehabt, daher nahmen meine ausgedachten Rollen oft drastische Formen an. Wie jetzt die Mörderrolle.
Schwarzgekleidet stand ich im Gerichtssaal, das Urteil wurde verkündet, und der Karren rollte vom Rathaushof zum Galgenberg, wo Scharfrichter Hjort schon wartete. Links von ihm, von ein paar Tannenzweigen verdeckt, lag das Beil ... der Pfarrer murmelte beruhigende Gottesworte ... die Bajonette der ringsum aufgestellten Soldaten blitzten in der Morgensonne ... Trommelwirbel ... ich zog die Jacke aus und kniete mich hin ...
Ich wußte ganz genau, wie es ablaufen würde. Ältere Kameraden, die vor zwölf Jahren gesehen hatten, wie der Gardist Göthe geköpft worden war, hatten bluttriefende Berichte geliefert.
Und man wurde geköpft, wenn man jemand umgebracht hatte oder daran beteiligt gewesen war.
Die Phantasie hatte mich fest in ihrem Griff — und schließlich hielt ich es nicht mehr aus. Irgend etwas in meinem Inneren zerbrach — ich hämmerte mit der Faust auf das Sitzbrett, ich weinte, schrie, fluchte, zog verzweifelt die Nase hoch.
Endlich fühlte ich mich besser. Ich setzte mich hin, sah mich in der Dunkelheit um und schnupperte wie ein Hund. Plötzlich war ich wieder zu mir gekommen — mit allen Sinnen. Ich nahm die Dunkelheit in mich auf, die Stille, den Geruch des Wassers, das Glucksen der Wellen. Ich spürte, wie mein Puls schlug.
Weit hinten auf der Eisenbahnbrücke pfiff eine Lokomotive. Der schrille Laut drang durch den Nebel und erfüllte mich auf einmal mit Glück. Er sprach davon, wie groß die Welt war, er erzählte von Wüsten und Meeren und Urwäldern und gewaltigen Städten ...
Ich war jung, und die weite Welt lag da und wartete nur auf mich.
Zwar lebte ich immer noch in der Rolle des Verbrechers, aber die Lage hatte sich jetzt verändert: Ich war frei und stark; was konnte mir die Polizei noch anhaben?
»Holt mich doch, wenn ihr könnt. Kommt nur her, ihr dickköpfigen ...«
Ich sagte die Worte laut vor mich hin, da stieß das Boot irgendwo an. Ich drehte mich schnell. Dicke Holzstämme, die wie ein gewaltiger Zaun aus dem Wasser ragten, schimmerten im Dunkeln. Hinter den Stämmen ahnte ich Laternen wie helle, verschwommene Flecken im Nebel. Ich begriff, daß ich vor der Stockbarrikade vor Skeppsholmen angelangt war.
Mein Plan stand fest.
Als ich weiterruderte, nahm der Nebel zu, so daß es unmöglich war, etwas zu erkennen, aber der Geruch nach Holz und nassem Heu führte mich. Nach einiger Zeit ragte ein Wald von Masten aus dem Nebel: Hier lagen die Schärenschiffe in langen Reihen; es müssen Hunderte gewesen sein.
Es gelang mir, zwischen den Schiffsrümpfen eine Lücke zu finden, in der ich an den Kai heranrudern konnte. Die Kaimauer war hoch und glitschig, aber ich hievte mich irgendwie hinauf. Das Boot stieß ich mit den Füßen hinaus. Es galt, keine Spuren zu hinterlassen.
Vorsichtig begann ich am Kai entlangzugehen, immer bereit, jeden Augenblick zwischen die Heuballen und Holzstöße hineinzutauchen und mich zu verbergen. Aber kein Mensch schien unterwegs zu sein. Von einem Kirchturm schlug es zwei Uhr.
Ich ging Skeppargatan hinauf. Von Storgatan drangen Hufschläge, eine Mietdroschke rollte sachte an mir vorbei. Nach ein paar Minuten war ich bei Tante Elins Haus angelangt. Dort hatte ich eine Schlafstelle in der Küche.
Als Vater mich im Regiment einschrieb, hatte er mit Tante Elin, der Schwester meiner Mutter, ausgemacht, daß ich bei ihr wohnen durfte. Die Kasernen, in denen das Regiment stationiert war, galten als sehr ungesund.
»Du mußt auf dich aufpassen, Dan«, sagte er damals oft. »Die Gesundheit ist das Kostbarste, was du besitzt. Du mußt mir versprechen, daß du auf dich aufpaßt.«
Allerdings weiß ich nicht, ob es viel besser war, in einem alten Haus an Skeppargatan zu wohnen als in der Kaserne. Es lag genauso nah am Hafen wie die Kasernen, und obwohl Tante Elin ihr Möglichstes tat, um die Ritzen abzudichten, so war es doch immer kalt und feucht in den Räumen. Sie selbst schlief in der Küche, hinter einem Vorhang. Sie war Lehrerin, aber schnarchen konnte sie wie der schlimmste Gardist. Und nachts hustete sie auch oft.
Daher schlief ich häufig in der Kaserne.
Ich trat in den Hof. Es raschelte, als Ratten zwischen den Abtritten verschwanden. Ich öffnete die Wohnungstür so leise ich konnte. Abgestandene Nachtluft und Tante Elins Schnarchen schlugen mir entgegen.
Wenn ich an Tante Elins Wohnung denke, erinnere ich mich zuerst an den Geruch. Dann kommt das Jesusbild an der Wand, die Spiegelkommode, das Holzsofa und alles andere.
In der Küche zündete ich eine Kerze an. Tante Elin schlief unruhig hinter ihrem Vorhang. Ich nahm die Kerze und schob vorsichtig die Tür zur Kammer auf, wo meine Kusinen schliefen. Ganz hinten neben dem Fenster war ein Wandschrank, in dem meine Kleider aufbewahrt wurden. Ein paar Kleidungsstücke meines Onkels hingen auch dort. Er war schon seit vielen Jahren tot.
Ich tastete mich zwischen den Betten vor, stellte die Kerze auf den Boden, schob einen Stuhl beiseite und öffnete vorsichtig die Schranktür. Ich holte alles heraus, was mir brauchbar erschien, und begann meine Uniform auszuziehen.
Als ich alle Taschen geleert hatte und die Uniform in den Schrank hängen wollte, stieß ich versehentlich gegen einen Kleiderbügel. Er fiel mit solchem Krach auf den Boden, daß eigentlich das ganze Haus hätte aufwachen müssen, so kam es mir wenigstens vor.
»Wer ist da?«
Das war Anna, meine älteste Kusine. Rasch schlüpfte ich in ein paar Hosen. Sie gehörten dem Onkel und waren in der Taille viel zu weit, doch zum Glück hatten sie Träger.
»Bist du es, Dan?«