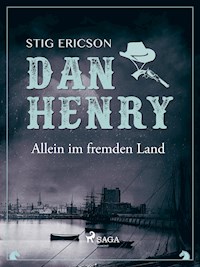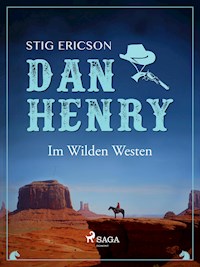
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Dan Henry
- Sprache: Deutsch
Die grosse weite Welt lockt: In diesem dritten Band der berühmten Kinderbuchserie ist unser Held, Dan Henry, der achtzehnjährige Kompanietrompeter, endlich im Land der großen Freiheit angekommen. Amerika, das Land, von dem er sehnsuchtsvoll geträumt hat. Die Wirklichkeit, die er hier jedoch vorfindet, entspricht ganz und gar nicht dem schönen Traumbild: Dan Henry erlebt den Wilden Westen hautnah. Er teilt das harte Los einer Farmerfamilie, sein Freund Martin fällt schwerbewaffneten, gierigen Western-Helden zum Opfer, er stößt auf die blutige Spur der Indianer und berührt zum ersten Mal das Geheimnis der Liebe. Er stellt sich der rauen Wirklichkeit, der er gegenübersteht und wächst an ihr. In der Auseinandersetzung mit der Rauheit seines neuen Lebens erlebt er Enttäuschung und Bitterkeit, aber er erlebt auch das Wunderschöne und Grausame an dieser neuen Welt - Rätsel über Rätsel, die ihn immer weiter in die Wildnis der Indianer führen... Dan Henry tritt dem Land aus Milch und Honing mit offener Stirn entgegen! Weitere Bücher der Reihe sind:Band1: Dan Henry's FluchtBand 2: Dan Henry allein im fremden LandBand 3: Dan Henry im Wilden WestenBand 4: Dan Henry Blas zum AngriffBiografische AnmerkungStig Ericson, 1929-1989, schwedischer Schriftsteller und Jazzmusiker, studierte auf Lehramt und betrieb nebenbei seinen eigenen Verlag "Två Skrivare". 1970 wurde er mit der Nils-Holgersson-Plakette ausgezeichnet. Die meisten seiner Kinder- und Jugendbücher spielen sich im Wilden Westen ab - hier versucht er, dem Leser das Schicksal und Leben der nordamerikanischen Indianer einfühlsam näherzubringen.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stig Ericson
Dan Henry
Im Wilden Westen
Saga
Erster Teil
Die Farm in Minnesota
1
Northfield
Der Mann auf dem Bild trug Stulpenstiefel und einen Hut mit breiter Krempe. Er hielt mit grimmiger Miene zwei Pistolen auf uns gerichtet.
„Ha, so sieht ein echter Westerner aus“, bemerkte Martin. „Die können schießen! Und reiten erst! Und was für Pferde die haben, Donnerwetter!“
„Das glaub’ ich schon“, sagte ich.
„Die können sogar sechs Schüsse auf einmal abfeuern“, behauptete Martin. „Wenn ich mich nicht irre, werden sie Sechserschützen genannt.“
„Das können sie nicht“, widersprach ich.
„Und ob sie das können!“
„Nicht auf einmal, das mußt doch sogar du begreifen! Das weiß ich.“
„Wie kannst du das wissen?“
„Ich habe selbst schon mit Pistolen geschossen.“
„Wo denn?“
„Im Regiment.“
„Ach was, da hast du doch nur gespielt ...“
Ich hatte ihm erzählt, daß ich bei der Ersten Leibgarde in Stockholm Klarinettist gewesen war und daß ich das Regiment und Schweden nach einer blutigen Schlägerei in Djurgarden hatte verlassen müssen.
„Nicht nur“, entgegnete ich. „Wir durften auch schießen.“
„Aber nicht mit solchen Pistolen, wie sie die Westerner haben“, beharrte er. Wenn Martin es darauf anlegte, konnte er stur wie ein Bock sein.
„Nein, natürlich nicht“, gab ich nach.
„Colt heißen sie“, sagte Martin. „Hier steht es. Sieh mal!“ Er zeigte auf den englischen Text unter dem Bild. Ich weiß nicht, wo er die Zeitung aufgetrieben hatte. Sie war voller Bilder und hieß New Sensation oder so ähnlich. „Solche Stiefel kaufe ich mir, wenn wir nach Minnesota kommen“, erklärte Martin. „Und vielleicht auch eine Pistole.“ Ich antwortete nicht. Martin lehnte sich zurück und gähnte. Der Bartflaum in seinem kindlichen Gesicht schimmerte farblos im Licht des Wagenfensters. Bald würde das Geschnarche anfangen, und sein Mund würde immer weiter aufklappen.
Herrgott, wie mir sein Gesicht und sein dummes Geschwätz auf die Nerven gingen! Aber andererseits war ich doch auch froh, daß ich ihn getroffen hatte.
Ihm hatte ich es zu verdanken, daß ich in Nordamerika ein Ziel hatte, in dem neuen Land, in dem ich endlich angekommen war.
Tage und Nächte waren wir in harten Eisenbahnwaggons durchgerüttelt worden. Wir hatten schon lange nicht mehr ordentlich geschlafen. Auf rußigen Bahnhöfen waren wir herumgeschubst worden, hatten uns durchgefragt, waren unsicher herumgestanden – und jeder neue Zug hatte härtere Sitze und rüttelte heftiger als der frühere.
Wir hatten aufgehört, uns für die Landschaft zu interessieren.
Wir hatten aufgehört, uns darüber zu unterhalten, wie es in Minnesota wohl werden würde.
Wir hatten aufgehört, uns Gedanken darüber zu machen, wann wir endlich in Northfield einträfen.
Es war an einem regnerischen Nachmittag Anfang November. Wir standen im Kohlenstaub und sahen die Lokomotive mit ihren drei Wagen davondampfen. Die Geräusche und Gerüche des Zuges blieben noch lange in der Luft hängen.
Ein Stück von uns entfernt stand – Martins ganzer Stolz – eine große, grünangestrichene Amerikakiste, die sein Bruder daheim in Schweden für ihn gezimmert hatte.
„Und was machen wir jetzt?“ fragte ich.
„Ich weiß nicht ...“
Ich wußte es auch nicht ...
Ein Bahnhofsgebäude, das wie eine Scheune aussah, dunkel gekleidete Männer neben den Gleisen, einige Pferdewagen, eine breite, lehmige Straße, an der langweilige zweigeschossige Häuser standen – ich fand Northfield öde und häßlich, fast feindselig.
„Wir werden wohl versuchen müssen, mit jemand zu sprechen“, sagte ich.
„Und Hunger hab’ ich auch“, murmelte Martin.
Als wir zum Bahnhofsgebäude hinübergingen, folgten uns mißtrauische Blicke. Ich fühlte mich genauso schäbig wie die Gegend hier, aber gleichzeitig war ich doch sehr gespannt auf das neue Land, und ich kann mich erinnern, daß ich meine Handfläche gegen eine Wand preßte und dachte, hier stehe ich also und presse meine Handfläche gegen die amerikanische Wand eines amerikanischen Hauses in Minnesota, und die Bretter stammen von Bäumen, die in den Wäldern der Indianer gewachsen sind; und dennoch kommt mir alles ganz selbstverständlich vor.
„Was ist los?“ fragte Martin.
„Nichts.“
Diesen Überlegungen hätte er sowieso nicht folgen können.
„Da drin scheint irgend jemand zu sein, der hämmert“, bemerkte er.
„Ja, ich höre es auch.“
Die Türe war nicht verschlossen; drinnen stand ein Mann, der eine Holzkiste zunagelte, hinter ihm war ein Regal, auf dem ich eine schwarze Schildmütze und eine Öllampe bemerkte.
„Frag ihn mal“, flüsterte Martin.
In diesem Augenblick hob der Mann den Kopf. Er hatte freundliche hellbraune Augen und trug zu große Hosen, die er mit Hosenträgern bis unter die Brust hochgezogen hatte.
„Sprechen Sie Schwedisch?“ fragte ich.
Er schüttelte den Kopf.
„Charles Nilssons settlement“, sagte ich langsam.
Ich hatte gelernt, daß eine Farm so auf englisch hieß.
„From Sweden?“ fragte der Mann. Als ich nickte, ging er an uns vorbei zur Tür hinaus und rief einen vierschrötigen Mann herbei, der einen schwarzen Hut aufhatte und dessen Wangen von feinen Äderchen überzogen waren.
„Ich hab’ doch gleich gedacht, daß ihr ein bißchen verloren wirkt“, sagte der Mann mit den Äderchen, als er zu uns herkam.
Er sah uns freundlich an und bemerkte, es komme nicht oft vor, daß Northfield von Besuchern aus Schweden beehrt würde, seit sich die Zeiten so verschlechtert hätten.
„Wir wollen zu jemand, der Charles Nilsson heißt“, erklärte ich rasch.
Von den schlechten Zeiten wollte ich nichts hören. Ich hatte schon früher davon gehört, aber auf dem Ohr hatte ich mich immer taub gestellt. Nordamerika war etwas Großes und Schönes, von dem ich lange geträumt hatte. Dieser Traum hatte mir über vieles hinweggeholfen, und ich wollte ihn mir so lange wie möglich bewahren.
Aber das wurde jetzt allmählich schwierig, jetzt, unmittelbar der Wirklichkeit gegenüber.
„Das ist nämlich mein Onkel“, erklärte Martin.
„Nilsson“, überlegte der Mann mit den Äderchen.
„Das wäre hier bei uns wohl Nelson. Und den Namen haben viele hier.“
Plötzlich erschien mir alles sehr unsicher, aber durch Fragen und Gegenfragen kamen wir doch allmählich dahinter, daß dieser Karl oder Charles Nilsson, zu dem wir unterwegs waren, einige Meilen weiter westwärts in Millersburg lebte.
„Ihr hättet eine Station weiterfahren müssen“, sagte der Mann mit den Äderchen. „Nach Dundas.“
„Aber in dem Brief stand dieser Ort“, beharrte Martin.
„Bist du ganz sicher?“ fragte ich.
„Und ob!“
Er warf mir einen wütenden Blick zu und kramte den Brief aus seiner Innentasche. Dann drehte er mir den Rücken zu und las lange.
„Hier! Sieh doch selber nach, dann siehst du, daß Northfield drin steht.“
Er sprach es wie Notfil aus.
„Lies es selbst!“ wiederholte er.
Ich las. Da stand tatsächlich Northfield. So hieße die nächste Stadt, aber das Dorf selbst heiße Millersburg, stand da, und in Dundas müsse man aussteigen.
Jetzt ging mir auf, daß Martin kaum lesen konnte, und wenn er mich nicht so triumphierend angestarrt hätte, hätte ich wohl meinen Mund gehalten. Aber so konnte ich es mir nicht verkneifen, es ihm unter die Nase zu reiben, und da wurde Martin natürlich wütend und fragte, ob ich denn jemals so weit gekommen wäre, wenn er mir nicht geholfen hätte, die Fahrkarte nach Chicago zu bezahlen!
„Du wolltest ja, daß ich mitkommen sollte“, entgegnete ich. „Zu deinem reichen Onkel! Ich habe nicht darum gebeten. Und wenn es so ist, daß ...“
„Hört mal, Jungs ...“
Der Mann mit den Äderchen unterbrach mich, und ich glaube, daß ich mich ein bißchen schämte. Auf jeden Fall verstummte ich.
„... dort wollt ihr also bleiben? Bei Nelsons ...“
Er sah zu Boden und scharrte mit dem Fuß im Sand.
„Ist etwas nicht ... nicht in Ordnung mit den Nelsons?“ fragte ich. „Ich meine ...“
Ich wußte nicht, was ich meinte, nur daß alles plötzlich so sinnlos schien, grau, klebrig und hoffnungslos.
„Ihr habt natürlich schon ziemlich lange nichts von ihm gehört?“ fragte der Mann und hob den Kopf. „Charles Nelson. Daher könnt ihr ja auch nicht wissen ...“
Er verstummte.
„Antworte doch“, zischte ich Martin zu.
Schließlich war es ja sein Onkel, zu dem wir wollten, nicht meiner. Ich hatte weder Vater noch Mutter noch einen Onkel und dem Karl Nilsson war ich völlig unbekannt. Daß ich jetzt hier in Northfield stand, kam nur daher, daß Martin und ich zufällig zwischen Hull und Liverpool im selben Abteil gelandet waren. Wir waren beide allein und fingen daher an, uns zu unterhalten, und dann gab er mit seinem reichen Onkel in Minesota an und fragte, ob ich nicht mitkommen wolle, und da ich in Amerika kein eigenes Ziel hatte, sagte ich eben ja. Aber jetzt begann ich es allmählich zu bereuen.
„Der letzte Brief kam gegen Mittsommer, glaube ich“, sagte Martin.
„Wenn es wirklich der Nelson ist, an den ich denke“, fuhr der Mann mit den Äderchen fort, „dann ist sein Hof vor kurzem abgebrannt ...“
2
In der Dunkelheit
„Abgebrannt!“ wiederholte Martin. Er sah mich mit halboffenem Mund an und seine kleinen Augen funkelten erschrocken.
„Der Blitz“, erklärte der Mann mit den Äderchen. „Hier in unserem Gebiet sind die Gewitter oft sehr heftig.“
„Der Hof – abgebrannt?“ schrie Martin. „Alles abgebrannt?“
„Nicht alles“, beruhigte ihn der Mann. „Aber ziemlich viel, nach dem, was ich gehört habe. Well ... ihr werdet’s ja selbst sehen, wenn ihr hinkommt.“
„Und wie kommen wir dahin?“ fragte ich.
„Well“, sagte der Mann, „da werdet ihr wohl Schusters Rappen nehmen müssen. Hier im Ort ist niemand, der jetzt dorthin fahren muß. Aber ihr seid ja jung und kräftig.“
„Aber meine Amerikakiste“, sagte Martin, „die kann doch nicht hier draußen im Regen stehen. Und was ist, wenn jemand ...“
Ich weiß nicht, wieviel Martin schon über seine Amerikakiste und ihren großartigen Inhalt gequasselt hatte. Schon seine Art, „Amerikakiste“ auszusprechen, ärgerte mich.
Ich, ich hatte keine – Amerikakiste. Alles, was ich auf dieser Welt besaß, war eine kleine Tasche, ein bißchen Kleingeld und ein Auswanderervertrag1), auf dem Dan Henry, Gothenburg, und die Zahl 15 stand.
Damals, als dieser Vertrag geschrieben worden war (in einem dunklen Zimmer in Hull in England), hatte ich den Namen Dan Henry erhalten. Mein richtiger Name, Daniel Henrik Gustafsson, würde sich in Amerika nur schwer aussprechen lassen, und so kam es eben zu meinem neuen Namen.
„Ich pfeif’ auf deine Kiste!“ fuhr ich Martin an. „Die brauchst du doch nur irgendwo unterzustellen.“
Während der Zugfahrt hatte man sich immer nur auf dem Boden ausstrecken können. Jetzt war ich einfach hundemüde, da spürte ich auf einmal jene Wut in mir aufsteigen, die mich entschlossen machte.
„Worauf warten wir eigentlich?“ sagte ich. „Wir brauchen doch bloß loszuziehen!“
„Nicht ohne die Amerikakiste!“
„Willst du sie dir etwa unter den Arm klemmen?“
„Och ...“
„Oder sie in die Tasche stecken?“
„Och ...“
Martin ging mit seinem wiegenden Gang davon und setzte sich mit dem Rücken zu uns auf seine Kiste, und der Mann lächelte und sagte, daß so weite Reisen wie die unsrige natürlich an Laune und Kräfte zehrten.
Gemeinsam trugen wir schließlich die Kiste in das Bahnhofsgebäude hinein und schoben sie in eine Ecke; Martin vergewisserte sich noch, daß alle Schnüre und Riemen ordentlich festsaßen.
„Hier steht sie so sicher wie das Amen in der Kirche“, sagte der Mann; „und hier gibt es auch genügend Leute, die darauf aufpassen. Wer würde übrigens schon ein solches Monstrum davonschleppen wollen?“
Martin schob die Unterlippe vor, sagte aber nichts. Der Mann grinste und beschrieb uns den Weg. Bis Dundas müßten wir der Eisenbahnlinie folgen, und dann immer nach rechts halten. Wenn wir jetzt zu müde sein sollten, so gäbe es hier am Ort ja mehrere Hotels.
Er zeigte dabei auf eines dieser Hotels, eine Holzbude etwas weiter oben neben den Schienen, alles andere als einladend.
Und so wanderten wir durch den Regen – aus der kleinen Stadt hinaus; der Weg führte über Felder und Äcker in den Wald hinein, immer geradeaus. In dem dichten Wald prasselte der Regen auf das gelbe Laub, und wir hielten uns auf dem Mittelstreifen des Fahrweges, um nicht allzu nasse Füße zu bekommen. Allmählich wurde es dunkel. Ich erinnere mich noch an zwei glänzende Radspuren auf dem Weg.
„Der Kerl hätte uns ruhig hinfahren können“, war das erste, was Martin sagte.
„Vielleicht hatte er kein Pferd.“
„Ein Pferd“, schnaubte Martin, der vor mir ging. „Mensch, das haben doch alle hier in Amerika. Hier ist es schließlich nicht wie daheim in Uppland!“
Er kam aus der Provinz Uppland. Seine Eltern waren tot, und seine Brüder hatten ihm seinen Anteil am Hof ausbezahlt und ihn nach Amerika geschickt. Das war ungefähr alles, was ich von ihm wußte.
„O nein“, wiederholte er. „Hier ist es nicht wie daheim, o nein!“
Ich sagte nichts. Aber ich gab ihm nicht recht. Nicht ganz. Wir hätten ebenso gut auf einem Waldweg daheim in Schweden sein können.
Wir gingen ungefähr eine halbe Stunde. Der Regen hörte auf und verwandelte sich in Dunst, eine schmale Mondsichel erhellte die Welt mit gespenstischem Licht. Die Baumstämme waren alle sehr dunkel; da fiel mir auf, daß es hier gar keine Birken gab.
Der Wald lichtete sich etwas. Neben dem Weg lag ein großer Felsbrocken, der oben auffallend flach war und der uns in dem blauen Dunst kalt entgegenglänzte. Bei seinem Anblick mußte ich an Trolle und Riesen denken und daran, wie es wohl vor vielen tausend Jahren hier gewesen sein mochte.
„Allmählich krieg’ ich kalte Füße“, klagte Martin und blieb neben dem Felsen stehen. „Und Hunger hab’ ich auch!“
Ich dachte an Märchen, die ich gelesen hatte – und an Indianer. Hier in Minnesota gab es Indianer, hatte ich gehört, vor ein paar Jahren hatte es hier einen Indianeraufstand gegeben. Damals waren sie hier zwischen den Bäumen mit ihren Messern und Streitäxten herumgeschlichen ...
„Auauau“, ächzte Martin, „da müssen wir doch weiter marschieren, als ich geglaubt hatte.“
Immerhin – jetzt schien er besser gelaunt; vielleicht wollte er die Sache mit dem verkehrten Bahnhof etwas vertuschen. Ich ging hin und berührte den Felsbrocken. Er war genauso hoch wie ich.
„Komm, wir klettern hinauf“, schlug ich vor.
„Wozu denn?“ wollte Martin wissen.
Aber dann folgte er mir doch hinauf, und als wir da oben in dem nächtlich glitzernden Wald standen, fühlte ich mich plötzlich auf unerklärliche Weise mächtig und begann in übertriebenem südschwedischem Dialekt zu predigen:
„Und da sprach Jesus zu seinen Jüngern und sagte, daß die Füße des heiligen Martin gewißlich wund seien ...“
Martin kicherte, doch dann wurde er unruhig und sagte, daß wir nicht zu spät zu Onkel Kalle kommen dürften.
„Heute oder morgen ... was spielt das schon für eine Rolle!“
Jetzt war ich übermütig wie ein Kind.
„Er hat doch gar kein settlement mehr“, sagte ich. „Das ist doch abgebrannt.“
„Halt’s Maul!“
Martin schob sein Kinn vor und versetzte mir einen harten Stoß mit dem Ellenbogen.
Ich stieß zurück – eine Prügelei schien unvermeidlich.
„Paß auf, du ...“
Wir fluchten und rangen miteinander, bis Martin vom Stein hinunterkletterte und davonging.
„Jetzt hast du gar keinen reichen Onkel mehr, zu dem du kommen kannst!“ rief ich hinter ihm her. „Aber dann kannst du ja in deiner Amerikakiste hausen!“
Er antwortete nicht, drehte sich auch nicht um. Nach einer Weile war er hinter den Bäumen verschwunden.
Allein im Wald mit brennenden Wangen. Schwaches Sausen in den Bäumen und gelbes Laub, das vorbeitrieb. Ich dachte an die düsteren Tage in Hull zurück, als noch alles ungewiß war, als ich noch keinen Vertrag hatte, und als ich durch die schummrigen Gassen streifte.
Es war finster damals, trotzdem hatte ich noch etwas, worauf ich hoffen konnte. Aber jetzt ...
Ich mußte Martin einholen. Ich war nicht stark genug, allein zu sein, die Angst und Unruhe fernzuhalten. Noch nicht.
Rasch ging ich die mit Laub gefüllten Radspuren entlang und schämte mich meiner Schwäche. Die feuchte Erde dampfte im Mondschein. Inzwischen war es sehr dunkel geworden, und der Wald war voller Geräusche – das plötzliche Auffliegen eines Vogels, raschelndes Laub und dann etwas anderes, Schweres ... ich wußte nicht was.
Ich blieb stehen. Die Dunkelheit kreiste mich ein. Phantasiebilder. Erinnerungen ...
... Der Zug rumpelt über die Ebene. Ein paar Bierflaschen rollen auf dem Boden unter den Sitzen hin und her, und das Gespräch dreht sich um Indianer, um den Hungeraufstand in Minnesota im Herbst 62. Einer sagt, er habe mit eigenen Augen gesehen, wie sich die Indianer auf einen seiner Verwandten stürzten, einen alten Mann, der nicht so schnell wie die anderen davonrennen konnte. Wie einer der Rothäute tanzte und heulte, und dann dem Alten seine Streitaxt in den Schädel hieb – und dann skalpierte und dann ...
Als ich so in der Dunkelheit dastand und an Indianer dachte, fürchtete ich mich sehr, und ich vermeinte, jemand rechts zwischen den Stämmen herumschleichen zu hören.
Oder – war es nur Einbildung? Plötzlich war alles still, ich hörte nur noch die natürlichen Geräusche des Waldes.
Ich wagte immer noch nicht, mich zu bewegen. Nein, es war doch keine Einbildung! Jetzt hörte ich es ganz deutlich: Schritte und sie kamen näher.
Ich duckte mich und starrte in die Dunkelheit hinein, ich war davon überzeugt, daß sich tatsächlich etwas zwischen den Stämmen bewegte.
3
Rauchgeruch
Die Ereignisse blitzten in Sekundenschnelle vor mir auf.
Ein erstickter, schriller Schrei, Knurren, schnelle Bewegungen im Laub, ein helles Aufleuchten – und dann tiefes Schweigen.
Kämpfende Tiere ...
Ich blieb noch lange geduckt sitzen, bevor ich aufzustehen wagte. Auch jetzt noch saß mir das Gefühl im Nacken, daß mir etwas in der Dunkelheit zwischen den Stämmen auflauerte; langsam schlich ich davon. Dann ging ich schneller und schneller und schließlich rannte ich. Meine Tasche schlug gegen mein Bein, während ich den nassen Weg entlangstolperte.