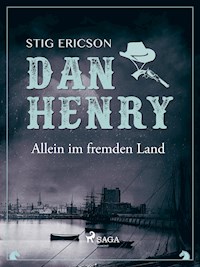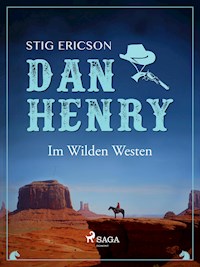Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Dan Henry
- Sprache: Deutsch
Die grosse weite Welt lockt: In diesem vierten Band der berühmten Kinderbuchserie ist unser Held, Dan Henry, der achtzehnjährige Kompanietrompeter, von Stockholm über England nach Amerika gelangt, wo er den Wilden Westen hautnah erlebt und für die Nachwelt - bereits im Felde - festhält, was sich zuträgt - packend und aufwühlend berichtet er über den furcht- und haßerfüllten Endkampf gegen die Indianer der endlosen Prärie Nordamerikas von dem es hieß, er würde der amerikanischen Zivilisation das Tor in den Westen aufstoßen. Auf dieser mörderischen Expedition gibt es kein Zurück für Dan Henry - in diesem vierten Band bläst er zur letzten Attacke!Weitere Bücher der Reihe sind:Band1: Dan Henry's FluchtBand 2: Dan Henry allein im fremden LandBand 3: Dan Henry im Wilden WestenBand 4: Dan Henry Blas zum Angriff Biografische AnmerkungStig Ericson, 1929-1989, schwedischer Schriftsteller und Jazzmusiker, studierte auf Lehramt und betrieb nebenbei seinen eigenen Verlag "Två Skrivare". 1970 wurde er mit der Nils-Holgersson-Plakette ausgezeichnet. Die meisten seiner Kinder- und Jugendbücher spielen sich im Wilden Westen ab - hier versucht er, dem Leser das Schicksal und Leben der nordamerikanischen Indianer einfühlsam näherzubringen.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stig Ericson
Dan Henry
Blas zum Angriff
Saga
Erster Teil
Fort Lincoln
1
Eisiger Wind pfiff über die Hügel westlich des Forts, und ich fror in meiner abgetragenen Uniform.
„Komm, wir gehen hinein“, schlug ich Conrad vor.
Ich wollte nicht dabei sein, wollte nicht zuschauen, diese nackte Gewalt war mir zuwider.
„Nein, halt ...“
Er sah abwartend zu den beiden hinüber, die aufeinander losgingen.
Leicht vorgeneigt standen sie sich jetzt gegenüber, mit herabhängenden Armen und gekrümmten Fingern. Der eine, blonde, war gut gebaut. Der andere war kleiner und hatte eine breite, höckerige Stirn.
Hinter dem Lagerhaus war es sehr still. Die Zuschauer musterten die beiden Kämpfer mit großem Ernst, warteten geduldig, wogen die Chancen der beiden gegeneinander ab.
Der Kleinere schlug als erster zu und schrie dabei, wie um seinem Schlag damit größere Wucht zu verleihen. Dann hieben sie sich gegenseitig wild ins Gesicht und in die Magengrube, steigerten sich in ihre Raserei hinein. Die Fausthiebe, die im Gesicht landeten, hallten durch die Kälte.
Hartgefrorener Schnee knirschte unter den Stiefeln, während sie versuchten, sich gegenseitig zu zerstören; in ihren Gesichtern zeichnete sich Angst und Schmerz ab, und bald begann der Kleinere zu schwanken.
Der Blonde mißhandelte ihn immer weiter, bis ihm das Blut aus der Nase und von den aufgeplatzten Lippen troff und er sachte zusammensackte und wie betend auf den Knien liegenblieb.
Der Blonde trat ihm verächtlich mit dem Fuß in die Seite und sah uns, die Zuschauer, dann mit einem verwirrten Ausdruck in seinem zerschlagenen Gesicht an.
„Na, fühlst du dich jetzt besser?“ fragte einer.
Der Blonde atmete schwer und bewegte das Kinn hin und her.
„Warum hat er das gesagt?“ stieß er mit belegter Stimme hervor. „Warum hat er das gesagt? Über Custer ...“
Der Besiegte hatte sich auf die Seite gelegt. Er jammerte vor sich hin. Sein Mund war eine dampfende Wunde. Ein paar von seinen Kameraden beugten sich über ihn.
Der Blonde schwankte plötzlich, stützte sich mit den Händen gegen die Wand und spuckte in den Schnee. „Es ist kalt“, bemerkte Conrad Beck.
Wir gingen rasch auf die Infanteristenkaserne zu, um Schutz vor dem Wind zu suchen. Unterhalb der Böschung hinter den Stallungen dehnte sich die fleckige Eisdecke des Missouri. Es war ein Sonntagnachmittag im Dezember 1876, und die Sonne am grauweißen Himmel erinnerte mich an einen runden Fettfleck.
„Ich verabscheue Kälte“, sagte Conrad. „Und das Frieren! Ich hasse es! Ooooh ...“
Der Schnee wirbelte über das Exerziergelände, und wir begannen zu rennen, an den Wachstuben, am Krankenhaus und an der Bäckerei vorbei, auf die Musikkaserne zu, die ziemlich weit von den anderen entfernt lag. Als wir endlich eintraten, schmerzte mein Gesicht vor Kälte.
„Es ist zum Kotzen“, sagte Conrad.
„Mach’s lieber draußen“, brummte der lange Flötist, der auf einem Bett neben der Tür lag und las. Die Zeitung war mindestens einen Monat alt.
„In diesem Gestank würde es sowieso keiner merken“, sagte Conrad.
„Nein, aber hören“, entgegnete der Flötist.
Das Holz schwelte säuerlich in dem großen Backsteinofen an der Schmalseite des Raumes, frisches Pappelholz, das mehr Feuchtigkeit als Wärme verbreitete. Die schwere, abgestandene Luft kam mir noch widerwärtiger als sonst vor. Unsere Mannschaftsstube war lang und schmal. Conrad und ich gingen an den eisernen Betten entlang bis zur hintersten, vom Ofen am weitesten entfernten Ecke des Zimmers. Hier hatten wir Jüngeren unsere Plätze.
Conrad legte sich auf den Rücken, mit den Stiefeln auf dem Fußende des Bettes. Er war lang und schlank und hatte braune, in der Mitte gescheitelte Haare mit hellen Strähnen. Er und ich waren die einzigen im Musikkorps des 7. Kavallerieregiments, die weder Bart noch Schnurrbart aufweisen konnten. Wir waren die Jüngsten.
Das war mit ein Grund, warum wir zusammenhielten.
„Wie war er?“ fragte ich.
„Wer?“
„Custer.“
Conrad hatte vor gut einem halben Jahr den Beginn des Feldzuges gegen die Prärieindianer mitgemacht. Das Musikkorps hatte die Kavallerie bis zum Yellowstonefluß begleitet, dort standen sie dann auf einem Hügel oberhalb des Flusses und spielten Garry Owen und The Girl I Left Behind Me, während das Regiment zu den Bighornbergen im Nordwesten weiterzog. Custer und zweihundertundzweiundsechzig seiner Männer kamen nie zurück. Das Indianerlager, das sie angegriffen hatten, war zu groß gewesen.
„Ein Mann mit einer großen Nase auf einem Pferd“, sagte Conrad. „Ich habe nicht besonders viel für Generäle übrig.“ Er sah mich augenzwinkernd an. „Wollen wir uns seinetwegen schlagen?“
Das hatten die beiden anderen getan, und es war nicht das erste Mal, daß Custer den Anlaß zu einer Schlägerei geliefert hatte. Held oder Mörder? Tapferer Offizier oder rücksichtsloser Ehrgeizling? Custers kopfloser Angriff auf das Indianerlager am Little Bighornfluß hatte das Regiment gespalten. Es gab Offiziere, die nicht mehr miteinander sprachen, seit sie sich wegen ihres früheren Kommandanten zerstritten hatten.
„Ich hab’ schon lange keinen General mehr gesehen“, sagte ich. „Und ich prügle mich nicht gern.“
Conrads Augen blitzten unter seiner erstaunt gerunzelten Stirn auf.
„Nicht? Und wozu, glaubst du, soll die Armee gut sein?“
„So habe ich es nicht gemeint“, murmelte ich.
„Du bist ein Idiot“, sagte Conrad. Er war 21, drei Jahre älter als ich, und er besaß die Fähigkeit, im Scherz Fragen zu stellen, die man nur sehr schwer beantworten konnte. Er lag da, seine verschossene blaue Schildmütze über dem Gesicht, und wartete auf eine Antwort, für die ich keine Worte fand.
Wozu sollte die Armee gut sein? Allmählich wurde es mir natürlich immer deutlicher bewußt: Der funkelnde Pomp, die Marschmusik, die Paraden und die Uniformen waren nur die äußeren Zeichen einer anderen Wirklichkeit, einer Wirklichkeit, die mich erschreckte. Aber die Gemeinschaft? Was war mit der Gemeinschaft?
„Du prügelst dich nicht gern, Soldat?“ wiederholte Conrad Beck. „Was tust du dann eigentlich gern? Du bist doch freiwillig hierhergekommen, hast den feierlichen Eid geschworen!“
Ich dachte an die Gemeinschaft, die ich gesucht hatte, an das Gefühl der Fremdheit auf der Farm in Minnesota, an meine einsame, hoffnungslose Wanderung nach Nordwesten, an den frostigen Morgen, als ich vor einem Hühnerhaus stand, das milde Gackern der Hennen hörte und mir wünschte, drinnen in der Wärme auf einer Stange zu sitzen.
Ich konnte nicht erklären, warum ich mich danach sehnte, einer von vielen Gleichen zu sein. Ich konnte die passenden Worte nicht finden. Englisch war nicht meine Muttersprache. Ich kam leidlich damit zurecht, mehr aber nicht.
Vielleicht befürchtete ich auch, daß Conrad meinen Traum von der Gemeinschaft zerstören würde. Plötzlich ärgerte ich mich über ihn, über seine geschmeidige Stimme, und ich stotterte etwas vom Spielen – und von Mädchen. Conrad Beck lachte auf seine leise Art.
„Dann bist du hier ja am richtigen Platz gelandet“, sagte er. „Du brauchst dich nur bei der neuen Wäscherin anzustellen. Du weißt, die nach Mary gekommen ist. Es dürften kaum mehr als ein paar hundert Mann vor dir an der Reihe sein, irgendwann im nächsten Jahr also ...“
„Du bist ein Idiot“, fauchte ich.
„Da bin ich wenigstens nicht allein“, versetzte Conrad.
Ich fragte, wer Mary sei.
„Eine Wäscherin, sagte ich doch“, entgegnete Conrad. „Und sie ist daran gestorben.“
Gedanken. Zeit zum Nachdenken. Kraft zum Denken. Während des ersten Monats in Fort Lincoln hatte ich das nicht gehabt. Ich fand mich nicht zurecht, kannte den Rhythmus noch nicht – ebensowenig die unentbehrlichen Schlupfwinkel. Die Trompetensignale jagten mich durch die Tage, und nachts schlief ich schwer und traumlos auf der Strohmatratze.
Die Trompeten beherrschten unseren Lebensrhythmus. Ich erinnere mich an graukalte Morgenappelle zum vereinten Klang von 12 Trompeten, während das Sternenbanner gehißt wurde. Ich erinnere mich an das eilige Getrampel vieler Stiefel nach den Essensignalen und an die Flüche, die auf die Signale für Drill und Arbeitsdienst folgten.
Nach ungefähr einem Monat hatte ich die 16 Trompetensignale, die Tag und Nacht bestimmten, gelernt. Die Welt von Fort Abraham Lincoln, vorher so groß und geheimnisvoll, begann um mich herum zu schrumpfen, und an jenem Sonntag im Dezember, von dem ich eben berichtete, war sie ziemlich klein.
In jenem Herbst waren viele neue Rekruten nach Fort Lincoln gekommen. Man benötigte viele Leute, um die fünf Kompanien zu ersetzen, die bei der Schlacht am Little Bighorn vernichtet worden waren. Schon gingen Gerüchte um, daß ein neuer Feldzug in das gefährliche Gebiet am oberen Yellowstone gestartet werden sollte. Das war die Gegend, in der Sitting Bull hauste, der Führer der Prärieindiander, von dem man allgemein nur mit Schrecken, zugleich aber auch voll trotziger Rachegelüste sprach.
„Soll ja ein schlauer Satan sein, der Kerl! Aber wir werden ihm schon die Flöhe aus dem Fell peitschen, daß er nie mehr sitzen kann!“
„Und das sagst ausgerechnet du! Dein Arsch sieht doch aus wie eine überreife Tomate!“
„Was weißt denn du!“
„Jedesmal, wenn du dich auf deine Schindmähre setzt, machst du doch ein Gesicht, als würde dir jemand ein Messer reinjagen!“
„Quatsch! Bald hat man sowieso überall Schwielen ...“
Stallgeplänkel zwischen den Neulingen der Kompanie F. Ich nahm an ihren Reitübungen teil, um die anderen im Musikkorps einzuholen. Ich kann mich besonders an einen kleinen, dunklen Kerl erinnern, der nie still war. Er hatte verschwommene Augen und lachte heiser über seine eigenen Witze, während er zu den anderen hinüberschielte.
„Na, hast du heute was Schönes gespielt?“ pflegte er zu sagen, wenn ich in den Stall kam.
„Auf jeden Fall spielt er verdammt viel besser als du!“ kam es von dem Mann in der Nachbarbox.
Und ein anderer:
„Aber jetzt wird hier nach Noten geritten! Daß es nur so zwitschert, was?“
„Geritten? Das ‚Halfter‘ hat ja keine Ahnung vom Reiten. Er hat nur sein verfluchtes Lehrbuch auswendig gelernt!“
Jedesmal dieselben Worte, dasselbe Lachen, dieselben Bewegungen, dieselben Laute und Töne. Auf Fort Lincoln war alles Schablone.
Das „Halfter“ war der Sergeant, der die Übungen zu Pferd abhielt.
„Die Halfterkette zwei Faustbreit hinterm Maul festhalten!“ hatte er geschrien, als wir die Pferde zum ersten Mal hinausführten. „Und die Nägel nach unten! Die Nägel nach unten ...“
Sein beflissenes Soldatengesicht schien mit der Mütze zusammengewachsen zu sein, und fast alle Linien in seinem Gesicht waren gerade – die Nase, der Schnurrbart, der kleine Mund.
„Fertig zum Aufsitzen! Aufsitzen! Packt sie an der Mähne, das halten sie aus! So ...“
Wir saßen in den Sätteln, während sich der Nebel über dem Missouri lichtete und das „Halfter“ mit herausgedrückter Brust schnarrte:
„Die Daumen entlang der Zügel ... die Hände so hoch wie die Ellenbogen, mit einer Faust Abstand ... gerade Rücken, weiter vor im Sattel ... und die Nägel nach unten, die Nägel nach unten! Sitzt gefälligst wie Soldaten im Sattel und nicht wie Pißnelken! Und ihr wollt Sitting Bull den Schwanz hochknüpfen?!“
Da war er wieder! Der Schreckliche. Der Feind hinter den Hügeln im Nordwesten.
Conrad Beck schien von Sitting Bull nicht sonderlich beeindruckt zu sein. Wenn die Rede auf die Indianer kam, zeigte er nur freundliche Gleichgültigkeit.
Manchmal, wenn ich aus dem Stall zurückkam, saß er auf dem Bett und würfelte mit sich selbst. Er schüttelte die knöchernen Würfel mit den fast abgewetzten Augen zwischen gewölbten Händen und warf sie dann auf der Decke aus. Immer wieder ...
„Woran denkst du?“ fragte ich eines Nachmittags, und ich weiß noch, wie er mit dem Zeigefinger eine Acht um die beiden Würfel herum zeichnete.
„Das möchte ich auch gerne wissen“, sagte er. „Vielleicht an Wärme. Und du selbst ... Er blickte hoch. „Kannst du sagen, woran du denkst?“
Er machte mich verwirrt. Meine Gedanken schossen mir schneller durch den Kopf als die dazugehörenden Worte.
„Tja, gegen Wärme hätte ich auch nichts einzuwenden“, versetzte ich schließlich.
„Nein, nein ...“
Conrad Beck spielte weiter mit seinen Würfeln. Ich erreichte ihn nicht; ich hatte das Gefühl, ihn enttäuscht zu haben.
„Bald gibt’s Essen“, sagte ich. „Ich habe Hunger!“ Conrad sagte nichts, und ich faßte sein Schweigen als Kritik an meinen Worten auf. Ein dummer Ausländer. A crazy Swede. Ich legte mich aufs Bett, schloß die Augen und versuchte, auf Englisch zu denken. Jetzt polterten auch die anderen in die Mannschaftsstube herein. Einer von ihnen war Otto Arndt, das hörte ich an seinem Pfeifen und an dem trampelnden Tanz, den er zwischen den Betten aufführte. Er pfiff laut und musikalisch und markierte den Takt durch Fingerschnippen. Ich mußte mich anstrengten, um ihm nicht zuzuschauen; in seiner Art zu pfeifen, in seinem Blick lag etwas Herausforderndes. Begegnete man erst einmal seinem Blick, war es schwierig, wieder loszukommen. Ein Trompetensignal vom Wachgebäude drang durch das Stimmengewirr und das Getrampel.
„Suppe, Suppe, Suppe“, sang einer. „Nie ein Stückchen Fleisch ...“
Zu allen Signalen gab es die entsprechenden Worte und Liedchen, die sich im langjährigen Soldatendasein zusammengefunden hatten.
Otto pfiff immer noch. Ich wandte mich ab. Er machte mich verlegen: er zwang mich, immer an meinen Mund, an mein Aussehen zu denken. „Du hast hübsche Lippen, Danny“, hatte er in der ersten Woche gesagt, in der ich beim Regiment war. „Nur schade, daß sie in deinem Gesicht sitzen. Jemand in Röcken wäre mir lieber!“
Schließlich wurde es still. Die Stille brachte mir erneut die Feuchtigkeit und die Kälte im Raum zu Bewußtsein. Ich sehnte mich fort.
„Kommst du jetzt?“ Conrad stand am Fußende und schüttelte die Würfel in seiner Faust.
„Sicher“, sagte ich und dachte, daß er an diesem Wort bestimmt nichts aussetzen konnte. So sagen ja alle hier. Sicher. Sure. Alles war sicher in Amerika. „Wird gut tun, sich ein bißchen abzukühlen“, sagte Conrad. Wir gingen in das Schneetreiben hinaus.
Ich weiß nicht, warum Conrad in die Armee eingetreten war. Er schien alles zu mißbilligen, was mit der Armee zu tun hatte. Sein schlanker, drahtiger Körper paßte nicht in die Uniform. Immer saß etwas schief an ihm, ohne daß er es selbst merkte.
Vielleicht hatte ihn die Musik verlockt. Er liebte seine Trompete. Wenn er Trompete blies, wurde sein feingeschnittenes Gesicht eins mit dem Instrument, und seine schmalen Augen funkelten vor katzenhaftem Wohlbefinden.
„Mmm, lecker! Ausnahmsweise Bohnen heute!“ sagte er, als wir um das Essen anstanden. „Das haben wir ja seit mindestens fünf, sechs Stunden nicht mehr bekommen!“
2
Morgens war die Kälte am schlimmsten. Oft wachte ich vom Frieren auf, und wenn ich hinterher mit einem Schluck Kaffee und ein paar Bissen Brot im Magen vor der Kaserne zum Appell antrat, schüttelte es mich vor Kälte. Am liebsten hätte ich mich zusammengekrümmt wie ein Wurm und wäre einfach vom Erdboden verschwunden.
Alle mußten antreten, Kranke und Gesunde, doch der schneidende Wind von den Hügeln machte da keinen Unterschied: der Winter auf Fort Lincoln war die Zeit der Schwindsucht und der wunden Nasen – aber auch die Zeit der Trunkenheit, der Gewaltverbrechen und der Selbstmorde.
Man betete die Sonne an. Im Februar, wenn die Sonnenstrahlen den Appellplatz erreichten und wenn es vom vorragenden Kasernendach tropfte, redete man in Gedanken die Sonne voll Verzücken an: „Du wunderbare Sonne, du Lebensspenderin“; man saugte die Wärme in sich hinein, entspannte sich, fing an, von der Welt zu träumen.
Ich erinnere mich an einen sonnenwarmen Februarmorgen, als Louis Schick die Tagesordnung durchging. Es war Samstag, und die Kompanie würde in Bismarck, der kleinen Stadt am Ende der Bahnlinie jenseits des Flusses, einen Ball geben.
„Heute abend müssen wir unser Bestes geben, Jungs“, sagte er. „Und das will nicht wenig heißen! Sonst werden die Kerls aus K uns was erzählen!“
Louis Schick war chief musician, der Leiter des Musikkorps. Er war lang und hatte blanke Stiefel, und während er sprach, ging er würdevoll auf und ab, gleichsam seine Schritte abwägend, wobei er gleichzeitig seine Schnurrbartspitzen betastete.
„Volle Parade natürlich. Konzert und Tanz. Um fünf Uhr fahren wir ab. Um eins wollen wir noch ein paar neue deutsche Walzer üben, die Leutnant Wallace gerne hören will. Es ist auf jeden Fall besser, sie ordentlich einzustudieren, um seine Gefühle nicht zu verletzen ...“
Vereinzeltes Gelächter. Leutnant Wallace war der Fortsadjutant und der Offizier, der für das Musikkorps verantwortlich war.
„... und bis zum Repetieren muß das große Blech geputzt sein. Beck und Henry sind dafür verantwortlich. Ihr könnt unmittelbar nach dem Stalldienst damit anfangen. Die übrigen, die nicht abkommandiert sind, üben auf ihren Instrumenten. Hat irgend jemand noch Fragen?“
Keiner hatte Fragen, und Louis Schick, der vor ein paar Monaten noch ein einfacher Korporal gewesen war, kommandierte rechts- und linksum marsch.
Das Putzen der Blechinstrumente ... Der stechende Geruch von Essig, Salz und Grünspan. Conrad auf einem Schemel mit einer Tuba auf dem Schoß. Er hält den Kopf schief, und die helleren Haarsträhnen glänzen im Licht eines schmalen Fensters. Er sagt nichts, starrt nur den Fleck an, den er mit dem Essiglappen reibt. Seine Mütze liegt auf dem Boden – eine schmutzige dunkelblaue Schildmütze mit einer Sieben und zwei gekreuzten Säbeln auf dem Kopf.
Er spiegelt sich in dem glänzenden Messing, lächelt seinem verzerrten Spiegelbild übertrieben zu. Das Lächeln verleiht ihm eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Katze.
Dieses Bild steht noch sehr deutlich in meiner Erinnerung. Und ich kann ihn noch immer Garry Owen, Custers Lieblingslied, in Moll spielen hören.
Plötzlich warf er den Lappen weg, legte die glänzende Tuba behutsam auf den Boden, nahm seine Trompete und begann zu blasen.
Breit und kraftvoll und etwas heiser strömten die Töne aus dem Instrument. Er spielte den flotten, mitreißenden Kavalleriemarsch langsam und würdevoll wie einen Begräbnismarsch. Seine Augen funkelten. Der Trompetenklang erfüllte das Zimmer, und zwei Korporäle, die im Nebenzimmer gesessen und Karten gespielt hatten, kamen herein und lauschten. Sie standen in der Türöffnung, die Uniformjakken aufgeknöpft und die Mützen im Nacken, während Conrad die letzte Wiederholung des Marsches blies. Als noch zwei Takte übrig waren, legte er eine unerwaretete Pause ein – dann ging er die Tonleiter hinauf, statt, wie erwartet, hinab. Einer der Korporäle zupfte seine Mütze zurecht und fing an zu dirigieren.
Die immer heller in die Höhe steigenden Trompetentöne riefen in mir eine seltsame Erregung hervor, ein Gefühl, daß dieser Augenblick von unerhörter Bedeutung sei – und als der letzte Ton verklungen war, hinterließ er eine schmerzende Leere.
Conrad fingerte an den Trompetenklappen und sah zu Boden. Auf seinen Lippen hatte das Mundstück der Trompete einen hellen Ring hinterlassen.
„Ich dachte schon, du seist übergeschnappt, als du so loslegtest“, bemerkte der Korporal, der dirigiert hatte.
„Vorläufig besteht kein Grund zur Besorgnis“, sagte Conrad ohne aufzuschauen.
„Spiel, wie du willst, auf jeden Fall muß das Blech bis um zwölf fertig sein“, sagte der andere Korporal. „Warum hast du das gemacht?“ fragte ich, als wir wieder alleine waren. „Ich meine ... warum ...“
Wieder konnte ich die Worte nicht finden. Schon wieder war ich ein crazy Swede. Was spielte die Ursache schon für eine Rolle? Alle diese dummen warum ...
Conrad hatte angefangen, ein anderes Instrument zu putzen.
„Sagen wir mal, es war für John Mulligan?“, sagte er.
„Wer ist John Mulligan?“ fragte ich.
„Ein Kerl aus Fort Rice, der sich vor ungefähr einer Woche das Leben nahm. Nach fünf Jahren in der Armee nahm er sich das Leben ...“
Repetieren deutscher Märsche, Bohnen und Speck im Speisesaal hinter der Kaserne, rein in die Paradeuniform – und dann los.
Wir fuhren in einem Ambulanzwagen über den gefrorenen Fluß. Auf der anderen Seite gelangten wir zuerst nach Whisky Point, das war eine Ortschaft, bestehend aus ein paar Bruchbuden, die sich Saloons und Dance-Halls nannten. Hier kam plötzlich Leben in die Soldatenreihen, die auf den Wandbänken des Karrens saßen.
„Ist Danny bei unserer Fuhre dabei?“
Das war Otto Arndts Stimme. Er befand sich irgendwo weiter vorne im Karren.
„Wo sollte ich denn sonst sein?“ fragte ich zurück.
Es wurde allmählich dunkel. Um die billigen Lampen vor den Saloons wirbelten Eiskristalle.
„Vor diesem Ort mußt du dich in acht nehmen, Kleiner!“ rief Otto Arndt.
„Weiß ich“, versetzte ich.
„Hier gibt’s Weiber und Flaschen“, schrie einer vorne im Wagen. „Und noch einiges mehr!“
„Eigentlich sollten wir ihn ja an einem Abend mitnehmen“, sagte Otto Arndt. „Damit er das Leben kennenlernt!“
„Ruhe jetzt!“ rief Louis Schick durch das Gelächter. „Ihr gefährdet die Moral des jungen Mannes!“
Wir rollten die gefrorenen Sandbänke hinter dem Ufergebüsch hinauf, über die Hügel der Prärie auf Bismarck zu, den Endpunkt der Northern-Pacific-Bahnlinie – und der Zivilisation des weißen Mannes. Eisenbahnschienen, ein langer Zaun aus Pfählen auf der einen Straßenseite, Holzhäuser auf der anderen Seite – dann bogen wir in die Hauptstraße ein, Main Avenue, wo der Lehm im gelben Schein der Fenster und Halbtüren glänzte.
„Ist das eine große Stadt, aus der du kommst?“ fragte Conrad, der neben mir saß.
„Stockholm, oh ja“, antwortete ich. „Das ist eine große Stadt.“
„Stockholm“, murmelte er halblaut. „Stockholm ...“
Es war ein eigenartiges Gefühl, so im Ambulanzkarren durch die Dakotafinsternis zu rumpeln und den Namen der Stadt zu hören, in der man aufgewachsen war. Plötzlich überkam mich unwiderstehliche Lust, meine eigene Sprache zu sprechen.
„Das ist was ganz anderes – was ganz anderes als diese Budenstadt“, sagte ich laut auf schwedisch. „Das Bauernnest hier! Das ist doch keine Stadt!“
Ich sagte, was ich von Bismarck und der 7. Kavallerie und vom Dasein im allgemeinen hielt, und benützte dazu lange, verschachtelte Sätze und alle Flüche, die ich kannte, die Worte strömten nur so aus mir heraus ... Ein paar lachten, andere baten mich, den Mund zu halten, einer der Korporäle stand mit erhobenen Händen auf. „Du brauchst dir gar nicht einzubilden, daß du der einzige bist!“ rief er. „Mit einer fremden Muttersprache, meine ich!“
Er fuhr auf Deutsch fort, und plötzlich schwirrten die vielfältigsten Sprachfetzen zwischen den Segeltuchwänden des Karrens hin und her, tschechisch, italienisch, spanisch ...
„Beruhigt euch wieder, Jungs!“ brüllte der Korporal, der deutsch gesprochen hatte. „Beruhigt euch! Ist jemand hier im Wagen, der von sich zu behaupten wagt, er sei ein echter Amerikaner?“
„Was meinst du damit?“ wollte einer wissen.
„Ich meine, daß beide Eltern hier geboren sein sollen“, erklärte der Korporal.
„Niemand ...“
„Ich kann den Namen eines echten Amerikaners nennen“, sagte Conrad. „Aber der ist jetzt nicht hier.“ Wer denn? wollte man wissen. Jemand schlug Custer vor.
„Custers Eltern kamen aus Deutschland“, sagte der Korporal.
„Auf jeden Fall der Vater. Das habe ich irgendwo gehört.“
„Sitting Bull“, sagte Conrad.
Einen Augenblick wurde es noch stiller im Wagen, dann fingen sie an zu lachen und zu reden, und ich fing die Worte „Spaßvogel“, „Rothaut“ und „tapfer“ auf.