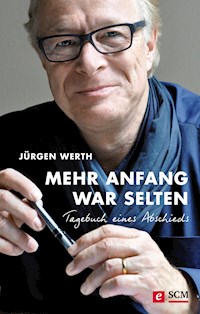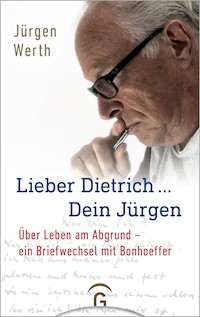Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Eigentlich wollen wir ja glücklich sein. Aber ständig kommt uns was dazwischen. Gehören Sie auch zu denen, die nur allzu gut wissen, was einem das Leben und die gute Laune so gründlich vermiesen kann? Jürgen Werth führt Sie zu einer Quelle, die Ihre Seele erfrischen wird - und die heißt "Dankbarkeit". Seine Gedanken und Einsichten sind wahre Augenöffner, das Gute in unserem Leben neu zu sehen. Es nicht als selbstverständlich hinzunehmen. Und sich an ihm zu freuen. Denn im Grunde haben wir 1.001 Gründe, "Danke" zu sagen. Probieren Sie die "Gesundheitskur" aus, die zwischen diesen Buchdeckeln steckt! Und erleben auch Sie: Danken tut gut. Und macht glücklich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 104
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Jürgen Werth war bis 2014 Vorstandsvorsitzender von ERF Medien und von 2007–2011 Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz. Er ist als erfolgreicher Autor, Liedermacher und Moderator bekannt.
Inhalt
Ein Wort zuvor
Danken kommt von denken
1 »Danke! Bin zufrieden!«
2 Denkmäler gegen die Vergesslichkeit
3 Jeder ist ein Wunderland
4 Niemand muss alleine sein
5 Gott schreibt Geschichte und Geschichten
6 Wer Christus hat, hat alles
7 Warum es manchmal so anstrengend ist, dankbar zu sein
8 Arme Reiche, reiche Arme
9 Reich und unzufrieden
10 Die Erde nährt die Seele nicht
11 Und wenn’s so gar nichts zum Danken gibt?
12 Gott sei Dank! Mensch sei Dank!
13 Rituale der Dankbarkeit
14 Danke sagen. Danke leben.
Ein Wort zuvorDanken kommt von denken
Nein, es ist nicht nur ein beliebtes Wortspiel. Danken kommt tatsächlich von denken. Das germanische Wort »danc« bedeutet ursprünglich: ich denke, ich gedenke. Wobei sich in das Gedenken vielleicht auf geheimnisvolle Weise dankbare Gedanken mischen und eine dankbare Gesinnung entsteht.
Heißt das nun: Wer denkt, wird dankbar? Und bedeutet es umgekehrt: Wer undankbar ist, hat nicht gedacht? Nicht nachgedacht? Das jedenfalls behauptet der Aphorismensammler Peter E. Schumacher: »Nur wer denkt, kann danken.«
Ganz so einfach ist die Formel sicherlich nicht. Aber sie weist in eine bedenkenswerte Richtung.
In diesem Buch möchte ich Sie ein wenig zum Denken anregen. Und vielleicht kann ich Ihnen dadurch auch eine Tür zum Danken öffnen. Dann werden Sie bestimmt merken: Danken tut tatsächlich gut!
Gedankenlosigkeit ist ein weitverbreitetes Phänomen in einer Zeit, in der wir so häufig so wenig Zeit haben, all das aufzunehmen und zu bedenken, was auf uns einströmt. »So vieles verhuscht heute«, sagte neulich ein guter Freund zu mir.
Aus Gedankenlosigkeit wird nicht selten Danklosigkeit. Wir loten nicht mehr tief. Wir schätzen nicht mehr viel. Wir wägen nicht mehr sorgfältig. Es ist die Zeit der Gleichgültigkeit. Und – zumindest hierzulande – die Zeit des stillen und lauten Jammerns.
Dabei geht es uns heute richtig gut in Mitteleuropa. Besser jedenfalls als allen Generationen vor uns. Besser auch als vielen Nachbarn, besonders denen im fernen Süden und im Nahen Osten.
Dort sind die Menschen aber häufig viel dankbarer als wir. Vielleicht, weil sie tiefer loten? Und ihre Lebens-Mittel bewusster wahrnehmen und schätzen?
Wir sollten unser Leben neu bedenken. Die Lebens-Mittel, die wir nutzen dürfen, neu schätzen lernen. Und uns bedanken. Bei Menschen und bei Gott. Denn, so schreiben es die Initiatoren des aktuell ausgerufenen »Jahres der Dankbarkeit«, »ein dankbares Leben ist ein gesundes Leben. Körperlich, seelisch und geistlich.«1
Also ist dieses Buch auch ein Gesundheitsratgeber.
Danke, dass Sie sich mit mir auf Wanderschaft begeben – auf eine Pilgerreise des Denkens und Dankens.
Jürgen Werth
1 die Seite zur Aktion im Internet: http://jahr-der-dankbarkeit.net
Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.
Francis Bacon (1561–1626), englischer Staatsmann und Philosoph
1 »Danke! Bin zufrieden!«
Immer wieder gab es dieses kleine Kämpfchen mit Mutti. Ort der Handlung: der Kaufhof. Genauer: die Spielwarenabteilung. Noch genauer: die glitzernde Theke mit den neuesten Siku-Autos. Bunte Bakelit-Straßenflitzer, die sich von den Originalen nur durch die Größe unterschieden. Aber was machte das schon! Im Geist sah ich diesen traumhaft schönen blauen Opel Rekord schon über die Straßen meiner Packpapierstadt gleiten, mit der ich mein Zimmer ausgelegt hatte. Alles würde er in den Schatten stellen! Alle BMW’s, Borgwards, Fords und Renaults. Den grünen Messerschmitt Kabinenroller und das rote Goggomobil sowieso.
Ich war zehn. Und ich konnte mich nicht losreißen. Aber ich wurde losgerissen.
»Aber du hast doch schon so viele!«
»Aber den hier nicht!«
»Und was ist daran so besonders??«
»Ach, Mutti!«
Wenn gar nichts half, half Oma. Und wenn selbst die sich nicht erweichen ließ, musste Tante Emmi ihr Portemonnaie zücken. Irgendwann würde ich ihn haben! Und fahren! Und glücklich sein!
Für zwei Tage.
Oder zwei Wochen.
Denn dann stand garantiert ein noch traumhaft schönerer Mercedes in der Siku-Theke der Spielwarenabteilung.
So ist das geblieben. Bis heute. Nein, Siku-Autos sind’s eher selten, die mein Herz erobern. Der Maßstab ist gewachsen. Heute müssen es schon richtige Autos sein. Oder Couchgarnituren. Oder Klamotten. Oder wenigstens Bücher. Oder Musik. Oder die ultimative neue Kalender-App. Nur, dass ich Mutti heute nicht mehr fragen mag. Und ich Oma und Tante Emmi schon seit Jahren nicht mehr fragen kann.
»Aber du hast doch schon so viele!« Heute sag ich’s mir immer wieder selbst. Weil die Schränke voll sind. Weil ich meist doch nur ein Jackett auf einmal trage. Weil die alte Couchgarnitur noch lange nicht durchgesessen ist. Und weil Autos immer teurer werden.
Und weil ich längst weiß, dass der alte Wilhelm Busch recht hat:
»Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge.«
In der Psychologie spricht man von »hedonistischer Adaption«. Das heißt: Man gewöhnt sich an alles Gute, das man hat, und hält es im Handumdrehen für den Normalzustand. Und will mehr.
Als unsere Kinder noch klein waren, hatten sie ein kleines Bilderbuch über »Zarifa, das unzufriedene Kamel«. Dieses dumme Wüstentier hatte wirklich ständig was zu meckern. Immer fehlte etwas. Mal war es zu kalt, mal war es zu heiß. Mal war das Futter zu feucht, mal war es zu trocken. Nie passte, nie reichte, was ihm zugedacht war. Beim Vorlesen spürte ich regelmäßig, wie mir der Kamm schwoll.
Manchmal habe ich Zarifa ärgerlich als Zeugin bemüht, wenn unsere Kinder wieder einmal etwas Neues zum Spielen oder zum Anziehen wollten, obwohl sie gerade erst etwas Neues bekommen hatten und die Schränke überquollen. Und habe mich dann an meine Kämpfchen mit Mutti im Kaufhof erinnert – und mich ein bisschen geschämt.
Es steckt offenbar tief in unseren Genen: Wir übersehen, was wir haben. Und sehen, was wir nicht haben, und was uns, so glauben wir, glücklich machen würde. Oder wenigstens zufrieden. Zumindest ein bisschen zufriedener als vorher.
Dabei ist Zufriedenheit ja eine Lebenshaltung. Das habe ich in einem Seminar bei einem amerikanischen Unternehmens- und Lebensberater gelernt: »Contentedness is a learned behaviour.« Zufriedenheit ist ein gelerntes Verhalten. Das heißt: Wer zufrieden ist, hat gelernt zu sehen, was er hat. Wer unzufrieden ist, hat gelernt zu sehen, was er nicht hat. Aber kann man das tatsächlich lernen?
Zunächst: Zufriedenheit hat etwas mit Dankbarkeit zu tun. Wer dankbar ist, ist zufrieden. So kann man selbst dann zufrieden sein, wenn man gar nicht viel hat.
Wenn ich heute mit Mutti telefoniere und sie frage, wie’s denn geht, dann sagt sie häufig: »Danke! Bin zufrieden.« Das hilft mir nicht wirklich. Denn ich möchte doch wissen, ob es ihr gut oder schlecht geht. Doch dann denke ich: Mehr als zufrieden sein geht ja nicht. Zufrieden, weil’s gut geht. Oder zufrieden, obwohl’s nicht gut geht. Wenn Mutti zufrieden ist, bin ich’s auch.
Und manchmal erzählt sie mir dann von den kleinen Erlebnissen ihres überschaubarer werdenden Alltags. Von menschlichen Engeln, die ihr immer wieder aus der Patsche helfen. Von den kleinen und großen Wundern, mit denen sie immer wieder beschenkt wird. All dies sind Dinge und Umstände, die kräftig mithelfen, dass sie zufrieden ist.
Darauf ist Mutti angewiesen. Seit Jahren wird ihre Sehkraft kontinuierlich schwächer. Neulich saß sie mir gegenüber und sagte: »Ich will ja nicht jammern. Aber ich sehe dich nicht. Ich erkenne dich an deiner Stimme. Und an deinen Bewegungen.« Mir fiel da nur ein schwacher Trost ein: »Schlimmer wär’s, wenn du mich sehen, aber nicht mehr erkennen würdest.« Worauf sie lächelnd antwortete: »Das stimmt. Nein, ich bin ja dankbar, dass ich noch denken kann.«
Dankbar, weil zufrieden. Zufrieden, weil dankbar.
Ich möchte das auch sein. Ich möchte das lernen. Und üben. Jeden Tag.
Darum habe ich mir angewöhnt, zum Beispiel auf langen Autofahrten all das aufzuzählen, was ich bin und habe. Ich zähle es für mich selber auf. Aber ich sage damit auch Danke.
Für das Auto, das mich sicher an mein Ziel bringt.
Für die Straße, die schlaglochfrei ist.
Für die korruptionsfreie Ordnung, auf die ich mich in diesem Land verlassen kann.
Für die abwechslungsreiche Landschaft, die ich genießen kann.
Für Sonne und Wolken und Wind und Regen.
Für den Wechsel der Jahreszeiten.
Für die Musik aus dem ipod.
Für die unzensierten Nachrichten und Kommentare aus dem Radio.
Für die Klamotten, die ich trage, und dass ich heute wieder einmal die Qual der Wahl hatte.
Für das Frühstück, das mir gutgetan hat.
Für Mittag- und Abendessen, die auf mich warten.
Für das Haus, in dem ich wohnen darf.
Für die Menschen, mit denen ich mein Leben teile, die mich lieben und zuweilen einfach aushalten.
Für die Liebe, die mich trägt.
Für die Aufgaben, die ich für andere erledigen darf.
Für die Lunge, mit der ich atme. Und dafür, dass ich sprechen kann. Hören. Sehen. Riechen. Fühlen. Und schreiben.
Für den Glauben. Und dafür, dass ich beten darf.
Für das Ziel dieser Fahrt – und meines Lebens.
Manchmal bete ich und komme kaum an ein Ende, weil jedes Dankeschön ein neues hervorlockt. Manchmal singe ich auch, zum Beispiel mit Texten von Paul Gerhardt:
Lobet den Herren alle, die ihn ehren;lasst uns mit Freuden seinem Namen singenund Preis und Dank zu seinem Altar bringen.Lobet den Herren!
Der unser Leben, das er uns gegeben,in dieser Nacht so väterlich bedecketund aus dem Schlaf uns fröhlich auferwecket:Lobet den Herren!
Dass unsre Sinnen wir noch brauchen könnenund Händ und Füße, Zung und Lippen regen,das haben wir zu danken seinem Segen.Lobet den Herren!
Dass Feuerflammen uns nicht allzusammenmit unsern Häusern unversehns gefressen,das macht’s, dass wir in seinem Schoß gesessen.Lobet den Herren!
Dass Dieb und Räuber unser Gut und Leibernicht angetast’ und grausamlich verletzet,dawider hat sein Engel sich gesetzet.Lobet den Herren!
Oft schätzen wir, was wir haben, erst dann, wenn wir’s hatten. Wenn’s weg ist, unwiederbringlich verloren. Dann aber ist es zu spät.
Der kleine und große Komfort meines Lebens, alles, worauf mein Namensschild klebt, meine Talente, meine Berufung, die Alltage und die Feiertage und die Menschen an meiner Seite – ich will nicht erst warten, bis ich sie schmerzlich vermisse.
Ich will sie schon heute beachten und achten und wertschätzen. Und Danke sagen. Und zufrieden werden.
Gesundheitstipp Nr. 1:
Zufrieden sein mit dem, was ich habe
Danke, guter Gott,dass du mich mit deinen Wohltaten geradezu überschüttest.Ich kann sie kaum alle aufzählen.Verzeih, dass ich mich an allzu vieles allzu schnell gewöhne.Dass ich darum ständig etwas Neues haben möchte.Ich weiß, dass es manchmal mehr ist, als ich tragen kann.Ich sehe nicht das, was ich habe,sondern das, was mir fehlt.Und werde unzufrieden.Dabei möchte ich ein dankbarer Mensch sein.Und ein zufriedener.Öffne meine Augen, lieber Herr! Öffne alle meine Sinne!Damit ich sehe und höre und fühle und rieche und schmecke.Danke, guter Gott!
Ich sage jeden Tag zu Gott: »Du bist wunderbar.« Je mehr ich dies sage, desto mehr lässt er mich Wunder seiner Liebe sehen.
Phil Bosmans
2 Denkmäler gegen die Vergesslichkeit
Der junge Kellner im indischen Mumbay war geradezu aus dem Häuschen, als er gehört hatte, dass wir aus Deutschland kommen. »Frrom Gerrmany!!«, prustete er in seinem unnachahmlichen Indisch-Englisch. Und dann sprudelte es nur so aus ihm heraus: dass wir ein beneidenswertes Land wären, weil wir das Wunder der Wiedervereinigung erlebt hätten. Und dass bei uns bestimmt alle Menschen jeden Tag auf der Straße tanzen würden vor Begeisterung. »Wenn ich einmal Großvater bin, werde ich meinen Enkeln erzählen, dass ich das erlebt habe! Dieses unglaubliche Wunder! Ihr seid das glücklichste Volk der Welt!«
Meine Reisegefährten und ich haben wohl ein bisschen betreten zu Boden geblickt. Wir schrieben das Jahr 1996. Und die Euphorie über die Vereinigung der beiden Deutschlands war längst davongeflattert, wie ein Schwarm Zugvögel auf der Durchreise. Wessis und Ossis hatten sich nur kurz in den Armen gelegen. Inzwischen waren viele wieder auf Distanz gegangen. Und machten Witze über die Möglichkeit, eine neue Mauer aufzubauen. Verwundert fragten sich viele, warum sie die Wiedervereinigung einmal für ein Wunder gehalten hatten.
Nein, ich glaube nicht, dass unser Kellner uns mit diesen Freundlichkeiten nur deshalb überschüttet hat, weil er auf ein üppiges Trinkgeld spekuliert hat. Denn seine dunklen asiatischen Augen blitzten, als er in unsere trüben europäischen blickte.
Als er in der Küche verschwunden war, raunten wir einander ein bisschen betroffen zu: »Er hat ja eigentlich recht. Blöd, dass wir das so schnell vergessen haben. Noch blöder, dass uns ein indischer Kellner daran erinnern muss.«
»Nichts ist vergesslicher als Dankbarkeit!«, heißt es in Friedrich Schillers Schauspiel »Don Carlos«.