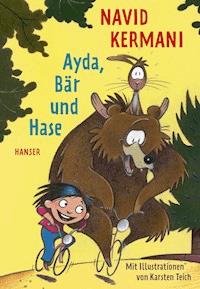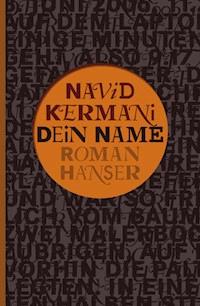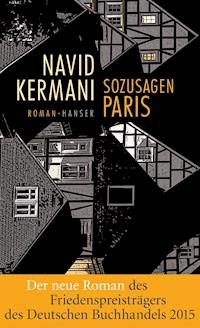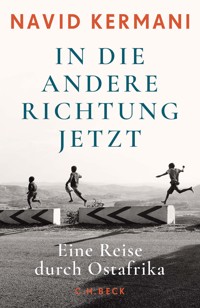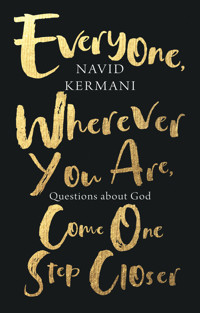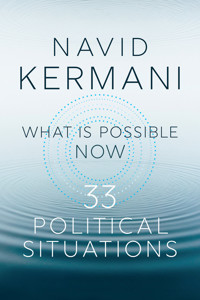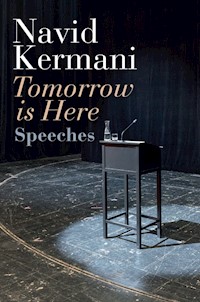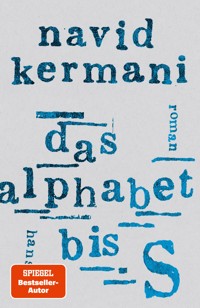
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Navid Kermanis großer, lang erwarteter neuer Roman - ein Fest der Literatur!
Eine Schriftstellerin auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs und zugleich am Tiefpunkt ihres Lebens: Die Ehe gescheitert, die Mutter gestorben, und plötzlich ist auch der Lebensentwurf als öffentliche Intellektuelle in Frage gestellt. Denn der sah vor, dass der Mann sich um Kind und Haushalt kümmert, während sie sich um das Elend der Welt sorgt. Virtuos verknüpft Navid Kermani die Grundfragen unserer Existenz, Geschlecht, Krieg und Vergänglichkeit, mit dem Alltäglichsten. So wie seine Heldin ist auch sein Buch ein Solitär: Roman und Journal, Essay und Meditation, ein Fest der Literatur. Etwas, das es so noch nicht zu lesen gab, weil es, wie alle großen Bücher, seine eigene Form erschafft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 907
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Navid Kermanis neuer sprachgewaltiger Roman über unsere Gegenwart, die Literatur und das LebenEine Schriftstellerin auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs und zugleich am Tiefpunkt ihres Lebens: Die Ehe gescheitert, die Mutter gestorben, und plötzlich ist auch der Lebensentwurf als öffentliche Intellektuelle in Frage gestellt. Denn der sah vor, dass der Mann sich um Kind und Haushalt kümmert, während sie sich um das Elend der Welt sorgt. Virtuos verknüpft Navid Kermani die Grundfragen unserer Existenz, Geschlecht, Krieg und Vergänglichkeit, mit dem Alltäglichsten. So wie seine Heldin ist auch sein Buch ein Solitär: Roman und Journal, Essay und Meditation, ein Fest der Literatur. Etwas, das es so noch nicht zu lesen gab, weil es, wie alle großen Bücher, seine eigene Form erschafft.
Navid Kermani
Das Alphabet bis S
Roman
Hanser
Winter
1
Das Grab der Mutter besucht, das die Gärtnerei hergerichtet hat, tröstlich: ein Rechteck dunkelbrauner, wie Torf lockerer, sorgsam begradigter Erde, groß genug auch für den Vater, mich und weitere Nachfahren. Mein Sohn hat bereits angekündigt, er möchte ebenfalls bei der Familie liegen, wenn es soweit ist. Als Markierung und schlichter Schmuck liegen zwei quadratische Steinplatten auf den unteren Ecken des Feldes, das dank der Blumengebinde wie ein Beet aussieht, ein Totenbeet, kein Acker. Im oberen Viertel, sehr auffällig, weil schräg Richtung Mekka statt rechtwinklig wie die Grabsteine ringsum, ist die Erde wie zu einem Sarg aufgeschüttet und mit weiteren Kränzen bedeckt, die nach zwei Wochen noch nicht vollends verblüht sind. Eine Holztafel mit arabischer Basmallah, auch das fremd unter den Deutschen, und dem verkehrt herum geschriebenen Namen, Nachname zuerst, weil der schiitische Bestatter nicht achtgegeben hat. Das verkehrte Geburtsjahr ist immerhin nicht sein Fehler; wir hätten es ihm sagen müssen, daß es im Paß falsch steht. Man war früher in Iran nicht so pedantisch. Die Frage stellt sich, ob wir warten, bis die Tafel mit dem Grabstein ausgetauscht wird, oder sie selbst austauschen, ob wir also pedantisch sind.
Der Vater wollte das Grab gestern besuchen, vor der Feier, die dieses Jahr keine sein konnte, der Feier der anderen, aber gestern trafen wir zu spät ein, weil der Friedhof ohne Ankündigung oder Erklärung eine Stunde früher geschlossen worden war; um Viertel nach vier kam man noch raus, aber man kam nicht mehr hinein, so daß sich ein seltsamer Anblick ergab: Während die einen durch eine eiserne Drehtür auf die Straße traten, als wären sie wiedererweckt worden, rüttelten die anderen vergeblich am Tor, als verwehrte man ihnen den Tod. Einige von denen, die zu spät waren, legten ihre Blumensträuße auf der Friedhofsmauer ab oder warfen sie hinüber. Die Blumen gelten dann allen Toten, nehme ich an, was vielleicht sogar die bedeutendere Geste ist.
Was ist Trauer? Selbst der Vater hat sich vorläufig wieder gefangen, mindestens in Gesellschaft. Du tust alles, was dir auferlegt ist oder wovon du dir einbildest, es sei dir auferlegt, flichtst die gewöhnlichen Beschäftigungen in den Tag, ohne geregelten Beruf ein bißchen später und zögerlicher, als wenn du morgens auf der Matte stehen müßtest, du lachst auch wieder, ja, du lachst!, obschon nicht übermäßig, meidest Feste, bist jedoch dankbar für den ersten Kinobesuch, ein Konzert, bei dem die Gedanken ausruhen oder schweifen, du erinnerst dich daran, daß du lebst, und blickst sogar zärtlicher auf die Dinge und die Menschen, weil dir die Verletzbarkeit bewußter ist, bist freundlicher als sonst, wie dir auch freundlich begegnet wird, du könntest sogar das erste Mal wieder einen Körper begehren, wenn du wüßtest welchen, du würdest es wollen und schämtest dich weder vor der gestorbenen Mutter noch vor dem Mann, der nicht mehr deiner ist, du könntest dich vergessen und sogar Erlösung finden für ein paar Sekunden, die niemand zählt.
Das Neue Jahr erwarteten wir zu viert: mein Vater, der nicht alleingelassen werden konnte, mein Sohn und meine beste Freundin, die wiederum mich nicht alleinlassen wollte und Schnitzel zubereitete, dazu Kartoffelsalat, als Nachspeise Eis, um es einfach zu halten, ein echtes deutsches Essen, wie der Vater anerkennend rief. Die Stühle meiner Mutter und meines Manns blieben leer. Offenbar potenziert die Trauer den Liebesschmerz und umgekehrt, jedenfalls kann ich beides kaum auseinanderhalten, es ist wie ein einziger, in seiner Größe nicht erwarteter Verlust. Dabei fühlt sich beides ähnlich an, auch das überraschend, der eigene Mann, eben noch der vertrauteste, nächste, selbst im Streit immer noch zugewandte Mensch, ist ein Fremder geworden, nein, weniger als ein Fremder, denn einen Fremden kannst du kennenlernen, du kannst mit ihm Tee trinken, ins Gespräch kommen. Eine Liebe, die fort ist, kannst du nicht einmal mehr anrufen oder nur, wenn es etwas Praktisches zu besprechen gibt, so wie man seinen Bankberater anruft oder bei der Deutschen Bahn. Auf niemanden habe ich bedrückt gewirkt, nehme ich an, aber niemand versuchte, mich zu überreden, die Freundin nach Mitternacht noch auf eine Party zu begleiten, nicht einmal der Sohn, der mich dieser Tage zu allem möglichen ermuntert, und beides tat gut, das vergnügte Abendessen und daß die anderen dennoch die Trauer wahrnahmen oder sie ebenfalls trugen. Um Mitternacht trafen wir uns wie jedes Jahr mit den Nachbarn zum Anstoßen auf dem Dach. Zwei von ihnen halfen meinem Vater, die Stiege hinaufzusteigen, damit er ebenfalls den strahlenden Dom erblicke, der zum Feuerwerk zu gehören schien. Das ist Trauer, wenn das Glück, das es doch gibt, nicht mehr zu einem durchdringt. Du siehst es, es ist da, und du verbeugst dich davor oder schüttelst ihm die Hand wie einem Besucher am Grab, mehr aber auch nicht.
2
Abends im Kino, bereits das dritte Mal in einer Woche, weil davor beinah fünf Monate nicht. Auffällig der immer gleiche Verlauf seit der Romantik: Nichtsahnend geht jemand aus dem Haus, als … Die Wirklichkeit, die über ihn hereinbricht, verwandelt oder vernichtet den Helden, erhebt oder läutert ihn, je nach Regisseur, Genre und Land. Aber was ist danach? Ich bin neugierig, ja, wie im Kino gespannt, was danach sein wird, also jetzt — dieses Jahr, diese Woche, morgen. Wird etwas aus der Wandlung folgen, aus der Läuterung, aus der Zerstörung? Oder setzt sich jene höhere Wirklichkeit fort, die sich in Notärzten und Familiengerichten offenbart oder in Gestalt des Vaters, der noch nicht weiß, ob vom Leben ihm noch etwas anderes bleibt als ein leichter oder langsamer Tod?
3
Die Wirklichkeit: am Morgen die Adressen aufgelistet für die Einladung zur Tschehleh, der islamischen Entsprechung zum Sechswochenamt, als wieder ein Anruf das Tagwerk abbrach. Am Abend ließ ich den Vater auf der obersten Etage eines Krankenhochhauses zurück. Man soll ihn nicht anrufen, richtete er der Verwandtschaft aus, das würde ihn zu sehr mitnehmen, ohne daß es Freude schenke wie Besuch. Das Zimmer, immerhin, hat Aussicht auf den Dom.
Das Tagebuch ohne Datum, das ich mir vorgestellt habe, soll nicht um mich gehen, soll mich gar nicht erwähnen. Es soll ausschließlich notieren, was zwei Augen sehen, die zugegeben nun einmal meine eigenen sind, oder zwei Ohren hören. Allein, selbst eine Chronistin, eine Berichterstatterin, eine Zeugin hat ein Gemüt, und an Tagen wie heute bin ich nicht imstande, einen Eindruck festzuhalten, der mir wichtig ist. Mir fallen die Augen zu, sobald ich mich endlich an den Schreibtisch setze, und lege ich mich ins Bett, vertreiben die Sorgen den Schlaf. Findet sich heute überhaupt nichts, was mitteilbar wäre, ohne daß ich meine Stimmung beigebe oder mein Privatleben ausbreite, nicht mal ein Moment, eine Beobachtung, bei der ich nur zwei Augen, zwei Ohren war?
Als ich aus dem Krankenhaus trat, rief ich endlich die Lektorin zurück; sie war nicht verärgert, solange gewartet zu haben, aber der Vorabdruck mußte dringend raus. Aber ich mußte auch zurück zum Sohn, der zu Hause wartete, außerdem hatten wir kein Brot. Während die Lektorin abwog, welches Kapitel wir der Zeitung vorschlagen, Mali, Jemen oder Tschetschenien, lief ich durch das Viertel am Stadtrand, ausgestorben wie ein Dorfkern nach Feierabend mit nur ein paar erleuchteten Geschäften und schäbig, wie man es in den besseren Vierteln nur aus dem Fernsehen kennt, dreistöckige Mietskasernen aus der Nachkriegszeit. Wahrscheinlich war hier vor dem Krieg noch freies Feld, so daß man nicht erst Ruinen wegräumen mußte zum Bauen, und später wurde der Turm für die Kranken hineingesetzt, damit der Stadtteil noch etwas anderes hat als billigen Wohnraum.
Sollen wir nicht eher die Jesiden nehmen?, fragte ich die Lektorin, die sich ihrerseits ausmalte, wie ich gleichzeitig am nördlichen Rand Kölns eine Bäckerei suche. Hier unterbrach ich das Telefonat erst, als ich an der Reihe war, eines der drei verbliebenen Brote zu kaufen, und war bereits beim Bezahlen zurück beim Islamischen Staat. Den IS haben die Leute noch auf dem Schirm, erklärte die Lektorin, warum ihr der Frontbericht aus dem Irak nicht originell genug schien für den Vorabdruck: Dann schon eher der Donbass. Im Auto probierte ich verschiedene Positionen des winzigen Nokia-Handys aus, mit dem ich meine Kulturkritik demonstriere, auf dem Schoß, zwischen die Oberschenkel geklemmt, an die Gangschaltung gelehnt, auf Bitte der Lektorin auch bei laufendem Motor, um zu testen, ob ich sie während der Fahrt höre und sie mich: Laß uns mal Myanmar durchgehen. Während ich durch die nächtliche Stadt zurückkehrte ins Zentrum, auf nach und nach belebteren Straßen, durchstreifte ich zugleich ein Flüchtlingslager in Bangladesch. Selten genug, fand ich auf Anhieb eine Lücke und gelang mir das Einparken mit dem ersten Schwung, so daß ich noch nicht mit den Rohingya fertig war, als ich bereits im Wohnungsflur dem Sohn einen Kuß auf die Stirn drückte. Selten auch dies, schmeckte ihm das reine Roggen, das wirklich sehr gut war, mit dem säuerlichen Geschmack und der genau richtigen, halbfesten Konsistenz der Stullen, die meine Mutter uns für die Schule schmierte. Wenn das Buch ein Erfolg wird, leiste ich mir eine Freisprechanlage, verkündete ich beschwingt. Ohne Smartphone nützt dir das nicht viel, erklärte der Sohn.
4
Aus dem Augenwinkel verfolge ich das Beziehungsdrama am Nebentisch, das alle Regieanweisungen bis hin zu Tränen, mühsam unterdrückten Schreien und Prosecco zur Versöhnung befolgt, mit zwei Frauen allerdings, aber der Wortlaut, die Gesten und selbst die Rollenverteilung könnten von jedem anderen Paar unseres Alters und sozialen Stands sein. Schauderhaft, die eigenen Grimassen zu erblicken, und der Spiegel ist nicht einmal verzerrt. Verzerrt sind unsere Lieben, in denen jeder ich sein will, nicht du, das haben wir so gelernt und finden aus den falschen Lehren nicht heraus. Allerdings stimmten auch schon die früheren Lehren nicht. Im Freundeskreis ist kein Paar unseres Alters und unseres Stands mehr übrig, das zur Versöhnung noch Prosecco bestellen kann. Statt dessen setzen nach den Tränen die Schuldgefühle ein, weil den Kindern, obwohl unbeteiligt am Streit, die Familie genommen worden ist. Wieviel tiefer, tief ins Unbewußte muß bei ihnen die Erschütterung wirken, wenn schon der Eindruck der Erwachsenen, verlassen worden zu sein, so drastisch ist, als hätte die eigene Mutter sie aufgegeben oder der Vater oder beide auf einmal.
Wenn statt der Unbekannten ein Paar aus dem Freundeskreis am Nebentisch stritte, würde ich mich dennoch fragen, wer sie sind. Würde sie nicht wiedererkennen, weil jeder vom anderen dessen Schlechtigkeit hervorholt. Nein, dann ist es wohl besser, sie trennen sich, wenn sie zusammen kleiner werden statt größer. Dabei war es doch auch ihre Liebe, bis vor kurzem ihre Harmonie und Eintracht, die den Sohn so wunderbar und stark und mitfühlend gemacht hat. Bis zuletzt waren sie zärtlich, weit über den Beginn der Trennung hinaus, als hätten ihre Körper noch nicht bemerkt, was ihren Seelen geschah. Wie aus dem Augenwinkel beobachte ich auch uns.
5
Wenn du geblitzt wirst, in dieser, ich weiß nicht, Zehntel- oder halben Sekunde, in der du buchstäblich nur noch rot siehst, der banalste Augenblick der Welt, dem nur der Blick auf den Tacho folgt — es durchfährt dich jedes Mal wie Strom, plötzlich gibt es nichts anderes, du wirst aus egal welcher Sorge, welcher Trauer oder welcher Überlegung herausgerissen, gegebenenfalls auch aus der Verliebtheit oder einer sexuellen Phantasie, und denkst tatsächlich, du seist erwischt worden, von einer höheren Macht erwischt bei allem, was du verbrochen hast, bis du begreifst, daß es nur wegen zu schnellen Fahrens ist. Beinah bist du erleichtert: zwischen sechzig und siebzig, nach Abzug der Fehlertoleranz vermutlich unter sechzig. Es gibt so viel mehr, was du im Leben falsch gemacht hast.
6
Totenwaschung. Ich hätte nicht geglaubt, daß ein Erlebnis tiefer aufwühlen könne als selbst die Geburt des eigenen Kindes, so tief, daß du es an der Oberfläche erst mit Verzögerung bemerkst. Im Vergleich wirkte das Sterben beinah natürlich, jedenfalls nicht überraschend, ein Übergang, von dem ich bereits viel gehört und manches gelesen hatte, und genau so war es dann auch: Der Atem hörte auf, und ich sah der Mutter noch hinterher. Etwas Lebendiges blieb kurze Zeit im Raum. Bei der Geburt hingegen, weil die Richtung die entgegengesetzte ist und du an die Brust drückst, was bereits ein Geschöpf ist, überwog die Fassungslosigkeit, die ins Glück, in die Begeisterung ausschlug. Am Totenbett blieb ich nach dem ersten Schock und recht wenigen Tränen ruhig, aufmerksam und ganz klar, froh, daß die Mutter friedlich gegangen war, ihre Hand auf dem Bauch, die andere entspannt neben dem Körper, die Gesichtszüge um Jahrzehnte verjüngt. Erst beim gemeinsamen Totengebet, als nach der Familie auch der Imam eingetroffen war, brachen die Tränen aus mir heraus, und selbst das leuchtete mir ein.
Dem schlechthin Unerklärlichen wie bei der Geburt begegnete ich erst, als wir den eiskalten Leib wuschen, mit großer, ja, zärtlicher Behutsamkeit angeleitet von der Wäscherin der Moschee, dieser körperliche, ohne jede Eile sich hinziehende Vorgang. Es war weniger schlimm, als ich befürchtet hatte, selbst der Geruch, der gerade noch merklich in die Nase stieg, selbst der Geruch erschien mir richtig. Es war nur überraschend, daß der Leib noch da war, man ihn berühren konnte, eine Hülle jetzt. Niemals habe ich stärker empfunden, daß der Mensch Würde hat, wenn er selbst nach seinem Tod so freundlich und respektvoll behandelt wird, bis hin zu ihrer Scham, die anders als im Krankenhaus, wo sie täglich den Blicken und den elendsten Situationen ausgesetzt war, stets bewahrt blieb. Die Wäscherin hob das Tuch, das die Scham bedeckte, für die Reinigung nur wenige Zentimeter an und wandte zusätzlich den Blick ab. Als die Mutter bis in alle Poren sauber war, auch ihr Haar mit Shampoo gewaschen, der Körper mit den feinsten Essenzen des Libanons bestäubt und ins weiße Tuch ihres Pilgergewands gewickelt, hoben wir sie zu viert an. Offenbar dachten die Schwestern das gleiche, jedenfalls schauten wir uns verblüfft an: So leicht war der Körper, viel leichter als erwartet. Wog denn die Seele so schwer? Das Gebet der Wäscherin nachmurmelnd, betteten wir die Mutter in den Sarg und betrachteten sie lange. Ihr Gesicht: als wäre sie schon im Himmel, flüsterte eine von uns, so schön. Mama ist ein Engel, sprach leise die andere, wie ein Kind. Zuletzt zog die Wäscherin das Tuch übers Gesicht.
7
Die Freude über das neue, mit Halogenleuchten versehene Kinderzimmer und die waagerecht gereihten Bilder, mein Stolz, daß uns der Umbau ohne fremde Hilfe gelungen ist, obwohl der Vater sich stets geweigert hatte, mich auch nur das Bohren zu lehren. Mochte er aufgeklärt sein wie er wollte, ein Bohrer gehörte nicht in die Hand einer Frau! Nun ist die Hand des Vaters längst zittrig geworden; nachdem auch das dritte Loch faustgroß geraten war, schimpfte er zum ersten Mal auf den fortgelaufenen Schwiegersohn.
8
Gleich, wieviel du bereits veröffentlicht hast, jedes Mal klopft das Herz, wenn das Päckchen mit dem neuen Buch an der Wand unterm Briefkasten lehnt. Nicht sofort, sondern in Ruhe und unbedingt allein holst du es heraus, oben am Schreibtisch hinter geschlossener Tür, betrachtest zunächst den Umschlag, wunderst dich über den Klappentext, als kenntest du ihn nicht längst, nimmst den Umschlag ab und tastest den Einband mitsamt dem Schriftzug ab, bleibst beim Durchblättern auf manchen Seiten hängen und hoffst, es werde den Lesern genauso gehen, die in der Buchhandlung stöbern. Dann prüfst du das Dankwort, falls der Dank aufgeschrieben ist, und findest in der Regel den ersten Fehler; in den Zusätzen geschehen die meisten Unaufmerksamkeiten, weil man sie erst im letzten Fahnenlauf geprüft hat. Wenn du nach Abzug der Fehlertoleranz immer noch glücklich bist, preist du im Stillen den Verlag und ebenso die Druckerei, die wie die Manufakturen in alten, seit jeher besser geglaubten Zeiten selbst auf die unscheinbaren Details Mühe verwandt hat — das Satzbild vollendet, die Farbe des Lesebändchens passend zum Einband, die Bindung reißfest, die Schrifttype passend zum Inhalt — Sorge getragen selbst für die Wahl und Klimaverträglichkeit des Papiers, preist ebenso die Leser, die seit jeher am Aussterben sind und dich dennoch weiter ernähren.
9
Während ich im Geiste die Feier zur Tschehleh durchgehe, beim Joggen wie so oft, verfalle ich auf die Idee, die Trauerrede als Broschüre auszulegen, den Verlag zu bitten, daß er mir beim Druck hilft, um einmal meine Branche einzubringen wie andere in meiner Verwandtschaft die Jurisprudenz, die Medizin oder die Finanzwirtschaft. Bei der Gelegenheit kommt mir wieder eine Episode in den Sinn, womöglich die maßgebliche für das spätere Verhältnis zur Mutter. Die Episode hatte nicht in die Rede gepaßt, die ihre Stärken besang, denn sie bescherte ihr eine Niederlage und mir einen unerwarteten, allerdings bitteren Sieg. In Wahrheit, so erkannte ich beim Joggen, hatten wir beide verloren, wie seither in jedem Kampf, unser ganzes Leben lang.
Ohne um Erlaubnis zu bitten oder auch nur meine neue Adresse preiszugeben, war ich in eine Wohngemeinschaft gezogen. Die Eltern meinten, sie könnten mich zwingen, in mein Kinderzimmer zurückzukehren, ich war erst sechzehn; ihre Sorgen verstand ich sogar halb und verstehe sie heute um so mehr. Stur, wie ich war, das hatte ich vom Vater, brach ich den Kontakt ab, als der Streit sich zuspitzte, den Kontakt zu iranischen Eltern, zu einer iranischen Mutter! Anfangs glaubte sie wahrscheinlich, ich würde ohne Geld schon klein beigeben, aber als sie merkte, daß ich tatsächlich nicht mehr zum Essen kam und nicht einmal anrief, fing sie mich vor der Schule ab, die ich immerhin weiter besuchte. Natürlich weigerte ich mich, ins Auto zu steigen. Ich nahm an, sie würde vor meinen Mitschülern zu einer Tirade anheben, zu Flüchen, Beleidigungen, pathetischen Wehklagen, was sie alles für mich getan. Aber meine Mutter blickte mich nur kalt an, eisig.
Damit hatte ich nicht gerechnet, und ich erinnere mich, beinah ärgerlich gewesen zu sein, skeptisch, als unterstellte ich ihr nur einen weiteren Trick. Heute denke ich, sie war einfach meiner Aufsässigkeit überdrüssig, traurig genug über den Auszug der beiden älteren, der zugewandten Töchter und jedenfalls zur letzten Eskalation nicht mehr fähig oder bereit. Und war nicht Mitte der Achtzigerjahre auch die Ehe meiner Eltern in schwerer Not, wenn ich die Abläufe nicht durcheinanderbringe, dazu die Enttäuschung über die Revolution in Iran, der Krieg gegen Irak und die Sorge um ihren Neffen, der verhaftet worden war, und hatten nicht auch die Wechseljahre eingesetzt? Ich weiß es nicht, ich habe mir mit sechzehn keine Gedanken um sie gemacht, sondern ausschließlich mich selbst gesehen, mich und die Freiheit der WG. Erst ihr neuerlicher, zu oft bereits für final erklärter Befehl, nach Hause zurückzukehren, sonst werde sie heute noch mein Zimmer ausräumen und ohne Rücksicht alles auf den Sperrmüll werfen, was ich besitze, gleich was der Vater an Entschuldigungen vorbringe — erst ihr Befehl brachte Erleichterung, weil er dem vertrauten Streit zum Ausbruch verhalf. Erstens nahm ich die Drohung nicht ernst, und zweitens hielt ich es sogar für vorteilhaft, wenn meine Mitschüler die Raserei meiner Mutter einmal selbst erlebten, sie würden mich dann noch besser verstehen. Die Mutter schrie aus voller Kehle, ich hielt dagegen, aber wenigstens schaute sie mich nicht mehr so verächtlich an.
Dann verebbten die Worte, keuchend standen wir uns einen Meter entfernt gegenüber auf dem Bürgersteig, ohne daß ich ihrem Blick auswich. In Zeitlupe hob sie die rechte Hand, die Finger gespreizt, als ob sie mich im nächsten Augenblick ohrfeigen würde. So verharrten wir, ich weiß nicht wie lang, sicher nicht so lang, wie es mir in der Erinnerung erscheint, und sie hatte wieder diese Kälte im Gesicht, unter allen Menschen ausgerechnet die Mutter diese Erbarmungslosigkeit. Plötzlich, als ob jemand einen Schalter umgelegt hätte, schlug sie mit beiden Händen sich selbst, weiter und weiter, sie hörte gar nicht mehr auf. Hilflos schaute ich zu, wie ihre flachen Hände mit aller Kraft auf die frisch frisierten Haare prasselten und ihr Gesicht rot anlief, jeder ihrer Schläge schmerzhafter als eine Ohrfeige für mich. Vor meinen Mitschülern, den Deutschen, die niemals die Contenance verlieren, wurde mir die iranische Mutter vollends unangenehm.
Endlich ließ sie die Arme sinken, die Frisur zerstört, Schweiß auf der Stirn, dicke Tränen liefen ihr die Wangen herunter. Zum ersten Mal fiel mir auf, daß einige Haare am Ansatz grau schimmerten, offenbar hatte sie beim Färben nicht achtgegeben. Ich ging an ihr vorbei zur Haltestelle, wo keine Minute später bereits der Bus eintraf.
Seit diesem Tag habe ich kein einziges Mal mehr, jedenfalls nicht bei einer wichtigen Entscheidung, auf meine Mutter gehört, und ich glaube, das Schlimmste war für sie, daß ich es nicht bereuen mußte, jedenfalls habe ich nie eingestanden, nicht einmal mir selbst, daß ich je falschgelegen hätte und sie mit ihren ungebetenen Mahnungen, Ratschlägen, Wünschen richtig. Und meine späteren Erfolge, so äußerlich sie auch sein mochten, bis hin zu den Rezensionen, die sie ausschnitt, der Bestsellerliste, die sie an den Kühlschrank heftete, den Preisverleihungen, für die sie sich neue Kleider kaufte, nicht ich — jeder meiner Erfolge bedeutete der Mutter viel und war doch, so empfand ich es (sie sicher schon lange nicht mehr), eine weitere Niederlage für sie, die das Studium aufgegeben hatte, als sie schwanger war. Wobei ich natürlich genau dadurch das Leben lebte, von dem sie in Iran geträumt, mein Vater hat schon recht, daß ich auf niemanden hörte als auf mein eigenes kleines Ich. Deshalb bin ich ja nun auch allein.
10
Abends Spaziergang am Rhein, stadteinwärts zur Stadt, um nicht ins Dunkle zu gehen. Vor der Hohenzollernbrücke jedesmal der Ärger über das Musicaltheater, das so lieblos, so improvisiert ist, ungelogen aus Containerkästen, wie es nur Köln mißlingt. Aber wie bei jedem Spaziergang und besonders den abendlichen bin ich keine dreißig Meter weiter überwältigt, wenn ich unter der Brücke wieder hervortrete und der Blick frei wird auf den gesamten Dom, die Ostseite vom Fuß bis zu den Turmspitzen hinauf. Schau, rufe ich dem Photografen Daniel Schwartz zu, der aus der Schweiz zu Besuch gekommen ist, schau doch! Und wie wir beide in die Höhe schauen, fällt mir ein, daß der Fortschritt doch auch Schönheit bringt, nicht nur bessere Funktion. Warum das?, fragt Daniel, der das Abendland mindestens so sehr untergehen sieht wie ich. Diese Beleuchtung, erkläre ich, diese wunderbare Beleuchtung des Doms, die jede Kontur sichtbar macht, ohne aufdringlich zu sein wie die Lichtorgel am Musicaltheater, und doch so, daß der Dom noch von der Ferne über Köln leuchtet. Früher sah man den Dom abends überhaupt nicht, da sah man nur Schwärze bis morgens in der Früh. Wie herrlich der Dom nachts ist, noch viel überwältigender als bei Tag, das haben die Bewohner und Reisenden früher nicht einmal geahnt. Diese Schönheit verdanken wir dem Fortschritt, nicht der Natur und ebensowenig der Kunst allein.
11
Zumal es ein paar Monate zuvor erst eine unerwartete und überwältigende Zärtlichkeit der Mutter gegeben hatte. Über Tage depressiv, hatte ich mich morgens in mein Zimmer eingesperrt, um der Fragerei zu entfliehen, was mit mir los sei (ich hätte auch gar keine Antwort geben können, was Teil der Not war oder die Not selbst). Auf das Klopfen und die Zurufe der Mutter hin vermeldete ich ein ums andere Mal, ich wolle in Ruhe gelassen werden. Mit Pausen zwar, pochte die Mutter dennoch weiter an die Tür, anfangs vorsichtig, Stunde um Stunde entschlossener. Ich hatte mir Kopfhörer aufgesetzt, so daß ich die Ankündigung der Mutter überhörte, aus dem Garten eine Axt zu holen. Als ich es merkte, war die Tür nicht mehr zu retten, während im Kopfhörer die Platte weiterlief. Zum ersten Mal machte mir die eigene Mutter Angst: schweißüberströmt, die Axt in der Hand. Sie selbst bekam wohl einen Schreck und verharrte reglos im Türrahmen, während ich auf die Axt starrte, die an ihrer Hand baumelte. Endlich ließ sie die Axt fallen und nahm mich in den Arm. Vielleicht hatte sie selbst nicht damit gerechnet, daß ich es mir gefallen ließ und den Plattenspieler ausstellte. Die Mutter brachte mich, während ich weiter weinte, nach oben ins Elternschlafzimmer, es muß ein regelrechter Nervenzusammenbruch gewesen sein, aber auch das ließ ich mir gefallen, daß die Mutter mich ins Ehebett legte. Über mich gebeugt, saß die Mutter auf der Bettkante, streichelte mein Gesicht und sang nach vielen Jahren wieder ihr Wiegenlied, bis die Tränen versiegten. Es war die letzte Nacht, mit vierzehn oder fünfzehn, in der ich im Bett der Eltern einschlief.
12
Seltsamerweise nur der Mittags- oder Minutenschlaf schenkt einige der kostbarsten Sekunden des Tages. Du legst dich wie jeden Tag hin, ohne zu wissen, ob der Schlaf gelingt, schließt die Augen, achtest auf die Atmung, denkst jedesmal, nein, heute leider nicht, aber ziehst die Luft eine Weile weiter konzentriert bis unter die Brust, und meistens, nicht immer, schläfst du nach einer Weile tatsächlich ein. Allein, das merkst du ja nicht, kannst also während des Schlafs nicht vom Schlaf überrascht sein. Das bist du erst, wenn du nach ein paar Minuten wach wirst und so langsam wie eine farbige Flüssigkeit das Bewußtsein in den Traum sinkt, daß du auf der Matratze, auf dem Balkon oder einfach nur im Gras liegst, um dich herum die Bücher, die Nachbarn oder ein anderer, sehr irdischer Ort. Du versuchst, den Schlaf vor der Wirklichkeit ringsum zu schützen und, wenn das schon unmöglich ist, wenigstens den Traum zu bewahren; vergeblich auch dies, die Mittagsträume vergißt du stets. Zum Glück mischt sich in die Trauer über die unaufhaltsam verrinnende Verzückung bald schon die Überraschung, daß du überhaupt eingeschlafen bist, denn der letzte wache Gedanke war doch, heute gelinge der Schlaf leider nicht. Und diesen Zustand, wenn das Wachsein erst zu drei Viertel da und der Traum noch nicht vergessen ist, wenn noch die Überraschung und das Wohlgefühl der Erholung überwiegen, also bevor die vorherigen Gedanken dich wieder am Kragen packen, diese wundersame Passage kannst du, wenn du dich noch einmal auf die letzten Züge des Schlafs konzentrierst, sogar ein, zwei Minuten verlängern, so daß sich die Verzückung — gar nicht grundlegend anders, nur zarter als das letzte Wachsein in den Schlaf — als Beschwingtheit, als neuerliche Kraft ihrerseits in den restlichen Tag oder zumindest den Nachmittag senkt.
13
Jetzt, da ich die Bücher neu geordnet habe, reicht die Hand wieder an Jean Paul, Joyce und Jelinek. Weil zu Hause viele Regalmeter frei geworden sind, habe ich die Gesellschaftswissenschaften auf einer Sackkarre aus der Lesegruft gerollt. Am ersten Bürgersteig kippte der Stapel vornüber, die beiden obersten Kartons brachen auf. Eine Passantin half mir, die Bücher eilig aufzulesen, die sich über die Straße ergossen hatten — die Autos stauten sich bereits —, und stellte sich anschließend als eine Leserin vor. Ja, beim nächsten Bürgersteig passe ich auf, versprach ich, nein, ich komme schon zurecht. So angetan, daß sie darauf bestanden hätte, neben mir herzugehen, um den Stapel zu stützen, war sie von meinem Werk offenbar nicht. Fünfzig Meter weiter fiel der oberste Karton ein zweites Mal herunter und löste sich in seine Bestandteile auf.
Ich stapelte die Bücher — Psychologie vor allem, Freud, Jung, Lacan und so weiter — in einem Hauseingang, rollte die übrigen Kartons hinter das eigene Tor und rannte zurück, um Stapel für Stapel den Rest nach Hause zu tragen. Es hatten sich bereits Interessenten aufgestellt, zwei gutaussehende junge Männer, Studenten, vermutete ich, die ungläubig staunten, was für tolle Bücher hier jemand verschenkt. Als Kavaliere erwiesen sie sich trotz meines flehentlichen Blickes nicht, sondern waren erkennbar enttäuscht, mißtrauten mir sogar, als ich außer Atem meinen Besitzanspruch anmeldete. Das also bin ich: zu alt, um für einen Flirt in Betracht zu kommen, und noch nicht alt genug, daß man mir beim Tragen hilft.
Solange Bücher noch eine materielle Gestalt haben, bleibt das Schreiben eine körperliche Arbeit, ging mir durch den Kopf, als ich die Bücher und Kartons drei Stockwerke hoch in die Wohnung trug. Die Broschüren für die Tschehleh werden natürlich jetzt unverschämt gut, da einer der renommiertesten Verlage des Landes sie herstellt. Ich weiß schon, ich werde mindestens achtmal mit der Setzerin telefonieren, dreimal werden die Fahnen hin und her verschickt, wir werden ein ums andere Mal im letzten Moment noch Fehler entdecken oder Verbesserungen vornehmen, aber am Ende wird jeder Punkt an der einzig richtigen Stelle stehen, die Schrift gut lesbar sein, auch das Papier stimmen und das Heftchen angenehm in den Händen liegen. Mit den Fingerkuppen wird die Verwandtschaft über die Rede streifen und beeindruckt in ihr blättern, dankbar für deren materielle Gestalt.
Nun stapeln sich die Gesellschaftswissenschaften im Wohnungsflur, dafür habe ich in meiner Lesegruft die Gedichte, Tagebücher und Romane, die sich auf dem Boden gestapelt hatten, in die Belletristik alphabetisch einsortiert. Wie gesagt, die Autoren mit J sind drei Regalböden nach unten gerückt, so daß ich vielleicht doch noch zu Uwe Johnson greifen werde, der ungelesen im Regal steht, seit ich seine Jahrestage zweiter Hand an einem der Bücherstände vor dem Philosophikum kaufte, und das ist … ich rechne … das ist sechsundzwanzig Jahre her. So lange bereits unter einem Dach, ohne ein Wort miteinander gewechselt zu haben, das schafft die beste Ehe nicht. Der noch gewichtigere Buchstabe H ist mir allerdings entrückt. An die anderthalb Meter Hölderlin und Heine reiche ich gerade noch heran, aber für Hafis muß ich mich schon auf den Stuhl stellen, ebenso für Homer, Hesse oder Zygmunt Haupt. Für die beiden oberen Bretter H benötige ich gar die Leiter; Hedayat, Hemingway und Hebel hat der Auszug meines Mannes übel erwischt. Grass ist ebenfalls nur noch Stuhlliteratur, das ist verkraftbar, Hauptsache, an Goethe komme ich auf Zehenspitzen mit ausgestreckter Hand. Arm dran war immer schon das A, das nun einmal in der Ecke links oben beginnt. Geändert hat sich durch die Neuordnung lediglich, daß das dritte, das Stuhlregal A angewachsen ist, Achmatowa, Antunes oder Adnan, während ich für Alexijewitsch, Aragon oder Andric weiterhin die Leiter aufstellen muß. Aber A ist ohnehin kein ganz wichtiger Buchstabe für die Literatur, nicht wie H oder S, zumal Aischylos unter den Dramen steht. B hat von der Auflösung meiner Familie profitiert, insofern es nunmehr vollständig in Reichweite liegt, nicht mehr nur Beckett, Borges, Büchner — diese jetzt auf Augenhöhe, wie man heutzutage sagt —, sondern ein Brett tiefer endlich auch Baudelaire, Berger und Bachmann.
Der freudige Gewinner jedoch ist J. Alle anderen Klassiker konnte ich zuvor bereits ohne Hilfsmittel erreichen, schon weil K, H oder S sich über mehrere Regalbretter erstrecken, das läßt Gewichtungen zu. Nur bei Jean Paul, Joyce und Jelinek war nichts zu machen; gleich, wie ich die Hölderlins und Kafkas nach oben und unten, links und rechts verschob (I kann man für die Literatur vergessen), blieben sie bedauernswerte Leiterautoren, mal im höchsten, mal im zweithöchsten Fach, allenfalls, daß ich sie mit ein paar Schummeleien zu Lasten der Is (Ibsen, Ishiguro, Immermann) noch auf Stuhlniveau ziehen konnte. Jetzt jedoch, einträchtig neben der ebenfalls ungelesenen Werkausgabe von Jahnn, blickt mich jedes Mal Uwe Johnson an, wenn ich aus der Teeküche trete, mit Glatze, Pfeife und Lesebrille nicht eben ein Beau, aber immerhin. Die übrigen Männer schauen wie auf Verabredung alle an mir vorbei.
14
Das Greisenalter hat Offenbach wie ein Make-up aufgetragen, die Furchen im Gesicht, als wären sie mit einem viel zu dicken Stift gemalt, die Haare wie weiß gesprayt, der Geist und ebenso der Körper beim Treppensteigen von kaum glaublicher Kraft und Beweglichkeit weiterhin. Also kann das Alter keine Erklärung sein, daß seine Worte nur noch klug sind und manchmal banal. Es sind dieselben Worte, die ich beinah für Prophetien hielt. Haben sie sich durch die Wiederholung verbraucht? Oder haben sie mehr bedeutet, als Offenbach von der Kritik gefeiert, ja, in den Himmel gehoben wurde? Wie eine Berufung erschien es mir, daß er unter allen jungen, unbekannten Autoren ausgerechnet mir ein paar Wegweisungen gab. Die Enttäuschung jetzt weist auf den weiteren Weg. Nicht nur der Ruhm, nein, auch die Bedeutung vergeht.
Aber während ich so denke, wird mir Offenbach, der nur noch in einem rechtskatholischen Kleinverlag publiziert, noch einmal lieber. Denn nach zwanzig, fünfundzwanzig Jahren sind wir uns nah wie je, nur nichts Besonderes, nichts Berufenes mehr, und das ist nun einmal die Realität, auf die er noch im Verschwinden weist. Beide sind wir heiter, zum ersten Mal seit Wochen, Monaten auch ich, und ich verspreche, ihn bald wieder zu besuchen im Heim.
15
Ob die Autoren ringsum in den Regalen den Widerstreit zwischen Liebe und Literatur selbst erlebt haben, der ein klassisches Muster ist, den Widerstreit zwischen bürgerlicher und künstlerischer Existenz? Im Hof beobachte ich den jungen Nachbarn aus der vierten Etage, der einmal in der Woche seine Tochter aus dem Kindersitz seines Autos hebt, zweijährig, schätze ich, und schon sind die Eltern getrennt. Der Nachbar drückt das Mädchen um so zärtlicher an die Brust, da es offenbar geschlafen hat oder aus einem anderen Grund verunsichert ist, und trägt es vorsichtig ins Haus. Eine Minute später weint das Mädchen hinter meiner Wohnungstür. So kurz seine Ehe gewesen sein wird, wenn das Kind bereits jetzt zwei Zuhause hat, werden dennoch viele Mißverständnisse ähnlich gewesen sein wie bei der Nachbarin, deren Bücherwände er vom Hof aus sehen kann, einfach weil es seit dem neunzehnten Jahrhundert fast immer, ob zweite oder vierte Etage Innenstadt, ähnliche Mißverständnisse sind, siehe die Romane von Austen bis Zweig. Seit ich selbst nur noch die halbe Woche mit dem Sohn bin und die andere Hälfte allein, schaue ich deshalb dem Nachbarn interessiert nach, mit dem ich selten gesprochen habe, dann und wann ein paar Worte im Treppenhaus, kaum mehr als Guten Tag und Guten Rutsch, und fühle mich ihm seltsam verbunden, sehne mich ebenfalls nach dem Kind, wenn es bei dem anderen Elternteil ist, auch nach dem Elternteil selbst, dem vertrautesten Menschen auf Erden, und bin traurig für das kleine Mädchen auf seinem Arm.
Aber zusätzlich könnte bei den Autoren ringsum in den Regalen ein Konflikt die Ehe erschwert haben, den es bei dem Nachbarn nicht gegeben haben wird, ebensowenig unter meinen Bekannten, deren Ehen gerade eine nach der anderen scheitern; ein Konflikt, der mit der Kunst im modernen Sinne als individuelle Schöpfung aufgetreten ist. Mit dem Bürgertum wurde der Künstler als Antibürger geschaffen, mag er äußerlich heute meist das gewöhnlichste Leben führen, Elternsprechtage, Lebensversicherung, Sport oder sogar ein Hobby, obwohl der Künstler keine freien Tage, sondern nur Waschtage kennt, wie Offenbach zu sagen pflegte. Denn frei ist der Künstler nur in der Arbeit, das ist gleichsam deren Definition, und Kunst nur möglich, wo nichts im Leben wichtiger genommen wird als sie. Allenfalls könnte ein Kind in seiner Aufmerksamkeit konkurrieren, eine Geliebte über den Zauber des Anfangs hinaus sicher nicht, und das Kind wahrscheinlich auch nur, weil er es ebenfalls als seine Schöpfung sieht. Und statt zu vernarben, eitert die Wunde der Geliebten, da sie beobachtet, wie aufopferungsvoll der andere sich seinem Kind zu widmen vermag, aber nicht ihr, ihren Bedürfnissen, ihren Freunden, ihren Zielen. Auf die Spitze getrieben jedoch ist der Konflikt, wenn der Künstler eine Künstlerin ist und den Geliebten zusätzlich in seiner Männlichkeit herabsetzt. Wenn er sie auch dank seines Aussehens gewonnen hat und sich dann noch als die bessere Mutter erweist, während sie durch wenig mehr als ihren Geist besticht.
Die Besessenheit von der eigenen Arbeit, die notwendig mit Narzißmus einhergeht — wie könnte ich tagein, tagaus aus mir schöpfen, wenn ich mich nicht wichtig nähme —, sprengt vermutlich nur dann nicht die Ehe, wenn der andere Muse, Bewunderer oder selbst Künstler ist. Umgekehrt wird der Konflikt unlösbar, wo man abschätzig auch von Bekenntnis spricht, bei Brinkmann, Kurzeck oder Ernaux, in der sogenannten Autofiktion, die nichts Neues, aber seit neuestem wieder eine regelrechte Mode ist; dann berührt er das Wesen der Literatur selbst. Meine Tage sind neben den Büchern in den Regalen nun einmal das Material; nur wenn sich beides ineinanderlegt, Leben und Lektüren, bildet sich ein weiteres Werk, das zwischen A bis Z eingereiht wird. Man versteht, warum ein Mann sich mißbraucht fühlt, entblößt, zumal wenn seine Liebe begann, als es noch kein Werk gab, und er beim Schwur keine Ahnung hatte, auf welche Ausbeutung er sich einläßt. Vielleicht darf er als Erster die Manuskripte lesen und muß noch dankbar sein dafür, aber wenn seine Einwände stören, läßt ihn die Autorin außen vor, während Kollegen, Lektoren, Verleger an ihren intimsten Gedanken teilhaben. Dann kommt auch noch der Eindruck hinzu, betrogen zu werden, betrogen sogar mit den Büchern ringsum in den Regalen, mit den Toten. Vielleicht ist die Liebe groß genug, daß der Mann die Eifersucht erträgt, vielleicht überwiegt die Verantwortung für die Familie oder braucht er keine Anbetung für sein Selbstbewußtsein, vielleicht auch wiegt die Autorin ihre Selbstsucht durch andere Qualitäten auf, ich offenbar nicht.
16
Am Rhein ist der Schnee meist nur ein Witz, nach einer Stunde bereits geschmolzen. Im Gebirge jedoch ist der Winter eingebrochen, heißt es in den Nachrichten, und es haben etliche Trauergäste abgesagt. Im Hof parkt wieder eines der Autos, das von einem anderen Kontinent losgefahren zu sein scheint, die Motorhaube und das Dach weiß bedeckt, ebenso die Scheibenränder. Fliegt denn das Pulver auf der Autobahn nicht weg? Im Westerwald, wo das schneebedeckte Auto losgefahren sein könnte, lag jeden Winter das Leben still für einen Tag oder sogar zwei, und selbst danach wurden auf den Bürgersteigen nur schmale Streifen freigeräumt. Diebisch die Freude des Mädchens, wenn die Welt der Erwachsenen aufhörte zu funktionieren. Obwohl sie Schrittempo fuhren, drehten sich die Autos dennoch, wendeten und krachten gegeneinander. Die orangen Warnleuchten blinkten vergebens, und was für eine Komik, wenn ein Fußgänger den Halt verlor. Die Erwachsene bedauert, daß viele nicht zur Feier anreisen können. Vielleicht aber hat das Gebirge, in dem die Mutter fünfzig Jahre gelebt, mit dem Schnee einen Gruß an den Fluß geweht. Sie selbst hat den Westerwald niemals Heimat genannt.
17
Das Bild, das allen leuchten wird, kein Vergleich mit der eitlen Broschüre, die zum Glück wenig Beachtung fand, sind die Enkel, die einer nach dem anderen ans Pult treten: daß Oma mich zur Begrüßung stets so lange umarmt hielt, bis sie spürte, ob es mir gut geht. Daß ich in die dampfende Küche stürzte, Oma, du hast die Milch verbrannt!, um Gottes willen, Oma, du hast die Milch verbrannt!, und sie mir versonnen die weiß-braun-schwarzen Schattierungen und Linien zeigte, ich möge bitte einmal den Zeichenblock holen; das Bild des Topfbodens hängt im Atelier des Enkels, der Künstler geworden ist. Daß sie mich einweihte, ihr liebstes Enkelkind zu sein, und es zwölf Jahre dauerte, bis ich herausfand, daß sie allen dasselbe Geheimnis verraten hatte. Daß mein Sohn ihren Geschichten lauschte, seine früheste Erinnerung überhaupt: Geschichten, die ja wiederum selbst Erinnerungen an etwas sind, was jemand erinnert hat, immer weiter zurück bis an den Anfang der Zeit, die selbst eine Geschichte ist, nur von Menschen erzählt.
Die Enkel haben recht, ihre Großmutter so und nur so zu sehen; Kindern wird die Verklärung nicht gelingen oder sie geriete zum Kitsch, weil sich eine Persönlichkeit nun einmal in der Abgrenzung, dem Widerstand gegen die Eltern herausgebildet hat; weil Eltern an ihren Kindern schuldig werden, ihnen unrecht tun, Fehler begehen, genauso wie umgekehrt, umgekehrt meistens noch mehr. Die Enkel sind es, die den Großeltern gerecht werden, ihr Blick ungetrübt von Verletzungen, Auseinandersetzungen, ihrer jugendlichen oder noch erwachsenen Emanzipation; die Enkel haben nicht wie ihre Eltern die Entwicklung verfolgt, das Scheitern, das Versagen, die Ausreifung, sie können die Großeltern vorurteilsfrei beurteilen als die Personen, die sie mit welchen Lernprozessen auch immer am Ende geworden sind.
Überhaupt der Eindruck, die Enkel sprächen über eine, ja, fast eine Heilige, während du als Tochter meinst zu differenzieren. Aber wer sagt denn, daß sie falschliegen? Daß der Tod diese Szene entwirft: Die Enkel sämtlich auf der Bühne, und spontan erhebt sich der Greis in der ersten Reihe, mit dem sie sechzig Jahre gelebt und gestritten hat — alles andere als eine romantische Liebe oder nur das erste Jahr —, müht sich am Stock die Treppe hinauf, stellt sich in die Mitte und deklamiert auf persisch ein Gedicht, als wäre er frisch verliebt. Dieses Bild des beinah Neunzigjährigen, der sich zwischen seinen Enkeln und Urenkeln nach seiner Liebe sehnt, und bei jedem der langen, fast gesungenen Ausklänge wirft er die freie Hand in die Höhe — am Ende ein einziges solches Bild, das ist es, euch Kinder braucht es nicht dafür. Ihr erkennt die Fügung erst, wenn sie gestaltet ist zu einer Schlußszene wie im Drama oder wie die Zufälligkeiten des Lebens zum Roman. Ihr seid nur ein Zwischenglied gewesen, eine Station, über euch geht die Familie hinweg.
18
Es endet ja doch jeder Grabredner selbst in einem Grab, fährt es mir durch den Kopf, als ich auf der Leiter Karl Kraus’ Worte vom 11. Januar 1919 auf dem Wiener Zentralfriedhof lese. Von hier oben sieht der rote, blumengeschmückte Teppich auf dem Holzboden beinah wie der längliche Hügel der Mutter aus, der sich frisch bepflanzt aus dem sorgsam begradigten Torf erhebt. Glücklicherweise hatte meine Schwester daran gedacht, dem Gärtner Bescheid zu geben, daß sich die Familie zur Tschehleh noch einmal am Grab versammelt, sonst hätten wir vor den verblühten Kränzen gebetet. Wäre es ein Trost, wenn sich mit dem Redner auch die Gäste klarmachten, daß sie einer nach dem anderen ebenfalls aufgebahrt in einer Trauerhalle liegen werden oder als Staub in einer Urne, die der Bestatter mit einer Hand tragen kann? Oder wäre gerade umgekehrt das Entsetzen groß?
Zum Ende des Trauermonats will ich die Autoren durchgehen, die ungelesen im Regal modern wie Uwe Johnson und Hans Henny Jahnn. Schon unter A sind es mehr als geahnt, sehr bekannte darunter, David Albahari, Paul Auster, Guillaume Apollinaire, die ich kaum je eines Blickes gewürdigt. Selbst in Achim von Arnims Werkausgabe stoße ich auf eine einzige Erzählung, Isabella von Ägypten, an die ich mich erinnere. Seit wann wohl das Gesprächsbuch über den Tod hier steht? Gesprächsbücher halte ich tendenziell für überflüssig — entweder ist es ein Gespräch oder ein Buch —, aber zwei Meter über dem Teppich, der ans Grab der Mutter erinnert, schlage ich es dennoch auf. Sehnen Sie sich nach dem Tod?, wird Ilse Aichinger gefragt. Ja, antwortet sie glatt: Mein einziger Kummer ist, daß man ihn nicht erfährt, den Zustand »Tod«. Das ist, wie wenn man sehr gut schläft; was mir aber auch selten passiert. Da sage ich auch immer: Was habe ich jetzt davon? Ich möchte, während ich tot bin, denken »Ich bin jetzt tot!«. Ich finde es erbitternd, daß ich den Triumph, weg zu sein, dann nicht auskosten kann. Das ist natürlich ein Widerspruch, denn wenn ich dann tot bin, hoffe ich, wirklich vollkommen weg zu sein, wie ich es eigentlich immer sein wollte.
Mit den Büchern vorm Bauch balanciere ich Stufe um Stufe die Leiter herab und stapele die ungelesenen Autoren mit A auf dem Schreibtisch, ein ebenfalls farbenfroher Turm so hoch wie mein Unterarm lang. Zum ersten Mal schenke ich Fadi Azzams Roman Sarmada Beachtung, den mir Rafik Schami geschenkt hat. So ist das mit Geschenken, mit meinen bestimmt genauso, aber für Rafik Schami noch trauriger, weil niemand sich für sein Land interessiert, an dem er wie jeder Exilant um so treuer hängt; Syrien bringt hier niemanden um den Schlaf, obwohl der Krieg bald länger als beide Weltkriege zusammen dauert. Afrin und Ost-Ghouta sind die Städtenamen, die zuletzt geläufig geworden sind, ohne daß irgendwer sich über das Hinschlachten und die ausländische Beteiligung aufregt, keine Demonstrationen, keine Mahnwachen, keine Petitionen, keine Debatten im Bundestag oder im Europäischen Parlament. Allein in den vergangenen Tagen dreißigtausend Menschen aus der Umgebung von Aleppo vor der heranrückenden Armee geflohen. Die höchste Anzahl von Toten innerhalb von 48 Stunden seit fünf Jahren, steht in der Zeitung außerdem.
In der Klappe ein Photo von Azzam: ein nachdenklicher Mann um die Vierzig, sofort sympathisch, ja, auch attraktiv, mit langen braunen Haaren und Vollbart, eine Hand unterm Kinn, schräg von unten vor einem bedeckten Himmel, der über Syrien sein könnte oder über Europa, man erkennt es nicht. Über sein Werk erfährt man kaum mehr, von seiner Biographie lediglich, daß er in einem Dorf namens Taara geboren wurde, nahe der Stadt Suweida, wo es keinen Strom gab. Ich habe bei Kerzenlicht lesen gelernt und deshalb leuchten Buchstaben für mich. Im Impressum der Hinweis, Rafik Schami selbst habe das Photo gemacht, der Autor muß ihm viel bedeuten. Gut, er lebt noch, ist in seiner Heimat vielleicht sogar berühmt, deshalb lege ich Fadi Azzam auf den Stapel zurück und nehme wieder Peter Altenberg zur Hand, dessen Buch der Bücher die Akademie kostenlos an alle Mitglieder versandt hat, weil es unverkäuflich war: Edler Mann! Edler Mann! Wehe dem Jahrhundert, das Dich von sich verstieß! endete Karl Kraus seine Grabrede, die den dritten und letzten Band beschließt: Wehe der Nachkommenschaft, die Dich verkennt!
Er wollte die Menschen, besonders die ahnungslosen, damit unschuldigen jungen Frauen vor der Destruktion ihrer Wirklichkeit beschützen, schreibt Wilhelm Genazino im Vorwort, der in seinen Büchern ein gar nicht so verschiedener Flaneur durch die Alltäglichkeiten ist, allerdings melancholisch-freundlicher, auch genießerischer, ohne ätzenden Spott, als hätte er sich den Traum bewahrt, nach dem Altenberg sich sehnt: Traum von etwas, was nicht da ist und was nicht kommt. Altenberg selbst kam in seinem Leben ein einziges Mal länger aus Wien heraus, als er sich dreiundzwanzigjährig in ein zehn Jahre jüngeres Mädchen verliebt hatte; er durchweinte seine Nächte, verlobte sich mit ihr und wurde Buchhändler in Stuttgart, um rasch Geld zu verdienen und später für sie sorgen zu können. Aber es wurde nichts aus alledem. Nein, wurde es nicht: Seit der Stuttgarter Zeit berufsunfähig geschrieben wegen einer Nervenkrankheit, verfiel Altenberg den Drogen, bis seine Notate nur noch Gedankensplitter waren. Es sind manche hübsche Sätze in meinen Büchern, nur muß man sie aus dem Miste herauszuklauben verstehen.
Offenbach berichtete, gerade fällt es mir ein, auf der Buchmesse habe ein zittriger, magerer alter Mann vor ihm gestanden, ein Greis fast und offenbar etwas verwirrt, der ihn todtraurig begrüßte. Offenbach brauchte lange, bis er Genazino wiedererkannte. Später überfiel uns das Schicksal wie eine unvorhergesehene Hunnenhorde und bereitete uns allenthalben schwere Niederlagen, lautet eine weitere Hübschheit. So wenige können es nicht sein, wenn allein schon Genazinos Vorwort so viele zitiert.
19
Am Rhein gehen wir Rede für Rede die Erinnerungen der Enkel an die verstorbene Großmutter durch. Nach Tagen aufgeklarter Winterhimmel, die Sonne zugleich im Rücken und als Spiegelung auf dem Fluß, der wie ein See anmutet, so weit ist er übers Ufer getreten. Stell dir vor, versuche ich meinen Sohn zu trösten, Oma wäre schon vor deiner Geburt gestorben: Das wäre ja auch nicht besser gewesen, als wenn sie jetzt gestorben wäre. So etwas kann man sich nicht vorstellen, belehrt mich der Sohn; man kann sich nicht vorstellen, daß es jemanden, den es gibt, nicht gegeben hat. Und dennoch passiert es häufig, daß Kinder ihre Großeltern nicht mehr kennenlernen. Und wie ist das? will er wissen. Wie ein blinder Fleck im Leben, weil die eigene Erinnerung — das kenne ich vom Schreiben — zwei Generationen vor und zurück reicht. Bis zu den Großeltern, die Kinder waren, und den Enkeln, die alt werden, kannst du dich noch einfühlen, deren Lebensspanne umrahmt noch gut sichtbar die eigene; alles davor und danach wird zum historischen oder phantastischen Roman, ohne Verbindung zu dir selbst. Meine Urgroßmutter auf dem schwarzweißen Photo, erste Reihe links in dem hellen Tschador und mit den zusammengewachsenen Augenbrauen, geboren Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, ist für mich ein so fremder, ein nicht auszudenkender, nur durch Überlieferungen bekannter Mensch, wie es meine Großmutter für dich ist. Der Mensch kann links und rechts zwei Menschen umarmen, zwei Generationen in die Vergangenheit und Zukunft blicken, so groß ist maximal seine Welt. Da hätte links außen jemand gefehlt, wenn Oma schon vor deiner Geburt gestorben wäre.
Wir begegnen einem Bekannten, der von dem Trauerfall gehört hat. Beileid auszusprechen fällt ihm offenbar schwer; wahrscheinlich findet er die üblichen Sätze verbraucht, jedenfalls schaut er uns nur wehmütig an. Mein Sohn schaut sofort weg. — Die Sonne, sagt der Bekannte und deutet nach Westen, die Sonne geht unter und morgen wieder auf, aber der Mensch, der verschwindet und … — Wir glauben daran, antworte ich mit fester Stimme, daß auch für die Verstorbenen die Sonne wieder aufgeht, nur in einer anderen und sogar besseren Welt. — Das ist ein schöner Gedanke, meint der Bekannte, obwohl mein Satz weniger ihm als dem Sohn gilt, den das Bild der untergehenden Sonne zu stören schien: Das will ich gern mit euch glauben. Immer noch bleibt der Bekannte stehen, ich weiß gar nicht warum, die untergehende Sonne strahlt uns dreien ins Gesicht.
Später ist es der Sohn, der verharrt, um die Formationen aus Ästen und Treibgut zu betrachten, die Flößen gleich auf dem Rhein schwimmen, die Bäume, die aus dem Strom ragen, das Spiel von Sonne und Wolken auf dem Wasser, keinen Meter vom neuen Ufer entfernt ein Schwarm Enten, denen nicht kalt ist und im Sommer nicht warm wird. Das hat sein Cousin gemeint.
20
Jeder Jogger freut sich wie ein Kind, wenn er der Polizei entwischt, die ihn beim Überqueren der Bahngleise ertappt hat, und wie erst eine Joggerin. Die Polizisten sind sich zu fein, einer Frau hinterherzurennen, das weiß ich schon und sehe ebenso voraus, daß sie um den Park herumfahren werden, um mich an der nächsten Querstraße lässig wie im Tatort abzufangen. Das sind wahrscheinlich die spaßigen Fälle für sie. Allein, ich bin ebenfalls ein Spaßvogel und trete durch ein glücklicherweise offenes Tor in einen Schrebergarten, laufe zwischen den Gemüsebeeten hindurch und komme an der nächsten Längsstraße heraus, um die Querstraße dreihundert Meter entfernt zu kreuzen. Von weitem sehe ich das Polizeiauto auf mich warten und hoffe, die Polizisten sehen mir ebenfalls zu, wie ich ein zweites Mal im Park entfliehe. Selbst wenn sie aussteigen, holen sie mich unmöglich ein, und ihre Rufe über die Entfernung würde ich leider nicht hören. Zur Sicherheit schaue ich ganz schnell wieder weg.
21
Schon will ich Peter Altenberg recht geben, wir müßten seine hübschen Sätze aus dem Miste seiner Frauengeschichten herausklauben, als ich den zweiten Band aufschlage, in dem er den Mangel an Rücksicht der Nebenmenschen aufs Nervensystem beklagt. Die Klage stünde wohl eher den Frauen an, die er belagert hat. Auf welchen Schwachsinn Männer verfallen und finden sich dabei galant: Der Mann hat eine Liebe — die Welt! Die Frau hat eine Welt — die Liebe! Aber kurz darauf bekommt Altenberg einen Wutanfall auf die Frauen — und was passiert? Nach 380 Seiten finde ich ihn zum ersten Mal interessant: Tausend Ungezogenheiten und Taktlosigkeiten der Menschen zerstören unsre angesammelten Lebensenergien. Ferner Sorge, Kummer, Eifersucht, Alkohol, schlechtes Essen, ungezogene Kellner, ungezogene Friseure, ungezogene Freunde, alles, alles das frißt uns täglich, stündlich unsre angesammelten Lebensenergien weg, und zwar auf eine merkwürdig schwächende, lähmende, Zuckerkrankheiten vorbereitende Art! Frauen besonders sind genial geschickte Zerstörerinnen unsrer aufgestapelten Lebensenergien, durch Erzeugung von Eifersucht, diesem Krebsbazillus der Seele! Man wird plötzlich grün und gelb, und die Lebenselastizität läßt nach. Jeder Mensch ist eigentlich ein feiger, heimtückischer Mörder eines jeden, den er in Unruhe setzt ohne zwingendsten Grund! Allein die Kurznachrichten des Vormittags: abwechselnd die Vorwürfe meines künftigen Exmanns, neben allem anderen auch noch eine schlechte Mutter zu sein, und die Erklärungen meiner Freundin, ausgerechnet meiner besten Freundin, warum sie Verständnis für ihn hat, während übers Festnetz eine Ministerin mich zu überreden versucht, die Rede beim, Achtung, festhalten: beim alljährlichen Gelöbnis der Bundeswehr zu halten, was schon beim bloßen Gedanken Lebensenergie verbraucht, und gleichzeitig, alles gleichzeitig mit dem Telefonat und den SMS, klingelt der Vater auf dem Handy Sturm. Papa, ich ruf gleich zurück, Papa, ich kann jetzt nicht!, oder ist etwas passiert, Papa?, und dann ist es nur ein Rezept, das ich zur Apotheke bringen soll. Die Erhaltung der Lebensenergien meines Organismus sei die Sehnsucht einer jeden ernstlich freundschaftlichen Seele. Wenn Franz Schubert sein Intimus gewesen wäre, behauptet Peter Altenberg, hätte er ihm weitere zweitausend Lieder entlockt, indem er ihn dazu gebracht hätte, sich der bedürfenden Menschheit durch allersorgfältigste Schonung seiner Lebensenergien zu erhalten: Ich bin einmal unerbittlich gegen den göttlichen Leichtsinn, ich bin für die erdenschwere Bedenklichkeit. Warum hält er sich dann nicht selbst daran? Weil ich dann vielleicht Lebensenergien entwickelte, um noch einige solcher Bücher wie bisher zu schreiben, und das muß unbedingt hintertrieben werden durch ungeordnete Lebensführung. So gesehen, müßte ich für den Vormittag dankbar sein: Es sind der Welt mindestens zwei Seiten von mir erspart geblieben, sosehr haben Mann, Freundin, Vater und Ministerin an meinen Lebensenergien gezehrt. Letztere bekundet auch noch unvorsichtig Verständnis, falls ich absagen würde: Sie habe ebenfalls lange ihren Vater gepflegt und wisse aus eigener Erfahrung, daß es Dringlicheres gibt als jedes Amt und jede Rede. Mein Vater ist kein Pflegefall! herrsche ich sie an; er habe sich nur noch nicht damit abgefunden, daß er alleine ist.
22
Was heute Leben war: Am Konrad-Adenauer-Ufer wartete ein Greis auf Grün, sein Gesicht so zerfurcht, die Beine so schmal und der Leib so gekrümmt wie bei den Heiligen auf alten Gemälden, nur daß er eine schottische Militäruniform mit Barrett, weißen Backenbart und Orden wohl aus dem Zweiten Weltkrieg trug. Ein Kostüm? Nichts deutete darauf hin. Also ein Bekenntnis — aber wozu? Zu sich selbst vermutlich, zur eigenen Biographie.
Wer in der Stadt wohnt, in einer großen Stadt, trifft jeden Tag Nachbarn, die mehr zu erzählen haben als er selbst, wirkliche Irre darunter wie in den Zeiten, als es noch keine Anstalten gab, Faktoten des Quartiers oder noch viel schrägere Vögel als ich, dazu die Fremden vor den Internetcafés, gestrandet vermutlich aus den Kriegen und Notlagen der Welt, so stell ich’s mir passend zu meinem Weltbild vor, oder die Junkies und ebenso die Drogendealer, jeder für sich ebenfalls ein Buch, ob es auch nicht so gut gefällt wie eine Passion. Allein dieser Alte: Welche Geschichte liegt hinter einem, der an einem eiskalten Wintermorgen in einem karierten Rock an einer Kölner Ampel steht mit seinen Orden an der Brust?
Und sonst? Jivamukti gemacht, weil der Mensch vom Geist allein Rückenschmerzen bekommt.
23
Auf YouTube staune ich über eine pseudoreligiöse Parallelwelt und daß ich in fünfzig deutschen Jahren kaum je mit ihr in Berührung gekommen bin: Stechschritt, Fahnen, Marschmusik, Standarten, Luftwaffe Marine Heer, Gewehr über, Gewehr in Paradehaltung, Gewehr absetzen, und beim gleichzeitigen Aufprall von mehreren Tausend Sturmgewehren macht es wie von einer Kanone Peng, Blick rechts, Blick gerade, Pause, aus, Stillgestanden, was die Soldaten ohnehin tun, und am kuriosesten: Rührt euch, weil das Rühren genauso uniform ist. Offenbar soll es ein Fortschritt sein, wenn jetzt auch Soldatinnen das Gelöbnis in abgehackten Satzteilen aus voller Kehle schreien. So wenig zu beanstanden die Worte selbst sind, macht die Lautstärke dennoch Angst. Aber gut, ein Militär, das friedlich tut, wäre ein Widerspruch in sich. Nur sind wir das nicht mehr gewohnt, sehen von der Bundeswehr nur gelegentlich die jungen Leute, die fürs Wochenende nach Hause fahren, ihre Tarnfarbe in den Städten heutzutage auffälliger als die Neonfarben der Sportler. Grölten sie früher noch und waren besoffen, als es ausschließlich Jungs waren, grüßen sie heute in den Zügen und sind hilfsbereit wie die Nationalspieler. Sosehr sie sich beim Rühren anstrengen — im Ernstfall würde ich von ihnen eher nicht verteidigt werden wollen gegen eine Schar todesmutiger Taliban in Adiletten. Der größtmögliche Gegensatz zu dem martialischen Ritus ist freilich die schmale Ministerin, also schon physiognomisch, und dann trägt sie auch noch einen zu engen Blazer, der in seiner Körperbetontheit wiederum das gütige Mutterlächeln konterkariert, mit dem sie ihre Truppe anspricht, Musterdemokratenansprache natürlich, deren Beglaubigung im letzten Jahr der jüdische Festredner war. In diesem soll also eine Muslimin die Reihen abschreiten, die zentimetergenau von Stiefeln gebildet werden, mag die Festrednerin selbst zweifeln, woran sie will, am Islam, an Deutschland oder dem Krieg, Hauptsache, sie bezeugt noch durch ihre Kritik die Musterdemokratie, wenn sie zum Abschluß des bedauernswert steifen Spaziergangs einer geschlechtergerechten Abordnung der Soldaten die Hand schüttelt und ein paar Worte wechselt, wie es wohl üblich ist, die sinnfreiste Kommunikation der Welt. Was sagst du da, während sechstausend, achttausend, zwanzigtausend Augen starr an dir vorbeischauen? Wo kommen Sie her?, wahrscheinlich, oder auch Was führt Sie zur Bundeswehr?, viel Glück.
Die Gästetribüne lag letztes Jahr in der Sonne — hatte denn niemand den Wetterbericht gelesen? —, so daß sich auf dem Video die meisten Zuschauer die Programmbroschüre vors Gesicht halten. Mögen die Honoratioren in ihren dunklen Anzügen und die Militärattachés in ihren exotischen Uniformen vor Schweiß triefen, wie sie wollen, nur einige Plätze weiter, selbst in der ersten Reihe, lümmeln sich die Berliner in kurzen Hosen und Trägershirts, als wären sie im Urlaub. In gewisser Weise ist das schließlich auch Urlaub für sie, mal am Krieg zu schnuppern, der so fremd wirkt, obwohl er nur zwei Flugstunden entfernt beginnt. Unter tunlichster Vermeidung des Imperativs werden die lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger eingeladen, die Nationalhymne zu singen.
24
Nicht nur Natur oder Kunst, nicht nur Liebe, Genuß, Drogen, Gebet, Tanz, Askese, Adrenalin und Sexualität, selbst so etwas Profanes wie mein Jivamukti, das von Madonna weltweit vermarktet wird, vermag Ekstasen hervorzurufen, wenngleich winzige und du zugegeben sehr genau auf den Moment achten mußt, wenn sich etwa eine Muskelverspannung löst — auf den einen Moment, wenn der Atem wieder frei durch den Rücken bis hinab zum Po fließt. Seit Stunden, seit Tagen schien der Atem in einem der Muskel um den Brustwirbel herum festzustecken, so fühlte es sich an, also wie ein Hindernis in der Luftbahn, die es physiologisch natürlich nicht gibt, aber doch in der Vorstellung, im Körpergefühl, und dann löst sich die Blockade auf, ohne daß du wüßtest, was genau die Befreiung bewirkt hat — ach, du schreist vor Wonne auf, wenn auch so leise, daß kein anderer Kursteilnehmer es bemerkt.
25
Früher haben wir mit Trillerpfeifen zu verhindern versucht, daß Soldaten auf ihre Waffen schwören. Selbst wenn es richtig geworden ist, bei aller Kritik zum Staat zu stehen, der nun einmal eine Armee unterhält — kann es die Aufgabe von Intellektuellen sein, ihn zu repräsentieren? Andererseits, wenn mir nun einmal die Möglichkeit eingeräumt wird zu berichten, auf wen die Waffen gerichtet sind — würde ich mich nicht schuldig machen, wenn ich den Rekruten, achtzehn, neunzehn Jahre alt vermutlich, nichts mitgäbe für die gegenwärtigen und mehr noch die künftigen Kriege? Unrealistisch, daß in Mitteleuropa weitere siebzig Jahre Frieden herrschen werden, oder auch nur sieben, da die Front bereits durch die Ukraine verläuft. Etwas mitzugeben für den Fall, daß Deutschland wieder Feinde hat bis aufs Blut. Die Affirmation, die richtig gewordene (wann?), beschädigte lediglich mich selbst.
Aber das Jahr sollte sich doch darauf beschränken, daß ich zwischen Wohnung und Lesegruft pendele! Einkaufen, Kochen, Kind, abends Kino oder Konzert, auch mal Urlaub, wenn es sich ergibt, aber nicht die Wirklichkeit, die aus Vertreibungen, Gemetzel, Völkermorden besteht. So viele Bücher, die lebendig werden könnten, Versprechen, die sich erfüllen oder mal nicht. Eine Bemerkung von Paul Nizon, zufällig aufgeschlagen, als ich im Vorübergehen nach dem schneeweißen Buch griff, breit wie ein Ziegel, das ebenfalls ungelesen im Regal stand: daß du fürs Schreiben nicht viel, sondern möglichst wenig erleben sollst, weil bereits ein Klümpchen Begebenheit oder Gefühl oder auch nur Einbildung genügt. Nizon steht schon für N bereit.
Im Geist gehe ich die wehrzersetzenden Gedanken durch, die allein eine Teilnahme rechtfertigen würden, Angst machen den Soldaten, nicht Mut. Über Feindesliebe reden. Über die verfehlte Politik, für die sie die Köpfe hinhalten müssen. Über den zweisprachigen Button, den sie in Afghanistan tragen werden: Winning hearts and minds