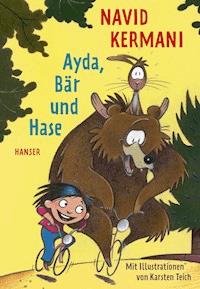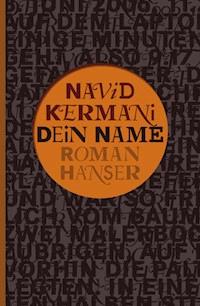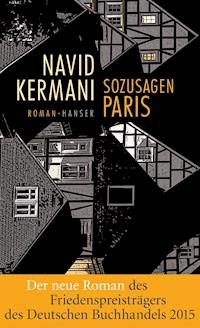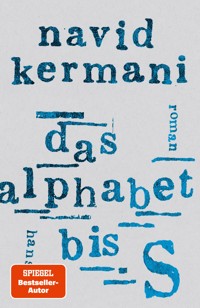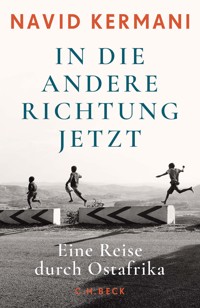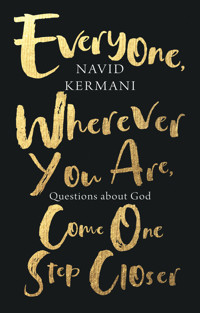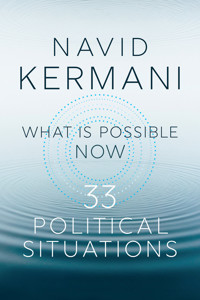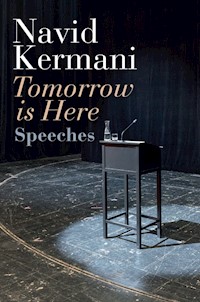Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch handelt vom Glück. Von der Freiheit. Von der Würde. Und siebenunddreißig weiteren Königswörtern, bekannt aus Andacht und Werbung, die Navid Kermani literaturhistorisch schüttelt, um am Ende jene Winzigkeit wundervoll poetisch ausgekratzt zu haben, die an ihnen noch sagbar ist, ohne zu relativieren. Wie groß diese Winzigkeit ist, wie unendlich: Holgers Sehnsucht nach der Dunstabzugshaube im Saturn (oder ist es die Sehnsucht nach der blaugewandeten Verkäuferin?). Adornos Wahrheit in der Falschheit seines Whiskysatzes. Spätestens aber, wenn Jesus durch den Deutzer Planet Büschel schreitet oder Thorsten den Tod in Gegenwartsform schildert, weiß man, dass Heilige verschroben, gottlos oder tieftraurig sein mögen, nur eines nicht: harmlos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Navid Kermani
Vierzig Leben
Carl Hanser Verlag
Vierzig Leben ist Teil des Bandes Album, welcher drei weitere Prosawerke Navid Kermanis versammelt, nämlich Das Buch der von Neil Young Getöteten, Du sollst und Kurzmitteilung.
ISBN 978-3-446-24713-0
© Carl Hanser Verlag München 2014
Alle Rechte vorbehalten
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Vierzig Leben
Die Zustände nach der
»Erklärung der Standplätze der Reisenden«
von Khadje Abdollah Ansari (1005–1089):
Liebe
Eifer
Sehnsucht
Besorgnis
Durst
Verzückung
Angst
Verwirrung
Erstes Licht
Geschmack
Von der Hoffnung
Für Stefan Wild
Ein Freund meines Bruders, Dariusch Nikolai Oelmüller, Oelmüller mit Oe, so hieß er, weil er einen deutschen Vater und eine iranische Mutter hatte, die Wert darauf legten, daß sein Name auf alle Länder seiner Abstammung verwies und also auch auf Georgien, die Heimat seiner Urgroßmutter mütterlicherseits, die mitsamt ihrer Familie nach Teheran übergesiedelt war, wo sie Hadsch Mahmud Gharibpur, den Staatsbeamten im Dienste seiner kaiserlichen Majestät, kennenlernte, Dariusch Nikolai Oelmüller also, der 1962 als Siebenjähriger mit seinen Eltern nach Hamburg gekommen und dort im wohlhabenden Blankenese aufgewachsen war, hatte das Unglück, sich in eine Frau zu verlieben, die ihn nicht liebte, während er selbst mit einer anderen Frau verheiratet war, mit der er, so schien es wenigstens meinem Bruder, glücklich in Köln-Bayenthal zusammengelebt und drei Kinder gezeugt hatte, die jedermann mit ihrer Fröhlichkeit ansteckten, also kaum unter schwierigen Familienverhältnissen litten. Dariusch Nikolai verließ seine Frau und die Kinder, obwohl ihm die Geliebte keine Hoffnung machte, je auf sein Werben einzugehen, und suchte sich ein Appartement in Ossendorf, das zwei Straßen von dem ihren entfernt lag, in welchem er, just für seine so elegante wie kostspielige Erscheinung bekannt, zu verwahrlosen begann, nicht putzte, kaum aß. Da er, der im Direktorium einer Versicherung am Mediapark arbeitete und in absehbarer Zeit, so versichert mein Bruder, in den Vorstand aufgestiegen wäre, morgens immer seltener pünktlich im Büro erschien, wurde er zunächst von Kollegen angesprochen und vom Vorgesetzten beiseite genommen, dann zum Psychologen geschickt und schließlich, nach mehreren Monaten geduldigen Zuredens, entlassen. Seine Eltern, die noch immer in Blankenese lebten, nahmen die Schwiegertochter und die Enkel bei sich auf und brachen, nachdem sie alles Erdenkliche unternommen und sogar, in der vagen Annahme, ihr Sohn sei Drogen oder einer Sekte zum Opfer gefallen, die Polizei eingeschaltet hatten, da brachen die Eltern mit ihm, ihrem einzigen Kind, das alle ihre Versuche, es zur Umkehr zu bewegen, schroff zurückgewiesen und sie in einem Maße respektlos behandelt hatte, wie es insbesondere für die Mutter nicht zu ertragen war, zumal sie Dariusch Nikolai ein Leben lang als liebevollen Sohn gekannt hatte, dessen Umgangsformen, Ernsthaftigkeit und Würde sie an ihren Großvater erinnerten, jenen Großvater, der gegen den Widerstand seiner Familie die georgische, also christliche Frau geehelicht und damit den slawischen Zweitnamen des Urenkels mittelbar verursacht hatte. Daß die Bemühungen noch seiner engsten Freunde, Dariusch Nikolai neben der offenen Abneigung seiner Geliebten auch deren intellektuelle Beschränktheit, ihr keineswegs hervorstechendes Äußeres, vor allem aber ihre moralische Verworfenheit vor Augen zu führen, nichts fruchteten, dürfte nicht mehr verwundern. Mochten die Unbedarftheit ihres Denkens und übrigens ebenso ihres Geschmackes wenigstens zum Teil ihrem allzu jungen Alter geschuldet sein, konnte zudem sein begeistertes Urteil über ihr Aussehen und also über die Attraktivität ihrer zwar nicht übermäßigen, jedoch unübersehbaren Fülle mit subjektiven Empfindungen erklärt werden, so gaben die charakterlichen Eigenschaften, die sie im Umgang mit ihm an den Tag legte, tatsächlich Anlaß zu größter Sorge. Die junge Frau beließ es nicht dabei, ihn abzuweisen, sondern schien sich einen regelrechten Spaß daraus zu machen, ihn zu demütigen, ja ihn öffentlich bloßzustellen. So hieß sie ihn zweimal die Woche in ihre Wohnung kommen, damit er dort putzte, bügelte und anschließend die Dinge einkaufte, die sie auf einem Zettel zu notieren pflegte, bevor sie selbst mitsamt seines Portemonnaies Schallplattenläden, Parfümerien oder die teuersten Boutiquen der Stadt aufsuchte. Von einem seiner Freunde zur Rede gestellt, brüstete sie sich damit, daß Dariusch Nikolai ihren gemeinsamen Urlaub mit dem Freund finanziert und sich sogar für die Postkarte bedankt habe. Ja, sie hatte einen Freund, einen großgewachsenen Italiener im gleichen jugendlichen Alter, der sich meist mit schwarzer Lederjacke und schwarzen Jeans kleidete und gelegentlich Betriebswirtschaft an der Universität Köln studierte, also im Unterschied zu ihr immerhin sporadisch einer Beschäftigung nachging. Ein Bekannter meines Bruders sah die drei in der Ehrenstraße, dem Einkaufsboulevard im Dreieck von Rudolfplatz, Friesenplatz und Neumarkt, der insbesondere eine junge Klientel anzieht, Dariusch Nikolai zwei Meter hinter der Geliebten und ihrem Freund mit Papiertüten bepackt; er muß gepflegter ausgesehen haben, als ihn mein Bruder zuletzt angetroffen hatte, er hatte sich rasiert, die Haare bürstenartig geschnitten und trug Kleidung, die neu aussah, allerdings nach Aussage des Bekannten seinem Alter auf groteske Weise widersprach, pfeilspitze Tanzschuhe, eine silbern glänzende Hose, ein feuerrotes Jackett über dem rüschenwerfenden weißen Hemd.
Das war vor vier Jahren. Letzte Woche traf mein Bruder auf dem Nippeser Markt Dariusch Nikolai Oelmüller, der beinah wie früher aussah, als er sich noch nicht in die Frau verliebt hatte, die ihn nicht liebte. Wohl waren seine einstmals pechschwarzen Haare fast vollständig ergraut, wirkten das dunkle Sacko leicht abgetragen und die Schuhe ungepflegt, doch trug er die luftigen Locken genau wie früher halblang und mit eben jenem angedeuteten Seitenscheitel, der damals seiner Eleganz die lässige Note verliehen hatte. Dariusch Nikolai sagte meinem Bruder, er wohne noch immer in dem Appartement in Ossendorf, habe es jedoch aufgegeben, um jene Frau, wenngleich er sie weiterhin liebe, zu werben oder sie auch nur zu sehen. Als Sachbearbeiter habe er vor einigen Monaten angefangen, in der alten Versicherung zu arbeiten, und habe Signale erhalten, recht bald befördert zu werden, falls er es an Engagement nicht mangeln ließe, wenngleich ihm klar sei, daß er nicht wieder an jene Position gelange, die er bei seiner Kündigung innegehabt hatte. Seine Frau habe einen anderen Mann geheiratet und es bislang vermocht, ihm das Wiedersehen mit den gemeinsamen Kindern zu verwehren – allerdings, so räumte er ein, seien seine bisherigen Anstrengungen auch zu zaghaft gewesen, er habe nicht einmal herausgefunden, wo genau sie wohnten. Doch sehne er sich nach den Kindern und wolle sich nicht mehr mit der telefonischen Auskunft abfinden, wonach sie es ablehnten, ihn zu sehen. Er könne sich das nicht vorstellen. Seine Mutter sei vor drei Jahren gestorben, und sein Vater weigere sich bislang, ihn zu empfangen, da er ihm vorwerfe, für ihren Tod verantwortlich zu sein. Er hoffe aber, ihn, der in seinem hohen Alter doch wohl allein lebe, noch umzustimmen, und werde sich künftig ernsthafter als bisher darum bemühen. Dariusch Nikolai Oelmüller lehnte die Einladung meines Bruders auf einen Kaffee mit der Entschuldigung ab, er müsse zurück ins Büro, da seine Mittagspause zu Ende sei. Mein Bruder sagte ihm, er würde sich freuen, ausführlicher mit ihm zu sprechen, und fragte, ob er noch seine, meines Bruders, Telefonnummer besitze. Dariusch Nikolai antwortete, er habe die Telefonnummer selbstverständlich in seinem Adreßbuch stehen und hoffe, sich recht bald einmal zu melden.
Von der Liebe
Zur Hochzeit von Turandocht Schlamminger und Götz Freiherr von Arnim
Um die Opfer zu rechtfertigen, die sie ihren vier Kindern gebracht hat – den Abbruch des Literaturstudiums, die Auswanderung in das immer noch ungeliebte Deutschland, die das Verhältnis zu ihren eigenen Eltern zerrüttet hat, aber den Kindern eine bessere Zukunft versprach, die zarten Stücke des Fleisches, die sie ihnen bis heute auf die Teller mogelt, um nur drei von unzähligen Beispielen anzuführen, die selbst ich täglich beobachte –, verweist unsere Nachbarin, die montags auf unsere Tochter aufpaßt, auf die inzwischen weltweit gerühmte Meisterschaft, zu der es ihr Onkel zweiten Grades, Feridoun Zandschi, auf dem Santour gebracht hat, der iranischen Form des Hackbretts, wie es irreführender auf Deutsch nicht heißen könnte, weil das Spezifische des persischen Instruments gerade in der Filigranheit seiner tausendwirkenden Saiten liegt, auf denen die federleichten Stöcke der Meister in so schneller Folge aufsetzen, daß sie so unsichtbar sind wie der Flügelschlag des Kolibris. Das Schicksal Zandschis entschied sich im Alter von siebzehn Jahren, als ihm sein Lehrer, ein weithin vergessener Musiker und Mystiker namens Asghar Scharafeddin Neymatollahi, vorhielt, auf die eigene Wirkung zu schielen, statt sich geduldig, in tausendsaitigem Gehorsam, den Nuancen des Instruments zu überlassen, mögen sie den gemeinen Hörer langweilen, da er sie nicht mehr zu unterscheiden vermag. Obwohl der Lehrer ihm über Monate hinweg ins Gewissen redete, der Verantwortung gerecht zu werden, die Gott ihm mit der überragenden Begabung verliehen habe, hörte der junge Feridoun nicht auf, Kunststücke zu proben, um bei den Auftritten nach Beifall zu heischen, ja, er begann sogar, sich lustig zu machen über die Mahnungen des Lehrers, die seinem Neid geschuldet seien. Freilich brachte er den Spott nicht in Worten zum Ausdruck – das zu wagen war undenkbar in jenen Beziehungen zu einem Meister –, sondern deutete bloß halb ängstlich, halb verwegen an, die Stirn in Falten zu legen, wann immer der Tadel ihn traf, aber Neymatollahi verstand.
Inmitten einer Übungsstunde, in der sich Feridoun wieder einmal zu musikalischen Pirouetten verstiegen hatte, fragte der Lehrer ihn schließlich, wie er ernstlich behaupten könne, die Musik zu lieben, wo er doch der Welt verhaftet sei und dem Lohn, den sie biete. So wie Ihr, erkühnte sich Feridoun und wollte sagen, daß auch der Lehrer am Ende nach diesseitiger Anerkennung strebe. Wie ich? fragte der Lehrer, erhob sich und verließ, den ersten Satz des islamischen Glaubensbekenntnisses auf den Lippen, den Raum. Begleitet von einem dumpfen Schlag, schrie er hinter der verschlossenen Tür kurz auf, um bleich in den Übungsraum zurückzukehren, dem Schüler die bluttriefende linke Hand entgegenstreckend, an der die drei mittleren Finger abgeschnitten oder, wie sich herausstellte: abgehackt waren, abgehackt wie auf einem Hackbrett, wie ich nicht umhin konnte zu denken, als ich Feridoun Zandschi vergangenen Monat in einem Konzert hörte, das der Westdeutsche Rundfunk in der Kölner Philharmonie veranstaltet hatte. Ich konnte nicht aufhören zu denken, daß sich das Wunder seines zweieinhalbstündigen Spiels der Liebe Asghar Scharafeddin Neymatollahis verdanke, der Liebe nicht etwa zu seinem Schüler, einem Menschen, sondern zum Santour, das ihm göttlich war und daher höher als das Menschliche, der Liebe des Lehrers also zu Gott, den er im zirzensisch feinen, aber eben von Liebe noch zu durchtränkenden Spiel des Schülers reiner manifestiert zu hören hoffte, als er es seinen eigenen Händen je zutraute. Ich konnte nicht aufhören, an Asghar Scharafeddin Neymatollahi zu denken und daran, daß selbst das Santour zum Hackbrett werden müsste, damit es kein Hackbrett mehr sei, ja, ich konnte die bluttriefende Hand nicht aus meinem Kopf vertreiben und bildete mir gar ein, sie selbst sei es, die bluttriefende Hand des Lehrers, die acht Stuhlreihen unter mir in der Kölner Philharmonie den linken Stab seines Schülers führte, bis die Musik mich schließlich so entrückte, daß ich an kein Blut und kein Hacken, an nichts mehr dachte und auch nicht bemerkte, wie die Tränen meiner Nachbarin, die uns die Karten besorgt hatte, auf den Boden trieften, weil jeder einzelne der wimpernschlagschnellen Schläge auf das Hackbrett so himmlisch leicht und zugleich schmerzgetränkt war, daß es ihr das Herz zerriß, zerhackte, wie mir unsere Nachbarin am darauffolgenden Montag zu verstehen gab, um zu erklären, warum sie ihr Literaturstudium abgebrochen habe und ins ungeliebte Deutschland gezogen sei, wo sie den längst erwachsenen Kindern bis heute die zarten Stücke des Fleisches auf die Teller mogele.
Von der Anmut
Seit Tagen geht mir eine dreiunddreißigjährige Architektin aus der nordjapanischen Stadt Asahikawa nicht mehr aus dem Kopf, die sich mir vorstellte, als mich ein japanischer, aus dem südlich gelegenen Fukooka stammender Freund, der vor Jahren mit mir gemeinsam Spanisch in Buenos Aires studiert hat und heute bei einer japanischen Konzernvertretung in Düsseldorf arbeitet, auf seinem privaten Computer in Mettmann durch japanische Internetseiten führte, um die globale Simultaneität neuerer kultureller Prägungen vorzuführen, über die wir uns beim Abendessen unterhalten hatten. Die virtuelle Reise brachte uns auch in sogenannte Chaträume, von denen einige dezidiert erotischen Themen vorbehalten waren, was ich nur aufgrund seines Hinweises erkannte, da sie sich nicht durch bestimmte Abbildungen oder anzügliche Zeichen auswiesen. Mein Bekannter übersetzte mir, soweit es ihm sein leidliches Deutsch erlaubte, die eine oder andere Stellungnahme, die seine These zu bestätigen schien, daß Japaner spätestens in einem erotischen Chatraum die anmutige Distanz ablegen, die ich immer mit ihrer Kultur identifiziert habe, und sich in der Wortwahl, den sogenannten Nicknamen und sogar in der Syntax nur unwesentlich von einem englisch- oder deutschsprachigen Chatpartner unterscheiden. Man wird überrascht, vielleicht sogar befremdet sein, wenn ich hinzufüge, daß es mir nicht unmöglich war, den japanischen mit dem diesbezüglichen deutschen Diskurs zu vergleichen, da ich den Reiz des Chattens, den zu erläutern anderswo der Ort ist, schon bei anderer Gelegenheit kennengelernt und dabei auch solche virtuellen Räume betreten habe, die sich dem Sexuellen im engeren, nicht durchweg appetitlichen Sinne widmen. Eben weil ich über eine gewisse Vertrautheit mit dem hiesigen Jargon verfüge, war ich während der Führung meines Bekannten durch den japanischen Teil des World Wide Web, die schließlich unser Gespräch über kulturelle Aspekte der Globalisierung zum Anlaß hatte, neugierig geworden, ob Japaner sich innerhalb eines Chatraums prinzipiell anders als Deutsche artikulierten, und so fragte ich ihn zunächst allgemein nach der Existenz japanischer Chatgemeinden, die er bejahte, ohne auf Anhieb Näheres berichten zu können, da er trotz der Ferne von der Heimat noch nicht auf die Idee gekommen war, im Internet mit Japanern zu kommunizieren, die er nicht kannte. Mittels einer Suchmaschine machte er bereits nach Minuten eine Website ausfindig, auf der wir wie von selbst in jenen Bereich gelangten, der auch in Japan Minderjährigen verboten, aber nicht verwehrt ist.
Nach kurzen Einblicken in Diskussionen, die unterschiedlichen homosexuellen und sadomasochistischen Praktiken gewidmet waren, richteten wir es uns bei einer neuen Flasche Rotwein in einem Raum ein, der dem japanisch transkribierten, aber aus dem Englischen entlehnten Namen zufolge die Interessenten realer Verabredungen zusammenführte. Wohl wegen der ungünstigen Ortszeit, auf die mich mein Bekannter hinwies, herrschte nicht eben Hochbetrieb, doch genug, um aus seinen willkürlichen Übersetzungen unter anderem zu erfahren, daß für die folgende Nacht an einem bestimmten Rastplatz der Autobahn von Kagoshima nach Kumamoto einiges zu erwarten war. Ein junger Mann, der sich das japanische Wort für eine brennende Zigarette zum Pseudonym genommen hatte (ein deutscher Chatter würde vermutlich Glimmstengel sagen, aber ich vergaß zu fragen, ob das japanische Wort ebenfalls der Umgangssprache angehört), suchte für die nämliche Nacht eine ältere, vorzugsweise verheiratete Partnerin gleich welchen Aussehens in der Region Koriyama, während Juri17 aus Nobeoka uns vergeblich auf eine Website aufmerksam machte, auf der live eingespielte Bilder von ihr zu sehen wären. Anders als in den deutschsprachigen Chaträumen, an die ich mich erinnere, schienen sich nur wenige Chatter zu kennen; sie unterhielten sich über ihre momentane Stimmung, ihre Neigungen und körperlichen Vorlieben (auffällig oft unter Nennung von Zentimeterangaben, denen in Japan entgegen dem Klischee eines spirituellen Ostens offenbar eine größere Bedeutung beigemessen wird als bei uns). Die meisten betrachteten den Raum als bloße Kontaktbörse, ohne daß uns der Erfolg ihres Werbens einsichtig geworden wäre, da die Interessenten sich ähnlich wie in Deutschland kaum im allgemeinen Chatraum gemeldet, sondern die Möglichkeit genutzt haben dürften, einen privaten, für die übrigen Chatter also nicht zu verfolgenden Dialog mit dem Annoncierenden zu beginnen.
Als mein Bekannter mir zum Spaß vorschlug, einen Satz zu nennen, den er übersetzt in den Chatraum stellen würde, konnte ich einerseits der Versuchung nicht widerstehen, mich einmal im Leben als Japaner auszugeben, um ein lüsternes Wort mit einer denkbar fremden Frau zu wechseln, mit der ich nicht einmal die Sprache teilte, wollte andererseits jedoch vermeiden, mich als Lüstling bloßzustellen, so daß ich auf die eitle Geste verfiel, eine Zeile des ihm unbekannten Paul Celan abzuwandeln, nämlich zu fragen, ob jemand bereit sei, mich mit Schnee zu bewirten, worauf sich besagte Architektin, deren Pseudonym übersetzt etwas wie Vorne und hinten bedeutete, in einem privaten Dialogfenster nach der Stadt erkundigte, in welcher ich lebte. Von mir gebeten, eine beliebige Stadt zu nennen, tippte mein Bekannter Kyoto ein, worauf sie ihr Bedauern bekundete, wohnte sie doch in Asahikawa, einer hochgelegenen Stadt ganz im Norden Japans, wie mein Bekannter mich aufklärte. Ein kurzer Schriftwechsel entspann sich, in dem ich ihren Beruf, ihr Alter und ihren Familienstand erfuhr und mich selbst mit Hilfe meines Bekannten als gleichaltrigen, im Unterschied zu ihr jedoch ledigen Arzt vorstellte. Dann schrieb sie nach Aussage meines Bekannten, daß sie sich durch meine, von Celan geborgte Frage nach dem Schnee angesprochen gefühlt habe, weil dieser bei ihr zur Zeit meterhoch liege, und ging unvermittelt über zu ihrer Sehnsucht nach jemandem, den ihre Wangen liebkosen dürften, jemandem, der sich ihren Haaren hingebe, eine Auskunft, die bei uns in Mettmann allerhand Spekulationen hervorrief, wußten wir sie doch nicht mit der Drastik ihres Pseudonyms in Verbindung zu bringen. Ich bat meinen Bekannten, sie vorsichtig nach dem Widerspruch zu befragen, indem er sie besonders auf die Anmut ihres Begehrens hinwiese, was ihn einige Überlegung kostete, bis er eine adäquate Übersetzung meines Anliegens fand. Sie antwortete nicht, sondern fragte ihrerseits, ob es mir prinzipiell möglich sei, kurzfristig zu ihr in den Norden zu fliegen, wo sie wegen einer beruflich bedingten Abwesenheit ihres Gatten zur Zeit allein die Kälte vertreibe. Ohne meine endgültige Reaktion abzuwarten, schrieb mein Bekannter, um mehr über die Architektin zu erfahren, daß ich prinzipiell bereit sei, mich heute noch ins Flugzeug zu setzen, falls unser weiteres Gespräch jenen Eindruck gegenseitiger Sympathie und gemeinsamer Wünsche verfestige, der sich mir bereits jetzt andeute. Nachdem ich beziehungsweise mein japanischer Bekannter also ihrer Lockung gefolgt und mit fast ausgestreckter Hand einen Schritt auf sie zugegangen war, rührte sich eine endlose Minute lang nichts auf dem Bildschirm meines Bekannten, bevor sich Vorne und hinten in einer Geste feenhafter Anmut unwiderruflich von uns abwandte: Sie schrieb, daß ich sie mit meiner prinzipiellen Bereitschaft, eigens für sie von Kyoto nach Asahikawa zu fliegen, glücklich gemacht habe, sie aber leider nicht antreffen würde, da – und hier gingen ihre Worte nach Aussage meines Bekannten in Verse über – ihr Schiff in See stoße, am Mast ein Segel wie von Ängsten geschüttelt; eine wundervolle Fahrt unter heiterem Himmel erwarte sie. Wenngleich er sich keineswegs sicher war, meinte mein Bekannter die Verse, die lateinisch zu transkribieren ich ihn bat, dem gleich Celan berühmten, mir dennoch zuvor unbekannten japanischen Dichter Kitahara Hakuschu zuschreiben zu können. Sooft wir die Architektin noch ansprachen, erhielten wir keine Antwort mehr, so daß wir bald schon wieder den Chatraum verließen, um auf Seiten der japanischen Winzervereinigung und des Verbandes der japanischen Fruchtsaftgetränkehersteller zu stoßen, bis ich meinen Bekannten mit Blick auf die Uhr – schließlich mußte ich mit meinem schiffgleichen Peugeot noch in die Hauptstadt des Rheins zurückkehren – darum bat, die Führung durch den japanischen Teil des World Wide Web für heute zu beenden, überzeugt von der globalen Simultaneität neuerer kultureller Prägungen und der Anmut einer dreiunddreißigjährigen Architektin, die sich den Namen Vorne und hinten gab, um sich vom Dichter die Worte Ho wo kakete kokorobosoge no yuku fune no ichiro kanaschi mo uraraka nareba zu borgen, wenn die Transkription meines Bekannten stimmt.
Vom Gehorsam
Eberhard, Direktor einer Kölner Versicherung, hat im Zuge jener Mode, die beispielsweise Madonna darauf brachte, Gedichte des persischen Mystikers Rumi zu vertonen, letztens einen sufischen Workshop in Kanada besucht, auf dem sich einer der engsten Schüler des Ordensführers als der ältere Bruder des Konzerninhabers entpuppte, von dem bis dahin wenig mehr als die bloße Existenz bekannt war. Selbst Eberhard, der schon vor zwanzig oder fünfundzwanzig Jahren in die Versicherung eingetreten ist und den Stammbaum der Gründerfamilie wie kaum ein anderer kennt, hatte lediglich gewußt, daß der Bruder in den sechziger Jahren dazu bestimmt gewesen war, die Leitung des Unternehmens zu übernehmen, es aber im Zuge oder womöglich erst nach der erfolgten Stabsübergabe zu einem Zerwürfnis mit dem Vater kam, der daraufhin den jüngeren Sohn zum Nachfolger ernannte. Was seither mit dem älteren Sohn geschehen ist, darüber hat es, weil bis zu seinem Tod weder der Vater noch der jüngere Bruder ihn je wieder erwähnt haben sollen, nur Gerüchte gegeben, wonach er sich entweder im Ausland oder in einer Nervenheilanstalt aufhalte.
In der Teepause zwischen zwei Tanzritualen klärte der ältere Bruder, der sich inzwischen Salim nennt, Eberhard darüber auf, 1966 die Anteilsmehrheit, die ihm bereits übermacht worden war, ausgerechnet einer trotzkistischen Arbeitsgemeinschaft geschenkt zu haben, die für den Vater, einen politischen wie persönlichen Freund Konrad Adenauers, nichts Geringeres war als eine Manifestation des Bösen. Noch am selben Tag, als der Vater von der Schenkung erfuhr, sei Salim unter Opiate gesetzt und mit einem Privatflugzeug in die zypriotische Ferienvilla der Familie gebracht worden, wo ihn die Eltern mit Hilfe von Leibwächtern in sanfter Gefangenschaft hielten, bis er sich bereit erklärt habe, unter notarieller Aufsicht seinen Verzicht auf die Schenkung wie überhaupt auf den Anteil am Konzern zu unterschreiben. Weil der Vater naturgemäß einen Skandal vermeiden wollte, willigte er ein, das restliche Erbe des Sohnes vorzeitig auszuzahlen, falls dieser im Gegenzug die Aussage machte, von den Trotzkisten unter Drogen gesetzt worden zu sein, von weiteren Forderungen absah, ins Ausland übersiedelte und das Übrige den Anwälten überließ. In Pakistan, wo Salim nach einer Fahrt per Anhalter durch die Türkei und Iran den Sufismus kennenlernte, schloß er sich einige Jahre später dem Orden an, dessen Workshop in Kanada Eberhard besucht hatte.