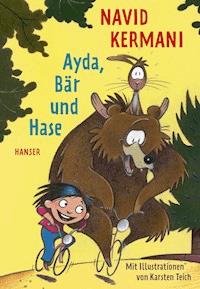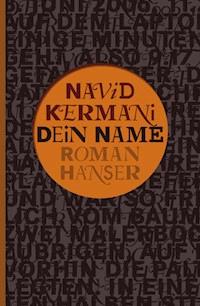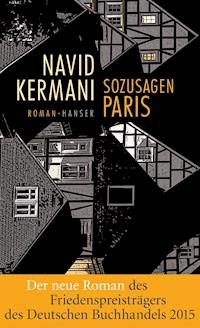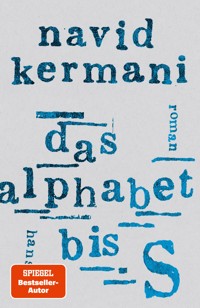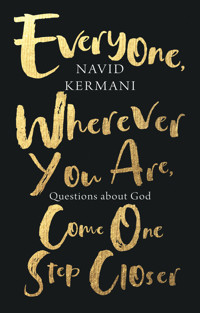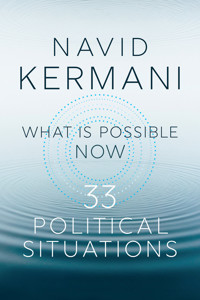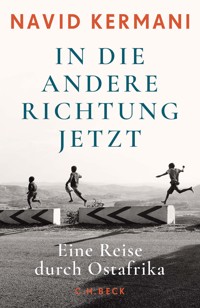
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Navid Kermani ist vom Süden Madagaskars bis in die Nuba-Berge im Sudan gereist. Behutsam, am einfühlsam beobachteten Detail, läßt er den Osten Afrikas lebendig werden. Aber zugleich, aus neuer Perspektive, denkt Kermani über die Themen auch unserer Gegenwart nach, über Klimawandel, Krieg, Entwicklung und Identität sowie die grundsätzlichen Fragen der Existenz. Bis heute gilt Afrika als der «vergessene Kontinent», dabei ist es spätestens seit dem 19. Jahrhundert vor allem der umkämpfte Kontinent. Europäische Kolonialmächte haben hier tiefe Wunden hinterlassen. Der arabische Norden trägt seine Religion und Kultur in den Süden, oft mit Gewalt. China und der Westen konkurrieren um Bodenschätze und Einfluß. Vergessen ist Afrika vor allem da, wo es nichts zu holen gibt, etwa auf Madagaskar. Hier haben die Vereinten Nationen die erste Hungersnot deklariert, die vom Klimawandel verursacht wurde. Hier beginnt die Reise, die Navid Kermani für DIE ZEIT unternommen hat. Sie führt ihn weiter über die Komoren, Mosambik, Tansania, Kenia und Äthiopien bis in den Sudan. Wo andere Schriftsteller Ursprünglichkeit suchten, entdeckt Kermani Bevölkerungen und Kulturen in Bewegung, oft auf der Flucht vor Krieg und Dürre. Vor allem aber haben sie schon immer kreativ neue kulturelle Einflüsse aufgegriffen und zu etwas Eigenem gemacht. Das zeigt sich nirgends so deutlich wie in der Musik. Sie bildet den heimlichen roten Faden des glänzend geschriebenen Buches, das einem unwiderstehlichen literarischen Rhythmus folgt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Navid Kermani
IN DIE ANDERE RICHTUNG JETZT
Eine Reise durch Ostafrika
C.H.BECK
Übersicht
Cover
INHALT
Textbeginn
INHALT
Titel
INHALT
Karte
HINREISE
KLIMA – Im Süden Madagaskars
EWIGKEIT – Im Hochland Madagaskars
RHYTHMUS – Bei Nainako und seinen Freunden in Antananarivo
ENTWICKLUNG – Auf den Komoren
Mayotte: Aus der Tauschwirtschaft in die Europäische Union
Anjouan: Am Anfang der Lieferkette
Moheli: Hier hast du nur Vergangenheit
Grande Comore: Wie im alten Athen
ENERGIE – In Cabo Delgado im Norden Mosambiks
FRIEDEN – Im Norden Tansanias
KOLONIALISMUS – Nairobi
KRIEG – In der Region Tigray im Norden Äthiopiens
GEBET – In den Kirchen und Klöstern Äthiopiens
JAZZ – Mit Mulatu Astatke in Addis Abeba
IDENTITÄT – In den Nuba-Bergen im Sudan
URLAUB
DANK
Zum Buch
Vita
Impressum
Karte
HINREISE
13. August 2022
Salman Rushdie ist angegriffen worden. Am Flughafen Frankfurt das zweite Interview gegeben, das erste vier Stunden zuvor beim Packen, während im Fernseher Fußball lief. Die üblichen Sätze, mit denen man sich selbst versichert, auf der richtigen Seite zu stehen, aber stimmt es denn nicht auch? In diesem Fall? Wenn ein Schriftsteller ermordet, das freie Wort verboten werden soll? In den Nachrichten der Papst, der für die Mißhandlung der indigenen Kinder in kanadischen Heimen um Vergebung bittet. Irgendwann ist er den Rest der Menschheit durch. Scham ist auch das, was ich empfand, als ich mich für die Reise vorbereitete, jedenfalls die Hälfte der Zeit. Die Hälfte? Ja, weil die Bücher über Afrika sich auf zwei Stapel legen lassen: Von dem einen lernte ich, daß man den Kolonialismus, so schändlich er auch gewesen sei, nicht für alles verantwortlich machen könne, und erhielt viele plausible Gründe für diese Sicht, bis man sich am Ende fragt, ob nicht doch der Rassenunterschied als Ursache für die Misere gemeint ist. Ja, ich ertappe mich selbst bei Gedanken der Art, die Schwarzen kriegten es einfach nicht hin. Haiti und Liberia. Der zweite Stapel Bücher legt in kaum glaublichen Details dar, wie sehr die heutigen Verhältnisse von Bedingungen bestimmt werden, die der Kolonialismus geschaffen hat. So bekommt man den Eindruck, die neuen afrikanischen Nationen hätten erstens keine Chance gehabt, und die Chancen, die sie nie hatten, seien von den früheren Kolonialmächten und einem Weltwirtschaftssystem, das die Armen bestraft, auch noch systematisch zunichte gemacht worden, bis die Hilfsindustrie übernahm, von der – selbst von der – die Geberländer ebenfalls profitieren.
Nicht wirklich herausgefunden habe ich, wie es den Menschen vor der europäischen Kolonisation ging, das wird auch von Landschaft zu Landschaft unterschiedlich gewesen sein; aber Unrecht, Grausamkeit, Hunger wird es gegeben haben, und nicht zu knapp, schon weil Unrecht, Grausamkeit, Hunger immer und überall herrschten vor der modernen Zivilisation, die mit großem Gleichheitspathos ein Reich der happy few schuf. Als Kind von Einwanderern gehöre ich glücklicherweise dazu. Die Berlinale-Gewinner Mohammad Rasoulof und Jafar Panahi nicht, die soeben in Iran verhaftet worden sind, zwei der bedeutendsten Filmregisseure der Welt, ohne daß sich die Bundesregierung während der Atomverhandlungen auch nur eine Erklärung abringt, Sicherheit schlägt Menschenrecht. Ich möchte die Vergangenheit nicht verklären, seit Kain und Abel bereits schlägt der eine Bruder den anderen tot. Aber viel klarer als bisher, nämlich im Detail, wurde mir dank des zweiten Stapels bewußt, daß nichts, was auf dem afrikanischen Kontinent heute geschieht, kein Krieg, kein Nepotismus, keine Hungersnot, ohne die Hinterlassenschaft des Kolonialismus zu erklären ist. Mit den von den Kolonialmächten eingesetzten Häuptlingen etwa geriet die kulturell tief verankerte Machtbeschränkung durch Ältestenräte und traditionelle Instanzen aus dem Gleichgewicht. Die Konzentration auf Exportprodukte, die sich in der jetzigen Nahrungskrise so dramatisch auswirkt, war bereits im 19. Jahrhundert von den Kolonialisten gewollt, ebenso wie die systematische Verhinderung der Industrie, damit ein ständiger Bedarf für verarbeitete Produkte blieb. Daß das Eisenbahnnetz und die wichtigsten Verkehrswege nicht verschiedene Regionen verbinden sollten, sondern fast ausschließlich dazu dienten, Rohstoffe aus dem Landesinneren an die Küste zu transportieren, macht sich bis heute bemerkbar, wenn man innerhalb eines Landes von Norden nach Süden unterwegs ist. Und das sind nur drei von unzähligen gut dokumentierten Beispielen, die den Stapel mit den Apologien wenn schon nicht widerlegten, so doch ziemlich alt aussehen ließen. Selbst ich, der in der Anklage des Westens häufig eine Ausrede erkennt, um vom autochthonen Versagen abzulenken, staunte Buch um Buch und Aufsatz um Aufsatz mehr, wie konkret die kolonialen Verbrechen den Kontinent bis heute belasten, die Ökonomie, die ethnischen Konflikte, die schlechte Regierungsführung … Danach findet man den Untergang des Abendlandes fast so gerecht wie Thomas Mann und Albert Einstein das Ende deutscher Staatlichkeit nach dem Zweiten Weltkrieg.
Simone Weil, auf die ich in meinen Lektüren zum Kolonialismus überraschend häufig traf, und jedesmal brachte sie einen neuen Gedanken ein, so weltfremd sie auch war oder gerade deshalb, wegen ihres fremden Blicks – Simone Weil hat das Neuartige am Hitlerismus bereits Anfang der Vierzigerjahre charakterisiert als «Deutschlands Anwendung von kolonialen Eroberungs- und Herrschaftsmethoden auf den europäischen Kontinent und noch allgemeiner gesagt auf die weißrassigen Länder». Und vermutlich ohne sie gelesen zu haben, pflichtete Aimé Césaire ihr 1950 in seiner Rede über den Kolonialismus bei, als er von «Hitlerism before Hitler» sprach: So sei es auch nicht das Verbrechen an sich gewesen, das der Westen unverzeihlich fand, das Verbrechen gegen die Menschlichkeit, «sondern das Verbrechen gegen den weißen Menschen und daß er, Hitler, kolonialistische Methoden auf Europa angewendet hat, denen bislang nur die Araber Algeriens, die Kulis Indiens und die Neger Afrikas ausgesetzt waren».
Weil und Césaire bezogen den Vergleich nicht allein oder nicht sosehr auf die Schoah, vielmehr auf die Idee des deutschen Lebensraums. Kolonialismus und Nationalsozialismus waren für keinen von beiden identisch. Eher sahen sie wie später Hannah Arendt in ihrem berühmten Buch über «Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft» in dem Zivilisationsbruch der Europäer anderswo den Vorboten für den Zivilisationsbruch auf dem europäischen Kontinent selbst. Mit den drastischen Worten Césaires: «Der Kolonisator verwandelt sich selbst in ein Tier, wenn er sich, um ein gutes Gewissen zu haben, daran gewöhnt, im Anderen das Tier zu sehen, und sich darin übt, ihn als Tier zu behandeln.» Offensichtlich ist außerdem, daß erst die moderne Zivilisation Verhältnisse geschaffen hat, in denen die Menschheit die Grundlagen ihrer eigenen Existenz zerstört, Brandrodung, Klimawandel, Überbevölkerung, Maschinengewehre, Wachstum und Konsum. Allmählich bekommen es auch die happy few mit. Für die übrigen ist es womöglich schon zu spät. Please come immediately to the gate.
*
«Man redet mir von Fortschritten, von Errungenschaften, geheilten Krankheiten, von gestiegenem Lebensstandard», lese ich auf dem Flug weiter Aimé Césaire: «Ich aber rede von Gesellschaften, die um ihre Identität gebracht sind, von niedergetrampelten Kulturen, von ausgehöhlten Institutionen, von konfisziertem Land, von ausgelöschten Religionen, von vernichtetem künstlerischem Glanz, von vereitelten großen Möglichkeiten. Man wirft mir Fakten, Statistiken, Straßen-, Kanal- und Eisenbahnkilometer an den Kopf. Ich aber rede von Millionen, denen man ganz bewußt die Angst, den Minderwertigkeitskomplex, den Kniefall, die Verzweiflung, das Domestikentum eingebleut hat.» Die westlichen Apologien des Kolonialismus, die Césaire zitiert, über die Ungleichheit der Kultur, über die Werte, die man nicht relativieren dürfe, und damit implizit die eigene moralische Höherwertigkeit, könnten von heute sein. Auf der richtigen Seite stehen.
14. August 2022
Zwischenlandung in Addis Abeba: Eigentlich wäre ich schon vor zwei Wochen geflogen, allein, der PCR-Test, der für die Einreise nach Madagaskar vorgeschrieben ist, fiel positiv aus. Keine Ahnung warum, Symptome hatte ich nicht, der Schnelltest blieb negativ. In Deutschland kommen die Epidemiologen mit ihren Erklärungen nicht mehr hinterher, und der Gesundheitsminister sagt heute dies und morgen das Gegenteil, weil selbst er die Zahlen nicht mehr versteht. Lova Andrianaivomanana, der mich durch den Süden Madagaskars führen wird, war eigens in die Hauptstadt Antananarivo gefahren, um mich abzuholen. Fünfzig Stunden nonstop im Minibus auf holprigen Pisten und zurück ergibt hundert, wieder hin … hundertfünfzig Stunden im Minibus, und neu planen muß er die Reise außerdem. Er stöhnte nicht einmal auf, als ich ihm absagte, wunderte sich auch nicht sehr, sondern war freundlich und warmherzig wie eh. Take care of you, my friend, simste er nach unserem Telefonat, weil ich offenbar besorgt geklungen hatte oder genervt. Sein Gleichmut steckte mich in meiner Quarantäne an, das war schön. Oder ist das auch wieder nur Kitsch, afrikanischer Fatalismus und so? Der senegalesische Ökonom Felwine Sarr setzt in Afrotopia gerade auf die Mentalität, die der koloniale Diskurs als Hauptgrund für die Rückständigkeit Afrikas bestimmt: Geduld, Gastfreundschaft und Gemeinschaftlichkeit als die zukunftsweisenden afrikanischen Tugenden, damit wirtschaftliche Entscheidungen nicht durchweg von der Ratio des Eigeninteresses bestimmt werden, die von den Weißen übernommen worden sei.
Den ersten Anlauf für die Reise hatte ich bereits im April unternommen, doch nach dem Angriff Rußlands auf Kiew war klar, daß sich jetzt erst recht niemand in Europa für Afrika interessiert, egal wieviel alle vom Klimawandel reden. Solange er nur dem Süden Dürre um Dürre bringt, bekämpfen wir ihn mit Heizungspumpen und Hafermilch. Also berichtete ich aus der Ukraine und schämte mich dort für meine Schriftstellerkollegen in Deutschland, die entweder betroffen waren von ihrer eigenen Betroffenheit oder verärgert über die Ruhestörung, jedenfalls nur von ihrer eigenen Befindlichkeit schrieben, der Narzißmus der einen die Kehrseite der Kälte der anderen. Die ukrainischen Kollegen hielten mir die Aufrufe zur Kapitulation auf dem Smartphone hin und fragten, was das soll. Aussichtslos wäre es gewesen, die Parteinahme für Rußland mit den deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg zu erklären, weil es einfach auch nicht stimmt. Schließlich wurden die Verbrechen wesentlich an eben jenen Völkern begangen, die zuvor bereits von der Sowjetunion unterjocht worden waren, und so sah ich in den Offenen Briefen nicht etwa deutsches Schuldbewußtsein aufschimmern, sondern ganz ungut deutsche Großmannssucht. Die kleinen Völker sollen sich mal nicht so haben, wenn es überhaupt eigene Völker sind. Der Graben, der überall in der westlichen Welt breiter wird und immer neue Lager voneinander trennt, der Graben zieht sich jetzt mitten durch unsere kleine Welt des Geistes, Verständigung nur noch möglich als Gebrüll wie auf der Tagung des PEN. Dabei schien mir selbst der Westen nur wenige Monate nach seinem moralischen wie sicherheitspolitischen Bankrott in Afghanistan überraschend auf der richtigen Seite zu stehen, gelb-blau überall.
Verunsichert haben mich später die Berichte über die Folgen der Sanktionen für den sogenannten Globalen Süden, insbesondere für die Länder Ostafrikas. Von dort betrachtet, gewönnen die zweifelhaften Friedensaufrufe womöglich doch an Plausibilität – weshalb sollen ausgerechnet die Ärmsten auf der Welt für die Freiheit der Ukraine mit teurem Brot zahlen? Gestern erst las ich, daß westliche Konzerne von der Getreideknappheit massiv profitieren, nicht so viel anders als Rußland vom knappen Gas. Und nach Ausbruch des Krieges sollen Banken allerorten empfohlen haben, in Agrarfonds zu investieren und auf steigende Lebensmittelpreise zu wetten. Allein in der ersten Woche haben Anleger 4,5 Milliarden Dollar auf höhere Preise für Getreide, Reis und andere Grundnahrungsmittel gesetzt. Trotz des Klimawandels, der allein in Afrika jedes Jahr Anbauflächen in der Größe der Schweiz zerstört, wurden noch nie so viele Nahrungsmittel hergestellt wie heute. Dennoch steigt die Zahl der Hungernden seit 2015 wieder kontinuierlich an. Schon in den zwei Jahren vor dem Ukrainekrieg hatten sich die Preise für Grundnahrungsmittel um vierzig Prozent erhöht. Damit sie ihre Schulden abbauen, wurden ärmere Länder angehalten, Exportgüter wie Kaffee, Baumwolle oder Kakao anzubauen statt Hirse, Maniok oder Süßkartoffeln für den eigenen Bedarf. Nun können die Bauern den Kunstdünger und die Pestizide nicht mehr bezahlen, die für die Monokulturen unverzichtbar sind, und halb Afrika steht ohne die Getreideimporte blank da. Und so weiter und so fort, bis dir vom Lesen schlecht wird. Immerhin wußte ich wieder, warum ich nach Madagaskar fliegen wollte, um meine eigene Welt zu verstehen. Ich selbst habe zum Boykott von russischem Öl und Gas aufgerufen und nach meiner Rückkehr aus der Ukraine für den Kauf von Nachtsichtgeräten gespendet. Hier kommt keiner sauber raus. Nein, dort.
In Äthiopien ist es allerdings auch seltsam, jedenfalls im Terminal: Corona scheint nicht zu existieren, niemand trägt eine Maske, aber dann sieht man zwischen all den gewöhnlich gekleideten Menschen aus aller Welt einzelne Chinesen in weißen, knittrigen Ganzkörperanzügen, FFP 2, 3 oder 4 sowieso, aber auch Plastikhandschuhe, Gesichtshaube, die Schuhe in weißen Plastiktüten. Manche tragen einen Aktenkoffer oder ziehen einen Rollkoffer hinter sich her, andere sitzen, warten wie ich auf ihren Anschluß, mit aufgeklapptem Laptop auf den Knien. Woher weiß ich überhaupt, daß es Chinesen sind, die wie Astronauten aussehen oder eher noch wie Arbeiter nach einem Atomunfall, und wir anderen, wir gewöhnlichen Bewohner, wären alle verseucht und isoliert? Ich schließe es aus der Anzeigetafel, auf der die chinesisch anmutenden Städtenamen viel häufiger sind als London, Paris, Madrid.
*
Ein Sandstreifen an der Küste, und dann nur noch eine braune, rote Fläche, wirklich wie verwundet, eiternd, schattenlos, hier und dort eingesprenkelt Reste des einstigen Waldes, vermutlich die Naturschutzgebiete. Keine größeren Siedlungen, nicht eine einzige befestigte Straße, nur staubige Pisten, soweit ich aus der Luke erkenne. Madagaskar, das einmal tropisch war. 95 Prozent des Baumbestands zerstört. «Man will mir mit der Tonnage an Baumwolle oder exportiertem Kakao, mit vielen Hektar gepflanzter Ölbäume und Weinreben imponieren», schrieb Césaire: «Ich aber rede von natürlichen Ökonomien, von harmonischen und lebensfähigen Ökonomien, von auf die Eingeborenen zugeschnittenen Ökonomien, die man zerrüttet hat, von zerstörten Nahrungsmittelkulturen, von planmäßig eingeführter Unterernährung, von nur am Profit des Mutterlandes orientierter Entwicklung der Landwirtschaft, von der Plünderung von Erzeugnissen, von der Plünderung von Rohstoffen.» Aus dem Flugzeug sieht Madagaskar aus wie eine Mine, die aufgegeben worden ist.
*
Die Arbeiter, die das Gepäck aus dem Flugzeug holen, könnten Indonesier oder Afrikaner sein: entweder – oder. Zwei Kontinente begegnen sich auf Madagaskar. In der Schule lernten wir, daß der Aufstieg Europas mit dem Zeitalter der Entdeckungen und sagenhaften Heldentaten begann. Nun erfahre ich von Howard W. French, was ich zuvor gehört, aber nicht recht ernstgenommen habe, daß andere Völker schon viel früher ähnlich verwegene Expeditionen unternahmen und mindestens so sagenhafte Entdeckungen machten. Genetische Untersuchungen haben gezeigt, daß indigene Bevölkerungsgruppen im Amazonas-Gebiet mit Ureinwohnern Australiens, Neuguineas und der Andamanen verwandt sind – das heißt, daß es schon in prähistorischen Zeiten Reisen über die Ozeane gab. Von den Wikingern weiß man als Europäer gerade noch, weil es Europäer waren. Unmittelbar vor den Westeuropäern unternahmen die Chinesen gewaltige Expeditionen, bis nach Ostafrika und ans Rote Meer. 1405 etwa: 28.000 Mann auf mehr als 250 Schiffen, die bis zu 120 Meter lang waren und neun Masten hatten. Kolumbus’ Santa Maria maß gerade einmal 20 Meter und hatte nur 52 Mann an Bord. Oder eben die Völker Südasiens und Arabiens, die mit der Monsunzirkulation vertraut waren, darunter die Malaien, die Madagaskar besiedelten. Was die europäischen Expeditionen einzigartig macht, sind nicht die Entfernungen, ist nicht die Neugierde, ist nicht die Kühnheit. Es ist das Ausmaß der Gewalt. Und der Erfolg: Die Plantagen – nicht erst die Industrialisierung – revolutionierten im Handstreich die Weltwirtschaft durch ihren unermeßlichen Profit. Aber beruht hat die ökonomische Revolution auf der Auslöschung indigener Gesellschaften und auf der Versklavung der Schwarzen. In Amerika sind vom Land der Einheimischen nur noch Reservate übrig, praktisch nur noch Zoos. Aber auch Afrika – mit Frenchs Buch gebe ich endgültig dem zweiten Stapel recht, der die heutigen Verhältnisse bis in Details aus der Herrschaft des Westens herleitet – aber auch Afrika: Auf 100 Millionen wird die Gesamtbevölkerung in der Mitte des 19. Jahrhunderts geschätzt. Etwa ein Fünftel davon – annähernd 20 Millionen – wurde in Ketten gelegt und nach Amerika verschifft oder kam bereits bei der Sklavenjagd um. Afrikas Unterwerfung, Versklavung und Ausplünderung, so die Grundthese von Howard French, begründete die Entstehung der modernen Welt. Von dem demographischen und materiellen Verlust – allein schon dem Raub unermeßlicher Mengen von Gold, auf dem der Reichtum und die kulturelle Blüte vieler afrikanischer Reiche beruhte – habe sich der Kontinent nie mehr erholt. Das lese ich, während ich aus dem Fenster einem Malaien und einem Schwarzafrikaner dabei zusehe, wie sie das Gepäck aus dem Flugzeug holen. Lange vor den Europäern haben ihre Vorfahren Madagaskar erreicht.
15. August 2022
Das Pain au chocolat, der Café au lait, dazu ein frischgepreßter Saft – es hat nicht nur Nachteile, von den Franzosen unterworfen worden zu sein, nur hat Präsident Sarkozy in seiner berüchtigten Rede von 2007 über die Segnungen der Kolonialherrschaft für den afrikanischen Kontinent nicht ans Frühstück gedacht, sondern an die überlegene europäische Zivilisation. In Afrika sei «kein Platz für das Abenteuer Mensch, für die Fortschrittsidee».
Meine Eltern behaupteten immer, die Kolonialherrschaft sei ein Paradies gewesen, sagt der Kellner, dessen Sakko so weiß ist wie seine Haare: Das wird so nicht stimmen, aber als ich jung war, und da waren wir schon unabhängig, gab es nicht diese extreme Armut, da hatten die Menschen Arbeit und viele eine gute Bildung. Das Land war voller Hoffnung.
Und warum haben sich die Hoffnungen zerschlagen?, frage ich.
Manchmal denke ich, wir würden bestraft, antwortet der Kellner.
Wofür bestraft?
Dafür, daß wir frei sein wollten, unabhängig. Die Unabhängigkeit war ein Berg, der zu hoch für uns war.
*
Auf dem Bürgersteig eine Bettlerin mit Kleinkind, angelehnt an eine Mauer, beider Kleidung, Haare, Haut verdreckt. So viele bettelnde Kinder auf den Straßen von Antananarivo, da bist du schon froh, wenn du einer Mutter begegnest, der du etwas zustecken kannst, denn den Kindern selbst sollst du nichts geben, weil sie … aber das ist ja auch Quatsch, weil sie überhaupt keine Chance hätten, zur Schule zu gehen, statt zu betteln, statt zu schuften, statt auf der Straße zu übernachten. Oft haben sie nicht einmal Eltern, wie ich aus anderen Ländern weiß, wo ich Straßenkinder ansprach, geschweige denn ein Zuhause oder einen Clan, der sie zum Betteln schickt. Obwohl sie vermutlich auch in Antananarivo auf sich allein gestellt sind, gebe ich den Kindern nichts, höchstens mal was zu essen, und spüre beinah physisch, wie sich deswegen mein Herz von Mal zu Mal mehr verschließt. Also der Mutter ein Scheinchen. Merci, sagt sie, und rasch gehe ich weiter.
Einige Minuten später komme ich ein zweites Mal an ihr vorbei, weil ich in die falsche Richtung gegangen bin, und sehe das Kind, vielleicht ein Jahr alt, wie es den Schein sorgfältig rollt und in die Blechdose steckt, wieder herausholt, aufrollt, einrollt und ablegt, eine ganze Weile, es ist vollkommen vertieft, und ich bin vertieft in das Kind, aber nicht nur ich, auch die Mutter, wie ich plötzlich aus dem Augenwinkel entdecke. Sie schaut ebenfalls lächelnd auf ihr Kind, das mit dem Scheinchen spielt, und schon treffen sich unsere Blicke. Wir lachen uns an, wirklich hörbar, wenn auch keine halbe Sekunde lang, wir lachen, weil wir das gleiche sehen, uns über das gleiche freuen, für eine viertel Sekunde entsteht eine Beziehung, obwohl wir auf zwei verschiedenen Planeten leben, und ihrer könnte unwirtlicher nicht sein. Vielleicht denken wir sogar das gleiche, nicht mal eine halbe Sekunde lang, denken bang, was für eine Zukunft dieses Kind wohl haben mag, wenn nicht zu betteln, zu schuften, früh zu sterben wie all die anderen Kinder auf den Straßen, und sind froh, daß es sich im Spiel vergißt. Rasch gehe ich weiter, in die andere Richtung jetzt.
*
Frustrating ist das häufigste Wort, das der europäische Diplomat verwendet, immer wieder it’s so frustrating. Am Ende der Kolonialzeit war Madagaskar ein Land mit mittlerem Durchschnittseinkommen und versorgte sich selbst. Heute wird es von Oligarchen beherrscht und hängt am Tropf der Entwicklungshilfeindustrie, obwohl es voller Bodenschätze ist. Unter den sechs Staaten auf der Welt, in denen praktisch alle Entwicklungsindikatoren negativ sind, ist es das einzige ohne Krieg. Ich sehe einfach, daß nichts von dem, was wir tun, irgendeinen nachhaltigen Effekt hat, rein gar nichts, klagt der Diplomat. Die Menschen gewöhnen sich an die Hilfsleistungen, außerdem fördert unsere Hilfe die Korruption, aber verhungern lassen kann man sie doch auch nicht.
Woran es liegt, frage ich.
Darüber zerbreche ich mir selbst den Kopf, antwortet der Diplomat. Sicherlich an der Mentalität, an der Kultur, aber wahrscheinlich auch an der Hilfe selbst. Wir bekommen es einfach nicht hin. Und wenn man nach ein paar Jahren ein bißchen was begreift, ist man schon wieder weg. Und erleichtert, daß es einen nichts mehr angeht.
Ich frage nicht, ob die Ursachen auch in der kolonialen Vergangenheit zu suchen seien, das kann so jemand bestimmt schon nicht mehr hören. Irgendwie ja, würde der Diplomat antworten, und irgendwie auch nicht. Vielleicht würde er auch auf Haiti und Liberia verweisen, wo sich die Sklaven als erstes von den Weißen befreien konnten und wo es heute am schlechtesten steht. Und wenn ich auf die Demokratie verwiese, die sich in Liberia seit dem Bürgerkrieg erstaunlich stabilisiert hat, würde der Diplomat rufen: Es geht doch, wenn sie nur wollen! Umgekehrt liege es doch nicht am Westen, daß Madagaskar in wenigen Jahrzehnten neunzig Prozent seines Baumbestands zerstört hat, würde er weiter argumentieren und betonen, daß die Europäische Union Umweltaktivisten unterstützt. Na ja, würde ich denken, an der Lebensweise liegt es ein bißchen schon, die alle Welt von uns übernommen hat. Hat der Westen mit seinen Goldgräbern nicht auch deren Mentalität eingeführt? Vielleicht muß man es eher so denken: Die Strukturen sind kolonial geblieben, nur daß die Ausbeuter jetzt Einheimische sind, während Entwicklungshelfer die Schuld ihrer Vorfahren abtragen. «Ein paar Monate Ausbildung, und fertig war das Prachtexemplar», sagt Kapitän Marlow über den Wilden, den er zum Heizer «veredelt» habe: «Ich sah ihn unter mir, und glaubt mir, der Anblick war so erbaulich, als sähe man einem Hund zu, der in Hosen und Federhut auf den Hinterbeinen geht.»
Joseph Conrads Herz der Finsternis gilt als Manifest des Kolonialismus, dabei könnte man den Roman als Protest gegen ihn verstehen, so unverstellt führt er das Herrenmenschentum aus. Frantz Fanons berühmtes Verdikt über die Vorkämpfer der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen, die sich Europa zum Vorbild nahmen, deutet etwas Ähnliches an: «Schwarze Haut, weiße Masken.» Die Scham darüber liefert hundert Jahre nach Conrad der Nobelpreisträger John Coetzee nach: «Wir, die Barbaren.» Das ist natürlich ein Widerspruch in sich, denn versteht man es wörtlich, können per Definition immer nur die anderen Barbaren sein: diejenigen, deren Sprache man nicht versteht. Kein Wunder, daß ein weißer Südafrikaner der vielleicht bedeutendste Autor unserer Zeit ist; wie ein trauriger Prophet trägt er den ganzen Widerspruch seiner, unserer Zeit in sich, wenn jeder Wohltäter zugleich ein Verbrecher ist. Oder bedeutend wieder nur aus weißer, letztlich neokolonialer Sicht? Allen anderen sind unsere Kopfschmerzen wahrscheinlich egal.
Gibt es denn überhaupt keine positiven Entwicklungen oder hoffnungsvollen Faktoren?, frage ich. Die Jugend? Die Frauen? Ich solle die Umweltministerin treffen, rät der Diplomat, die sei achtundzwanzig Jahre jung. Das ist doch gut, sage ich, eine junge Frau. Nein, sie sei vollkommen unbedarft und verstehe nichts vom Thema, ins Amt gekommen vermutlich, weil die Nichte oder Tochter von irgendwem. Aber nun sei sie es, die Tacheles reden muß mit den Oligarchen, den internationalen Konzernen, mit Dorfbewohnern und Ministern aus der ganzen Welt, wenn sie durchs Land reist oder Madagaskar auf Klimakonferenzen vertritt. Hier störe sie nicht, und für die Europäische Union mache sie sich gut.
*
Am Abend haben sich in Antananarivo zu den Obdachlosen die Prostituierten gesellt, so jung, daß man die Polizei rufen möchte oder das Jugendamt. Müßte man mal machen und sehen, was passiert, falls es überhaupt eine Nummer gibt.
Immer die Frage in den Büchern, die ich für die Reise las, wer schuld ist an dem Elend in Afrika, an der Armut, der Korruption, der Zerstörung der Umwelt, der Dürre. Ist es die Mentalität, oder sind es die einheimischen Eliten, ist es das Weltwirtschaftssystem, der Klimawandel oder letztlich doch der Kolonialismus? Die Antworten, wie immer sie ausfallen, sind politisch, weil sie sich auf menschliches Handeln beziehen. Aber warum das eine Kind auf der Straße geboren wird und das andere in einem hervorragend ausgestatteten Krankenhaus, diese Frage reicht über die Politik hinaus: Sie ist metaphysisch. Denn das Kind heute, das Kind der Bettlerin, hatte vom ersten Atemzug an keine Chance, und ich habe nichts dafür geleistet, damit mir qua Geburt die Welt offenstand. Hier war Gott am Werk, falls es einen gibt.
*
Im Restaurant zeigt mir Lova auf seinem Smartphone Photos vom Süden Madagaskars, wo die Vereinten Nationen die weltweit erste klimabedingte Hungerkatastrophe ausgerufen haben. «Die Herausforderung besteht für Afrika darin, mehr in die Geschichte zu treten», verkündete Sarkozy 2007 in Dakar. Allein in den letzten drei Jahren ist Trinkwasser um dreihundert Prozent teurer geworden – in einem Land, in dem neun von zehn Bewohnern unter der absoluten Armutsgrenze von zwei Dollar am Tag leben. Mit dem Wassermangel geht auch die Kultur zugrunde; mehr als Landwirtschaft und Musik habe es früher nicht gegeben, sagt Lova, und ohne das eine habe auch niemand Geld für das andere. Geblieben seien die Sitten, etwa daß Zwillinge als Babys ausgesetzt werden, weil sie angeblich Unglück bringen. Eine katholische Mission ziehe die groß, die sie findet oder die abgegeben werden. Daß Albinos in ständiger Gefahr lebten, geraubt und geschlachtet zu werden für Voodookulte. Frauen seien überhaupt nichts wert, gar nichts. Käme jemand in ein Dorf, in dem er nur Frauen sieht, frage er, ob hier irgendwer sei. Würden verkauft, zwei Zebus, zehn Zebus, je nach Aussehen und Stand, haben keine Wahl, gut, die Bräutigame auch nicht.
Genau in dem Moment, als auf Lovas Smartphone eine Frau erscheint, die mit einem Löffel im Schlamm Wasser sammelt und in einen Plastikeimer schüttet, was nur eine braune Brühe ergibt, betritt ein älterer weißer Herr das Restaurant, Mitte siebzig, schätze ich. An seiner Seite ein schmales, stark geschminktes Mädchen, das wie vierzehn aussieht.
Auch nicht so viel anders als mit den Zebus, sage ich.
Es ist komplizierter, antwortet Lova, sie scheint seine Freundin zu sein, die beiden wirken vertraut. Aber letztlich ja, genau wie mit den Zebus.
*
Nebenan im Club, wo eine Band afrikanische Popmusik spielt, wenn man das noch Popmusik nennen kann, denn dafür sind die Rhythmen zu diffizil, und die einzelnen Songs dauern ewig und hüllen dich mit guten Vibes ein. Auf der Tanzfläche ein paar junge Männer, ein paar Frauen und ein Weißer, der am ausgelassensten ist, während ringsum, an der Bar, auf den Sesseln, fast nur Mädchen sitzen, nicht einmal volljährig, und wieder drei ältere weiße Herren, die umherstreifen, sich umsehen oder bereits jemanden haben, ganz normale Männer, eher schüchtern, sähen an jedem anderen Ort nicht unsympathisch aus. Als weißer Mann bist du hier Jesus, sagt Lova, der bemerkt, daß ich starr auf die Bühne schaue, um nur ja keinen Blick zu erwidern, was eine Geschäftsanbahnung wäre. Eine besonders Hübsche, die etwas älter wirkt, um die zwanzig, schätze ich, mein Blick hat sie dann doch gestreift, spricht mich an. Nur so viel erfahre ich, daß sie aus dem Nordwesten kommt, über den ich am Morgen noch geflogen bin. Erst vor vier Tagen ist sie in der Stadt eingetroffen und will Photomodell werden. Ich würde gern mehr von ihr erfahren, aber unter den Umständen gibt es keine Kommunikation, keine Beziehung, die nicht ausbeuterisch wäre, oder ich wüßte nicht wie. Unmöglich, auf der richtigen Seite zu stehen. Nicht einmal Jesus stünde dort, wenn er ein Weißer wäre.
24. August 2022
Erstmals seit der Pandemie wieder Ankunft in einem Flughafen, auf dessen Rollfeld kein weiteres Flugzeug steht. Das Terminal, zu dem wir zu Fuß gehen, könnte auch eine größere Garage sein. Auf der Fahrt in die Stadt blicke ich auf die Menschen, die Wohnhäuser, Hütten und kleinen Ladenlokale, mische mich später allein in die Menge, obwohl ich kein Wort verstehe oder gerade deshalb. Egal wo, der bloße Umstand, daß du dich gar nicht auskennst, alles zum ersten Mal siehst, dich für jede Auslage interessierst, jedes Gesicht aufsaugst und nicht darauf kommst, was dahinter sein mag, ist ein Geschenk und Vorbote, wie es später einmal wird, wenn du endlich nur noch ein Name bist, der auf einem Grabstein verwittert. Auch als Reisender löst du dich auf in der Welt oder hast jedenfalls einen Geschmack davon, reich zu werden, indem du dich verlierst. Vorausgesetzt, du hast ein Visum und genügend Geld. Das Paradies wäre, wo Gott keinen Unterschied macht.
KLIMA
Im Süden Madagaskars