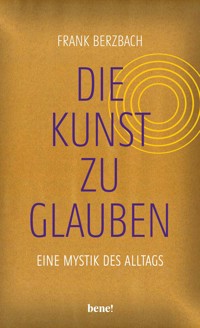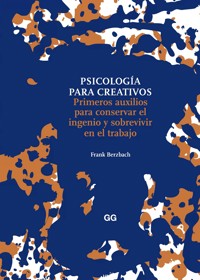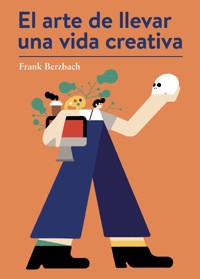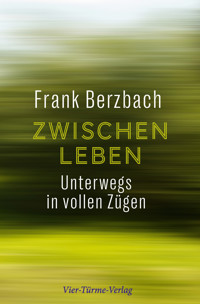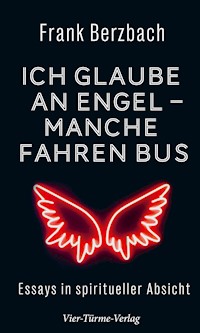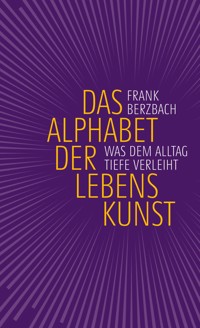
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: bene! eBook
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Seit der Antike beschäftigt uns die Ars vivendi – »die Kunst zu leben«. Was macht sie aus, die Kunst des Lebens? Dazu will Frank Berzbach Anregungen geben: in 69 Miniaturen von A wie Achtsamkeitsübung über F wie Freundschaft bis W wie Wetter; mal sachlicher oder poetischer, ästhetischer oder kulturkritischer – je nach Stichwort. Allen Texten gemeinsam ist: Sie sollen dem Alltag mehr Tiefe geben. Damit verbindet sich auch die Hoffnung, dass nachvollziehbar wird, was das Unsagbare ausmacht; es geht im Leben um mehr als um pure Vernunft. - Die Suche nach einer zeitgemäßen, kraftvollen und lebensbejahenden Spiritualität - Neue Perspektiven, überraschend anders: für Momente des Glaubens, die faszinieren und begeistern - Besonders hochwertige Ausstattung mit Sonderfarben, Tiefprägung und Lesebändchen – ein schönes Geschenk
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Frank Berzbach
Das Alphabet der Lebenskunst
Was dem Alltag Tiefe verleiht
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Seit der Antike beschäftigt uns die Ars vivendi – »die Kunst zu leben«. Was macht sie aus, die Lebenskunst? Dazu will dieses Buch einige Anregungen geben: von A bis Z, in 69 Miniaturen. Mal leicht oder schwer, sachlicher oder poetischer, ästhetischer oder kulturkritischer – je nach Stichwort.
Allen Texten gemeinsam ist: Sie wollen dem Alltag mehr Tiefe geben.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.bene-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
69 Miniaturen, eine Einleitung
__Alte Zeiten
__Arbeit
__Aufklärung
__Achtsamkeitsübung
__Aufräumen
__Amour fou
__Beichte
__Bettelbriefe
__Bildung
__Briefe
__Briefe abschreiben
__Briefwechsel
__Hauptquartier der Bohème
__Demut
__Dichter und Denker
__Eisenwarenladen
__Elfenbeinturm
__Ernsthaftigkeit
__Erziehung
__Existenz
__Ersatzreligion
__Fasten
__Feminismus
__Femme fatale
__Flanieren
__Flohmarkt
__Freundschaft
__Gastrosophie
__Glaube
__Jazz
__Jesuitenkommunität
__Joseph und seine Brüder
__Karneval
__Katzen
__Klagen
__Komplimente
__Kreativität
__Kulturkritik
__Kunst
__Kunst-Station Sankt Peter
__Landpartie
__Lesen
__Laubbläser
__Marias Blicke
__Mostrarsi
__Musen
__Nachtgedanken
__Nebenfiguren
__Nostalgie
__Perfektion
__Playboy
__Playlist
__Polyamorie
__Proust lesen
__Rahner, Karl
__Rituale
__Schönheit
__Schreibzeug
__Selbstliebe
__Sensibilität
__Sexismus
__St. Pauli
__Sterblichkeit
__Susanna
__Tattoos
__Toleranz
__Trinkgeld
__TV-Serien
__Übergröße
__Universale Werte
__Wetter
__Zen
Danksagung
für Nina N. Brunetto
Vernommen hast du sie, verstanden die Sprache der Fremdlinge,
Gedeutet ihre Seele! Dem Sehnenden war
Der Wink genug, und Winke sind
Von alters her die Sprache der Götter.
Friedrich Hölderlin
In den Gebieten, mit denen wir es zu tun haben, gibt es Erkenntnis nur blitzhaft. Der Text ist der langanhaltende Donner.
Walter Benjamin
69 Miniaturen, eine Einleitung
Seit der Antike beschäftigt uns die ars vivendi – »die Kunst zu leben«. Was macht sie aus, die Lebenskunst? Dazu will dieses Buch einige Anregungen geben: von A bis Z, in 69 Miniaturen; mal leicht oder schwer, sachlicher oder poetischer, ästhetischer oder kulturkritischer – je nach Stichwort. Allen Texten gemeinsam ist: Sie sollen dem Alltag mehr Tiefe geben. Dieses Buch soll Sie dazu motivieren, in sich selbst zu lesen. Daher präsentiere ich Erinnerungen, Erfahrungen und Sichtweisen, in denen Sie sich wiederfinden oder gegen die Sie sich abgrenzen können. »Alles, was der Mühe wert ist, ist in gewisser Hinsicht subjektiv«, meinte der Schriftsteller Vladimir Nabokov.
Das Leben ist weder isoliert zu betrachten noch definierbar, es verläuft nicht in chronologischer Ordnung und es ist auf keine Formel reduzierbar. Dieses Buch liefert keine Definitionen oder abschließenden Urteile, es geht nicht um »Zahlen und Figuren«, wie der Romantiker Novalis es in einem berühmten Gedicht formulierte. Denn da, wo die Komplexität zu groß wird, helfen nur noch Intuition und Erzählung. Da, wo das Materielle nicht alles ist, hilft der Glaube. Im alten Sinne der Bildung ist dieses Buch befreit vom Fluch der Nützlichkeit. »Das Leben aber ist eine Geschichte, man muss sie gut erzählen können, um gelebt zu haben«, schrieb der große Lyriker Elazar Benyoëtz. Eine Erzählung definiert auch etwas, nur eben nicht zu eng. Für mich steht die Lebenskunst der Kunst nahe – es gibt kein gutes Leben ohne die Schönheit. Die Ästhetik der Existenz ist mit dem Guten sicher verwandt, aber sie widmet sich der Schönheit, keineswegs nur der Moral.
Meine Themen in die alphabetische Reihenfolge zu bringen, ist ein Hinweis auf einen meiner Lieblingsaußenseiter, auf Hans Jürgen von der Wense, für mich der Lebenskünstler schlechthin. Ein Mann, der es geschafft hat, niemals eine feste Anstellung zu haben und doch durchs Leben zu kommen. Er konnte komponieren, übersetzen, schreiben, wandern – was will man mehr? Sein herausragendes Briefwerk gliederten die Herausgeber »Von Aas bis Zylinder«; und ich begleite Sie in meinem Buch analog von den »Alten Zeiten« bis »Zen«.
Damit die Stichworte über sich hinaus weisen, finden sich am Ende jeweils Buchtipps. Mit dieser Idee schreibe ich meinen Literaturverführer über Die Kunst zu lesen und die Vertiefung über Die Kunst zu glauben fort. Die Stichworte und die jeweils empfohlene Literatur stehen in einem indirekten Verhältnis, nachvollziehbarer werden sie aber in der Tiefe der Lektüre. Damit will ich einen Anspielungsreichtum erzeugen, weil auch das Leben unerschöpflich vielfältig bleibt.
Das Glück versteckt sich in der Möglichkeit, sich sporadisch aus allem herauszunehmen, um irgendwo abgeschieden zu sitzen und zu lesen. Dafür ist dieses Buch geschrieben; motiviert hat mich ein Gedanke, den Goethe in den Wahlverwandtschaften formuliert: »Ach! und da das Mögliche unmöglich ist, bilde ich mir ein, das Unmögliche müsse möglich werden. Nachts, wenn ich aufwache, die Lampe einen unsichern Schein durch das Schlafzimmer wirft, da sollte …«
Die Kunst zu lesen: Walter Benjamin: Denkbilder Suhrkamp, Berlin, 1994Frank Berzbach: Die Kunst zu glauben bene!, Solms/München, 2023
__Alte Zeiten
Im Sommer 1954 schrieb der französische Schriftsteller Julien Green in sein Tagebuch:
Und wenn ich hundertmal schriebe, dass ich das Leben dieses Jahrhunderts nicht liebe, würde es mir nichts nutzen, aber was will ich?
Der Autor weiß um die Irrationalität des Gefühls, es hat mehr mit der Gegenwart zu tun als mit den alten Zeiten. Wer fliehen möchte, der hat Gründe vor Ort; wohin er will, ist gar nicht so wichtig. Jede Zeit kennt, vor allem unter den Kunstschaffenden, eine Sehnsucht nach dem grundsätzlich anderen, nach dem Verschwinden in der ureigenen Vorstellung anderer Zeiten. Das ist naheliegend, da der Bildungsprozess von den Meisterwerken der Vergangenheit dominiert wird. Wovon lernen, wenn nicht von längst ausgewiesenen Höchstleistungen? Das Meisterwerk wird erst durch die verstreichende Zeit imprägniert, erst die verstreichende Zeit lässt es zeitlos schimmern. Die Vorbilder liegen auf dem Trümmerhaufen der Vergangenheit, glitzern uns entgegen, geben Auskunft über vieles, was in der Entstehungszeit übersehen wurde – Mozart starb verarmt, van Gogh unentdeckt, kaum einer hörte sich Vorlesungen von Schopenhauer an. Bildung ist Kenntnis und eigensinnige Aneignung der Vergangenheit; neue Werke sind das Ergebnis produktiver Distanz. Thomas von Aquin oder der Philosoph und Jurist Michel de Montaigne widmeten sich der griechischen Antike. Vertieft man sich in Friedrich Nietzsches Schriften, dann ahnt man: Dieser Mann las nicht nur, sondern er war von griechischen Göttern umgeben; bei Michel Foucault glaubt man, er war mit ihnen im Bett.
Julien Green fragte: Was will ich? Was will man von den alten Zeiten, außer weg aus der Gegenwart? Zuerst einmal will man gar nicht die alten Zeiten, sondern meist nur eine umgrenzte alte Zeit. Für heutige Rockabilly-Fans ist es die Zeit von Elvis und Sam Cooke, für Rechtsradikale ist es die Hitler-Zeit und welcher Christ wäre nicht gern bei den Wüstenvätern oder Ordensbruder des Heiligen Franziskus? Der Dürstende glaubt, an den Quellen das reinste Wasser zu finden; wir sehen die Zeitzeugen als Lupe, die den weit entfernten Ursprung vergrößert, ihn uns näher bringt.
Die Vergangenheit ist zwar unübersichtlich, aber unser Denken verleiht ihm gern Struktur. So kennen die Deutschen, das meinte der Publizist und Literaturkritiker Karl Heinz Bohrer, vor allem die Naherinnerung: Die Geschichte beginnt für viele 1933, für Informiertere 1918, aber davor? Einem Italiener, der Dante oder Boccaccio liest, würde das nicht passieren. Auch wurde China nicht von Mao und Russland nicht von Lenin gegründet. Unser Epochendenken ist recht einfach. Das erkennt, wer sich in die Historie vertieft – nichts als Widersprüche. Auch vor den Aufklärern gab es Vernunft und Aufklärung, auch vor den Romantikern Naturgefühle und göttliche Natur. Wer die alte Zeit nicht als säuberliche Epochenfolge nimmt, wird hingegen bestraft; er gefährdet die wohlvertraute Ordnung. Das sieht man an einem deutschen Nationaldichter für Fortgeschrittene, an Heinrich Heine. Dem hat man wohl nie verziehen, dass er Aufklärer und Romantiker war, Jude und Christ, Deutscher und Europäer, wilder Kerl und Traditionalist. Er erkannte Grenzen nicht an.
Wie wir überhaupt über die Geschichte im christlichen Abendland denken, welche Bilder wir davon haben, darüber denkt der Schriftsteller, Lyriker, Theologe, beinah möchte ich schreiben, evangelische Mystiker nach: Christian Lehnert. In seinen vielschichtigen, poetischen, erkenntnissuchenden Fliegenden Blättern zur Apokalypse des Johannes, so der Untertitel seines Buches Das Haus und das Lamm, schreibt er, nichts präge das »europäische Verständnis von Geschichte, vom Wesen der Zeit und den Erscheinungsweisen Gottes in ihr« stärker. Das Wort Apokalypse ist damit ebenso wichtig für unser Thema der alten Zeit wie die viel besungene Nostalgie. Lehnert übersetzt Apokalipsis mit »Bloßlegung«, es geht um Krisenhaftes, um das Enthüllen. Wir finden in anderen Zeiten etwas, das sich heute verbirgt und das die Kunst produktiv macht. Auch früher schon war etwas, lief etwas ab, endet in Glück oder Unheil. Dass wir diese alte Zeit als rückwärtsgewandte Utopien entwerfen, ist kein Phänomen des Vergangenen, sondern nur Charakteristikum unseres Gehirns. Das folgt stets seinem Lieblingsspiel zwanghaft-spontaner Bewertung: Früher war es deshalb oft besser oder schlechter. Gute Historiker provozieren allein deshalb, weil sie sich dieser alltagspsychologischen Sicht nicht anschließen.
Deshalb konnte Albert Camus behaupten, er sei nicht modern – eine ziemlich moderne Sichtweise. Alte Zeiten in ihrer Vielfalt gibt es erst heute, früher gab es nur eine alte Zeit, wie es nur ein Weltbild und nicht die Weltbilder gab. Wie sehr die Liebe zu vergangenen Zeiten die Gegenwart überschreibt und neu fasst, das sieht man nicht nur in der Renaissance, sondern bis in die Popkultur hinein.
Wenn die Sängerin Beyoncé Knowles als erste schwarze Frau die Country-Charts anführt, gleich ein ganzes Country-Album vorlegt, dann korrigiert sich der Inbegriff von »weißer Musik«, die anfangs gar kein Reinheitsgebot kannte. Es war immer social music, eine Bezeichnung, die Miles Davis der des Jazz vorzog. Die Idee vom Ursprung geht oft in die Irre:
Die Quelle ist nicht rein, sie ist nur ein gesetzter Anfang. Dem vereinfachenden Ursprungsdenken müssen wir widerstehen. Das Wasser, das aus der Quelle sprudelt, war schon anderswo. Die eindeutige Vergangenheit ist jedoch noch geduldiger als Papier, das macht sie zur Projektionsfläche. Selbst wenn es Zeitzeugen gab, ist ihnen zu trauen? Erzählen die Evangelien die gleiche Geschichte nicht gleich vier Mal, damit keiner auf die Idee kommt, diese alte Zeit vollends zu kennen? Die vier Variationen suggerieren: Füge deine fünfte hinzu und übersieh die Konstanten nicht!
Alte Zeiten sind sortierte Zeiten in unsortierter Gegenwart, nur was sich durchsetzte, nur was blieb, blieb – diese gefilterten Varianten haben ihren jeweils eigenen Stil. Daher waren jederzeit die Menschen besser gekleidet als heute und die bildende Kunst oft handwerklich anspruchsvoller. Die alten Zeiten sind vor allem Stillehren. Und, erneut Miles Davis: Es geht immer nur um Stil. Was Julien Green sucht, wohin er will, ist ihm als Christ klar vor Augen: eine Welt, in der nicht nur geglaubt wurde, sondern man im Glauben aufgehoben war. Eine Welt, in der ein Dichter wie Shakespeare in einer einzigen Szene, in der jemand ein Taschentuch fallen lässt, die ganze weltliterarische Kraft in ein paar Zeilen packen konnte. Wer wollte nicht dorthin? Früher noch wünschte sich mancher 500 Jahre zurück, heute geht’s schneller. Vielleicht werden wir uns heute Abend schon an diesen Morgen erinnern, als sei es gestern gewesen.
Die Kunst zu lesen:Julien Green: Tagebücher. 1926–1998List, München/Leipzig, 1999Karl Heinz Bohrer: Ekstasen der Zeit. Augenblick, Gegenwart, Erinnerung Hanser, München, 2003
__Arbeit
Die Welt der Arbeit ist ganz verändert, aber nur in einem ausgewählten Bereich der Büroarbeit. Insgesamt grassiert die reine Schufterei und die wird in einem zwar für jeden sichtbaren, aber notorisch wenig thematisierten Segment des hard work mehrheitlich von Zugewanderten absolviert – unsere Gesellschaft kennt auch die Sklavenarbeit ohne Mindestlohn, mit nur wenigen Grundrechten. Sie liegt meist im Schatten. Diesen Menschen hilft keine KI und keine fesche Darstellung in sozialen Medien. Nach ihnen wird keine Kosmetiklinie benannt und von ihnen gehen keine Trends aus. Sie putzen schicke Büros, pflegen die Alten, liefern den Hipstern ihr Essen, sie leben auf Baustellen in Containern oder müssen sich prostituieren. Viel schillernder aber ist die kleine Welt des new work, so benennt man die Flexibilisierung von Arbeitsorten, Arbeitszeiten und Aufgaben, zum Teil auch von Verantwortung. Für new work gibt es inzwischen ebenso viele »Berater« wie in ihr Tätige. Es gefällt Entscheidern, die ein komfortables Büro mit Vorzimmer, einen festen Parkplatz in der Tiefgarage, Assistenten oder Assistentinnen haben, wenn andere das alles nicht haben. Die, die viel Geld verdienen, arbeiten erstaunlich traditionell. Die anderen kämpfen um eine Arbeitsecke im postmodern gestalteten Areal neben dem Kicker oder Bälleparadies oder sie arbeiten gleich Vollzeit zu Hause. Wenn im Deutschen Anglizismen erfunden werden, die es im Englischen gar nicht gibt, sollte man aufmerksam werden. Homeoffice ist einer dieser Begriffe. Da muss der Arbeitgeber weder für Ergonomie oder mitfinanziertes Essen sorgen noch für Büromaterial oder für schnelles WLAN; die Unternehmenskosten werden einfach »externalisiert«. In der ursprünglichen Variante war eine Kombination von Arbeiten zu Hause und Büroleben beabsichtigt, die viele Vorteile mit sich bringt. Daraus geworden ist allerdings oft etwas anderes – es gibt vielerorts gar keine Bürotage mehr. Je oberflächlicher die digitalen Einsiedler sind, desto euphorischer beschreiben sie diese Kostensparmaßnahmen des Arbeitgebers als »Freiheit«. Und obwohl natürlich die Freiheitsgrade zunehmen, müssen wir die sich damit ausbreitenden seelischen Schäden in den Blick nehmen: Einsamkeit und Familienzwist im Homeoffice, Kinder als Störfaktor, das Raumaufteilungsproblem, manchmal auch verlotterte Kleidung – und für berufliche Neueinsteiger oftmals die damit einhergehende mangelnde Erfahrung im sozialen Umgang mit anderen. Stillschweigend rächen sich die so Arbeitenden. Immer mehr Themen des Privatlebens schieben sich zwischen und gegen die Arbeitsaufgaben. Immer öfter werden Defizite der Arbeit mit Privatem begründet. So wie Studierende gern die verspätete Abgabe von Prüfungsleistungen mit ausufernden Schilderungen privater Probleme begründen, so auch immer mehr im späteren Job … Das Kind ist krank, der Hund muss zum Tierarzt, man war noch spazieren, musste in der Pause an der Kasse länger warten, meldet sich montags und freitags krank (Kopf- und Gliederschmerzen) … Insgesamt gruppierte man früher das Privatleben um die Arbeit, heute ist es umgekehrt. Eine ins Häusliche verschobene Arbeit wird zum Randaspekt neben Privatangelegenheiten. Das sollte niemanden wundern, der den Luxus eines eigenen Büros hat, er lebt nämlich in einer gänzlich anderen Welt. Warum für den Arbeitgeber mehr tun, wenn der für einen immer weniger tut? Es ist also weniger eine Frage der verfallenden Arbeitsmoral, es ist die Antwort auf die vermeintlichen Freiheiten, die new work nur bei wirklich durchdachten und guten Rahmenbedingungen bietet. Allerdings existieren die meist nur auf dem Papier. Der Fluch fehlender Büros, fehlender Arbeitswege, fehlender realer Interaktion im Team, fehlender Pausenroutine oder die hohe Lärmbelastung in zu kleinen Großraumbüros führen eben nicht nur zu den Segnungen neuer Freiheit. Oder warum sind immer mehr Arbeitnehmer psychisch überbelastet, warum kündigen immer mehr den »inneren Arbeitsvertrag« und behalten den äußeren bei? Aus Sicht der schönen neuen Arbeitswelt können das die Arbeitnehmer in privaten Therapien bearbeiten, aus den Veränderungen der Arbeitswelt wird ein Persönlichkeitsdefizit gemacht.
Der neue Kapitalismus erzeugt auch: Ignoranz, fehlendes Selbstwirksamkeitsgefühl, zunehmende Vereinsamung in digitaler Einsiedelei, familiäre Konflikte, zwielichtige »Trainings« und »Coachings«, die meist alles noch schlimmer machen. Unterstellt wird dabei allerdings, dass man zu Hause die Möglichkeit des Rückzugs hat, und übersehen wird, dass der Weg zur Arbeit vielfältige positive psychologische Folgen hat. Er dient als Schleuse zwischen Arbeitszeit und Muße. Stadtwohnungen sind bei den heutigen Verdienstmöglichkeiten und zugleich hohen Mietkosten in der Regel viel zu klein; und es soll sogar noch Menschen geben, die Kinder, Partner und Haustiere haben – oft ein beruflicher Nachteil.
Einer sinngebenden Arbeit nachzugehen, bleibt ein Königsweg zum Glück, ebenso wie einer ethisch verträglichen – die Buddhisten nennen es den »rechten Broterwerb«. Aber damit lässt sich nur noch selten ein Haus bauen, eine Familie ernähren oder würdevoll leben. Wer also möchte, dass im scharfen Wind dieser Wirtschaft das eigene Kind noch halbwegs gute Chancen hat, der soll paradoxerweise gerade diese Welt durch maximierten Gelderwerb zerstören. In anderen Branchen wird hingegen immer weniger verdient. Wer sich von all dem nicht angesprochen fühlt, der hat das Glück, eine der Arbeitsstellen zu besitzen, die ethisch akzeptabel sind. Es galt für die letzte Generation und für die nächsten wird noch mehr gelten: Auch mit höherem Bildungsabschluss wird man nicht mehr das Geld verdienen dürfen, das früher verdient wurde. Rechnet man Teuerung und Miete, Flexibilisierung und Bildungskosten, Arztgebühren und technische Ausstattung ein, dann verdient heute ein Professor, was früher ein Lehrer verdiente; eine mittlere Führungskraft verdient, was früher ein Facharbeiter bekam, und im unteren Segment ändert auch der Mindestlohn nicht, dass es kaum reicht. Die Amerikanisierung hat nicht nur Zuckerlimonade und Fastfood gebracht, sondern auch die Freiheit, sich vor allem an ökonomische Zwänge anpassen zu müssen. Mancher hat drei Jobs und ist dennoch arm. Meine Freundin hat schon neben dem Vollzeitjob Essen ausliefern müssen und ich hatte schon drei halbe Stellen, um über die Runden zu kommen. Anders ist das nur oben in der Tabelle. Da ist zu lesen: Die Millionäre werden zu Milliardären; sie verdoppeln bei jeder gesellschaftlichen Krise, bei jedem Krieg, bei jeder platzenden Blase ihre Gewinne. Die Despoten leben ungeniert in Palästen mit tausend Zimmern. Ab einer bestimmten Schwelle hat der Verdienst mit der Arbeit nichts mehr zu tun, sondern wohl nur noch mit Unmoral. Es liest sich als poetic justice: Laut Glücksforschung werden die Reichen keinesfalls glücklicher, sie leben nur im Wohlstandsunglück, während andere im Armutsunglück leben. Sie liegen allerdings satt in ihren Luxusbetten und zerstören sich feiernd mithilfe von Designerdrogen. Andere frieren hungrig auf einer miesen Matratze und trinken Billigalkohol. Erst unter der Erde sind sie dann wieder gleich; warum nicht einmal öfter als an Weihnachten an das Schicksal von Ebenezer Scrooge in der Erzählung von Charles Dickens denken? Es hat also Vorteile, nicht zu den Verkommenen zu gehören, egal ob unten oder oben. Sonst zeigt der Blick in den Spiegel die Folgen des Egoismus, das Herz aus Stein oder das von Armut und Arbeit zerstörte Antlitz. Im Bereich der schöpferischen Arbeit gilt bis auf wenige Ausnahmen: Es ist ein erfülltes Leben, aber ein ärmliches. Bildung, Fleiß, ethischer Broterwerb und Kreativität werden geringer entlohnt als jemals zuvor.
Die Kunst zu lesen:Édouard Louis: Wer hat meinen Vater umgebracht Fischer, Frankfurt/Main, 2019Hannah Arendt: Vita activa oder Vom tätigen Leben Piper, München, 2009
__Aufklärung
Der Begriff hat es in sich, gleich zweifach. Zum einen fragen sich Eltern bis heute, ob ein Kind schon »aufgeklärt« sei, also ob es über sexuelle Praktiken als Ursprung des Lebens informiert wurde. Zum anderen idealisieren, ignorieren oder falschverstehen wir die Epoche der Aufklärung, aus der unser modernes Vernunftdenken stammt.
Als ich zehn Jahre alt war, gab es für die sexuelle Aufklärung noch eine legendäre Rubrik in der Jugendzeitschrift BRAVO. Als meine Tochter, damals 13 Jahre alt, neulich auch die BRAVO kaufte, hatte ich eine nostalgische Erinnerung an das Magazin, das Generationen aufgeklärt hat; dass es überhaupt noch existiert, beruhigt mich. Nicht alles wird »TikTok«, dem »Pornhub« oder artverwandten Kulturuntergängen überlassen. Die halbjährlich neu erscheinenden Bilderbücher zum Thema »sexuelle Aufklärung« erzählen davon, dass heute vieles anders ist als früher, als es noch Mädchen und Jungen gab und es auch um Biologie ging. Bis es überhaupt um Biologie gehen durfte, und nicht nur um religiös verzerrte Moral oder die patriarchale Bewertung der Geschlechter, war es ein langer Kampf der Aufklärer. Doch leider arbeiten gerade »Geisteswissenschaftler:innen« heute wieder am Untergang der naturwissenschaftlichen Sicht. Die leichtfüßige Vorstellung einer generellen Konstruiertheit und absoluten Kulturabhängigkeit von allem (die eigene Meinung natürlich ausgenommen) widerspricht zwar oft dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand, aber der war in allen Zeiten meist Anlass zum Streit. Gerade wissenschaftlich denkende Menschen mussten immer wieder ins Exil, hinter Gitter oder auf Scheiterhaufen, weil sie mit ihrer Erkenntnis das kulturell Gewünschte überstrapazierten. Heute dürfen zu manchen Themen Biologinnen gar nicht mehr sprechen. Es heißt, die Biologie soll sich beispielsweise zur »Biologie der Geschlechter« nicht mehr äußern – als sei die Naturwissenschaft nur ein kultureller Irrweg. Auch in Umweltfragen ist nicht immer gern gehört, was Naturwissenschaftler dazu sagen. In den Aufklärungsbüchern für Kinder wird es wahrscheinlich bald nicht nur divers zugehen (ein Gewinn!), sondern es werden sämtliche Spielarten der Sexualität zwischen Blümchensex und BDSM aufgelistet. Manche sehnen sich sogar nach den Sexualpraktiken der griechischen Antike, vergessen dabei allerdings, dass dort Pädophilie kein kriminelles Verhalten war, sondern für den denkenden Mann zum guten Ton gehörte und Teil gewöhnlicher Erziehungspraktiken war. Angesichts der Praktiken, die an den Rändern existieren, in telegenen Swinger- und Fetischclubs, muss sich der langweilig und prüde vorkommen, der einfach nur mit seinem Partner »schlafen« möchte. Also wer mit nur einem Partner Sex haben will, und zwar auf die Weise, wie es die vier bis sechs gewöhnlichen Stellungen sexueller Akrobatik seit Jahrtausenden bieten, wirkt antiquiert. Wie sollte man das jemandem in Berlin erklären? Halbseidene Bestseller fabulieren vom Ende der Monogamie – als hätte es die jemals dominant gegeben, das Bürgerliche kannte immer die Normalität verheimlichter Affären. Vielleicht muss der monogame Mensch sogar aufgeklärt werden? Mit den meist kenntnislosen Hinweisen auf Sigmund Freud? Der selbst unterschied in einer heute nicht mehr haltbaren Weise Männer und Frauen und innerhalb seiner eigenen Familie war jede Form sexueller Befreiung völlig tabu. Warum als Mensch überhaupt noch mit einem anderen Menschen einfach nackt – ohne fünf andere, ohne Lack und Leder, ohne Fesseln oder App-gesteuerte Toys, ohne »Rave« – erregt, befriedigt und zufrieden auf einem Bett liegen? Warum noch nach dem Höhepunkt, ohne vorher ausgepeitscht worden zu sein, einfach nur nackt und erfüllt, vielleicht sogar altmodisch mit einer Zigarette auf dem Bett liegen, Miles Davis hören und innige Gespräche führen?
In Bezug auf leidenschaftlichen, aber zeitgeistig recht unflankierten Sex: Manchen erscheint die alte Praxis als perverse, als antiquierte Gewalttat im »heteronormativen Sektor«. Aber muss gleich hämmernder Techno den Sexualakt begleiten, um sich gegenwärtig zu fühlen? Viele Menschen lieben die althergebrachten Sexpraktiken, aber die Minderheiten äußern sich, vor allem an Universitäten, gern so, als sei die Welt außerhalb des Hörsaals nur eine abweichende, bornierte Absonderlichkeit. Manchmal ist das real existierende Leben hingegen nur etwas eingängiger historisch informiert. Diese Universitätswelt hat leider nur wenig demokratischen Geist hervorgebracht; die NS-Zeit hat das mehr als bewiesen, der gegenwärtige Antisemitismus folgt ihm nach.
Jede Subkultur ist vom abgelehnten Mainstream abhängig, nur eben »ex negativo«. Niemand trug ernsthaft Hippie- oder Punkkleidung, weil sie schön war, sondern vor allem, weil sie antibürgerlich daherkam. Dass der düsterste Black- und Deathmetal aus dem puritanischen Skandinavien kommt, wundert nicht. Was wäre er ohne das Christentum? Ich bin sicher, die Zukunft wird einen zeitgeistaffinen, latent abwertenden Namen für die ehemals gewöhnliche Art westlich-moderner Sexualität erfinden. Vielleicht ist diese Art, Sex zu haben, ewig praktiziert und genossen, gar der Ursprung allen Übels? Meine persönlichen Kontakte mit dem Neuberliner Liebesstil fand ich zwar nicht überzeugend, aber er ist eben ziemlich »instagramable«. Er ermöglicht jede Untat mit dem Hinweis auf ein »vielleicht«, er bringt sogar einen spezifischen Typus des »Vielleicht-Menschen« hervor, der alles tun will, außer sich festzulegen, Verantwortung zu tragen oder sich zu binden. Was man früher einfach »Single« nannte, »Playboy«, »Hedonist« oder »Toyboy«, will keine Gegenkultur mehr sein, sondern gibt sich als »aufgeklärt« – im Gegensatz zum Rückständigen. Doch bei näherem Blick sticht ins Auge, dass all das vor allem, ganz die alte Geschichte, (weißen) Männern entgegenkommt. Die leiden meist weder an Blasenentzündungen noch an einer Vielzahl von Geschlechtserkrankungen und nie an Schwangerschaften. In der Reihe der offenen Beziehungen, die mir bekannt sind, waren die Regeln der Männer stets ganz andere als die der Frauen – vereinfacht: Die eingeforderten Freiheiten gelten für den Mann, aber nicht analog für die Frau. Nachtigall, ick hör dir trapsen. Das alles bedeutet nicht, dass ich naiv der alten dogmatischen Monogamie traue oder Abenteuer verwerflich finde. Vielleicht sogar im Gegenteil: Gäbe es mehr ausgelebte, einvernehmliche Lust, gäbe es weniger Gründe zur Aggression. Aber was ich an Zeitgeist sehe, das erscheint mir noch nicht als Befreiung, sondern als plakative Ideologie.
Der natur- und geisteswissenschaftlich kundige Philosoph Paul Feyerabend sagte in einem Gespräch mit Rüdiger Safranski kurz vor seinem Tod: Die Aufklärung würde zwar jeder Idiot loben, aber bei genauerer Sicht wolle sie niemand. Geisteswissenschaftliche Konstruktivistinnen sprechen daher nur ungern mit Biologinnen. Der irritierte Interviewer fragt nach und Feyerabend: Wollen Sie darüber aufgeklärt werden, dass Ihr Partner untreu ist? Das will doch niemand wissen! Er spricht damit etwas Sensibles an. Menschen möchten nicht die Wahrheit hören, und wenn überhaupt, dann nur gering dosiert. Zudem wollen sie über die Folgen ihrer Handlungen lieber nicht Bescheid wissen. Viele Menschen essen immer noch Fleisch, aber was das mit ihrer Gesundheit und der Umwelt macht, vor allem wie bestialisch der industrielle Umgang mit Tieren ist, darüber wollen sie keine Aufklärung. Lieber streichelt man innig seinen Hund und hält sich für tierlieb. Natürlich will kaum einer selbst schlachten, obwohl das Aufklärung bringen würde. Die meisten wären wohl schlagartig Vegetarier oder – häufiger – gegen die Aufklärung. Paul Feyerabend ist einer der Philosophen, die zu Unrecht beinah vergessen sind, oder er wird auf das Schlagwort des anything goes reduziert. Das wird gern herangezogen, um allerhand zu rechtfertigen, aber ich schätze, der Philosoph dreht sich im Grab um, wenn er wüsste, wofür es herhalten muss. Natürlich geht nicht alles, Feyerabends Schlagwort bezog sich auf einengenden Methodenzwang in der Wissenschaft. Eine weithin ebenfalls irrige Sicht auf die Aufklärung betrifft deren Verhältnis zum Christentum. Die Aufklärer werden in kenntnisloser Lesart als Atheisten gedacht und ihr Denken als Anschlag auf die Religion. Aber das stimmt nur für eine kleine Minderheit, keineswegs für die Epoche und nicht für ihre einflussreichsten Akteure.
Selbst die, die gern mit Darwin argumentieren, haben sein Hauptwerk nicht zu Ende gelesen; nach fast 700 Seiten findet sich sein alles andere als atheistisches Finale:
Es ist wahrlich etwas Erhabenes um die Auffassung, dass der Schöpfer den Keim allen Lebens, das uns umgibt, nur wenigen oder gar nur einer einzigen Form eingehaucht hat und dass, während sich unsere Erde nach den Gesetzen der Schwerkraft im Kreise bewegt, aus einem so schlichten Anfang eine unendliche Zahl der schönsten und wunderbarsten Formen entstand und noch weiter entsteht.
In vielen Bereichen, die aufgeklärtes Denken betreffen, fiel mir auf: Diejenigen, die eher radikal argumentieren, haben nicht gelesen, worauf sie sich beziehen. Die reformpädagogischen Fans des »Emil«, des Erziehungsromans von Jean-Jacques Rousseau, überlesen die im hinteren Teil des Buches erwähnte Sophie – für diese sollen viele der fortschrittlichen Einsichten, die neuen aufklärerischen Ideale gar nicht gelten. Für Emil hingegen schon. Auch Das andere Geschlecht wird nicht zu Ende gelesen: Die Autorin schreibt am Ende ihres Werkes, der Sozialismus würde alle Geschlechterunterschiede auflösen.
Ich diskutierte schon mit selbsternannten Kommunisten, die nie eine Zeile von Karl Marx oder Rosa Luxemburg gesehen hatten; mit Feministinnen, die Ein Zimmer für sich allein nicht gelesen hatten. Oder es diskutieren Evangelikale, die die Bibel nicht wirklich kennen, mit »Naturwissenschaftlern«, die physikalisch ungebildet sind und ihre populären Sachbuchpropheten als Quasi-Heilige betrachten. Und da gibt es einen aufklärerischen Zusammenhang: Nur wer sich auskennt in den Sphären des Wissens und des Glaubens, gelangt zur nötigen Erkenntnis und zur gebotenen Zurückhaltung.
Immanuel Kant oder Ephraim Lessing, John Locke und Max Planck, Isaac Newton, Albert Einstein bis Carl Friedrich von Weizsäcker – sie waren keine Atheisten. Aber nicht einmal Karl Marx hatte Josef Stalin oder Mao im Sinn und Darwin nicht die Abschaffung der Kirche. Fundamentalisten verstoßen gegen die Werte des Glaubens, für den sie zu kämpfen meinen. Sie können das nur, weil sie nicht in die jeweils Heiligen Schriften schauen. Gegen die Vernunft verstoßen sie ebenfalls, aber sie verdoppeln ihre Anstrengung, während sie ihre Ziele vergessen.
Das Märchen vom Atheismus der Aufklärer ist eine im Nachhinein erfundene Idee, den Herren (leider fast durchgängig Herren) war eine ganz andere Frage wichtig: Wie können Religionen friedlich koexistieren? Und keinesfalls: Wie kann man sie abschaffen? Die für alle befreiende Trennung von Kirche und Staat ist eine aufklärerische Gewaltenteilung, um beide zu retten.
Wie kann man der Kirche die politische Macht nehmen, die sie meist korrumpierte? Das Weltliche kann eben nicht nur die Politik pervertieren, sondern natürlich auch die Kirchen. Das lässt sich an der katholischen Kirche unter Franco bestaunen oder an der orthodoxen Kirche unter Putin: Die aufklärerischen und die christlichen Werte werden mit Füßen getreten. Es war auch nicht die Idee der Aufklärer, die Wissenschaft als etwas zu etablieren, das gänzlich unchristlich sei oder an dessen Stelle rückt. Die Wissenschaft als Ersatzglaubenssystem, wie es sporadisch in halbseidenen Rückbezügen auf Marx und Engels oder auf die »Rassenlehre« der Biologie formuliert wird, hat zum KZ und zum Gulag geführt, nie in die Freiheit. Und sie beruht, zumindest bei Marx, eher auf einer instrumentellen Fehldeutung. Bei Darwin hieß es nie, dass die Stärksten überleben – sondern es galt »survival of the fittest«; also die anpassungsfähige Ratte, nicht das größte Tier, beispielsweise ein Dinosaurier.
Beinah niemand der unabhängigen Geister, die den Mut hatten, sich ihres Verstandes zu bedienen, war Atheist. Sie waren unangepasste Christen, die sich aus autoritären Strukturen einer kirchenhierarchisch verzerrten Wahrheit lösten. Damit sind die Aufklärer eher mit den christlichen Ordensleuten, meist Kirchenkritiker, vergleichbar. Für die Wahrheit braucht man etwas mehr als nur den Kirchgang, das wusste nicht nur Kant, sondern schon Teresa von Ávila; von den zahllosen forschenden Mönchen und Nonnen stammen vielfältige Beiträge zur Wissenschaft. Die Aufklärer hatten die Einsicht, dass die Vernunft der Religion als nötiges Korrektiv zur Seite stehen müsse – und umgekehrt – und das befreit dann die Wissenschaft von Dogmen und die Religion von Fundamentalismen. Für die Theologie müssen wir daher tief dankbar sein! Ohne sie überlassen wir den Job den Fundamentalisten. Dass vernünftiges Denken außerhalb ihrer Kompetenz liegt, zeigt meist das persönliche Gespräch. Der aufgeklärte Geist hingegen fügt der Naturwissenschaft das Naturgefühl hinzu, natürlich sind Flora und Fauna etwas Beseeltes. Der aufgeklärte Mensch hat einen reflektierten, vernünftigen Glauben, er weiß Glauben und Wissen überhaupt zu unterscheiden (nicht: gegeneinander auszuspielen). Novalis, einer der großen Romantiker, war eben kein bloßer Schöngeist, sondern hatte Montanwissenschaften an der Bergakademie in Freiberg studiert – einer renommierten naturwissenschaftlichen Institution. Und der Bergwerksspezialist schrieb:
Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren
Sind Schlüssel aller Kreaturen
Wenn die, so singen oder küssen,
Mehr als die Tiefgelehrten wissen,
Wenn sich die Welt ins freye Leben
Und in die Welt wird zurück begeben,
Wenn dann sich wieder Licht und Schatten
Zu ächter Klarheit werden gatten,
Und man in Mährchen und Gedichten
Erkennt die ewgen Weltgeschichten,
Dann fliegt vor Einem geheimen Wort
Das ganze verkehrte Wesen fort.
Auch der Verfasser des Homo faber war Architekt mit ingenieurshafter Ausbildung: Um etwas zu kritisieren oder zu ergänzen, braucht man tiefe Kenntnis.
Die Aufklärung klarer zu sehen, kann sporadisch zu unzeitgemäßen Urteilen führen, der Zeitgeist ist nicht alles, so wie auch die Tradition nicht alles ist. Weder in der Vernunft noch in der Tradition finden sich Argumente dafür, dass Frauen von kirchlichen Ämtern ferngehalten werden. Dass es dennoch nicht weitergeht in Rom, muss also andere Gründe haben, jedenfalls weder »vernünftige« noch »christliche«. Vielleicht war einer der berühmten Mystiker und Jesuiten des 20. Jahrhunderts, Michel de Certeau, daher auch bedeutender Soziologe.
Die Vernunft ist eine kommunikative Angelegenheit, aber achten Sie darauf, mit wem Sie sprechen. Vielleicht sind Gelassenheit und eine gewisse Distanz zur schnellen Moralisierung, zu Ersatzglaubenssystemen und zu naiver Hingabe an alles Digitale gegenwärtig Kennzeichen aufgeklärter Geister. Aus individualistischer Moralphilosophie darf Kulturkritik werden. Der gläubige Aufklärer ist ein Ideal – er weiß, dass es mehr gibt, als das Auge sieht, er weiß, dass Erfahrung nicht in Zahlen passt, und er weiß, dass Menschen, die glauben, sie seien Götter und im Besitz der Wahrheit, ziemlich gefährlich werden können. Das trifft für messiashafte Ersatzreligion (Heidegger) ebenso zu wie messiashafte Naturwissenschaftler (Dawkins). Die blassen Propheten reklamieren für sich einen wie auch immer begründeten privilegierten Zugang zur Wahrheit. Menschen zu belehren, ist eins der Werke der Barmherzigkeit – aufgeklärte Gläubige finden dafür vielleicht die geeigneten, nicht allzu übergriffigen Mittel. Aufklärer können abklären, vieles ist überzogen, hysterisch und laut, sogar die Spielarten des Atheismus. Manchmal gilt: Es geht auch sachlicher, das Leben ist unspektakulärer, es wirkt beruhigend, wenn die dramatische Musik fehlt. Früher war nichts besser, aber keinesfalls alles falsch. Dieses Paradox muss man wohl aushalten; Bildung hilft, um die einzelnen Widersprüche zu sortieren. Die Aufklärung hat die Lautstärke etwas herunterreguliert, das war ziemlich gut fürs Gehör. Und natürlich gilt immer: Wer Ohren hat, der höre! Ohne Verzweiflung keine Aufklärung, ohne Verzweiflung keine Hoffnung. Die Aufklärung ist weder vollendet noch überwunden, sie bleibt – wie die wundervolle französische Philosophin Corine Pelluchon schreibt – ein Zeitalter des Lebendigen.
Die Kunst zu lesen:Paul Feyerabend: Historische Wurzeln moderner Probleme Suhrkamp, Frankfurt/Main, 2023Corine Pelluchon: Das Zeitalter des Lebendigen: Eine neue Philosophie der Aufklärung WBG,Göttingen, 2021
__Achtsamkeitsübung
Askesemethoden, Selbstoptimierungstechniken, allerlei psychologische Übungen sind en vogue, zumindest, wenn sie nicht mit größeren Anstrengungen verbunden sind. Auf dem Markt ersatzreligiöser Praktiken stehen Achtsamkeitsübungen hoch im Kurs. Sie klingen schon wegen des Wörtchens »achtsam« beruhigend, sie verlangen keine konkrete Disziplin, sie sind daher der Inbegriff der Harmlosigkeit. Manche Übungen finden sich schon auf den bedruckten Etiketten von Kräuterteebeuteln. Wir begegnen ihnen auf unterschiedlichem Niveau. Entweder zur Einstimmung auf anderes, egal ob Tai-Chi, Yoga, Esoterik, Coaching und so weiter; oder im seriösen Anti-Stresstraining im Rahmen eines MBSR-Kurses. Seltener begegnet man ihnen im ernsthaft-religiösen Zusammenhang, aus dem der Begriff Achtsamkeit stammt, nämlich als Teil des Edlen Achtfachen Pfads im Buddhismus. In meinen vielen Jahren in Zen-Dojos, egal ob Soto-Zen oder christlicher Via Integralis, begegneten mir solche Übungen nie. Meine Zen-Lehrer nahmen den Begriff gar nicht in den Mund, das lässt aufhorchen. Wer Seriöses darüber lesen will, konsultiere die Bücher von Thích Nhất Hạnh. Ohne eigene Praxis kann man sich allerdings jedes Buch über buddhistische Themen sparen. Der Buddhismus ist keine Philosophie, er ist vor allem Selbsterforschung, Selbstauflösung und beinharte Praxis.
Sie haben alles falsch gemacht, wenn Sie Achtsamkeitsübungen in einer Arena voll mit Ersatzreligionssuchern absolvieren, auf einem der großspurigen Coaching-Events. Vorn ein Ex-Sportprofi, Ex-Unternehmer, NLP-Flirttrainer, »Lifecoach«, Ex-Gefängnisinsasse, Doktor der »Chiropraktik«, selbsternannter Neurowissenschaftler, Giftpilz- oder Drogenbaron, allesamt windige »Speaker« mit Headset. Wenn jemand von diesen Leuten sagt, Sie sollen die Augen schließen, Ihre Komfortzone verlassen, atmen, Trenddrogen nehmen oder Ähnliches, verlassen Sie schnell den Raum. Es läuft darauf hinaus, dass diese Menschen Ihr Geld wollen und Sie ins seelische Unheil von Ideologien stürzen. Wer verspricht, Sie seien nächste Woche erleuchtet und Millionär, der will Ihren seelischen und finanziellen Bankrott (und lebt selbst verdammt gut davon). Nichts liefert den seriösen, krankenkassenlegitimierten Therapeuten und Therapeutinnen mehr Patienten als die unseriösen Seelenklempner.
Natürlich gibt es dennoch Achtsamkeitsübungen. Die sind alles andere als einfach. Sie machen andere und auch Sie nicht reich, sie sorgen nicht für Karrieresprünge. Sie heilen auch nicht alle Krankheiten. Erstaunlich sind die, die in Ihre Routinen eingreifen: sich nach dem Duschen in anderer Reihenfolge abtrocknen, mit der linken Hand die Zähne putzen (wenn Sie Rechtshänder sind) oder immer, wenn Ihr Telefon klingelt, vor der Annahme des Anrufs drei Atemzüge bewusst ausführen. Das alles irritiert und bremst in gewisser Weise. Am härtesten ist eine der einfachsten Übungen:
Versuchen Sie, im Alltag dauerhaft langsam zu gehen.
Sie werden es nicht durchhalten. Wir hetzen durch den Tag, auch wenn wir keine Termine haben. Wir gehen zu schnell, sind zu hektisch, obwohl wir dadurch keine Zeit sparen. Wer schnell durch eine Stadt geht, fährt, radelt, der ist nur geringfügig schneller am Ziel. Er hat beinah nichts gewonnen, aber viel verloren: Er ist gehetzter, lässt mehr Energie, ist angespannter und erschöpfter. Denken Sie, wenn Sie gehen, ans Gehen, ans langsame, natürliche Tempo. Dass es kaum gelingt, gibt Auskunft: Man ahnt, dass mit uns in mancherlei Hinsicht etwas nicht stimmt; hier haben Sie den seltenen Fall des konkreten Beweises.
In Bezug auf »Achtsamkeit« gilt, dass die Mehrheit nicht im Geringsten ahnt, was damit überhaupt gemeint ist. Viele üben also etwas, das sie nicht verstehen – und es ist auch klar, dass dies zu nichts führen kann. Und dass drei Minuten in einer überfüllten Arena mit geschlossenen Augen eher das Gegenteil erzeugen. Generell sollen solche Übungen auch die Augen öffnen, der Zielzustand heißt »Erwachen«, nicht »Einschlafen«.
Sie haben einen achtsamen Menschen vor sich, wenn Sie sehen, dass er eine Sache in Ruhe ausführt. Nicht albern-esoterisch, unnatürlich langsam, sondern einfach, natürlich und konzentriert. Und erst nachdem er das eine beendet hat, geht er das Nächste an. Während er etwas tut, denkt er daran, was er tut. Und während er etwas konzentriert ausführt, kann er die eigenen Denk- und Gefühlsmuster beobachten. Wer so handelt, ist ein Meister und er ist achtsam. Es erklärt sich von selbst, dass wir solchen Menschen selten begegnen, und auch, dass niemand 24/7 in diesem Modus bleibt. Der Mensch bekommt nicht in die Wiege gelegt, so zu sein, zu denken und zu fühlen. Er kann nur üben, so zu werden. Dazu bedarf er langwieriger, langweiliger, seriöser und religiöser Übung. Überhaupt ist die tiefgründige Hinwendung zu solchen Übungen nur sinnvoll, wenn sie religiös motiviert ist. Sie beten als Atheist auch nicht dreimal pro Tag den Rosenkranz, Sie beugen sich nicht fünfmal am Tag zum Gebet Richtung Mekka oder lesen die Thora auf Hebräisch, nur weil ein »Motivationstrainer« das verlangt. Daher ist es hilfreich, allen trendaffinen Begriffskombinationen zu misstrauen. Achtsame Führung, achtsames Arbeiten, achtsames Kaugummikauen, achtsames Surfen … Ich glaube, Buddha hätte nicht begriffen, was gemeint sein soll. Es war immer schon gut, bedacht, bedächtig zu handeln; zu denken, bevor man spricht, seinen Gefühlen nicht ungefiltert freien Lauf zu lassen und sich konzentrieren zu können. Wer aufmerksam ist, hat Vorteile, in der Ruhe liegt die Kraft – die westliche Tradition ist voll von Einsichten, mit denen man gut durchs Leben kommt. Sie müssen nicht gleich Buddhist werden oder Wunder erwarten, nur weil Sie Ihre Atemzüge zählen. Und wenn Sie buddhistisch sein möchten, dann praktizieren Sie ernsthaft, suchen seriöse Unterweisung in seriösen Zusammenhängen, halten Sie durch, üben Sie täglich. Ein wichtiger, vielleicht der wichtigste Hinweis aus dem Edlen Achtfachen Pfad: die rechte Anstrengung! Es ist Arbeit, es braucht Kraft. Eine Doku im TV, ein alberner Coach oder ein pfiffiger Bestseller über japanische Trendbegriffe machen Sie nicht zum Buddhisten und auch nicht achtsamer.
Die Kunst zu lesen:Tenzin Gyatso, 14. Dalai Lama: Einführung in den Buddhismus: Die Harvard-Vorlesungen Herder, München, 2015Thích Nhất Hạnh: Die Heilkraft buddhistischer Psychologie Goldmann, München, 2013
__Aufräumen
für Renée Patricia
Die gezimmerte Holztür und die Art, wie der Lichtschalter umständlich hinter der rechten Seite des Rahmens angebracht ist, auch der Geruch und das Geräusch der alten selbst gebauten Holztreppe, erinnern mich an das abgelegene Haus meiner Großeltern. Diese Atmosphäre hatte ich nicht erwartet, das Haus meiner Großeltern existiert lange nicht mehr, aber die Erinnerung bringt mich zurück bis in die frühe Kindheit. Meine Freundin lag oben im Bett, sie hatte keine gute Zeit. Die einzige spirituell hilfreiche Idee, die mir kam, war der Wechsel ins tätige Leben: So schlug ich vor, den Keller ihres lange verstorbenen Urgroßvaters aufzuräumen. Ich suchte eine körperliche Beschäftigung, eine Anstrengung jenseits der Bücher.
Die Ordnung eines Raumes, sogar verborgen als Keller, beeinflusst alles. Ganz oben lag die Großmutter, ihre Pflegerin bereitete ihr Frühstück zu, im Erdgeschoss schlief meine alpträumende Freundin und ich stand im Keller mit der fünfzigjährigen Unordnung einer Vergangenheit, die ich zwar nicht kannte, aber nun sah. Nach dem Tod des Großvaters blieb die Werkstatt unberührt, aber man fing damit an, alles in den Raum zu stellen, was »in den Keller« sollte. Nach ein paar Jahren liegt alles über- und durcheinander und niemand ahnte mehr die ursprüngliche Ordnung.
Ich begann, mich umzuschauen, und erkannte, dass hier einiges aus der Sicht der oberen Stockwerke verbannt worden war: die Jugendjahre des Vaters in blauen Adidas-Schuhkartons, Musikkassetten (späte 1970er), allerhand mir unbekannte Werkzeuge, Notizen aus der Berufsausbildung – »Berichtshefte« – Spuren auch des Onkels, den ich nicht kannte, Tand der Oma, Kleidungsstücke, verbogene Stahlnägel und rostige Schrauben, Stricknadeln und Garn, Magazine lange vergangener Zeiten.
Ich schob die Gegenstände auseinander, brachte einiges vorsichtig zum Altglas, sichtete Holzreste, das typische Sammelsurium einer Werkstatt, in der alles wieder Verwendung gefunden hatte. Es gab unzählige Kabel und Stecker, Rollen und Spulen, Zangen und Klemmen, Dübel und Blechdosen. Mir fiel ein Pappschächtelchen entgegen, Pelikan-Patronen in Schwarz, lange eingetrocknet. Noch ohne Barcode in einer vollendeten Produktgestaltung, ein Glück für Liebhaber einfacher Illustration und Typografie. Ich setzte mich auf das freie Stück der Werkbank und betrachtete das Schächtelchen. Ein Alltagsgegenstand aus dem Schulmäppchen vergangener Zeiten, heute eine nostalgische Schönheit, aus einer Zeit, in der man nicht auf jede Verpackung Moralhinweise, fesche Sprüche und Ersatzlebensweisheiten druckte. Tintenpatronen, Schwarz, für Pelikan-Füllhalter. Vielleicht konnte man damals noch selbst denken und auch Kinder wussten, ohne darauf hingewiesen zu werden: Das sind die Dinger, die den Füller am Schreiben halten, man muss sie weder trinken, anbeten noch in die Blutbahn injizieren, sie haben kein Geschlecht. Sie enthalten weder Alkohol noch Koffein, eine »Triggerwarnung« war nicht nötig, ohne Verletzungsgefahr konnten Kindern sie aus dem Pappschächtelchen nehmen, die leere Patrone austauschen und wieder weiterschreiben.
Niemand kam auf die Idee, das jemandem vorzuwerfen, daraus eine ganze Philosophy of Life abzuleiten, die Konfession zu erkennen oder die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Ich schreibe immer noch mit Füllhalter und nutze Pelikan-Tinte, wie Generationen an Autoren vor mir. Ein Foto zeigt die Hand von Thomas Mann mit einem Pelikan-Füller aus den 1930er-Jahren, ein anderes den hundertjährigen Ernst Jünger mit altem Pelikan-Kolbenfüller. Wahrscheinlich schrieb auch Luise Rinser ihre Briefe an Karl Rahner mit einem solchen Füller.
Im Gerümpel fand ich einen christlichen Gedichtband, darin einen Text von Marie Luise Kaschnitz, »Auferstehung«, in meiner Vorstellung mit ebensolcher Tinte geschrieben:
Manchmal stehen wir auf
Stehen wir zur Auferstehung auf
Mitten am Tage
Mit unserem lebendigen Haar
Mit unserer atmenden Haut.
Nur das Gewohnte ist um uns.
Keine Fata Morgana von Palmen
Mit weidenden Löwen
Und sanften Wölfen.
Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken
Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus.
Und dennoch leicht
Und dennoch unverwundbar
Geordnet in geheimnisvolle Ordnung
Vorweggenommen in ein Haus aus Licht.
Über mir schliefen die Frauen, eine junge und eine sehr alte. Ich stand verschmutzt und innerlich mich durchs Aufräumen reinigend mit alten Tinten-Patronen in der Hand und fühlte mich gut. Das eigenartige Licht im Keller beleuchtete die alte schwarze Tinte. Ich widmete mich weiter der »geheimnisvollen Ordnung«, wandte das Gedicht in meiner naiven Kunst zu lesen auf den Keller an, auf mich. Kein Geräusch drang aus dem Haus und dennoch wurde es immer stiller und heller, je mehr der Raum wieder die Form einer alten Werkstatt annahm. Ich ordnete die Schachteln mit Erinnerungen säuberlich im Regal, füllte Müllsäcke mit alter Pappe und krummen Nägeln, Stunden verbrachte ich im dunklen Staub, der sich immer mehr lichtete. Die Schubladen der Werkbank waren Jahrzehnte nicht geöffnet worden. In ihnen die vergangene Ordnung eines Menschen, der ein Vorfahre meiner Freundin war und dem ich meinen Respekt zollte, indem ich seinen Raum wieder ins Leben holte. Hinter einer Nische entdeckte ich Kinderzeichnungen des Vaters, die er für den Großvater gemacht hatte. Ein Schrank war abgeschlossen und später erklärte mir meine Freundin, dass darin die selbst gemachte Marmelade stände – da die demente Oma Diabetes habe, dürfe sie die nicht allein finden. Alles andere war zugänglich und geordnet. In den Schränken bleibt die alte Ordnung meist bestehen, nur das Gesamte versinkt im Chaos. Niemand wollte diesen Raum nutzen, aber nach nur einem Tag strahlte er sauber und nostalgisch, ein wenig wie ein Museum für handwerkliche Arbeit. Wie viel Zeit Renées Vorfahren hier wohl verbrachten? Einsame Stunden, mit einer Flasche Bier nach dem Feierabend, an den Belangen des Hauses herumwerkelnd, Geräte für Freunde aus dem Verein reparierend, den verborgenen Gedanken nachgehend. Schon bei meinem Großvater, den ich beim morgendlichen Kartoffelschälen im Keller beobachtete und beim Gärtnern, immer begleitet von einer Flasche Bier, hatte ich den Eindruck, dass hier die alten Männer zu sich fanden, schweigend und ohne Verpflichtung, sie hatten – generationenbedingt – mehr als genug auf der Seele. Sie mussten mehr denken, da ihre Generation weniger gelernt hatte, Gefühle zu äußern. Das war nicht Sache der Männer, sie blieben damit allein. Keine Tränen, keine Schwäche zeigen, an den vergangenen Krieg denken, aber nicht darüber sprechen. Die erlösende Verschwiegenheit einer Werkstatt im Keller. So wie man heute die Gefühle nicht ernst nimmt, indem man jede Befindlichkeit steigert und anderen zumutet, sie aufbläst und in klischeehafter, esoterisch verbrämter Sprache serviert, so galt damals das Verbot der Gefühlsäußerung. Die Unfähigkeit zu sprechen, ist inzwischen durch notorischen Bekenntniszwang ersetzt. Wer damals litt, zog sich zurück oder überantwortete sein Problem dem Alkohol. Der damaligen Unfähigkeit zu sprechen, steht heute die Unfähigkeit zu schweigen gegenüber. Inzwischen gibt jeder jedem Ratschläge, macht Probleme anderer zu den eigenen, küchenpsychologisiert und ereifert sich in Respektlosigkeit vor der Intimität des seelischen Lebens anderer. Es gibt keine wunden Punkte mehr, es ist sofort ein »Trauma«, man ist nicht übellaunig, sondern »depressiv«, ständig wird Harmloses zu Pathologischem übersteigert. Im Inneren vieler, die im Frieden geboren wurden, herrscht ein subtiler Krieg mit drastischen Scheingefechten.
Das Aufräumen des Kellers hat das Haus, mich und die Menschen darin verändert. Eine romantische Sicht, vielleicht eine religiöse. Jede Form wirkt über ihre Grenze hinaus. Ich sitze in schmutziger, zerrissener Jeans erschöpft auf der nun leeren Werkbank. Ich hätte gern eine Flasche Bier. Der Keller ist das Unbewusste des Hauses, sein Ur- und Untergrund. Ich glaube, meine Freundin, die im Raum über mir schläft, wird besser schlafen und die Großmutter ganz oben wird spüren, dass die Werkstatt ihres Mannes wieder intakt ist. Immerhin kommt jeder, der zur Waschküche geht, an der »alten Werkstatt« vorbei. Ich habe nun das Pelikan-Schächtelchen an meinem Schreibtisch stehen. Mein Blick streift es, bevor ich schreibe.
Als Dank für das Aufräumen schenkt mir Renée am Abend zwei alte Ringe und die Manschettenknöpfe des Urgroßvaters. Ich habe nicht aufgeräumt, um dafür etwas zu bekommen, bin aber ganz ergriffen. Sie sagt, es wäre schön, wenn ich den Schmuck trage, warum soll er weiter in einer unaufgeräumten Schublade schlafen? Zum Aufräumen gehört nicht nur das Ausmisten, sondern auch das Weitergeben, das Abgeben. Ich trage die Manschettenknöpfe mit der Erinnerung an die Kraft des Aufräumens; an einen Keller, an ein Haus, an die inneren und äußeren Räume ihrer Menschen.
In meiner Fantasie kehrt der Geist des Großvaters nun zurück in die alte Werkstatt, sortiert und schraubt, sinniert und werkelt. Er repariert viel mehr als nur das alte Radio, das vor ihm liegt.
Die Manschettenknöpfe werden irgendwann in meinem Keller liegen und jemand wird ihn vielleicht aufräumen, sie finden und sie tragen. Sie wandern weiter durch die Zeit, ich werde eine Zeit lang auf sie aufpassen.
Die Kunst zu lesen:Frank Berzbach: Formbewusstsein. Eine kleine Vernetzung alltäglicher Dinge6. Auflage, Hermann Schmidt, Mainz, 2023Orhan Pamuk: Der Trost der Dinge. Münchner Ausgabe Hanser, München: 2024 (Ausstellungskatalog zum Roman Das Museum der Unschuld).
__Amour fou
Seit Paulus denken wir uns die Liebe als etwas ziemlich Ausgewogenes. In der Antike war damit etwas durchaus Vernünftiges gemeint, sie »ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf«. Dies gilt für eine mitfühlende, in die Breite gerichtete Nächstenliebe, aber auch für das universelle buddhistische Mitgefühl mit dem Leiden. Wir haben es mit etwas Prosozialem, Gebendem, die Welt Heilendem zu tun. Natürlich kennt auch die soziale Hilfstätigkeit, die soziale Arbeit im weitesten Sinne eine ganze Reihe von Pathologien. Es gibt den Liebeswahn auch in subtiler Verborgenheit, als Herablassung im übergriffigen Helfen. Schwierig wird es, wenn man die moderne Erfindung einer »natürlichen Mutterliebe« in den Blick nimmt. Wer von Mutterliebe spricht, meint oft nicht nur das sorgend-wohlwollende Kindeswohlverhalten, sondern sie dient als Moralkeule gegen die Frauen, die machen, was alle Männer dürfen: Karriere. Da kann ja etwas nicht stimmen, »Liebst du deinen Job mehr als dein Kind?«. Liebevoll ist dieser Vorwurf keinesfalls.
Auch die Caritas kennt eine seltsame Überheblichkeit des Helfens, das geht bis in die Familienpflichten hinein. Eltern – eher Väter – lieben ihre Kinder meist so lange, wie die sie nicht übertreffen. Oder so lange, wie sie den vorgesehenen Weg und keinen anderen gehen. Die Familienpraxis zeigt, dass die Familienbande keineswegs nur von Liebe gehalten werden, sondern sie ist mit Bedingungen und Hierarchien verknüpft, von finanziellen Abhängigkeiten noch gar nicht zu reden. Viele Eltern wünschen ihren Kindern von Herzen, dass die im Leben machen, was sie selbst