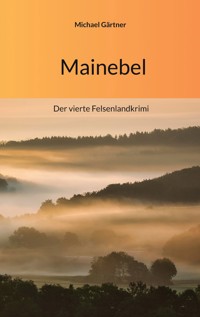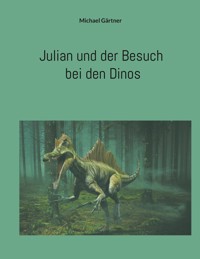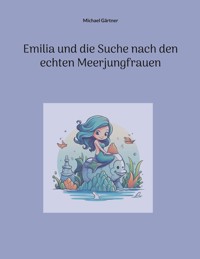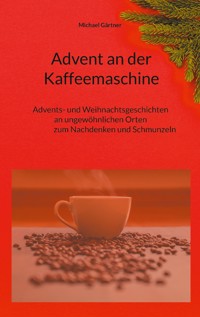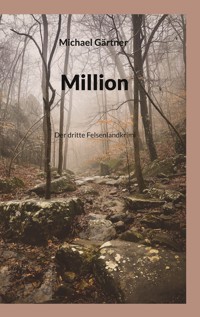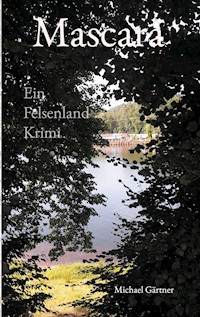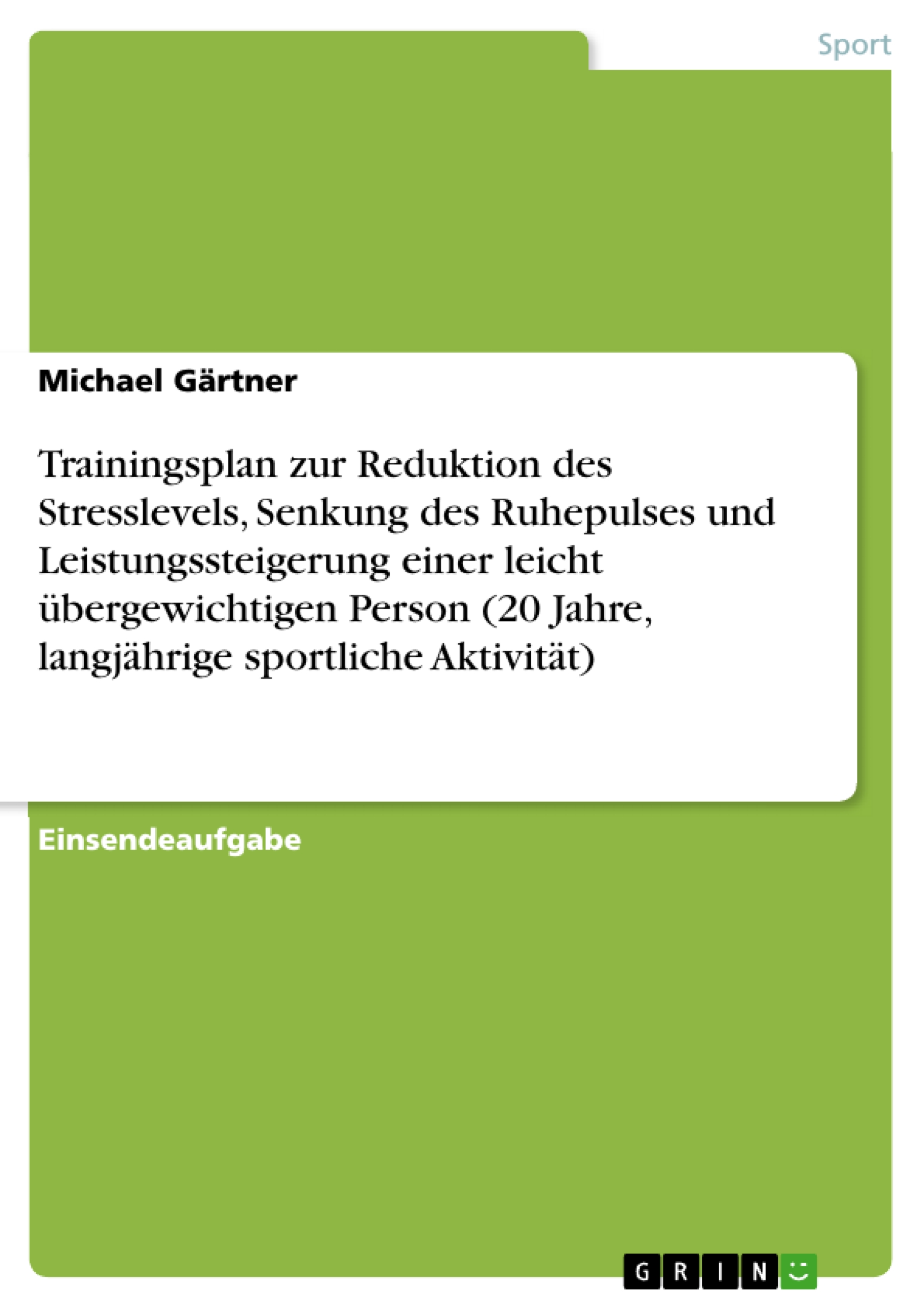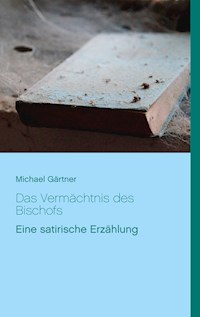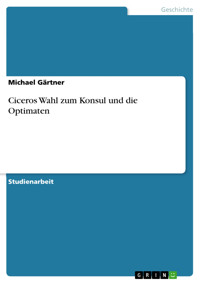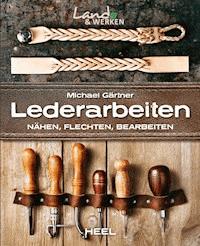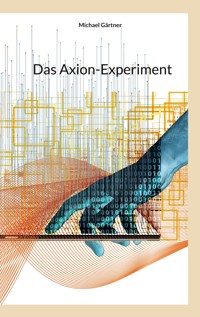
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Was können wir wissen? Was gibt es wirklich und was bilden wir uns nur ein? Dr. Sebastian Rasch ist sich da sicher: Beobachten, messen, berechnen, experimentieren - denn das sind seine Werkzeuge als Physiker. Auf der Suche nach dem legendären Axion wird er mit dem mysteriösen Tod einer von ihm verehrten Kollegin konfrontiert. Sebastian macht sich auf die Suche nach dem Mörder und entdeckt die Antwort dort, wo man nichts sicher wissen kann. Die Welt des Max-Planck-Instituts gerät durch das Unberechenbare aus den Fugen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Axiondas, -s/Axi'onen, zur Lösung von grundsätzl. Spiegelungsvarianzproblemen der starken Wechselwirkung postuliertes Elementarteilchen.« Brockhaus Enzyklopädie, 18. Aufl. 1987
»Das Axion ist ein hypothetisches Elementarteilchen ohne elektrische Ladung und mit Spin Null, das eine Lösung des Problems wäre, dass theoretische Überlegungen zwar eine Verletzung der CP-Symmetrie in der Quantenchromodynamik (QCD) forderten, diese aber nicht beobachtet wurde.«
(Wikipedia)
»Axionen haben die Eigenschaften, die sie haben müssen, um die kosmologische dunkle Materie zu bilden: Sie interagieren nur schwach miteinander und mit normaler Materie. Sie entstanden bei hohen Temperaturen und sonderten sich später von der Materie des übrigen kosmischen Feuerballs ab. Ihr Nachglühen, der Axion-Hintergrund, müsste im gesamten Universum zu sehen sein.«
(Frank Wilczek. Fundamentals. Die zehn Prinzipen der modernen Physik, Beck Darmstadt 2021, 202.)
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Epilog
Prolog
Der 19. September des Jahres 2017 veränderte nahezu alles in meinem Leben. Um es naturwissenschaftlich auszudrücken: Am frühen Vormittag dieses Montags wurde an unserem Institut für experimentelle Physik in München aus einem allseits beliebten Stück belebter Natur durch stumpfe Gewalteinwirkung ein betrauertes Stück unbelebter Natur. Es dauerte eine Weile, bis man der Vorgeschichte dieses Ereignisses auf die Spur kam. Diese Wochen veränderten mein Leben einschneidend.
Mit jenem Tag hielt ein neues Denken Einzug im Institut und versuchte sich einen Platz neben der experimentellen Physik zu erobern. Es hatte zur Folge, dass wir, die beteiligten Physikerinnen und Physiker, zu ungeahnten Fragen und Antworten geführt wurden. Das Ereignis unterlag wie alle – abgesehen vielleicht von jenem vor über dreizehn Milliarden Jahren, das wir Urknall oder in der Weltsprache der Naturwissenschaften Big Bang nennen – dem Prinzip der Kausalität, deren genauen Verlauf zu rekonstruieren es neben physikalischer nun auch kriminologischer Kenntnisse bedurfte.
An jenem Morgen trank ich eine Tasse Kaffee mit dem Pförtner unseres Instituts. Das tat ich jeden Tag. Als meinen Beitrag zum gemeinsamen allmorgendlichen Genuss hatte ich ein Pfund fair gehandeltes Kaffeepulver mitgebracht. Ich fachsimpelte mit Herrn Huber über das System der Auspuffklappen des Wagens von Frau Dr. Langlotz, einer der Abteilungsleiterinnen. Meine andere Kollegin vermutete ich in den Räumen für die Versuchsaufbauten im Untergeschoss. Charlotte Kurasek orientierte sich mit ihren Arbeitszeiten an den Schulstunden ihrer Tochter und war immer früh da. Ich vermutete jedoch falsch und war nicht auf das vorbereitet, was mich erwartete.
Ich verabschiedete mich von Alois Huber, versprach ihm, am nächsten Tag den Bildband mit den grandiosen Fotos des Hubbleteleskops mitzubringen, ging die zwei Stockwerke in den Bürotrakt meines Teams hinauf, schloss mein Zimmer auf und setzte mich an den Schreibtisch. Ein Druck auf die Taste am PC und der Computer begann hochzufahren. Wie immer dauerte es zu lange. Das lag an den Sicherheitseinrichtungen der Server, die mehrfache Redundanzen verlangten, bevor sie einen einzelnen PC freigaben. In der Zeit schaute ich mich um.
Die Zimmer unserer Etage waren durch Glasfenster voneinander abgetrennt und sind es auch heute noch, wenn ich recht informiert bin. Inzwischen haben wir ein neues Institutsgebäude erhalten und das alte wird anderweitig genutzt. Man konnte in die Büros der anderen sehen. Mir fiel auf, dass die Tür zum Raum von Charlotte Kurasek offen war und ihre Aktentasche auf dem Schreibtisch stand. Das war ungewöhnlich. Dr. Kurasek stellte die Tasche immer sofort neben den Tisch, wenn sie sich setzte, um ihren Rechner hochzufahren. Die Aktentasche auf der Schreibtischplatte, das hatte ich noch nie gesehen. Ungewöhnlich, aber zunächst nicht von Bedeutung. Es gehört jedoch zu meinem Job, den Dingen auf den Grund zu gehen. Dieser Wunsch ist ein dominierender Teil meiner Persönlichkeit. Außerdem dauerte es zu lange, bis mein Computer startklar war, und ich mit der Ar beit beginnen konnte. Also stand ich auf, ging auf den Flur und zu Charlotte Kuraseks Zimmer, zog die Tür ein Stückchen weiter auf und schaute hinein. Ich sah sie erst, als ich neben den Schreibtisch trat.
Sie lag auf dem Boden, Arme und Beine seltsam angewinkelt, der Rock hochgeschoben, der Pullover zerrissen, die schönen langen Haare in einer Lache dunklen Bluts, die Augen geschlossen.
Ich hatte das Gefühl, dass der Boden unter mir vibrierte. Meine Beine trugen mich nicht mehr. Das hatte ich noch nie an mir beobachtet. Ich glitt auf den Besucherstuhl und starrte auf die Tote. Eigentümliche Gedanken überfielen mich. Sie war auch jetzt noch, verkrümmt und blutig, schön. Ich bekam Angst, wurde ganz starr. War es die Gegenwart des Todes, die mich lähmte? Da war ein Schuldgefühl, nicht da gewesen zu sein, als sie Hilfe brauchte. Ich empfand eine eigentümlich intime Nähe zu der Frau, die ich bewunderte. Gefühle, die ich bisher nicht gekannt hatte, verkrampften meinen Körper.
Vielleicht lebte sie noch. Ich zwang mich, die notwendigen Schritte auf sie zuzugehen, beugte mich hinab und legte zwei Finger an den Hals. Nichts, kein Puls, nur wächserne Kälte.
Was ich in den nächsten fünfzehn Minuten tat, erinnere ich nicht mehr, kann es aber rekonstruieren. Ich stand auf, ging in mein Zimmer, rief Herrn Huber an, dass er die Polizei benachrichtige, lief hinauf zum Vorzimmer von Professor Miller und bat Frau Sorglos, den Chef zu informieren.
Anschließend begab ich mich zurück zu den Büros meines Teams. Keiner war da. Bald, so vermutete ich, würde es hier von Polizisten und Technikern zur Untersuchung des Tatorts wimmeln. Ich nahm mir einen Stuhl und setzte mich vor die Tür zu Charlottes Zimmer. Niemand sollte hinein. Ich hatte das Gefühl, ich müsste sie beschützen. Ich wusste, dass es zu spät war. Trotzdem – ich musste aufpassen. Niemand sollte dieses Zimmer betreten. Was war passiert? Ich verstand nichts.
1
Vielleicht sollte ich mich zunächst einmal vorstellen. Mein Name ist Sebastian Rasch. Ich bin inzwischen 33 Jahre alt und – wie wir alle – nicht als Fertigprodukt auf diese Welt gekommen, quasi mit vorgeprägten, unabänderlichen Eigenschaften und Fähigkeiten, vergleichbar einem Haushaltsroboter.
Ich stamme aus einer kleinen Stadt in Niederbayern, wie es sie viele gibt, liebenswert, lebenswert mit freundlichen Menschen, die notwendigen Veränderungen und Erneuerungen gegenüber keineswegs so verschlossen sind, wie es dem Volksstamm der Bajuwaren bis heute gerne nachgesagt wird. Dies ist vermutlich deshalb so, weil nur die wenigsten der Menschen unserer Stadt in der Landwirtschaft tätig und damit durch die überlebensnotwendige Verbundenheit zur Scholle und dem, wie es schon in früheren Zeiten gewesen war, geprägt sind. Bei diesem Ort nahe dem Inn kommt hinzu, dass er ganz jung ist, nach dem Krieg gegründet, um den vielen Landsleuten aus dem Osten Europas, die flüchteten oder vertrieben wurden, eine Heimstatt zu geben. Sie waren im Westen Deutschlands keineswegs immer nur willkommen und auch nicht im Südosten des Westens. Die Verwaltung hatte damals versucht, sie so unterzubringen, dass die Berührungen mit den Alteingesessenen möglichst selten und vor allem kontrollierbar blieben. Man ließ sie eine eigene Stadt zwischen den im Wald gelegenen Bunkern einer ehemaligen Munitionsfabrik bauen.
Mein Vater war Techniker in einem Betrieb für Gummiprodukte am Ort, meine Mutter Krankenschwester im Kreiskrankenhaus einige Kilometer entfernt. Ich wuchs zusammen mit meiner zwei Jahre älteren Schwester auf, die es mir zu meinem Vorteil ersparte, mich wegen jeder Kleinigkeit mit den Eltern auseinandersetzen zu müssen, denn das hatte sie bereits erledigt. Als mir diese Vorleistung meiner Schwester – so um das zehnte Lebensjahr herum – bewusst wurde, begann ich neben der schon früh vorhandenen geschwisterlichen Liebe eine ausdrückliche Dankbarkeit ihr gegenüber zu entwickeln. Sie verschonte mich vor manchen häuslichen Konflikten, was meiner angeborenen Mentalität entgegenkam, derzufolge ich die Welt und die Menschen zunächst gerne intensiv betrachte, bevor ich mich mit ihnen auseinandersetze. Betrachten und Verstehen waren von Kindheit an meine bevorzugten Daseinsformen.
Nun möchte ich mich jedoch nicht als einen weisen Alten im Kindesalter präsentieren, wie es für die Heiligenviten der Antike typisch ist. Abgesehen von dieser ausgeprägten Grundtendenz zum Betrachten und Verstehen war ich ein ganz normales Kind, war hungrig und müde, schrie aus für meine Eltern nicht immer verständlichen Gründen, baute gerne Türme aus Bauklötzen, riss sie wieder ein und zwickte an mutigen Tagen meine Schwester am Arm.
Mit drei Jahren kam ich in den Kindergarten, betrachtete mir das Treiben dort eine Weile, verteilte meine Sympathien und machte ab dem dritten Tag mit. Ich spielte mit den anderen Kindern, mit den einen lieber als mit den anderen, zog mich zurück, wenn es laut wurde, untersuchte im Sommer die Kieselsteine der Beeteinfassung und sortierte sie nach Größe und Farbe.
In der Schule tat ich mich schwer mit der Rechtschreibung und einer leserlichen Handschrift. Ich sah es nicht ein, dass man Wörter und Sätze schreiben sollte. Wörter und Sätze könne man sprechen, erklärte ich meiner verblüfften Lehrerin im zweiten Schuljahr, aber alles wirklich Wichtige ließe sich in Zahlen und Zeichen ausdrücken. In der vierten Klasse schwärmte ich für meine neue Lehrerin und fand den Geschichtslehrer in der siebten ausgesprochen doof. Mädchen erschienen mir manchmal als wundersame Wesen von einem anderen Stern, nicht selten jedoch als dumme Gänse, die mich nicht ernst nahmen. Ich verstand im Laufe der Zeit, dass ich einigen von ihnen vertrauen konnte, anderen nicht, und entwickelte eine Vorliebe für die mit langen schwarzen Haaren. Auch lernte ich das Glück kennen, das sich einstellte, wenn ich ein interessantes Buch in einem Zug durchlas. Ich mochte fantasiereiche Erzählungen, bevorzugte mit zunehmendem Alter die Realität und begann ab dem fünfzehnten Geburtstag naturwissenschaftliche Sachbücher zu konsumieren. In der Schule interessierte ich mich für alles, was mit Mathematik und der unbelebten Natur zu tun hatte. Eine Zeit lang auch für das Fach Religion, das mir die vielen Fragen, die ich an das Leben hatte, zwar nicht beantwortete, sie jedoch zumindest ansprach. Mein Interesse an den Fragen des Religionsunterrichts geriet zunehmend in Konflikt mit der Faszination für die Naturwissenschaften. Der Gott der Religionen war mit den Mitteln der Physik nicht zu erkennen und schien sich hinter den Urknall zurückgezogen zu haben.
Insgesamt betrachte ich meine Kindheit und Jugend im Rückblick als angenehm. Ich blieb von manchen Irrwegen verschont, wohl auch deshalb, weil es in meinem Leben etwas gab, für das ich mich brennend interessierte, und ich mich mit meinen anderen Fragen aufgehoben fühlte. So kann man sagen, dass ich Glück hatte, denn lange nicht allen blieb es erspart, ihr Herz an die falschen Dinge oder Menschen zu hängen und etwas sehr Vorläufigem eine endgültige Bedeutung zu geben. Ich musste nicht wie andere wegen einer Unsicherheit bezüglich dessen, was die Welt im Innersten zusammenhält und was das Leben trägt, durch viele Sackgassen wandern oder den Hunger nach Sinn durch Konsum stillen.
Zu einer Vorstellung gehört auch das, was andere für einen als bezeichnend empfinden. Für mich scheint es folgende kleine Geschichte zu sein, die bisher bei jedem Treffen unseres Abiturjahrgangs immer irgendeiner zum Besten gab. Ich finde an meinem darin geschilderten Verhalten nichts Besonderes, aber die anderen meinen, auf so eine Idee könne nur ich kommen. Es war in der zwölften Jahrgangsstufe. Ich hatte den Führerschein gemacht und von den Ersparnissen aus den Ferienjobs einen VW Golf der zweiten Serie gekauft – in der Meinung, was zwanzig Jahre gehalten habe, halte auch zwei weitere Jahre. Eigentlich musste er nur noch zwei Wochen halten, denn ich wollte damit nach Paris fahren und sehen, wie sich die Erde dreht. Das sagte ich allen, die mich fragten, was ich denn in Paris wolle. Was ich damit meinte, schien niemand zu verstehen und ich erklärte es auch nicht. Ich fragte einen Freund aus Kindergartentagen, ob er mitkommen wolle, auf der Fahrt könnten wir im Zelt schlafen, in Paris im Auto am Stadtrand oder auf einem Campingplatz. Auch ihm wollte ich nicht verraten, was ich damit meinte, dass ich sehen wolle, wie die Erde sich dreht. Ich sagte einfach, Paris sei immer eine Reise wert. So fuhren wir zu zweit in den Herbstferien in die Hauptstadt Frankreichs. Meine Eltern hatten Bedenken, wussten aber auch, dass sich Achtzehnjährige nicht von etwas abhalten ließen, das sie sich in den Kopf gesetzt hatten.
Es war eine tolle Fahrt über Straßburg, Metz und die Champagne. Die Mitbringsel aus diesem Landstrich waren nach der Rückkehr geeignet, den Unmut der Eltern zu stillen. In Paris verliefen die Tage in einem gewissen Gleichlauf. Ich begab mich morgens ins Pantheon, mein Freund durchstreifte Parks und Museen. Am Abend setzten wir uns an die Seine, aßen Crêpes, Döner oder Pizza, tranken den billigen Wein der Pays d‘Oc und besprachen, was wir erlebt hatten. Am Tag vor der Abfahrt holte mein Freund mich abends von dem Ort ab, an dem ich die letzten fünf Tage verbracht hatte.
Er erzählte hinterher allen, die es hören oder auch nicht hören wollten, wie er mich dort antraf: »Sebastian ruhte, auf ein Gestell ähnlich einem Jägerstuhl gestützt, an der Absperrung des Foucaultschen Pendels und starrte auf den Mosaikboden, der sich langsam unter dem Pendel verschob. Der Boden bewegte sich mit der Erde – und mit ihm alle Besucher dieser monströsen klassizistischen Halle. Das riesige Pendel verharrte an seinem Ort im Weltall und die Skala auf den Fliesen machte die Drehung der Erde unter dem Pendel deutlich. Als Sebastian mich sah, winkte er mich zu sich und sagte total fasziniert: »Schau, wie sie sich bewegt. Kannst du es sehen? Man kann es spüren, wie wir uns mit der Erde unter dem Pendel wegdrehen.« Mein Freund erntete mit dieser Erzählung jedes Mal ein amüsiertes Lächeln.
Tatsächlich hatte ich die Tage unseres Parisaufenthaltes nahezu ununterbrochen in dieser Stellung verbracht – von der Öffnung der Ruhmeshalle am Vormittag bis zur Schließung – und mich immer wieder neu in die Drehung der Erde um sich selbst und ihre Bewegung im All hineingedacht. Es waren viele Stunden der Meditation über das Universum und den Ort der Erde darin, sowie über deren zweibeinige Bewohner, die dies alles erkunden konnten. An diesen Tagen war wohl der Entschluss vorbereitet worden, Physiker zu werden und das All zu erforschen.
Ich machte ein – bei aller Bescheidenheit – sehr gutes Abitur und zog im folgenden Wintersemester als Physikstudent an die Universität München. Nun konnte ich meine natürliche Neigung zum Betrachten und Verstehen vollends ausleben. In den Jahren des Studiums blieb ich von erschwerenden Umständen verschont, hatte genügend Geld, jedoch zum Glück nicht zu viel. Meine Eltern waren gesund und arbeiteten auf die Rente hin, die große Schwester trat ihre erste Stelle als Lehrerin an und machte mich bald zum Onkel. Was die Mädchen anging, hatte ich nicht viel Zeit und zeitweise auch nur ein geringes Interesse, aber es gelang mir, mein Anforderungsprofil mit den Jahren zu schärfen. Ich blieb nach einem kurzen Ausflug ins Rotblonde schließlich doch den schwarzen Haaren treu, schaute mich unter den Physikerinnen um und bei den Medizinerinnen, verliebte mich letztendlich ernstlich in eine Juristin, die den Staatsdienst anstrebte. Da sie, um dieses Ziel zu erreichen, viel lernen musste, verblieb mir genügend Zeit fürs Studieren, und ich schloss meine Promotion summa cum laude ab.
Eigentlich wollte ich zusammen mit meiner geliebten Juristin die elementaren menschlichen Aufgaben erledigen, von denen meine Eltern immer gesprochen hatten, also ein Haus bauen, einen Baum pflanzen und mindestens ein Kind aufziehen. Dies verhinderte jedoch ein Arzt, angehender Radiologe, der bereits über ein geregeltes Einkommen verfügte und von meiner examinierten Rechtskundigen als derjenige der beiden Männer in ihrem Leben angesehen wurde, der ihren zukünftigen Kindern bessere materielle Lebensbedingungen zu bieten versprach. Rein rational konnte ich ihre Entscheidung nachvollziehen und als klug und nachhaltig anerkennen. Ich wunderte mich, dass sie mir trotzdem nicht zu gefallen schien. So war ich plötzlich allein und konzentrierte mich ganz auf die Arbeit. Im Grunde war es mir ganz recht, mich nicht den sogenannten elementaren menschlichen Aufgaben, sondern vor allem der Wissenschaft widmen zu können.
Was die Physik anging, setzte ich mir zum Ziel, eine experimentelle Bestätigung der Existenz von Axionen zu erbringen. Das sind kleine Teilchen, deren Existenz die theoretischen Physiker schon lange vor meiner Geburt vorausgesagt hatten und die man seitdem fieberhaft nachzuweisen versuchte. Nichts schien mir schwieriger und deshalb als berufliches Ziel besser geeignet als dieses Unterfangen. So führte mein Weg mich mit einer gewissen inneren Konsequenz an das Max-Planck-Institut der Landeshauptstadt des Freistaates Bayern.
2
Ein Anfänger bleibt auch dann ein Anfänger, wenn er mit summa cum laude promoviert wurde, und der »Dr.« vor dem Namen verliert an Bedeutung, wenn alle anderen Kolleginnen und Kollegen denselben Namenszusatz tragen. Dessen war ich mir durchaus bewusst, als ich an einem Junimorgen des Jahres 2015, meinem ersten Arbeitstag, gegen acht Uhr den Eingangsbereich des Instituts betrat. Umso mehr überraschte mich die Begrüßung des Pförtners: »Ach, da ist ja unser neuer Herr Doktor!«
Einmal schon war ich zuvor in diesen Mauern gewesen. Da war ich gerade zwölf Jahre alt geworden. Mein Vater nahm mich zum Tag der offenen Tür mit, den das Institut alljährlich durchführte. Es wollte damit den Kontakt zur Bevölkerung halten und Gerüchten darüber vorbeugen, welche geheimnisvollen und gar gefährlichen Experimente unter den in verschiedenen Ebenen versetzen Dächern des Gebäudes stattfanden. Danach war ich immer wieder da – mit dem Fahrrad, mit der S-Bahn, im Vorbeifahren mit dem Auto – und hatte nahezu sehnsuchtsvoll die Fassade in den Blick genommen. Da wollte ich hinein, da wollte ich irgendwann einmal arbeiten.
Das damalige Institutsgebäude war ein massiges Bauwerk, nicht sonderlich hoch, nur vier oder fünf Stockwerke, von einer enormen Breite, deren Wucht durch die regelmäßige Untergliederung der Fassade noch verstärkt wurde. Ich wusste um die unterirdischen Stockwerke, die fast genauso umfangreich waren wie die oberirdischen. Dort standen die Versuchsaufbauten und wurden die Experimente durchgeführt. Untersuchungen, mit denen man die Vorstellung der Menschen vom Universum verändern und in neue Dimensionen emporheben konnte. Was hier geschah, das war meiner Meinung nach schlichtweg revolutionär im wahrsten Sinne des Wortes. Es stellte das Bild vom Universum auf den Kopf, wirbelte Ideen durcheinander, durchdrang Zeiträume und Entfernungen, die sich der menschlichen Vorstellungskraft entzogen, im Großen wie im Kleinen. Dieses Gebäude hatte für mich eine ähnliche Bedeutung wie die Kaaba für die Muslime, der Jerusalemer Tempelberg für die Juden und der Petersdom für die Katholiken. Wenn es eine Kategorie in meinem Denken gewesen wäre, so hätte ich diesen Ort heilig nennen können. An ihm konzentrierte sich alles, was für mich von Bedeutung war. Architektonisch war das Gebäude eher schlicht, von einer fast abstoßenden Monumentalität. Was darin geschah, verlieh ihm jedoch eine unvergleichliche Aura.
Alois Huber, den Mann am Empfang, sollte ich bald gut kennenlernen. Er wurde zu einem väterlichen Freund, den ich meines Erachtens gar nicht gesucht hatte. Seit fast vierzig Jahren arbeitete er in diesen Räumen, davon die ersten fünfunddreißig als Hausmeister. Als solcher war er für die alltagspraktischen Aspekte der Physik zuständig. Vier Jahre zuvor war er beim Auswechseln einer Leuchtstoffröhre von der Leiter gestürzt und hatte sich eine Verletzung am Knie zugezogen. Die wollte nicht wieder richtig ausheilen. Seitdem wurde er als Pförtner eingesetzt. In dieser Rolle fühlte er sich wohl.
In all den Jahren hatte er es sich nicht abgewöhnen können, die Doktoren als solche anzureden. Auch jeden der nicht wenigen Professoren, die durch ‚seine‘ Tür kamen, begrüßte er ausnahmslos mit ihrem akademischen Titel. Die Hochachtung der Fünfziger Jahre vor den Akademikern steckte ihm tief in den Knochen. Darauf angesprochen, meinte er nur, diese Menschen hätten dafür schwer gearbeitet, dann stände es ihnen auch zu. Die gelegentlich deutlich werdenden menschlichen Unzulänglichkeiten dieser hoch qualifizierten Akademiker konnten ihn nicht von seinem Verhalten abbringen. Diese Schwächen waren ihm keineswegs entgangen, denn er kannte alle gut, die im Haus arbeiteten und auch die regelmäßigen Gäste. So manches aufschlussreiche Gespräch hatte er geführt, wenn jemand beim Empfang stand, weil das Taxi noch nicht da war, oder ein erwarteter Besucher sich verspätete. Er hatte sich seine eigenen Gedanken gemacht über die Physik, die Menschen und das Leben. Gerne kam er am Morgen zur Arbeit und fuhr genauso gerne am Abend zurück ins nahe gelegene Garching. Dort wohnte er mit seiner Frau im geerbten Elternhaus, dessen Verkauf ihn zum Millionär machen würde, was ihm aber gar nicht in den Sinn kam.
»Sie sind früh dran«, sagte er an jenem Morgen meines ersten Tages im Institut, trat hinter seinem Empfangstresen hervor, nahm Haltung an und reichte mir die Hand. »Mein Name ist Huber, ich bin hier der Pförtner und soll Sie in Empfang nehmen. Der Herr Professor kommt erst gegen neun Uhr. Sie können solange da vorne Platz nehmen, wenn Sie möchten.«
Er deutete auf eine Sitzgruppe aus Edelstahl und Leder, der man das Alter des Institut und die Löcher im Institutshaushalt ansah.
»Gerne«, sagte ich, setzte mich und schaute mich um. Dies war mein erster, lang ersehnter Tag als Mitarbeiter im Institut.
Wir Physiker gelten im Allgemeinen als nüchterne Menschen. Das bietet sich auch an, wenn man sich mit Fragen beschäftigen will, die unser Vorstellungsvermögen übersteigen. Allzu leicht kann man da ins Spekulieren kommen. Das sollten wir den Sciencefiction Literaten überlassen. An diesem Tag jedoch durchfluteten mich die Glückshormone in einer Weise, dass es mir schwer fiel, die Selbstkontrolle zu behalten. Ich war noch nicht am Ziel meiner Träume, aber schon auf der Straße dort hin.
In dieser Halle, die mit ihrer Höhe an den Münchener Flughafen erinnerte, sich über alle Stockwerke nach oben zog und dort mit einem Glasdach endete, zeigte sich eine architektonische Neigung zum Gigantischen. Mir kam der Gedanke, dass man von hier aus in der Nacht die unzähligen Lichter des Universums sehen könnte, wenn nicht das Streulicht der Stadt den Blick verderben würde. Im Moment brannte die Sonne hindurch, die Verdunklung fuhr heraus und tauchte den Raum in ein angenehm blaues Licht. Bald würde die Klimaanlage zur Höchstleistung auflaufen müssen. Es war ein heißer Frühsommer.
Trotz aller Faszination für das Institut musste ich mir eingestehen, dass das Gebäude unübersehbar in die Jahre gekommen war. Etwas Farbe, die Ausbesserung der gesprungenen Bodenfliesen und der Austausch einzelner blind gewordener Fensterscheiben hätten dem Foyer gutgetan. Ich verstand sofort, warum ein Neubau in Angriff genommen worden war. Der Hochglanzprospekt lag neben dem Jahresbericht des Instituts vor mir auf dem niedrigen Couchtisch.
Tatsächlich war ich zu früh gekommen. In den ersten zehn Minuten meines Wartens betrat niemand die Eingangshalle. Lediglich die aus einem Mann und zwei Frauen bestehende Putzkolonne mühte sich von der einen zur anderen Seite, um dann in den breiten Gängen entlang der Außenfassade zu verschwinden. Jedoch stellte sich die Wartezeit als keineswegs vergeudet heraus.
Herr Huber kam zu mir. Der untersetzte Mann tat sich ein wenig schwer mit dem Gehen. »Möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Ich hab da vorne eine kleine Maschine.« Mit einem verständnisvollen Blick fügte er hinzu: »Sie können sich auch gerne zu mir setzen, wenn Sie wollen.« Erstaunlich, dieser Mann, der eben noch so achtungsvoll distanziert gewesen war, zeigt nun seine fürsorgliche Seite.
Hätte Herr Huber eine knielange Lederhose – oder auch eine kurze – mit wollenen Strümpfen und Trachtenhosenträgern angehabt, er hätte nicht mehr dem Klischee eines Bayern entsprochen, als er es in dieser braunen Cordhose und dem groß karierten Hemd tat. Das lag an seinen kräftigen grauen Haaren und dem melierten Schnurrbart, seiner untersetzten Gestalt sowie dem unüberhörbaren Zungenschlag. Er erinnerte mich an meinen Onkel, mit dem ich in den Ferien durch die Voralpen gewandert war. Dann waren wir mit festen Schuhen versehen und einem ledernen Rucksack ausgestattet losgezogen. In dem Rucksack befanden sich der Kaffee für den Onkel, die Limonade für mich sowie die nahrhafte von der Tante zusammengestellte Brotzeit – und das Fernglas, mit dem wir die Berge betrachteten. Der Onkel war ein gemütlicher Mann, der beim Wandern allerdings einen guten Schritt hatte. Er leistete einen beträchtlichen Beitrag zu meinem Interesse am Universum. Als wir – da war ich gerade zwölf Jahre alt geworden – bei einer der Wanderungen auf einer Hütte übernachteten, hatten wir einen überwältigenden Blick auf den Nachthimmel und die Milchstraße. Der Onkel konnte einige meiner Fragen beantworten, aber es blieben so viele offen, dass ich fortan nicht mehr von diesem Thema loskam.
Ich bin nicht der Kaffeefreak, wie er manchmal unter Akademikern anzutreffen ist, die den Körper bei unserer zumeist sitzenden Tätigkeit durch irgendwelche chemischen Stimulanzien in Gang halten müssen. Das Wort »Kaffee« klang in meinen Ohren jedoch nach einer angenehmen Abkürzung der Wartezeit. So folgte ich Herrn Huber in die Pförtnerloge, setzte mich auf den angebotenen Stuhl, von dem aus ich einen guten Blick in das Entree hatte, und nahm die Tasse mit dem heißen Getränk entgegen.
»Sie sind also der neue wissenschaftliche Mitarbeiter. Dann müssen Sie ja ein kluger Kopf sein. Die nehmen hier nicht jeden.«
In diesem Moment wusste ich nicht, ob ich Herrn Huber aufdringlich und distanzlos oder einfach nur freundlich finden sollte. Das anerkennende Lächeln, mit dem er seine Worte unterstrich, ließ mich jedoch Freundlichkeit vermuten. Was sollte ich ihm antworten? Wer weiß, wem er meine Antwort weitergeben würde.
»Na ja, ich denke, die Arbeit hier ist ungeheuer wichtig, sehr interessant und wird mir Spaß machen.« Ich versuchte zu lächeln: »Aber ganz leicht wird es sicher nicht.« In einer Verlegenheitsgeste griff ich zu meiner Kaffeetasse.
Die Eingangstür wurde geöffnet und eine sorgfältig gestylte Frau in den mittleren Jahren trat ein, winkte Herrn Huber zu und ging zum Aufzug.
»Das ist die Sekretärin vom Chef, Frau Sorglos«, sagte der Pförtner.
»Origineller Name«, gab ich zurück.
»Der Name passt nicht so ganz. Sie macht sich vielleicht wenige Sorgen um sich, dafür umso mehr um andere. Sie kümmert sich um alles, was sonst keiner machen will. Also, ohne Frau Sorglos hätten manche hier ziemlich viele Sorgen.« Herr Huber schien mit einer praktischen Intelligenz ausgestattet zu sein.
»Das ist eine gute Eselsbrücke, um mir den Namen zu merken«, sagte ich freundlich. »Mit Namen habe ich es nämlich nicht so.«
»Wohl mehr mit den Elementarteilchen, was?«
»Deren Namen konnte ich mir bisher merken.« Ich versuchte humorvoll zu wirken.
Im Flur wurde es laut. Eine Gruppe junger Frauen und Männer, allesamt leger gekleidet, zwängte sich herein und verteilte sich unter unüberhörbaren Abschiedsrufen in offensichtlich guter Stimmung auf die verschiedenen Gänge.
»Da ist ein Bus angekommen. Sie werden sehen, in fünfzehn Minuten kommt wieder so eine Gruppe. Das sind dann die, die es riskieren, zu spät zu kommen, falls der Bus nicht pünktlich ist.«
»Sie kennen Ihre Leute aber gut«, sagte ich und nahm einen Schluck von dem Kaffee. Er schmeckte unerwartet aromatisch. Bestimmt eine alte bayerische Traditionsmarke.
»Ich kenne sie alle. Ob ich sie gut kenne, da bin ich mir nicht so sicher. Wie heißt es doch so schön: Man schaut den Menschen nur vor den Kopf.« Herr Huber nickte nachdenklich.
Zwei Handwerker in Blaumännern betraten die Halle und näherten sich mit unsicheren Blicken an die hohe Decke der Pförtnerloge. Herr Huber schaute auf das Schreiben, das sie vorlegten, erklärte ihnen den Weg, griff zum Telefon und meldete sie an. Er lehnte sich zufrieden ob der erledigten Aufgabe in seinem Schreibtischstuhl zurück.
Draußen vor der Tür, bei den reservierten Parkplätzen für die Leitenden, wurde es laut.
»Auftritt Langlotz!«, raunte Herr Huber mir zu. »Frau Dr. Sandy Langlotz. Vielleicht unsere nächste Chefin.« Er unterstrich diesen Satz mit einem hochachtungsvollen Gesichtsausdruck.
Vom Parkplatz her war ein gewaltiges Röhren zu hören, dann Ruhe, ein letzter Gasstoß, der die Scheiben des Entrees vibrieren ließ, ein gurgelndes Geräusch, Stille.
»Jetzt wissen alle, dass sie da ist. Dieser entsetzliche Klappenauspuff ihres Jaguars ist unüberhörbar und gefährdet mit seinen Schallwellen sämtliche Versuchsanordnungen im Haus, wenn Sie mich fragen. Aber keiner wagt etwas zu sagen, denn es ist Frau Dr. Sandy Langlotz.« Herr Huber hob einen Zeigefinger und lächelte vielsagend. »Sie macht diesen Krach nur, wenn sie sicher sein kann, dass der Chef noch nicht im Haus ist.«
Wohl darauf bedacht, nicht gesehen zu werden, lugte ich um die Ecke und war gespannt, wie sie wohl aussah, diese Frau Dr. Langlotz. Der Name sagte mir viel. Sie war eine der renommiertesten Experimentalphysikerinnen der Welt, hatte ein halbes Jahr auf der Raumstation ISS gearbeitet und zuvor in Moskau Physik studiert. Sie stammte aus Erfurt und hatte noch zu DDR-Zeiten in der Schule Russisch gelernt. Man erzählte sich, der Militärische Abschirmdienst habe sie ganz gezielt für das Institut angeworben, weil sie im Zuge ihrer Laufbahn Einblicke in russische Forschungen gehabt hatte. Man hoffte, davon zu profitieren. Diese Koryphäe war einer der Gründe, warum ich an diesem Institut arbeiten wollte.
Die Tür ging auf und ein freundliches »Guten Morgen, Herr Huber!« in dem angenehmen Tonfall einer Altstimme klang durch den Raum. »Guten Morgen, Frau Dr. Langlotz!«, antwortete Huber und deutete eine Verbeugung an.
Aufrechten Ganges durchschritt Dr. Langlotz – sie war damals eine Frau Mitte vierzig mit blondierten Haaren und einer Hochsteckfrisur – das Entree, ging mit einem deutlich vernehmbaren Klacken der Absätze zum Aufzug und verschwand darin.
Irgendwie hatte ich sie mir anders vorgestellt. Vielleicht etwas strenger, hagerer, asketischer, nicht so fraulich und natürlich. »Die wirkt auf den ersten Blick ganz nett«, sagte ich zu Herrn Huber.
»Das ist sie auch. Immer freundlich. Bei fachlichen Diskussionen soll sie allerdings unerbittlich sein.« Huber schaute mich wissend und warnend zugleich an. »Vielleicht meint sie es nicht so, aber sie hat schon manche mit ihrer Kritik entmutigt.« Er kräuselte die Stirn. »Also: Vorsicht!« Er war unerwartet offen. Wenn er mit allen über alle so redete, würde er sich bald ins soziale Aus katapultieren.
»Danke für die Warnung«, sagte ich. »Sonst noch irgendwelche Tipps?«
»Sie werden die schon noch alle kennenlernen. Ich denke, nach dem, was ich hier so mitbekomme, ist das Arbeitsklima in Ordnung.« Also ein versöhnlicher Schluss. Herr Huber schien doch kein Anhänger der üblen Nachrede zu sein.
Er nickte den nächsten Eintretenden zu. Vor der Tür sah ich nun einen jüngeren Mann, der sich in gebückter Haltung näherte.
»Jetzt kommt Ihr Kollege, der Dr. Albert Weinstein. Ein kluger Kopf.« Hubers Gesicht wurde ernst. »So ganz bin ich noch nicht aus ihm schlau geworden. Man sagt ihm nach, er würde dem Professor ständig nach dem Mund reden.«
»Ist in der Wissenschaft eigentlich nicht üblich.« Ich war skeptisch, ob diese Behauptung stimmte.
»Vielleicht hat er das von zu Hause. Sein Vater ist im Vorstand bei Daimler.«
»Ist der für die unglückliche Wahl des Vornamens verantwortlich?«
»Mag sein, vielleicht ist es auch die Mutter, die so ehrgeizig ist«, sagte Huber nachdenklich. »Auf jeden Fall tut der Kerl mir irgendwie leid.« Also, Huber sah in Doktoren der Physik nicht nur zu bewundernde Wesen einer höheren Ordnung, sondern auch Menschen in all ihrer gelegentlichen Kläglichkeit.
Albert Weinstein betrat gebückten Rückens die Lobby, als müsse er durch die niedrige Tür eines mittelalterlichen Gefängnisturms hindurch, richtete sich anschließend kaum merklich auf und ließ ein »Hallo, Herr Huber!« vernehmen. Huber grüßte zurück und Weinstein schlich zum Aufzug.
Ich lugte um die Ecke ins Foyer. Weinstein schien mir durchaus sympathisch zu sein. Er war das, was man als gut aussehend bezeichnet hätte: sehniger, muskulöser Körper, markantes Kinn, blaue Augen und volles Haar, das gescheitelt und an den Seiten kurz geschoren war. Seine gebeugte Körperhaltung stand allerdings in deutlichem Widerspruch zu seinem Aussehen. Vielleicht war er der gut aussehende Sohn eines gut aussehenden Vaters, ohne dessen Durchsetzungsfähigkeit geerbt zu haben? Albert war derjenige im Institut, mit dem ich und andere etwas unglaublich Ungehöriges erleben sollten.
Huber lehnte sich in seinem Drehstuhl zurück. Das Telefon klingelte, er nahm ab und verband den Anrufer. Dann wandte er sich wieder mir zu: »In spätestens zwei Minuten ist der Chef da. Er kommt nie später als neun Uhr.«
Nun wurde ich nervös. Es war an diesem Tag nicht die erste Begegnung mit Brian Miller, dem Direktor des Instituts. Beim Einstellungsgespräch hatte ich ihm bereits gegenüber gesessen. Nun sollte die Zusammenarbeit mit dem Mann beginnen, den ich schon seit Jahren verehrte. Ich hatte alles, wirklich alles, von ihm gelesen, und kannte die Stationen seiner Laufbahn auswendig: Miller stammte – auch wenn sein Name das nicht vermuten ließ – ebenfalls aus Bayern, hatte in Augsburg sein Physikstudium begonnen, war dann aber bald nach Lyon gewechselt, um dort zu promovieren. Nach ein paar Jahren in Berlin an der Humboldt-Universität folgten eine Zeit in Princeton und eine Professur in Heidelberg, bevor er zu einem der sieben Direktoren der Abteilungen der Max-Planck-Institute in München berufen wurde. Miller war noch keine vierzig Jahre alt, als man ihn mit dieser Aufgabe betraute. Nun durfte ich mit diesem Mann zusammenarbeiten. Dieser Tag war ein ganz besonderer in meinem Leben. Ich hatte ein erstes wichtiges Ziel erreicht: Ich durfte hier arbeiten. Jetzt galt es nur noch, das Axion nachzuweisen.
Eine Minute vor neun Uhr betrat Brian Miller sein Institut. Er winkte Herrn Huber zu, entdeckte mich und kam näher.
»Da sind Sie ja schon, Herr Rasch.« Miller reichte die Hand über den Empfangstresen. »Herzlich willkommen.« Er machte eine abwehrende Geste. »Bitte trinken Sie in Ruhe Ihren Kaffee aus und kommen Sie dann in fünfzehn Minuten in mein Büro! Herr Huber wird Ihnen den Weg zeigen. Dann stelle ich Ihnen auch Frau Dr. Kurasek vor, Ihre direkte Vorgesetzte. Aber«, er lächelte »die haben Sie ja schon beim Vorstellungsgespräch gesehen«, ging zum Aufzug und rief: »Also bis gleich.«
Das Ganze hatte keine zehn Sekunden gedauert. Ich kam nicht dazu zu antworten und muss einen ziemlich verblüfften Gesichtsausdruck gemacht haben.
Huber lächelte: »So ist er. Nur keine Zeit verlieren! In den fünfzehn Minuten, die er jetzt noch Zeit hat, telefoniert er mit dem Forschungsminister oder einem Kollegen in den USA und hat schon wieder einen Punkt auf seiner To-do-Liste abgearbeitet.«
Ich sollte Brian Miller als einen außergewöhnlichen Physiker, einen guten Chef und einen angenehmen Menschen kennenlernen.
Das war gut zwei Jahre vor dem Tag, der für eine spürbare Erschütterung des Instituts sorgte, an dem ich einen bisher nicht gekannten Schmerz empfand und in Ereignisse hineinzogen wurde, mit denen ich nie gerechnet hätte. Sie zwangen mich, es nicht beim Betrachten und Verstehen zu belassen und mein Physikergehirn auch anderen Aufgaben zu widmen.
3
Die morgendliche Tasse Kaffee im Hinterzimmer von Herrn Hubers Pförtnerloge hatte sich für mich im Laufe der Zeit zu einem Ritual entwickelt. Er hatte mich in gewisser Weise adoptiert und ich hatte es geschehen lassen, ohne genau zu wissen, warum. Vielleicht wegen der Ähnlichkeit mit meinem Onkel, vielleicht weil er für mich in der sachlich anspruchsvollen Atmosphäre des Instituts ein wenig bayerische Heimat bedeutete. Nur die wenigsten der Kolleginnen und Kollegen hatten dafür Verständnis. Huber stand in dem Ruf, ein freundlicher und hilfsbereiter Zeitgenosse zu sein, aber zu einem längeren Gespräch mit ihm hatte kaum jemand Lust. Die meisten fanden keinen rechten Zugang zu Hubers urbayerischer Art. Manche hatten auch einfach Probleme, seinen Dialekt zu verstehen. Zudem: Was sollte es schon bringen, sich mit einem Pförtner und ehemaligen Hausmeister zu unterhalten, der von der Grundlagenforschung im Institut doch so gar nichts begriff? Es gab Tage, da interessierte mich das, was Alois Huber mir erzählte, tatsächlich nur wenig. Dafür hörte er geduldig zu, wenn ich ihm von der Arbeit und den Diskussionen im Team berichtete, die er vermutlich wirklich nicht verstand. Obwohl – ich hatte zwar den Eindruck, dass Alois Huber nicht allen Gedanken zum Standard-Modell der Elementarteilchen mit seinen Quarks, Bosonen, Leptonen und Fermionen und den angedachten Erweiterungen folgen konnte. Wofür er jedoch eine ausgesprochene Sensibilität bewies, war all das, was in den Menschen und zwischen ihnen ablief. Alois Huber hatte eine gute Menschenkenntnis. Das lag, so versuchte ich mir das zu erklären, daran, dass er auf einem Dorf aufgewachsen war, wo man sich schlecht voreinander verstecken konnte. Da finden sich alle Tugenden und Laster, alles Gelingen und Verfehlen, was es in der großen weiten Welt gibt, im Kleinen. Wer die Menschen kennenlernen will, lebt besser auf dem Dorf als in der Stadt.
Möglicherweise hatte es auch mit seiner Außenseiterrolle als Hausmeister und Pförtner zu tun. Die zwang ihn in eine beobachtende Position und ermöglichte ihm, sich so seine Gedanken zu machen. Wie dem auch gewesen sein mag: Die Gespräche mit Alois Huber hatten mir in den vergangenen zwei Jahren geholfen, mich ins Arbeitsleben im Allgemeinen und ins Institut im Speziellen einzugewöhnen. Der Pförtner vermittelte mir das, was mir sonst in meinem von der Elementarphysik bestimmten Leben nicht begegnete. Ich vermisste es – ehrlich gesagt – auch nicht. Es half mir jedoch, im Rückblick betrachtet, in der wenigen Zeit, die ich außerhalb des Instituts verbrachte, zu bestehen.
Die zweite Person, die mir das Einarbeiten erleichterte, war Charlotte Kurasek, anfangs meine direkte Vorgesetzte. Sie war gut zehn Jahre älter als ich, galt als außergewöhnlich kreative Experimentalphysikerin und war von Brian Miller nach dessen Übernahme der Institutsleitung von einem Ingolstädter Automobilhersteller abgeworben worden. Dort forschte sie an der Entwicklung eines neuartigen Bremssystems, das die bereits guten Werte noch einmal um einhundert Prozent verbessern sollte. Diese Stellung hatte sie angenommen, weil sie nach Abschluss ihrer Promotion möglichst bald zu einer gut bezahlten Arbeit kommen wollte. Sie musste als ledige Mutter eine Tochter im Grundschulalter aufziehen und die notwendige Kinderbetreuung finanzieren. Im Bereich der Grundlagenforschung gab es zu der Zeit keine freie Stelle und so ging sie in die Industrie.
Ich bewunderte manches Mal diese toughe Frau, die nun, mit Ende dreißig, eine Tochter im besten Pubertätsalter hatte und zugleich hervorragende Arbeit leistete. Dass sie tatsächlich prädestiniert für die mögliche Nachfolge in der Institutsleitung gewesen war, wie eine Doktorandin einmal meinte, erschien mir jedoch keineswegs so eindeutig. Schließlich war da noch Dr. Langlotz und die war eine Physikerin von Weltruf. Charlotte Kurasek war mir hingegen außergewöhnlich sympathisch. Zudem hatte sie sich mit ihren langen brünetten Haaren und der schlanken Figur ein mädchenhaftes Aussehen bewahrt. Immer wieder erwischte ich mich dabei, in ihr mehr als nur eine vorgesetzte Kollegin zu sehen. Ihre stets freundliche, jedoch uneingeschränkte Sachlichkeit hielt mich allerdings davon ab, diese Fantasien über einen längeren Zeitraum weiter zu spinnen. In meinen Gedanken war sie jedoch, wie mir später bewusst wurde, stets präsent.