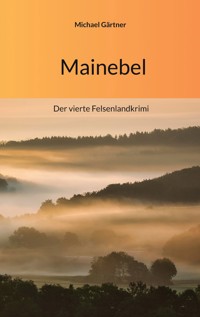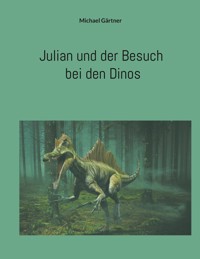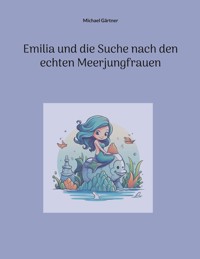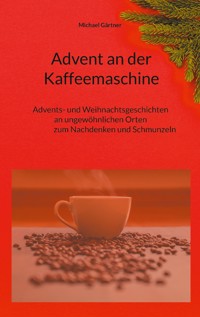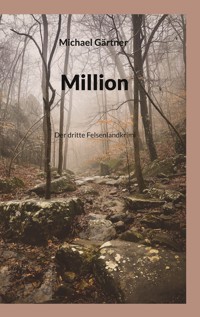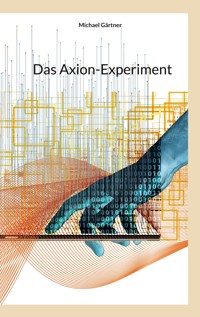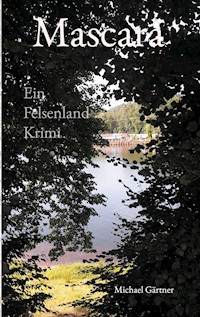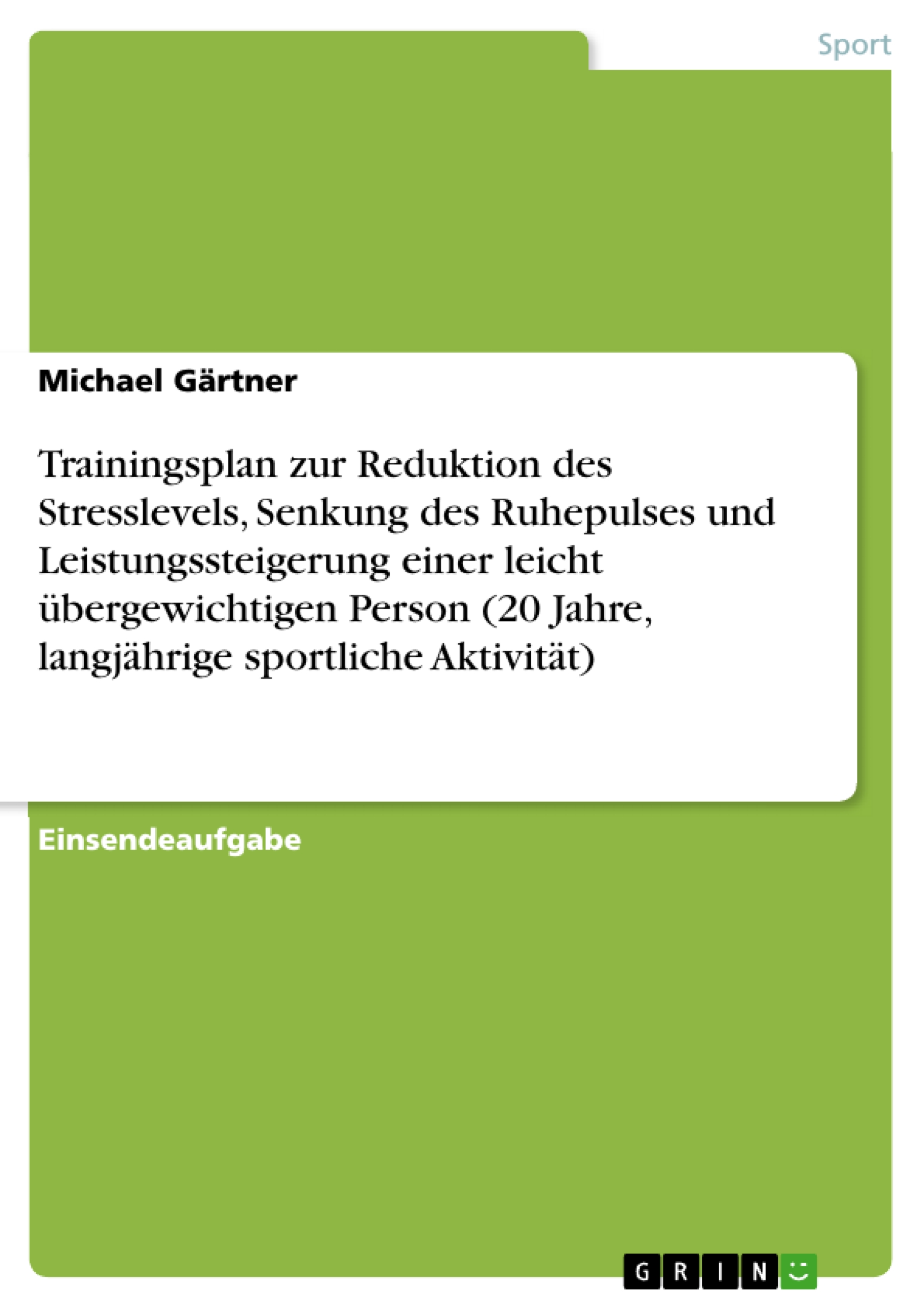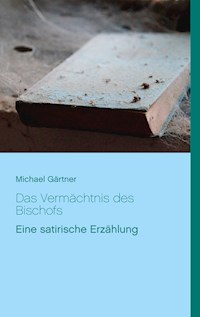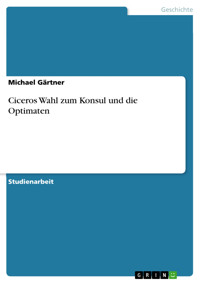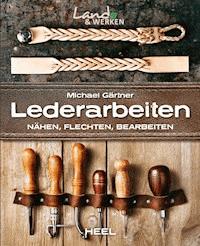6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine unerwartete Entdeckung beim Tunnelbau stürzt die kleine Großstadt in Aufregung. Es beginnt ein großes Spiel, in dem sie alle auf ihre Weise mitmischen möchten: die Parteien, die Kirche, die Presse und die große Chemiefabrik. Ein Mann gerät in die Mühlen der Politik und zwischen zwei Frauen. Und das alles wegen der paar Steine ... Humorvoll und spannend erzählt von Michael Gärtner, der seit dreißig Jahren in Ludwigshafen am Rhein wohnt. Die Steine und ihre Folgen, eine Tote auf dem Filmfestival, die Beichte eines Binnenschiffers und eine seltsame Begegnung unter einer Brücke sind die Themen der vier in diesem Band zusammengefassten Erzählungen. Gemeinsam ist ihnen der Ort an dem sie spielen: die kleine Großstadt, Ludwigshafen am Rhein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Die Basilika
Die Tote auf dem Filmfestival
Amandia
Winterdorf
Die Basilika
1
Ein Anruf vom Büro des Oberbürgermeisters. Noch ein paar Tagen zuvor hätte er nicht damit gerechnet und es wäre ihm egal gewesen. Jetzt war es ihm auch egal, nur hatte er damit gerechnet. Womit er jedoch zu diesem Zeitpunkt der Ereignisse nicht rechnete, war die rasante Entwicklung der nächsten Tage und Wochen, die ihn für manche zu einem Helden, für andere zu einem unumgänglichen Faktor im politischen Kräftespiel und schließlich zum Salvator Ecclesiae, zum Retter der Kirche, machte. Außerdem ahnte er nicht, wie sehr er sich zwischen zwei Frauen hin- und hergerissen fühlen würde, ohne zu bemerken, dass seine Entscheidung im Grunde schon gefallen war.
Nach dem Telefonat lehnte er sich in seinem Schreibtischstuhl zurück. Jetzt fiel es ihm noch schwerer, sich zu konzentrieren, außerdem war die Kaffeetasse leer, aber er war der festen Absicht, keine weitere zu trinken, denn Kaffee war letztlich ungesund. Es machte einfach keinen Sinn, so hatte er sich schon oft gesagt, sich jeden Tag mit mehreren Tassen Kaffee volllaufen zu lassen, und dann an drei Tagen in der Woche zu versuchen, den Körper mit morgendlichem Joggen wieder fit zu bekommen.
Bis zu dem am Telefon vereinbarten Gespräch im Rathaus dauerte es noch zwei Stunden, so legte er den Besuch, den er eigentlich erst am Nachmittag machen wollte, auf den Vormittag. Es war sowieso besser, vormittags zum Geburtstag zu gratulieren, dann, wenn die Gäste außerhalb der Familie erwartet wurden. Man hatte ihm schon durch einen ganzen Blumenstrauß hindurch mitzuteilen versucht, dass man seine Besuche eigentlich am Vormittag erwartete, und zwar zwischen elf und zwölf, pünktlich und möglichst bei allen gleichzeitig. Egal ob er nun ein, zwei oder drei an einem Tag zu absolvieren hatte. Es wäre völlig unangebracht, wie er es gerne machte, erst am Nachmittag zu kommen, machte man ihm klar. Manchmal erschienen ihm die Erwartungen seiner Gemeindeglieder absurd. Es war nicht seine erste Stelle, aber er hatte sich immer noch nicht an all die Ansprüche gewöhnt, die an manchen Tagen auf ihn herab prasselten.
Den Weg zum Rathaus ging er zu Fuß. Hätte er sich umziehen sollen? Nein, entschied er, wer für den Geburtstag einer achtzig Jahre alten Frau angemessen gekleidet war, war das auch für ein Gespräch mit dem ersten Bürger der Stadt. Außerdem, was heißt das, erster Bürger der Stadt? Genau genommen war das eine verlogene Formulierung, von der allenfalls das „erste“ stimmte, aber nicht der Bürger. Das suggerierte eine Gleichheit, die es nicht gab. Dieser Bürger hatte in der kleinen Großstadt mehr Macht als jeder andere – abgesehen vielleicht vom Vorstand der großen Chemiefabrik. Dieser „erste“ Bürger kannte vermutlich nicht die aktuellen Preise für H-Milch oder Spaghetti. Er kannte wahrscheinlich auch nicht die Benzinpreise, denn sein Wagen wurde von seinem Fahrer gepflegt und gewartet. Bürger war er in dem Sinne, dass er wahlberechtigt und wählbar war, Steuern zahlen musste. Ansonsten erlebte er das Leben nur aus zweiter oder dritter Hand, kannte nicht die Enge und den Gestank einer Straßenbahn, das Anstehen beim Bürgerservice oder das Warten beim Arzt und hatte vermutlich schon lange nicht mehr schwere Einkaufstüten ins Parkhaus geschleppt.
Bis zum Rathaus waren es vielleicht zwei Kilometer. Er hätte die Straßenbahn nehmen können, dann hätte er jedoch umsteigen müssen. Mit dem Auto hätte die Parkplatzsuche länger gedauert als der Fußmarsch. Außerdem, wer zu Fuß ging, sah sowieso viel mehr, und man roch auch etwas. Das Erste, was er roch, als er sein Haus in der Südstadt verlassen und die Tür hinter sich zugemacht hatte, war der Duft des Fliederstrauchs vor seinem Haus. Von diesem Geruch konnte er nie genug bekommen, und so sog er ihn tief ein und versuchte ihn in der Nase und allen angrenzenden Höhlen des Kopfes zu speichern. Bilder aus seiner Jugend schossen ihm bei diesem Geruch in den Sinn – der Fliederstrauch im Garten seiner Großeltern, die sie am Sonntag besuchten, die Schokoladentorte im Frühjahr, der Erdbeerkuchen im Sommer, die Schwester an seiner Hand, Sonne in allen Winkeln seines Kopfes. Ganz andere Gerüche begleiteten ihn auf seinem weiteren Weg zum Rathaus, vor allem der Geruch der Autoabgase, der stickige Geruch der Benzinmotoren – so hatte sein erstes Auto gerochen –, die aromatischen Kohlenwasserstoffe der alten Dieselfahrzeuge, der stumpfe Geruch des Abriebs der Bremsen, die dumpfen Ausdünstungen der Elektromotoren der Straßenbahnen und dann dieser eigentümliche Geruch der großen, alles bestimmenden Chemiefabrik im Norden, der sich an manchen Tagen wie ein Vlies über die Stadt legte, besonders dann, wenn die Hitze im Rheintal brütete und keine Bewegung in die Luft kam.
Unter diese Gerüche der Motoren und Bremsen mischte sich alle paar Meter ein anderer. Hier ein Hauch von den letzten Lindenblüten der Straßenbäume – das Aufbäumen der Natur gegen die Zivilisation –, da der feuchte Bierdunst aus der Kneipe – die Reste eines Abends in der verführerischen Euphorie des Alkohols –, ein paar Meter weiter der Gestank des schlecht platzierten Mülleimers – ein überquellendes Symbol des Wohlstandes –, in den sich dann nach und nach der wunderbare Duft der Kaffeerösterei mischte – der wohlriechende Beleg für die Ausbeutung der Südhalbkugel durch die alte und die neue Welt –, abgelöst von den vielfältigen Aromen des türkischen Obst- und Gemüsegeschäftes – das die kulturübergreifenden Bedürfnisse wachrief – , und dem tief ins Unterbewusstsein eingeprägten Duft aus der Bäckerei. Den Weg in die City ging er immer zu Fuß, und vielleicht hätte er es einmal mit geschlossenen Augen und nur seiner Nase nach versuchen sollen.
Er fühlte sich glücklich, wenn er durch diese Straßen ging und die gewohnten Gerüche einander abwechselten. Er hatte sich diese Stadt ausgesucht, auch wenn das manchen Kollegen auf dem Land unverständlich erschien. Die Südstadt war einer der schönsten Stadtteile, noch viel alte Bausubstanz, ein bisschen Jugendstil, ein bisschen Neoklassik. Hier bauten einst die ihre Häuser, die vom Aufblühen der Chemieindustrie profitierten. Von denen hatten inzwischen die meisten die Stadt verlassen und waren in die Weindörfer an den Rändern der Rheinebene gezogen. Aber auch das Alte und manchmal etwas Verfallene hatte seine Reize. Vor allem aber liebte er an dieser Stadt ihre Vielfalt, die Vielfalt der Menschen mit der Vielfalt ihres Aussehen und der Vielfalt ihrer Lebensstile. Er konnte wütend werden, wenn man ihnen das Recht absprach, in diesem Land und in dieser Stadt zu sein.
Auf dem Weg zum Rathaus machte er einen kleinen Umweg, um noch einmal an der Stelle vorbeizugehen, an der er heute Morgen beim Joggen stehen geblieben war. Es war alles in Ordnung dort. Sein eiliger Anruf im Rathaus hatte gute Dienste getan. Nun würde man weitersehen müssen.
Er wusste nicht, was er von dem bevorstehenden Gespräch zu erwarten hatte. Der Oberbürgermeister persönlich, eigentlich war das nicht sein täglicher Umgang. Er gehörte nicht zu denen, die eingeladen wurden, wenn etwas los war in der Stadt, eine Einweihung, irgendein besonderes Ereignis oder der Neujahrsempfang zum Beispiel. Er gehörte nicht zu den sieben- oder achthundert Menschen, die jedes Jahr in der zweiten Januarwoche in die gute Stube der Stadt geladen wurden, um miteinander und mit dem Oberbürgermeister auf ein gutes und erfolgreiches neues Jahr anzustoßen – ein Anlass, bei dem man sich umsah, um gesehen zu werden, einander anlächelte und höfliche Worte wechselte, den unangenehmen Gestalten auszuweichen versuchte und, falls sich die Begegnung nicht vermeiden ließ, sie dann um so freundlicher anlächelte, im Stehen ein Glas Sekt oder Bier oder deren auch mehrere zu sich nahm, denn es kostete ja fünf Euro Eintritt, und die wollten verzehrt ein. Für den Oberbürgermeister war es eine gute Gelegenheit, Freunde und Feinde an sich zu binden, mit einer Einladung außer der Reihe zudem verdienten Bürgern eine besondere Ehre zu erweisen und das politische Programm für das folgende Jahr seiner ausgewählten Hörerschaft nahe zu bringen. Der Rest würde es über die Zeitungen erfahren – falls es ihn interessierte. Für die Besucher war es eine Gelegenheit, dem Oberbürgermeister die Hand zu schütteln und dem einen oder anderen Beigeordneten oder Stadtrat ein lang gehegtes Anliegen zum wiederholten Male nahezubringen. Dann nahm man wieder ein Bad in der Menge, falls dies zu dem gehörte, was man im Leben suchte. Wobei sich diese Menge in zwei Gruppen teilte, nämlich diejenigen, die in der Rede des Oberbürgermeisters namentlich und mit ihrer Funktion begrüßt wurden, und diejenigen, die unter „ferner liefen“ rangierten. Dabei war es jedes Jahr ein schönes Spiel zu analysieren, wer in welcher Reihenfolge begrüßt wurde, wen er gar wegließ bei dieser Ehrenbezeugung, um dann Vermutungen anzustellen, welche Gründe ihn, den Oberbürgermeister, wohl dazu bewogen haben könnten, seine Auswahl so und nicht anders getroffen zu haben, und nachher festzustellen, dass die Polizei, das Handwerk, die Schulen oder was auch immer in seiner Rede zu kurz gekommen waren. Dieser Abend hinterließ bei seinen Besuchern alljährlich das wohlige Gefühl, zu jenem halben Prozent der Bürgerschaft zu gehören, das durch diesen Empfang aus der Masse herausgehoben wurde.
Er war noch nie dabei gewesen, und auch sonst hatte man ihn bei den offiziellen Anlässen nicht gesehen. Er sah seinen Platz bei den restlichen 99,5 Prozent der Einwohner, bei denen, die regiert und verwaltet wurden, die alle paar Jahre wählen durften, um sich damit in die Hände jenes halben Prozents zu begeben, das die Fäden in der kleinen Großstadt zog oder den Fädenziehern half. Aber heute hatte er innerhalb einer guten Stunde einen persönlichen Termin beim Oberbürgermeister bekommen, einen Termin, auf den er keinen Wert legte, den er aber wahrnehmen musste, dazu verpflichteten ihn sein Beruf und die Tatsache, dass er ein Bürger dieser Stadt war, wenn auch erst seit ein paar Jahren.
Dabei hatte dieser Tag begonnen wie viele Tage, wie ungefähr jeder zweite Tag in seinem Leben. Gleich nach dem Aufstehen, noch vor dem Frühstück, machte er sich zum Joggen bereit, zog den Trainingsanzug an und die Turnschuhe, verschloss die Haustür und lief zunächst in leichtem Trab, dann aber das Tempo steigernd an den Rhein, erst um den Park herum und danach nach Süden auf die große Brücke zu. Er brauchte das einfach, sonst wurde er nach wenigen Tagen ungenießbar. Das viele Sitzen, das geduldige Zuhören, die beschwichtigende Diplomatie, die zu seinem Arbeitsalltag gehörten, kosteten viel Kraft und hatten wenig mit dem Jäger und Sammler zu tun, dem seine genetische Ausstattung entsprach. Wenn ein Mann mit Mitte dreißig seinen Körper vernachlässigte, dann merkte er es spätestens mit Mitte vierzig, und dazu hatte er keine Lust – abgesehen davon, dass Laufen für ihn so etwas wie eine körperliche und mentale Runderneuerung bedeutete, die nur noch mit den Stunden der Meditation zu vergleichen war, die er an den Tagen morgens pflegte, an denen er nicht lief.
Jeden Morgen ging es an die Rheinpromenade, und er genoss den Geruch des Flusses, der lange nicht mehr so stank wie in seiner Jugend. Nein, er empfand diesen Geruch als angenehm und in seinem Gehirn war er unlösbar verbunden mit dem tuckernden Geräusch der Schiffsdiesel und den gelegentlichen Schreien der Möwen. Der Fluss war nie derselbe, auch die Schiffe und die Möwen nicht, aber sonst wiederholte sich vieles. Fast jeden Morgen dieselben Spaziergänger, die meisten mit ihren Hunden, die gleichen Busse, die die Schüler zu ihrem Tagespensum transportierten, dieselben Fahrradfahrer und Jogger und dieselbe Joggerin, auf die er schon wartete, die denselben Zweitagesrhythmus beim Laufen hatte wie er, auf deren Rhythmus er sich nach einigen Fehlversuchen eingestellt hatte, ihm meist in der Nähe der Hafeneinfahrt begegnete, die er schon von Weitem erkannte, an ihrer Art zu laufen, ihrer Gestalt, ihren Haaren, ihren Gesichtszügen, der Nase, die ein wenig schief zu stehen schien und dieses Gesicht einzigartig machte, an den schmalen Augen, deren Farbe er noch nicht hatte erkennen können, den hohen Wangenknochen und diesem Lächeln, das er ihr manchmal abringen konnte, das von einem unvergleichlichen Charme war und ihn wie ein unverhoffter und doch langersehnter Sonnenstrahl aus einer Wolkendecke traf.
Heute Morgen hatte ihn dieser Strahl nicht getroffen, denn er brach seinen morgendlichen Rundlauf früher ab. Er lief an den Rhein und bekam den letzten Hauch der Morgendämmerung mit, bevor sie sich in den Tag hinein auflöste. Die Häuser auf der anderen Rheinseite warfen lange Schatten auf die Uferwiesen, der Verkehr auf der Brücke hatte noch nicht seinen Höhepunkt erreicht, ein Zug fuhr darüber, eine Straßenbahn gesellte sich dazu. Fast konnte man dieses Spiel von Hunderten von Rädern und Motoren schön finden, wenn man nicht selber in einer dieser Metallkisten sitzen musste, die die Menschen zur Arbeit auf die andere Seite des Flusses brachten, man sich nicht durch die Gänge der Züge oder die Schlangen auf den Fahrspuren schlängeln musste, dicht an dicht mit anderen Menschen oder Fahrzeugen, die Meisten voller Restmüdigkeit und mit mieser Laune, manche gehetzt und aggressiv, die Einen gewaschen, zu viele nicht, die Kleider den Kneipengeruch des Vorabends ausdünstend und die Münder den Geruch von Kaffee oder Knoblauch. Wenn man das Spiel der Lichter und Farben auf der Brücke zugleich mit dem frischen Geruch des Morgens wahrnahm, dann konnte man das schön finden, und er fand es schön. Diese Zeit am Morgen gehört ihm, es gab keine Anrufe und er traf keine Menschen, mit denen er Worte wechseln musste, die er lieber für sich behalten hätte.
Wenn man den Rhein hinunter auf die Brücke zulief, so befand sich dort früher eine große Industriebrache. Zwar war die Stadt erst annähernd einhundertfünfundsiebzig Jahre alt, aber sie hatte schon viele Veränderungen hinter sich. Sie hatte ihre Existenz der chemischen Industrie zu verdanken, die auf der anderen Seite des Rheines keinen Platz mehr fand und deshalb hierher auswich. Mit den Arbeitsplätzen kamen die Menschen, aus Arbeitersiedlungen wurde eine Stadt. Aber nicht jede Fabrik lebte so lange wie eine Stadt. Diese hier oberhalb der Brücke hatte das Schicksal vieler gehabt. Zwischen den Weltkriegen und im Krieg war sie gewachsen und hatte geblüht, bis in den Siebzigern der Stahl gegen die Chemie zu verlieren begann und die große Konzentration im Stahlgewerbe anfing. Dann wurde sie von einem ausländischen Konzern aufgekauft und zerstückelt. Einzelne Bereiche wurden wieder verkauft, die unwirtschaftlichen wurden stillgelegt, als die staatlichen Förderungen nichts Positives mehr zum Konzernergebnis beizutragen hatten. Da nutzten Demonstrationen und Solidaritätsbekundungen der Bundestagsabgeordneten nichts, vielleicht hörte man in der fernen Konzernzentrale auch nichts, und wenn, dann tat es nicht weh, denn auf der nächsten Hauptversammlung hatte man schöne lange schwarze Zahlen vorweisen können. Die Shareholder waren weit weg und hatten feste Pläne mit ihrer Dividende oder mit dem Erlös aus dem gestiegenen Aktienkurs. Irgendwann war es dann aus mit dieser Fabrik und mit den Arbeitsplätzen, und weil die Gebäude sowieso inzwischen mitten in der Stadt lagen, wo die Industrie nichts zu suchen hatte, da kaufte die Verwaltung das Gelände auf, um es von den Kontaminierungen zu befreien und weiterzuverkaufen. Wohnungen entstanden und Fahrbahnen. Man hatte lange miteinander gestritten, wie die Straße, die hier durchgehen, zur großen Chemiefabrik im Norden der Stadt führen und die Arbeitnehmerlogistik erleichtern würde, verlaufen sollte: geradeaus oder um die Kurve, unter der Erde oder darüber. Die Entscheidung darüber sah Oberbürgermeister kommen und gehen, Koalitionen im Stadtrat brachen darüber auseinander, neue wurden geschlossen, und schließlich entschied man sich für eine ebenerdige, denn die war am günstigsten.
Danach gab es ein neues Großprojekt, das die Verantwortlichen in Stadt und Land in Atem hielt und die Bürgerschaft spaltete – man brauchte eine weitere Brücke. Die beiden alten waren marode und würden nicht mehr lange dem täglichen Ansturm der großen und kleinen Autos standhalten. Die Auseinandersetzungen darüber waren heftiger gewesen als alle Diskussionen um den Neubau an der Stelle eines abgerissenen runden Kaufhauses oder die Gestaltung eines zentralen Platzes zuvor. Seit Jahren war immer wieder die Forderung nach einer dritten Rheinbrücke erhoben worden, denn der Verkehr auf den beiden anderen führte jeden Morgen und Abend zu langen Staus. Als man daran ging, die Zufahrt zu der einen zu erneuern, wurde die andere marode, und schiere Verzweiflung brach aus. Wie sollte man die vielen Autos über den Rhein bekommen? Man sprach von einer Fähre, verhandelte mit der Bundeswehr über den Bau einer Pontonbrücke wie dereinst kurz nach dem Krieg, oder schlug vor, den alten Bahnhof zu einer Verladestation für Autoreisezüge umzubauen und einen Pendelverkehr einzurichten, wie er sich schon für die Insel Sylt bewährt hatte. Alles erwies sich als wenig zielführend und so hatte man eine weitere Brücke ins Auge gefasst. Sie sollte am Stadtpark die kleine Großstadt verlassen, um im Naherholungsgebiet der großen Großstadt auf der anderen Rheinseite anzukommen.
Dass dieses Projekt allen ökologischen Bedenken zuwiderlief, war jedem auf Anhieb klar. Das Image der kleinen Großstadt würde leiden, noch weiter leiden. Leiden würde aber außerdem nicht nur die Natur, sondern auch das zweitgrößte Filmfestival Deutschlands, das alljährlich in eben diesem Stadtpark abgehalten wurde. Das war für manche noch schlimmer als jeder Eingriff in die Natur. Man war verzweifelt und ging mit dieser Verzweiflung nach ausführlichen Diskussionen mit Fachleuten, im Stadtrat, in den Medien, an den Stammtischen, zu Hause und am Arbeitsplatz in die Sommerpause.
Es erwies sich als ein großes Glück – einige nannten es auch Fügung –, dass der Oberbürgermeister in diesem Jahr seinen Urlaub mal nicht an der Nordsee, sondern in der Schweiz verbrachte. Beeindruckt von der Tunnelbaukunst des kleinen Alpenvölkchens ließ er am ersten Arbeitstag nach dem Urlaub verbreiten, man wolle eine Tunnellösung prüfen.
Mit den Bauarbeiten war vor zwei Monaten begonnen worden. Täglich gruben sich die schweren Geräte eines großen internationalen Baukonzerns tiefer in die Erde. Man baute eine große Schlucht in den Schutt und den Kies, in die die Tunnelbohrmaschine hineingefahren werden sollte. Die Bauarbeiten hatten an jenem Tag noch nicht begonnen, seiner Neugierde folgend lief er den Umweg zur Baustelle und warf einen Blick in die Tunnelschlucht.
Man hatte an dieser Stelle nur Sand vermutet, Sand, den der Rhein irgendwann in seiner langen Geschichte, vielleicht zu einer Zeit, als die Evolution noch nicht an Menschen dachte und sich noch mit Dinosauriern abgab, hier angeschwemmt hatte, Sand, der aus dem Gestein der Alpen gewaschen und über Hunderte Kilometer hierher transportiert worden war. Die Stadt war eine Stadt ohne Geschichte, ohne nennenswerte Geschichte jedenfalls, zumindest im Vergleich zu den Nachbarstädten um sie herum, eine Stadt, die entstanden war, weil eine Fabrik einen Bauplatz und Menschen Arbeit suchten. Aus den kleinen Anfängen einer Chemiefabrik war eine der größten Industrieanlagen Europas geworden, Arbeitsplätze für fast vierzigtausend Menschen allein in diesem Werk, dann die Zulieferer, die Handwerker und die Dienstleister, die sich nach und nach angesiedelt hatten, die Kneipen und Kirchen, die Sportplätze und Schwimmbäder, die Tennisplätze und Kleingartenanlagen, die auf den Äckern an den Rheinauen entstanden waren. Aus dem Nichts war eine Stadt geworden und das in nicht viel mehr als fünfzig Jahren.
Aber was er da beim morgendlichen Joggen in der Tunnelschlucht entdeckte, war nicht dieses Nichts. Es waren Steine. An sich auch nichts Ungewöhnliches, wenn es nicht behauene Steine gewesen wären, Sandsteine, die zudem in einem ganz bestimmen Muster auf der Erde lagen. Er kannte dieses Muster, und wenn er es nicht im Laufe seiner Allgemeinbildung kennengelernt hätte, dann spätestens in den Jahren seines Studiums. Es war – und er brauchte gar nicht genauer hinschauen oder nachzudenken, um das festzustellen – es war der Grundriss einer Kirche, einer romanischen Kirche genauer gesagt, der Grundriss einer dreischiffigen Basilika.
Die Bauarbeiter rüsteten sich gerade für den Tag, vertauschten in den Umkleidecontainern ihre Jeans und Poloshirts mit der Arbeitskleidung, erzählten sich die Erlebnisse des Vorabends oder die neuste Zote vom Stammtisch. Er stieg in die Baugrube hinab und schaute sich die Sache genauer an. An einer Stelle waren die Steine am Vorabend aus der Form gerissen worden, wohl kurz bevor die Arbeiten wegen der einbrechenden Dunkelheit eingestellt wurden. Aber es war ganz sicher das Grundgemäuer einer Kirche. Neben einem der Steine lag, ein wenig versteckt im Sand, ein Ring, und den steckte er ein.
Man hätte mit vielem rechnen können an dieser Stelle im Sand am Ufer des Flusses, mit Mammutknochen aus der Steinzeit, vielleicht auch mit den Überresten eines gestrandeten römischen Schiffes, mit den vergrabenen Resten der Industrieproduktion zu Beginn des Jahrhunderts, vielleicht auch mit dem bisher unentdeckten Opfer eines Mordes – aber mit einer Kirche, einer antiken Basilika zudem, konnte man nicht rechnen. Denn der Ort, an dem heute diese kleine Großstadt stand, war auf keiner der alten Karten verzeichnet, war zweihundert Jahre zuvor nie genannt worden. Es gab keine bekannten Siedlungen hier an dieser Stelle und erst recht keine römischen, in keinem der überlieferten Texte war je etwas erwähnt worden. Speyer, Köln und Mainz, das waren Städte, die man bis in die Antike zurückverfolgen konnte, auch viele andere kleinere Orte, aber nicht diese Stadt. Hier hatten noch nie Menschen gewohnt, so viel man wusste – so viel man bis zu diesem Tag gewusst hatte.
Eine Basilika bedeutete nicht nur eine Kirche auf freiem Feld, eine Basilika bedeutete eine Stadt, eine kleine vielleicht, aber eine Stadt, und sie bedeutete den Sitz eines Bischofs. Vielleicht war es der Blick des Ortsfremden, dem die Ungeschichtlichkeit dieser Stadt noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen und selbstverständliche Erwartung geworden war, dessen es bedurfte, um in diesen Steinen etwas anderes zu sehen, als ein Haufen Geröll.
„Ich freue mich, dass Sie so schnell kommen konnten, Herr Pfarrer Seyfert. Sie haben sicher einen prall gefüllten Terminkalender.“ Der Oberbürgermeister kam mit eiligen Schritten auf ihn zu, nachdem die Damen im Vorzimmer ihn hatten warten lassen. Wollte er ihm schmeicheln? Eine etwas plumpe Art der Captatio Benevolentiae? Der Oberbürgermeister war ein kleiner untersetzter Mann, sodass Seyfert leicht über ihn hinwegsehen konnte, vermutlich eine der wesentlichen Antriebsquellen seines persönlichen Ehrgeizes und Grund für seinen politischen Erfolg. Dieser spontane Blick über den OB hinweg war vielleicht nicht sehr höflich, aber die Aussicht, die sich ihm hier im obersten Stockwerk des Rathauses bot, war schlichtweg überwältigend. Nach drei Seiten hin war das Büro von einer hohen Fensterfront umgeben, die Scheiben reichten vom Boden bis an die Decke, sodass man fast das Gefühl haben konnte zu schweben, über der Stadt zu schweben. Von hier aus hatte der Oberbürgermeister wirklich einen fantastischen Überblick über seinen Zuständigkeitsbereich, den Rhein und die Häuserschluchten, aus denen hier ein höheres Gebäude, dort ein Kirchturm herausragte, in der Ferne die Hügelketten an den Rändern des Rheingrabens und alles dominierend die riesigen Werksanlagen der Fabrik, die jeden Tag hunderte Tonnen von chemischen Produkten ausstieß, auf Züge verlud, die wie Würmer nach allen Seiten aus der Stadt herauskrochen, auf Schiffe und auf Lastkraftwagen. Industrieanlagen konnten auch schön sein, es war nur eine Frage der Perspektive.
Beim Betreten des Rathauses hatte er die Stadt und ihre Gerüche hinter sich gelassen. In diese Räume drangen die vielfältigen Aromen der Großstadt nicht hinein. Hier hörte man nicht die lautstarke Disputation der italienischen Familie, das von ruhigen Gesten begleitete Gespräch der vollbärtigen Anatolier, das Schimpfen der gestressten Mutter und die aggressiven Sprüche der Halbstarken. Hier roch es nach Papier und Klimaanlage, dämpften der Teppichboden und die missbilligenden Blicke der Mitarbeiterinnen jedes zu laute Wort, herrschte die distanzierte Sachlichkeit der Verwaltungsvorschriften. Die Wände des langen Ganges zum Vorzimmer des Oberbürgermeisters waren geschmückt mit Fotografien der herausragenden Bauprojekte seiner Amtszeit und den Porträts seiner Vorgänger.
Seyfert streckte mit einem „Guten Tag“ dem Oberbürgermeister seine Hand entgegen.
„Nehmen Sie doch Platz“, lud er ihn ein. „Möchten Sie einen Kaffee?“
Der Eröffnungs-Smalltalk nahm seinen Verlauf. Er lehnte den Kaffee dankend ab, nahm Platz und schaute noch einmal auf das Panorama jenseits der Fensterscheiben.
„Vielen Dank, dass Sie gleich angerufen haben“, begann Oberbürgermeister Wagner das Gespräch. „Das ist ja eine überraschende Nachricht. Zunächst konnte ich es nicht glauben, aber als man mir sagte, Sie hätten angerufen, da habe ich mir gedacht: Der Mann muss es ja wissen. Wie lange sind Sie denn nun schon dort an der Lukaskirche?“
„Fünf Jahre, und es gefällt mir wirklich gut.“ Franz Seyfert schaute sein Gegenüber offen aber ausdruckslos an.
„Ihren Vorgänger habe ich gut gekannt. War der nicht zwanzig Jahre auf der Stelle? Damals haben wir in Ihrer Gemeinde gewohnt. Er hat unsere Kinder konfirmiert.“ Der Oberbürgermeister strich sich die quergestreifte Krawatte über seinem Bauch glatt und fuhr sich mit der linken Hand durch die Haare. „Die Gemeinde wird immer kleiner, stimmt das? Haben Sie so viele Kirchenaustritte, oder wie kommt das?“
Franz Seyfert war es gewöhnt auf seinen Vorgänger angesprochen zu werden, der gute Arbeit geleistet hatte, aber in diesem Fall war es für ihn ein Zeichen, dass der Oberbürgermeister, was die Kirche betraf, in der Vergangenheit lebte, Sein Hinweis auf die Kirchenaustritte war entweder ein gekonnter Tritt ins Fettnäpfchen oder aber der erste Versuch, sein Gegenüber einzuschüchtern. Also, entweder saß da ein Tollpatsch auf dem Sessel des OB oder ein zielstrebiger Taktiker, der von Anfang an auf Überlegenheit aus war.
„Nun, unser Mitgliederschwund ist bedauerlich, hält sich aber zum Beispiel im Vergleich zu dem der Parteien und Gewerkschaften noch in Grenzen.“ Seyfert lächelte sein harmlosestes Lächeln. „Wir haben immer noch mehr Mitglieder als Ihre Partei Wählerinnen und Wähler.“ Er hatte nicht vor, sich auf so plumpe Weise die Butter vom Brot nehmen zu lassen.
Das Stadtoberhaupt wechselte das Thema und kam zur Sache. Während er seinen Gesprächspartner durch schmale Augen musterte, sagte er: „Wir haben die Bauarbeiten an diesem Teil des Tunnels gleich einstellen lassen. Uns liegt die Geschichte unserer Stadt am Herzen. Ihnen sicher auch!“ Der OB bemühte sich um einen sorgenvoll leidenden Tonfall. „Ich hoffe nur, die Presse bekommt keinen Wind davon. Das möchte ich zunächst vermeiden. Diese Steine stürzen uns nämlich in Probleme.“
Seyfert sah zwar keine Probleme, aber er nickte. Ein Mann von der Erfahrung des Oberbürgermeisters musste recht haben, wenn er so etwas sagte, und falls er nicht recht haben sollte, würde es sicher schwer sein, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Denn ein Oberbürgermeister musste zunächst einmal immer recht haben, sonst begann seine Autorität zu bröckeln.
„Ich habe auch schon mit Ihrer Dekanin gesprochen“, fuhr der OB fort, räkelte sich in seinem Sessel und richtete sich auf. „Sie ist ganz meiner Meinung. Eine kluge Frau haben Sie da in Ihrer Kirche.“
Vielleicht hat er auch schon beim Kirchenpräsidenten angerufen, dachte Seyfert. Warum fährt er diese Bataillone auf? Warum diese Rückversicherung in der Kirchenhierarchie?
„Wir waren uns einig, dass Sie ein verständiger Mann sind, auf den man rechnen kann.“
Seyfert war sich sicher, dass er heute Morgen lediglich die Grundmauer einer alten Kirche gesehen hatte, aber weder eine Giftgasbombe aus dem letzten Weltkrieg, noch ein Massengrab, noch Fässer mit Chemikalien oder was auch immer. Offenbar hatte die Nachricht über die Entdeckung dieser Steine mehr Aufruhr ins Rathaus gebracht, als es die Nachricht von einem Gewinneinbruch in der Fabrik oder ein Flugzeugabsturz auf eine Schule getan hätte. Nun wollte er ein bisschen mehr hören als diese enigmatischen Äußerungen und sublimen Einschüchterungsversuche.
„Ja, leider kann ich den Fund historisch nicht so richtig einordnen“, setzte er an und fuhr fort: „Aber bei der Rheinpfalz gibt es einen Redakteur, der in Kunstgeschichte sehr beschlagen ist. Vielleicht sollte man dort einmal anrufen.“
Wenn er sich hätte winden können, dann hätte sich der Oberbürgermeister nun gewunden, aber angesichts seiner kugelförmigen Figur kam nur ein sanftes Kreisen des Kopfes oberhalb des Maßanzugs heraus.
„Ich denke, das sollten wir unsere eigenen Leute machen lassen. Ich könnte es auch einmal mit einem Anruf beim Landesamt für Denkmalpflege versuchen. Da ist das in besseren Händen als bei der Presse.“ Der OB neigte sich ein wenig vor und fuhr in vertraulichem Ton fort. „Überhaupt, Herr Seyfert, ich halte es für angebracht, dass wir über diese Angelegenheit zunächst einmal Stillschweigen bewahren. Sie können sich doch vorstellen, welche Konsequenzen ein solcher Fund an dieser Stelle hat.“
Natürlich konnte er sich das vorstellen, wobei er zunächst einmal daran dachte, dass es eine erfreuliche Entdeckung war, denn dieser Fund bedeutete, dass die Stadt nicht nur hundertfünfundsiebzig, sondern weit über tausend Jahre alt war. Er bedeutete, dass man die Geschichtsbücher um eine kleine Nuance ändern musste.
„Es bedeutet, das wir die Geschichte unserer Stadt neu schreiben können. Sie wird fortan eine alte Stadt sein, das wird ihr guttun.“ Seyfert beobachtete die Reaktion seines Gesprächspartners genau. „Vielleicht werden wir statt eines umstrittenen Tunnels dort am Rhein bald eine wieder aufgebaute alte Basilika haben.“
Der Oberbürgermeister zuckte, aber nur ein wenig.
Seyfert fuhr in nachdenklichem Ton fort: „Aber wir brauchen auch die Rheindurchquerung.“
„Ich möchte gerne, dass wir so verbleiben, dass diese Angelegenheit zunächst einmal nicht an die Öffentlichkeit gebracht wird.“ Der OB hatte einen Schluck Kaffee aus seiner Tasse getrunken und sich zurückgelehnt. Aus seiner Stimme war jede werbende Wärme verschwunden und einer Kälte gewichen, der es an Eindeutigkeit nicht fehlte. Vielleicht war es dieser Ton, der ihm den Ruf eingebracht hatte, hart zu sein, und der ihm bei seinen Mitarbeitern so viel Antipathie eingetragen hatte. „Ich habe diese Abmachung wie gesagt auch mit Ihrer Dekanin getroffen und ihr zugesagt, dass ich sie auf dem Laufenden halten werde. Ich denke, so können wir miteinander verbleiben.“
Auf Drohungen mit der Kirchenhierarchie reagierte Seyfert in der für seinen Berufsstand typischen Weise, nämlich allergisch. Die reformatorische Erkenntnis von der Gottunmittelbarkeit jedes Menschen pflegte man in der protestantischen Pfarrerschaft auch auf das Dienstverhältnis anzuwenden. Wenn der Job eines Pfarrers oder einer Pfarrerin nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung war, dann war allein schon durch diese Doppelung eine konsequente innerkirchliche Hierarchie ausgeschlossen. Getreu dem biblischen Motto, man könne nicht zwei Herren dienen, zog man sich im Konfliktfall auf die Behauptung zurück, der himmlische Herr stelle andere Anforderungen als der weltliche Dienstherr, selbst wenn dies theologisch nur schwer zu begründen war.
Oberbürgermeister Wagner stand auf. Eine kurze Lektion kommunaler Machtausübung, die erste für Franz Seyfert, und es sollte nicht seine letzte sein. Hatte Wagner auf ihn zunächst noch so sympathisch gewirkt wie auf den Wahlplakaten, mit denen er im Jahr zuvor die Wahl gewonnen hatte, so war ihm nun deutlich geworden, dass ein kleiner dicker Mann keineswegs gemütlich sein musste, und dass der, der nun neben ihm stand, es wahrscheinlich auch nach einigen Gläsern Wein nicht werden würde.
2
Während Seyfert noch auf dem Weg zum Büro des Oberbürgermeisters war und im Aufzug des Rathauses der Anzeige der Leuchtdiode bis in den obersten Stock folgte, hatte er keine Ahnung davon, welche Kreise seine schlichte Beobachtung vom frühen Morgen bereits gezogen hatte.
Bei Balduin Sonntag hatte just in dem Moment, in dem Seyfert den Aufzug betrat, das Telefon geklingelt. Der Ortsvorsteher der Südstadt war an diesem Morgen so früh aufgestanden, wie es sich für einen Rentner geziemte, und das war spät. Der Wecker hatte nicht geklingelt, denn er war nicht eingestellt worden. Die Frau war schon beim Bäcker, als er den rechten Fuß auf den Boden neben seinem Bett stellte, worauf er jeden Tag peinlich genau achtete. Deshalb stand er nie auf, bevor er wirklich richtig wach war, um nicht aus Versehen doch mit dem linken Fuß den Boden zuerst zu berühren, was vermutlich üble Folgen für den Rest des Tages gehabt hätte.
Der Abend vorher hatte den für einen Lokalpolitiker alten Schlages, wie Balduin Sonntag es war, typischen Verlauf genommen. Er war bei einem der Vereine des Stadtteils zu Gast – wobei dies auch eine Ortsbeiratssitzung, eine Ausschusssitzung der Stadtratsfraktion, ein Treffen der Katholischen Arbeitnehmerschaft, der Kolpingfamilie oder was auch immer hätte sein können. Solche Sitzungen erforderten ein gutes Sitzfleisch und eine geduldige Ehefrau, die sich zu beschäftigen wusste. Das wusste Frau Sonntag, die fast fünfzig Jahre mit diesem Mann verheiratet war und außerhalb der Urlaubszeit nur wenige Abende mit ihm allein verbrachte.
Früher hatte sie bei einigen Veranstaltungen mitgemacht, in der Frauenunion zum Beispiel, aber dann widmete sie sich mehr den Kindern und später den Enkeln und begleitete ihren Mann nur noch gelegentlich zu seinen abendlichen oder wochenendlichen Ausflügen in Politik, Vereine und Kirche.
Solche Abende endeten in der Regel bei einem Glas Wein, dem eine Reihe anderer folgten – in der Vereinsgaststätte, im Kolpinghaus oder im Sitzungsraum des Ortsbeirates. Gemeinsames Trinken fördert die Kommunikation, gemeinsames Saufen führte zu so etwas wie einer Blutsbrüderschaft. Es schweißte zusammen, wenn man gemeinsam über die Stränge schlug, es erleichterte die politischen Niederlagen, verstärkte die Euphorie der Siege, auch wenn die im Rausch gefassten Beschlüsse im Licht des nächsten Tages nicht immer Bestand hatten. Aber wie schön war es, über die Sozis zu schimpfen, wenn alle um einen herum derselben Meinung waren, während ein paar Straßen weiter bei den Roten die Vorfreude über den irgendwann sicher zu erwartenden Untergang der Schwarzen heraufbeschworen wurde.
Die Leber von Balduin Sonntag schien sich an diese Lebensweise gewöhnt zu haben, sie war nur leicht vergrößert, aber in seinem Bauch sei noch genug Platz, sagte er immer, und außerdem wüsste auch er nicht, wie lange er noch zu leben hatte. So sah er keinen Grund, etwas zu ändern, denn der Herrgott hatte den Menschen den Wein geschenkt, warum sollte er dann schlecht sein.
An diesem Morgen hatte er die beiden Zeitungen seiner Heimatstadt gelesen, sich darüber geärgert, dass der Bericht von der letzten Ortsbeiratssitzung immer noch nicht erschienen war, und sich über den Kommentar gefreut, in dem die gestrige Rede des Fraktionsvorsitzenden der SPD als kurzsichtig und rechthaberisch bezeichnet wurde. Er brachte seinen Wagen in die Werkstatt und sah die eingegangene Post durch. Er freute sich schon auf das Mittagessen, als bei ihm das Telefon klingelte, während Franz Seyfert im Aufzug des Rathauses bei der Fahrt hinauf in den obersten Stock stand.
„Ich muss in einer halben Stunde beim OB sein!“, rief er in hektischem Ton seiner Frau durch die Wohnzimmertür zu. „Die große Runde ist einberufen worden.“
Frau Sonntag nahm diesen Notruf mit Gelassenheit zur Kenntnis. Die Männer regten sich gerne auf, wahrscheinlich weil sie sich dann wichtig fühlen konnten. Das war eines der innigsten Bedürfnisse der schwächeren Hälfte der Menschheit – alles groß und alt gewordene kleine Jungen, für die die Kommunalpolitik ein Räuber- und Gendarmspiel zu sein schien, bei dem Verlieren und Gewinnen genauso dazu gehörte wie Verstecken, Überlisten und gelegentlich auch Belügen. Bei dem unterm Strich aber nur die wirklich zu den Gewinnern zählten, die die gut bezahlten Posten im Rathaus oder im Landtag bekamen. Den Rest versuchte man mit kleinen Vergütungen und Ehrungen bei Laune zu halten, und wenn es gar nicht anders ging, dann mussten sie als Bauernopfer dienen.
Ihr Mann gehörte zu denen, die immer wieder für die anderen die schmutzige Wäsche gewaschen und verbale Angriffe gegen den politischen Gegner gefahren hatten. Er verhalf dem Kandidaten seiner Partei zum Landtagsmandat, und dafür dufte er sich dessen Unterstützung gewiss sein, wenn es im Stadtteil mal größere Probleme gab. Nach seiner Verrentung, nach vierzig Jahren in der Fabrik machten sie ihn zum Ortsvorsteher. Jetzt hatte er einen Titel und durfte sich noch mehr Abende auf irgendwelchen Sitzungen um die Ohren schlagen. Frau Sonntag sagte nichts dazu, nein, sie sagte ihm sogar, dass sie sich für ihn freue, als er ganz glücklich vom Treffen des Kreisverbandes zurückkam, auf der man ihn zum Kandidaten für die Ortsvorsteherwahl in der Südstadt gemacht hatte, eine Wahl, die er mit großer Wahrscheinlichkeit gewinnen würde bei der traditionellen CDU-Mehrheit in diesem Stadtteil, und die er auch mit deutlichem Vorsprung gewann.
Das war vor zwei Jahren gewesen. Seitdem war er für die Menschen hier im Südosten der Stadt ein wichtiger Ansprechpartner, von dem man erwartete, dass er sich um ihre Anliegen und die Probleme des Ortsteils kümmerte, dass er Politik gestaltete, obwohl die eigentlich im Rathaus gemacht wurde. Bewegen konnte er nur etwas, wenn es dem Oberbürgermeister oder einem der Dezernenten nicht in die Quere kam. Wenn er tat, was man ihm sagte, die Probleme vom Rathaus fern und eine gute Stimmung im Stadtteil aufrecht erhielt, dann war er bei der Verwaltung ein gern gesehener Gast. Wenn er mit Forderungen kam, wies man ihn erst freundlich und dann deutlich in seine Schranken. Entscheidungskompetenzen hatten der Stadtrat und die Verwaltung, aber nicht der Ortsbeirat und der Ortsvorsteher. Aber ihr Mann schien damit leben zu können, und sie konnte sich auch eine schlechtere Gestaltung seines Rentnerdaseins vorstellen.
So machte sich Balduin Sonntag also auf den Weg ins Rathaus zu einer wichtigen Sitzung.
Am folgenden Nachmittag kam einiges an Bewegung in der Stadt, auch wenn die meisten ihrer Bürger davon nichts bemerkten. Franz Seyfert bemerkte ebenfalls nichts davon. Er war gut beschäftigt. Am Nachmittag hielt er seinen Konfirmandenunterricht und am Abend hatte er eine Sitzung des Finanzausschusses seines Presbyteriums, ein wenig erquicklicher Tagesabschluss, denn es ließ sich ganz gut über Geld reden, wenn man welches hatte – obwohl es auch dann Streit darüber geben konnte, wofür man es ausgab – wenn man aber kein Geld hatte oder jedenfalls zu wenig, dann zermürbten die sich daraus ergebenden Diskussionen die Nerven. So ging es ihm in seiner Gemeinde mit einer großen Kirche und einem prächtigen Gemeindehaus, aber einem ebenso imposanten Renovierungsstau.
Im Rathaus und in den Geschäftsstellen der Parteien liefen derweil die Telefone heiß. Der Oberbürgermeister hatte alle aus der großen Runde zum Schweigen verdonnert, nur die Fraktionsvorstände dürften etwas erfahren und natürlich der Ortsvorsteher der Südstadt, das ließ sich nicht vermeiden. Bei dieser Entdeckung handelte es sich um ein Politikum, das hatte der OB schnell erkannt und versuchte, es den anderen mit Nachdruck deutlich zu machen. Man hatte lange um eine Lösung des Verkehrsproblems gerungen, Koalitionen waren deshalb unter Spannung geraten und geplatzt. Nun hatte man sich für das teure Tunnelprojekt entschieden, und da durfte nichts mehr in die Quere kommen. Vor allem durfte die Opposition im Stadtrat nichts erfahren, bevor die CDU und das Wählerforum als Mehrheitskoalition sich auf eine klare Position verständigt hatten.
Es brodelte an diesem Nachmittag in der kleinen Großstadt an drei Stellen gleichzeitig, während bei denen, die direkt davon betroffen waren, ein Kopfschütteln die Runde machte. Wieso gleich am Morgen, noch vor Arbeitsbeginn, der Bauleiter gekommen war und angeordnet hatte, man solle an einer anderen Stelle der Tunnelschlucht weiterarbeiten, warum die Grube, die man am Vorabend ausgehoben hatte, zur Hälfte wieder zugeschüttet werden sollte, das leuchtete den Bauarbeitern, vor allem dem Caterpillarfahrer nicht ein. Aber des Menschen Wille war sein Himmelreich, und bezahlt wurden sie nach Stunden und nicht nach erledigten Kubikmetern. So waren diese eigentümlichen Fundamente am frühen Morgen wieder unter einer zwei Meter hohen Sandschicht verschwunden und harrten geduldig der Dinge, die da kommen sollten.
Was da kommen sollte, das war auch die Frage bei der Fraktionssitzung des Wählerforums. Diese kleine Partei war das dreispitzige Zünglein an der Waage der kommunalen Machtpolitik. Nachdem die CDU sich partout nicht auf eine Koalition mit den Grünen einlassen wollte, es für die Grünen und die SPD aber nicht zur Mehrheit gereicht hatte, war es zur Koalition von CDU und Wählerforum gekommen.
Mit der Behauptung, anders zu sein als die anderen, vor allem bürgernäher, hatten es ein Zahnarzt, eine Lehrerin und ein Frührentner geschafft, in den Stadtrat zu kommen und schließlich zu Mehrheitsbeschaffern zu werden. Die Lehrerin erhoffte sich davon, die nächste Sozialdezernentin zu werden, der Zahnarzt eine Belebung der Praxis und der Frührentner wieder etwas mehr Anerkennung. Profitiert hatte vor allem die nähere Umgebung der drei. Die Patienten des Zahnarztes gingen mit besseren Füllungen nach Hause, weil nun immer öfter ein Stellvertreter in der Praxis arbeitete. Die Schülerinnen und Schüler der Lehrerin erhielten einen besseren Unterricht durch die Ersatzlehrer, und der Frau des Frührentners wurde nicht mehr ständig bei der Hausarbeit über die Schulter geschaut. Was die drei und die anderen fünfzehn Mitglieder der Partei des Wählerforums politisch eigentlich wollten, wussten sie selbst nicht. Auf eine Linie konnten sie sich selten einigen, was schon zu öffentlichen Spekulationen über ein Auseinanderfallen der Partei geführt hatte.
Aber heute Nachmittag wussten die drei, bei denen Fraktion und Fraktionsvorstand zusammenfielen, zumindest eines, nämlich dass der Tunnel weitergebaut werden musste, komme, was wolle. Denn mit diesem Projekt hatten sie im Wahlkampf geworben, sich von den Grünen, die dieses Bauwerk entschieden ablehnten, abgesetzt und ihren Teil aus dem Lager der unzufriedenen Wähler gewinnen können.
Der Zahnarzt mit den grau gefärbten Schläfen des Gutbetuchten und den sauberen Fingernägeln eines akademischen Handwerkers versuchte einen Konsens zu formulieren: „Diese Steine müssen möglichst unauffällig verschwinden, dann können die Arbeiten unbehindert weitergehen. Wir geben der Verwaltung Rückendeckung, und die sollen tun, was sie wollen. Hauptsache, es wird so schnell wie möglich weitergebaut.“
Man hatte sich in einem der Sitzungsräume des Rathauses getroffen. Für drei Personen war er mehr als ausreichend, jedes Mitglied der Fraktion hätte acht bis zehn Stühle belegen können. Aber man hatte ausdrücklich dieses große Sitzungszimmer gefordert, denn an der Größe eines Büros wird die Wichtigkeit seines Besitzers deutlich, und an der Größe eines Sitzungszimmers die Bedeutung einer Fraktion – und hier tagten schließlich die Königsmacher.