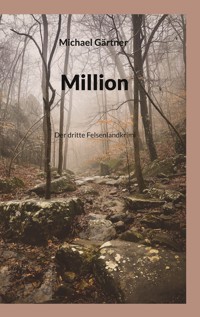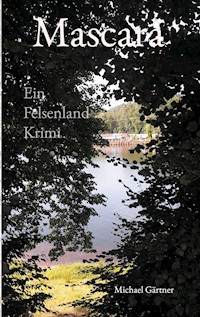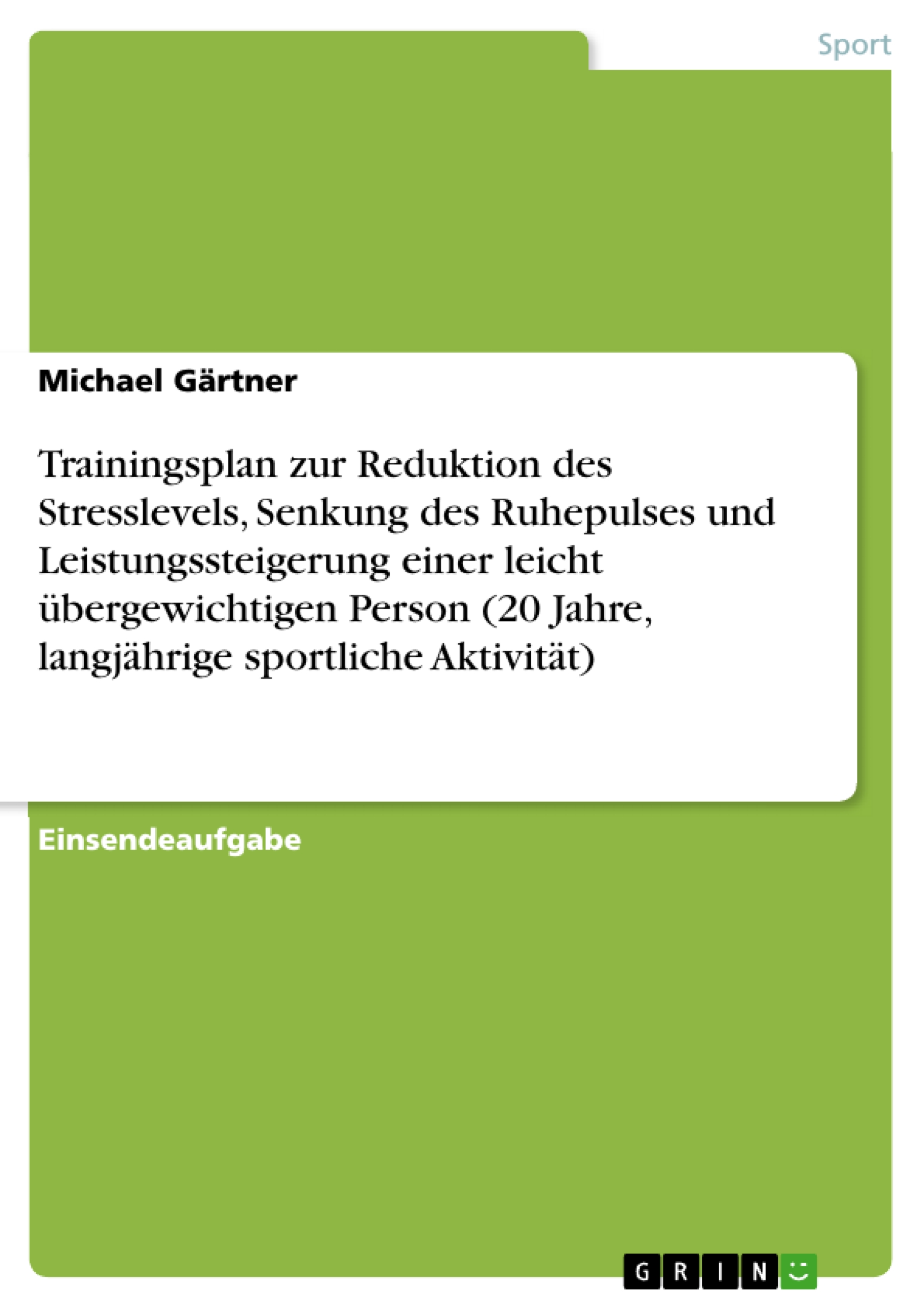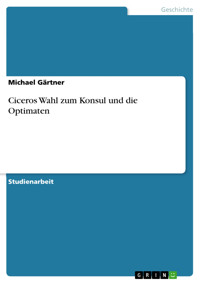Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der plötzliche Tod des amtierenden Bischofs löst eine große Unruhe in der kleinen Landeskirche aus. Sein Stellvertreter sieht seine Chance gekommen, dem allzu liberalen Kurs seiner Kirche ein Ende zu bereiten und selbst die Führung zu übernehmen. Hinter den Kulissen entbrennt ein unwürdiger Machtkampf. Satirisch überspitzt werden die Machtmechanismen in der Kirche und ihre Protagonisten aufs Korn genommen. Ein Lesespaß!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
1
Sie mühte sich die letzten Meter der schmalen, steilen mit groben Steinen gepflasterten Straße hinauf, tauchte in den Schatten ein und stand endlich vor dem Tor. Es war verschlossen, aber sie wusste, dass es sich heute für sie öffnen würde. Sie ging davon aus, dass es sich ab heute fraglos täglich für sie öffnen würde. Das Tor war zu beiden Seiten von hohen, aus massivem Sandstein gefertigten, vom Regen der letzten Tage feuchten und dunklen Gebäuden eingerahmt. Zwischen ihnen spannte sich der steinerne Bogen, der das Tor nach oben hin abschloss und so einen einige Meter tiefen düsteren Durchgang bildete. Die beiden schweren Flügel aus geschmiedeten Eisenstäben waren am Boden in moderne Halterungen eingerastet, an den Rückseiten wurden sie von starken Stangen gehalten, die in den Zylindern einer hydraulischen Schließanlage verschwanden. Die moderne Technik an diesen alten Toren ließ sie unwillkürlich nach den Überwachungskameras suchen, von denen sie aber nur eine entdeckte, die sie fest im Blick hatte und die ihr Bild vermutlich in irgendeinen abgedunkelten Kellerraum übertrug.
Wenn sie nicht gewusst hätte, wo sie sich befand, so hätte sie die Anlage, die sie nun betrat, für eine Burganlage halten können, die man den modernen Bedürfnissen nach Sicherheit entsprechend mit der neusten Elektronik ausgestattet hatte. Doch war das Gebäude gerade gut einhundert Jahre alt und von Anfang für seine heutigen Zwecke errichtet worden. Sie durchschritt die Einfahrt, ohne dass etwas passierte. Als sich vor ihr der Hof öffnete, verstärkte sich der Eindruck, sich in einer Burg zu befinden. Das Haus zur Rechten zog sich in seiner ganzen Massivität mit zwei weiteren Flügeln um die eine Seite des Platzes herum. Das Gebäude zur Linken endete, ohne dass sich ein Querflügel anschloss, sodass auf dieser Seite der Hof nur von einer Mauer abgeschlossen wurde. Sie war nicht ganz so hoch wie die Gebäude an den anderen drei Flanken, sodass nun am frühen Morgen die Sonne schräg hereinfallen konnte. Sie würde in der Mittagszeit ungehindert den Weg auf den Platz finden, um am Abend hinter dem gegenüberliegenden Haus zu verschwinden. Wenn man über diese Mauer hinwegschauen könnte, aber dazu war sie zu hoch und man hatte auch keine Öffnungen gelassen, müsste man einen wunderbaren Blick in das Tal mit dem Fluss und den Weitblick über die sich anschließenden Höhen mit ihren Feldern und Dörfern haben. Vielleicht war es diese Lage auf dem Berg und der mühselige Anstieg vom Parkplatz die letzten hundert Meter eine gepflasterte Straße hinauf, die sie heute auf den Gedanken hatte kommen lassen, sich in einer Bergfestung zu bewegen und nicht im Hof des Landeskirchenamtes.
Heute war ihr erster Tag. Aber sie musste sich nicht lange auf dem Hof orientieren. Sie war schon einige Male hier gewesen in den letzten dreizehn Jahren, seit sie ihr Examen in diesen heiligen Hallen abgelegt hatte. Gegenüber der Einfahrt befand sich am rückwärtigen Gebäude eine große Freitreppe, die zu einem geschwungenen Portal hinaufführte, das durch eine schwere zweiflügelige Eichentür verschlossen war. Auch über diese Entfernung konnte sie Klingel und Gegensprechanlage erkennen. Sie wusste, wo sie hingehen musste, nutzte aber den Weg über den Hof dazu, sich ein wenig umzuschauen. Die Fassaden der drei Gebäudeteile waren in einer faszinierenden Gleichförmigkeit gestaltet und erinnerten sie an die Schlösser, die sie in ihrem letzten Urlaub besichtigt hatte. Nur das mittlere Stockwerk des Gebäudes, das den Hof zur Rechten abschloss, fiel durch eine Reihe besonders hoher Fenster auf, hinter denen sich ein Saal verbarg. Zu beiden Seiten der Freitreppe standen je einen großen Blumenkübel, doch der Oleander mochte in dem dürftigen Sonnenschein nicht recht gedeihen. Der Hof war mit denselben unbequemen Granitsteinen gepflastert, die sie schon vom Parkplatz zum Tor hinauf hatte treten müssen. Eine ausgefahrene Spur führte zu einem großen Garagentor im Kellergeschoss jenes Gebäudeteiles, den sie gerade zur Linken hinter sich gelassen hatte. Diese leichten Vertiefungen im Pflaster waren das einzige Zeugnis von Leben, das dort zu entdecken war. Es roch muffig, der Regen der letzten Woche war in die Sandsteine eingezogen, und das bisschen Sonne, das man einmal pro Tag in diesen Hof ließ, hatte nicht ausgereicht, um für Trockenheit zu sorgen.
Sie ging die Freitreppe empor, wandte sich um, warf einen Blick zurück auf die sich finster vor dem Himmel abzeichnenden Gebäude und wagte es dann, auf den Klingelknopf zu drücken.
„Ja, bitte?“ schnarrte es aus dem Lautsprecher.
„Judith Engel. Ich möchte zu Bischof Dr. Martin.“
Der Türöffner summte. Dr. Judith Engel wollte gerade die schwere Tür aufdrücken, als sie hinter sich mit gedämpftem Poltern einen Wagen in den Hof rollen hörte. Sie drehte sich um und sah einen Leichenwagen, der vor dem Seiteneingang des Haupttraktes hielt. Als die Tür mit einem dumpfen Geräusch zu fiel, wurde die Heckklappe des Wagens geöffnet, und die beiden Männer in dunklen Anzügen zogen einen Sarg von der Ladefläche.
2
Hatte Oberkirchenrat Johannes Steufel ein leises Lächeln auf den Lippen gehabt, als er die Sitzung verließ? Marliese König arbeitete schon zwanzig Jahre in diesem Büro, hatte dem alten Bischof genauso treu gedient, wie dem neuen, der nun auch nicht mehr jung war, ein Mann Ende fünfzig, der aber doch noch einige Zeit vor sich haben würde. Er galt als liberal und war es auch. Sie hatte sich daran gewöhnt, auch wenn es ihr manchmal schwerfiel, zu akzeptieren, dass nicht alles beim Alten blieb, dass die Kirche sich änderte, dass die überkommene Ordnung infrage gestellt wurde. Aber sie diente diesem Chef genauso ergeben, wie ihrem alten, denn er war der Bischof und sie war die Sekretärin des Bischofs, nein, eigentlich war sie die Bischofssekretärin, denn sie gab es auf dieser Stelle bereits, als Dr. Martin noch Probst gewesen und sich immer über sie zu einem Gespräch mit dem damaligen Bischof anmelden musste. Sie hatten alle schon auf dem schmalen Stuhl gegenüber von ihrem Schreibtisch gesessen, den Arme-Sünder-Stuhl, wie sie ihn gerne für sich nannte, und hatten darauf gewartet, dass sie sie zu ihm hineinließ. Nur dieser Dr. Stein setzte sich nie auf diesen Stuhl, stand lieber gestanden oder ging hin und machte spöttische Bemerkungen über ihren Zimmerschmuck oder den Zustand ihrer Zwischenablage.
Dabei war es Marliese König so wichtig, dass alles seine Ordnung hatte. Das begann für sie mit ihrer Kleidung, immer ein Kostüm, meistens in dezentem Grau, die Bluse in Weiß, nur selten ein kleiner farblicher Akzent, die Dauerwelle wöchentlich erneuert und der Haaransatz vierzehntägig blond nachgefärbt. Es setzte sich fort mit einer ausgesprochen gründlichen täglichen Reinigung des Büros des Bischofs und ihres Vorzimmers, an die sie die Putzkraft stets erinnerte, manifestierte sich in sorgfältig geschriebenen Briefen, wie sie der Schreibkraft zu sagen nicht müde wurde, zeigt sich in der korrekten Anrede von Dr. Martin mit „Herr Bischof Dr. Martin“, auf die sie jedem Anrufer und Besucher hinwies, und kulminierte darin, dass man mindestens zwei Minuten auf dem Sitzmöbel gegenüber von ihrem Schreibtisch zu sitzen hatte, bevor man das Allerheiligste betreten durfte. Bei einem Besuch des Ministerpräsidenten wollte sie diesen gerade auf den Sitzplatz hinweisen, als Dr. Martin aus seinem Zimmer kam und eine mittelgroße Verstimmung im Verhältnis von Kirche und Staat gerade noch abweisen konnte.
Die wievielte Sitzung des Kollegiums es heute war, die sie miterlebt und mitbegleitet hatte, wusste sie nicht. Sie hatte nie gezählt. Wenn sie gezählt hätte, dann wäre sie irgendwo jenseits der Tausend angekommen. Über tausendmal Tagesordnungen schreiben und sie den Sekretärinnen der Oberkirchenräte und den Referenten zusenden, über tausendmal Kaffee und Tee vorbereiten, Obst und Gebäck auf dem Sitzungstisch richten, den leisen und manchmal auch sehr lauten Tönen aus dem Sitzungsraum lauschen, neuen Kaffee hineinbringen und schließlich aufräumen. Manchmal wurde sie hineingerufen, wenn es etwas zu erledigen gab. Dann bekam sie mit, wie die Stimmung war. Worum es ging, worüber sich die fünf Herren und die eine Dame unterhielten, das wusste sie meistens, schließlich schrieb sie die Tagesordnungen, bereitete die einzelnen Tagesordnungspunkte vor und fertigte einen Großteil der Briefe an, mit denen die Beschlüsse vollzogen wurden. Sie wusste, was in diesem Landeskirchenamt ablief. Sie war eine der bestinformierten Frauen der ganzen Landeskirche, aber sie konnte schweigen. Sie schwieg auch darüber, was sie spürte, wenn sie in die Sitzung hineingerufen wurde, oder was sie aus den Gesichtern lesen konnte, wenn die Mitglieder des Kollegiums den Raum verließen. Sie bemerkte die eisige Atmosphäre, wenn die Meinungen wieder einmal heftig aufeinandergeprallt waren, wenn die internen Machtkämpfe sich an Personalentscheidungen festmachten, wenn man darum rang, wer was vor der Öffentlichkeit oder vor der Landessynode vertreten durfte. Davon drang kaum je etwas nach außen. Nach außen, da stützte man sich gegenseitig, trug einhellig die Entscheidungen des anderen mit, verstand sich als Repräsentanten der Kirche, deren gesellschaftlichen Einfluss es zu erhalten galt. Gelegentlich beobachtete sie auch das Kommen und Gehen der Verbindungsmänner in die Synode, der Strippenzieher der synodalen Gruppen, die jeweils ein Mitglied des Kollegiums unterstützten und für die anderen die Fallstricke spannten. Sie konnten damit rechnen, irgendwann auf einen Posten gehievt zu werden, der sie aus der Masse der Pfarrerinnen und Pfarrer heraushob, mit nur wenig mehr Gehalt, aber dafür deutlich mehr Publicity und dem Gefühl von Bedeutung.
Oberkirchenrat Johannes Steufel hatte gelächelt, als er aus dem Sitzungszimmer gekommen war. Gerade er, der zwar der Stellvertreter des Bischofs war, aber zugleich sein größter Gegenspieler. Die Stimmung musste gut gewesen sein. Zum Glück, das würde das Arbeiten in diesen hohen stuckverzierten Räumen in den nächsten Tagen leichter machen. Nach und nach kamen die anderen. Auch die schienen keineswegs erregt, wenn auch nicht so entspannt wie Oberkirchenrat Steufel.
Oberkirchenrat Fritz Meyer machte wieder eine seiner üblichen Bemerkungen zu ihr, die witzig sein sollten, aber vor allem anzüglich waren. Marliese König hatte es aufgegeben, sich dagegen zu wehren. Es half sowieso nichts. Einmal hatte sie sich sogar bei dem Gedanken erwischt, dass OKR Fritz Meyer sie immerhin noch als Frau wahrnehme, was man von den meisten anderen Männern nicht mehr sagen konnte.
OKR Rufus Liber fragte sie mit dieser sterilen Freundlichkeit, mit der er allen Menschen begegnete, vor allem denen, die ihm gleichgültig waren, denn wirklich interessiert war er nur an Büchern, mit denen er den größten Teil seiner Zeit verbrachte, wie es ihr ginge. Aber er war wenigstens freundlich, fast immer freundlich, und das war keine Selbstverständlichkeit bei diesen hohen Herren.
OKR Dr. Stein passierte ihren Schreibtisch mit einem „So, jetzt ist es vorbei mit dem Ausruhen, Frau Königin. Der Tisch muss abgeräumt werden.“ Ein Satz, den er häufig sagte, wenn ihm kein anderer Sarkasmus einfiel. Hinter ihm trottete seine folgsame Rechtsdirektorin, in unscheinbarem Grau von den Haaren bis zu den Kniestrümpfen unter dem knöchellangen Wollrock.
Der Bischof saß ein wenig erschöpft am großen runden Sitzungstisch. Marliese König riss die Fenster auf, um etwas von der würzigen Herbstluft unter den Sitzungsmief zu mischen. Der Blick hinunter auf die Stadt war einfach überwältigend, besonders in diesen Wochen, in denen sich die Laubbäume bunt gefärbt hatten und die Zugvögel sich in großen Schwärmen sammelten, laut kreischend ihre Kreise über den Häusern und Straßen zogen, um dann scheinbar plötzlich in den Süden aufzubrechen. Marliese König fühlte sich diesen Tieren verbunden. Wenn sie Urlaub hatte und all das hier einmal hinter sich lassen konnte, dann zog es sie in den Süden, in ein kleines Hotel in Soller auf Mallorca. Dort konnte sie all die Verlogenheit und die Intrigen, die in diesem Mauern herrschten, vergessen.
Oft fragte sie sich, wie ihr Chef das alles aushielt. Normalerweise kam so ein Mann wie er nicht auf den Bischofsstuhl. Er hatte nicht zu denen gehört, die über Jahre hinweg im Hintergrund an ihrer Karriere arbeiteten. Er war ein Kompromisskandidat, weil die Fraktionsdisziplin in den kirchenpolitischen Gruppen nicht funktionierte. Die beiden großen Gruppierungen konnten sich nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen. Also stellten beide einen auf und versuchten, Stimmen aus der dritten, kleinsten Gruppierung zu gewinnen und die wenigen wirklich unabhängigen Synodalen auf ihre Seite zu bekommen. Beide Gruppen waren sich ihrer Sache sicher gewesen, aber sie hatten nicht mit den Dissidenten in den eigenen Reihen gerechnet. So hatte man sich nach misslungener Wahl auf einen dritten Kandidaten geeinigt, von dem alle annahmen, er sei so schwach, dass man ihn im Landessynodalausschuss gängeln könnte. Die beiden ursprünglichen Bewerber wurden gut versorgt. Der eine, Johannes Steufel, war nun Oberkirchenrat, den anderen machte man zum Chef im Diakonischen Werk. Beide versuchten immer wieder, dem Bischof das Leben schwer zu machen.
Sie wollte sich gerade umwenden, als sie das Klirren einer Tasse gefolgt von einem dumpfen Aufschlag hörte. Erschrocken drehte sie sich um. Der Bischof lag am Boden neben dem Sitzungstisch, der Mund geöffnet, die Augen aufgerissen.
Marliese König stieß einen Schrei aus. OKR Dr. Stein, der sich im Vorzimmer ein wenig die Korrespondenz des Bischofs angeschaut hatte, kam herein und fragte noch in Tür: „Was ist denn Königin? Will Ihnen der Bischof an die Wäsche?“ Dann sah er den Bischof neben dem Tisch, beugte sich zu ihm hinunter und sagte nach wenigen Augenblicken: „Er ist tot. Rufen Sie einen Arzt und seine Frau. Ich kümmere mich um den Rest.“
„Der Ministerpräsident erwartet eine genaue Untersuchung des Todes.“ Staatssekretär Baldauf hatte sich mit Rechtsdirektorin Gundula Wiesnhüter in Verbindung gesetzt und die Reaktion der Landesregierung mitgeteilt. Das offizielle Beileidstelegramm an die Frau des Bischofs sowie die Pressemeldung wurden bereits vorbereitet. Der plötzliche Tod des Bischofs hatte die gesteigerte Aufmerksamkeit der Landesregierung erregt. Denn für sie war es nicht unwichtig, wer die Evangelische Kirche im Land führte. So war es im Staatsvertrag unter anderem geregelt, dass sich die Kirchenleitung mit der Landesregierung bezüglich der Bischofskandidaten ins Benehmen zu setzen habe. Dieser Bischof war zwar nicht von Anfang an der Wunschkandidat der Landesregierung gewesen, man hatte jedoch keinen prinzipiellen Einwand gehabt. Er erwies sich dann allerdings als ein verlässlicher Partner und liberaler und aufgeschlossener Kirchenführer, dem es wichtig war, dass sich die Kirche nicht hinter ihre Mauern zurückzog, sondern sich als Kirche in der Welt und für die Welt darstellte. Er vertrat die Interessen der Frauen, trieb die Diskussion über die Stellung der Kirche zur Homosexualität mutig voran und erhöhte die Akzeptanz seiner Kirche im Land und bei den politisch Verantwortlichen deutlich. Er machte sich aber auch viele Feinde, gerade im Zusammenhang der Auseinandersetzung um die Fragen der Homosexualität und seine Befürwortung eines kirchlichen Traugottesdienstes für eingetragene gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. Das ging über öffentliche Angriffe und Diffamierungen bis zur Androhung von Gewalt. Die innerkirchliche Opposition war stark und gut organisiert, OKR Steufel profilierte sich als Kritiker der Linie des Bischofs, favorisierte einen Kompromiss und erwies sich nach einem Votum der Synode im Sinne des Bischofs als ein schlechter Verlierer, der in der Folgezeit hinter den Kulissen gegen eine Wiederwahl des Bischofs arbeitete
Er hatte nun die Geschäfte zu übernehmen und war mit dem Tod des Bischofs zum Ansprechpartner für die Landesregierung geworden. Vielleicht würde er auch dessen Nachfolge antreten. Man horchte auf in der Staatskanzlei. Steufel war drei Jahre jünger als Dr. Martin, würde also nach dessen regulärer Ruhestandsversetzung kaum eine Chance haben, sein Nachfolger zu werden, und wenn doch, dann nur für einen zu kurzen Zeitraum, um in die Annalen seiner Kirche eingehen zu können. Deshalb hatte er seine einzige Chance darin gesehen, die in einem Jahr anstehende Wiederwahl des Bischofs zu vereiteln. Aber dessen Position war in den letzten Monaten eher noch stärker geworden.
Steufel wurde von staatlicher Seite als ein problematischer Kirchenführer angesehen. Ihm wurden Verbindungen zum Protestantischen Bund nachgesagt, einem europaweiten Zusammenschluss konservativer protestantischer Kirchenleute, die eine Reorganisation der Kirchen im Sinne einer stärkeren Hierarchisierung, die Abschaffung der Frauenordination und Rückkehr zum völligen Verbot der Abtreibung und die Einführung der Todesstrafe anstreben. Dies alles konnte nicht im Interesse der Landesregierung sein.
3
Es war am frühen Nachmittag, als die fünf anderen sich wieder versammelten. Die Termine für den Tag waren abgesagt. Krisenmanagement war angesagt. OKR Steufel nahm das Ruder für das Kirchenschiff in die Hand.
Er ging in die Toilette neben seinem Büro, wusch sich die Hände, schob die Krawatte zurecht, kontrollierte die Frisur und zog den Scheitel nach. Er musste dafür gerüstet sein, dass selbst das Fernsehen heute etwas von ihm wollte. Noch war Polen also nicht verloren. Der Bischof ist tot, es lebe der Bischof. Er war sich seiner Sache sicher, fast sicher. Er würde der nächste Bischof dieser Kirche sein. Manchmal hatte er die Hoffnung schon aufgegeben. Aber es hatte sich wieder einmal gezeigt, Gott ist mit dem Gerechten. Bete und arbeite, das war immer sein Motto gewesen. Gebetet hatte er darum, dass er doch noch einmal der Bischof werden könnte, getan hatte er auch etwas dafür – nun war es so weit. Er würde die Früchte seiner Bemühungen ernten können.
Man hatte sich im kleinen Prüfungssaal versammelt, in dem zweimal im Jahr die Kandidatinnen und Kandidaten der Theologie schwitzen mussten, um das erste theologische Examen zu bestehen, um aufgenommen zu werden in den Kreis der Vikarinnen und Vikare, um die Laufbahn eines Geistlichen einschlagen zu können, um als Beamte auf Lebenszeit zu einem Teil des Systems zu werden. Freilich kamen sie mit ganz anderen Zielen, die meisten mit hohen Idealen. Am besten überlebten die, die wollten, dass alles so bliebe, wie es ist, die keine unnötige Energie in Veränderungsprozessen verschwendeten. Die wenigen Neurotiker, die immer wieder über beide Examen hinweg in den kirchlichen Dienst hereinschwappten und entweder in einer Art Regression Geborgenheit im Schoße von Mutter Kirche suchten oder die Eigenständigkeit des Pfarramtes als eine Möglichkeit erkannt hatten, eine solipsistische Selbstbezogenheit ausleben zu können, konnte man in der Regel nach einigen Jahren, wenn auch mit hohen Kosten, auszusortieren. Mit den Idealisten aber hatte man ein Berufsleben lang Probleme. Sie machten ihre Arbeit gut, sie waren in den Gemeinden beliebt, sie strebten auch immer wieder in leitende Ämter, aber bedauerlicherweise wollten sie etwas verändern, maßen die Kirche an der Botschaft Jesu Christi und waren mit ihrem momentanen Zustand nicht zufrieden.
OKR Steufel legte Wert darauf, dass alles beim Alten blieb, dass man wieder zu dem zurückkam, was bis vor wenigen Jahren unbestritten gewesen war. Er ließ sich Zeit. Erst als er sicher sein konnte, dass die anderen schon zehn Minuten im Sitzungssaal waren, verließ er sein Büro und begab sich in den kleinen Prüfungsraum. Er ließ sich am Kopfende des Tischs nieder, ordnete seine Papiere, schlug das Gesangbuch auf und sagte: „Liebe Brüder“, die anwesende Schwester Gundula Wiesnhüter, schien er nicht wahrzunehmen, „lassen Sie uns gemeinsam den ersten Psalm sprechen. Bischof Dr. Martin hat seinen Lebensweg vollendet. Wir wollen für ihn beten:
„Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen
noch tritt auf den Weg der Sünder
noch sitzt, wo die Spötter sitzen,
sondern hat Lust am Gesetz des Herrn
und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht!
Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den
Wasserbächen,
der seine Frucht bringt zu seiner Zeit,
und seine Blätter verwelken nicht
und was er macht, das gerät wohl.
Amen“
„Wie oft hat Dr. Martin im Rat der Gottlosen gesessen“, dachte OKR Steufel während sie gemeinsam in getragenem Ton den Psalm lasen. „Wie oft hat er sich mit der Vereinigung Homosexuelle und Kirche getroffen, wie oft hat er beim Theologinnenkonvent gesessen. Der Gerechte wird sein wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen. Jetzt ist die Zeit angebrochen, in der ich Frucht bringen werde.“
Dr. Stein hatte während des ganzen Psalms starr auf die Porträts der verblichenen Bischöfe gestarrt und an seiner kalten Pfeife gezogen. Er war aus dem Alter heraus, in dem er heucheln musste, vor allem angesichts dieser Frömmelei des Herrn Kollegen Steufel. Er sagte kein Wort, zog aber, kaum dass das Amen gesprochen war, seine Streichhölzer aus der Tasche und setzte seine Pfeife in Brand, die er normalerweise während der Kollegiumssitzungen kalt und vor sich auf dem Tisch liegen ließ. Er erntete erstaunte Blicke seiner Kollegen. Steufel versuchte es mit Missbilligung, schaute aber sofort nach unten, als er auf die selbstbewussten Augen von Dr. Stein traf.
Rufus Liber erklärte sich das ungewöhnliche Verhalten des Juristen durch dessen Angespanntheit wegen des Todes von Bischof Dr. Martin und ließ ein verständnisvolles Lächeln über sein Gesicht gleiten.
Nur OKR Meyer grinste unmerklich, denn er konnte sich vorstellen, welche Verachtung in Dr. Stein angesichts der Scheinheiligkeit von Steufel heraufgestiegen sein musste. Meyer gewann wie auch sonst in dieser Situation das ihn tragende Gefühl der Überlegenheit dadurch zurück, dass er für die Ereignisse und die Verhaltensweisen seiner Mitmenschen historische oder soziologische Parallelen suchte, sie im weitmaschigen Netz seiner psychologischen Kenntnisse filterte, sie auf diese Weise bannte und sich eine Bewertung ersparte. Gelegentlich traf er ins Schwarze, so auch in diesem Moment, als er das für ihn unerträgliche Verhalten von OKR Steufel für sich mit den Worten kommentierte: Der König ist tot – es lebe der König! Diesmal war es eben ein Bischof.
„Liebe Kollegen, es lastet nun eine große Verantwortung auf uns. Wir müssen ab sofort das Ruder des Kirchenschiffs übernehmen, bis die Synode sich entschieden hat, wem sie es für die nächsten Jahre übergeben möchte.“ Steufel hatte eine bestätigende Reaktion erwartet, ein anerkennendes Nicken für seine Tatkraft, ein bedauernder Blick angesichts der ihn nun erwartenden Aufgabenfülle. Aber die Kollegen blieben stumm. Also fuhr er fort: „Ich werde nun die Aufgaben des Bischofs übernehmen, kommissarisch sozusagen. Ich weiß im Moment noch nicht, wie ich dabei gleichzeitig die umfangreichen Arbeiten des Personaldezernates erledigen kann. Gegebenenfalls müssen in diesem Bereich einige Entscheidungen warten.“
Rufus Liber konnte dies nicht mit ansehen und bot sich an: „Lieber Herr Vizebischof!“
Der Liber lernt in seiner Devotion schneller als andere, dachte Steufel.
„Ich bin gerne bereit“, fuhr Rufus Liber fort, „Ihnen in diesem Bereich zur Seite zu stehen. Die Bücher in der Bibliothek sind in der Regel doch noch etwas geduldiger als unsere Pfarrerinnen und Pfarrer.“ Dabei lächelte er wiederum verständnisvoll und Zustimmung heischend.
„Ich weiß dieses Angebot zu schätzen, Herr Kollege“, antwortete Steufel huldvoll und entschied sich zugleich, nie wieder darauf zurückzukommen. Liber schaute demütig mit einem süßlichen Lächeln unter sich.