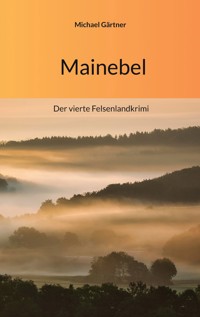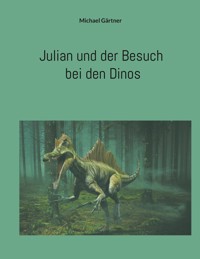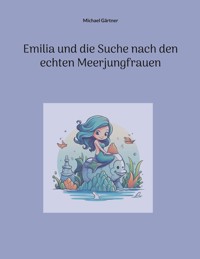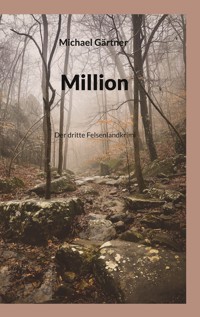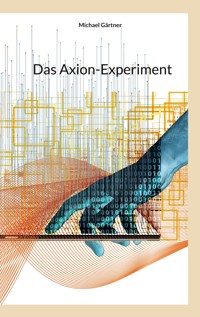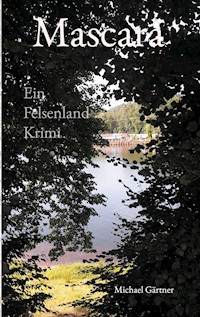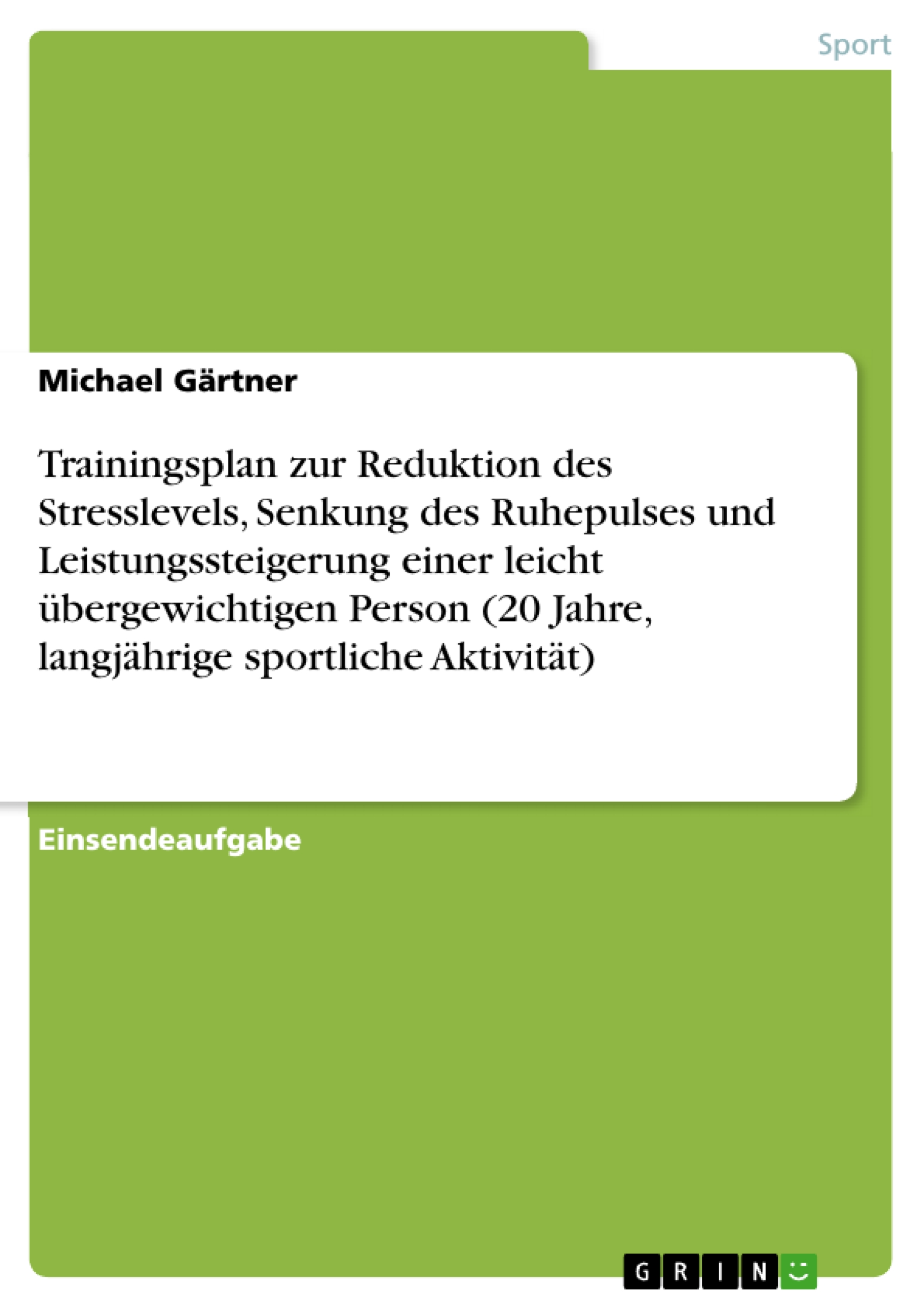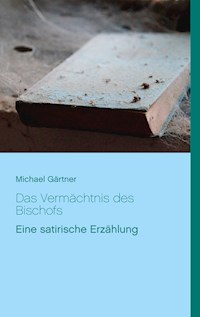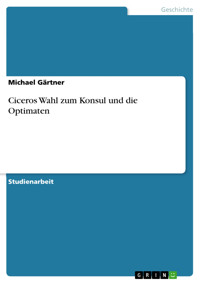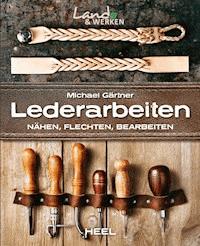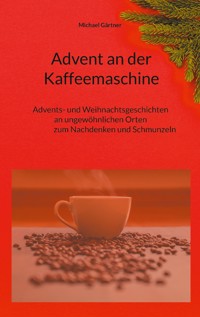
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichten dieses Sammelbandes spielen in für Advents- und Weihnachtserzählungen ungewohnten Umgebungen und erzählen ungewöhnliche Begebenheiten. Allen gemeinsam ist die Zeit, in der sie spielen: die Wochen des Wartens und Feierns in der dunklen Jahreszeit. Sie erzählen von Anfängen zu einem guten Miteinander im Kleinen. Zum Lesen und Vorlesen. Die Leselänge ist angegeben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 84
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorbemerkungen
Advent an der Kaffeemaschine (12‘)
Das unentschlossene Christkind (5‘)
Der Traum des Intendanten (8‘)
Nicht das letzte Weihnachten (4‘30)
Licht im Lehrerzimmer (10‘30)
Sägmühlweiherweihnachtsfeier (7‘)
Heiligabend auf dem Lutherplatz
Das Kreuz (2‘)
Das Virus (5‘)
Die Traumtänzer (2‘)
Die Bäume (2‘)
Die Tauben (1‘30)
Die Ratten (3‘)
Begegnung am Ludwigsplatz (4‘30)
Unter der Brücke (11‘)
Weihnachtsbaumkerzen (7‘)
Das Krippenspiel (7‘)
Schneewehen auf der A 6 (4‘30)
Jingle Bells (9‘30)
Recogne-Bastogne (10‘)
Die Figuren der Erzählungen sind frei erfunden und haben keine Ähnlichkeit mit lebenden Personen
Vorbemerkungen
Die folgenden Geschichten spielen in für Adventsund Weihnachtserzählungen ungewohnten Umgebungen und erzählen ungewöhnliche Begebenheiten. Allen gemeinsam ist die Zeit, in der sie spielen – die Wochen des Wartens und Feierns in der dunklen Jahreszeit.
Weihnachten war der Anfang eines Neuanfangs mit einer stillen Revolution von unten. Das Kind, das in jener Nacht geboren wurde, versuchte als Erwachsener die Welt zu verbessern. Jesus bot seinen Mitmenschen einen neuen Anfang mit Gott und den Menschen an, um die Welt zu einer besseren Welt zu machen. Vieles ist gelungen, vieles wartet noch auf Verwirklichung.
Sein Weg:
Friedensliebe statt Machtgelüste,
Leidensfähigkeit und Sanftmütigkeit,
Bescheidenheit statt Luxus,
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit.
Kann man so wirklich die Welt verändern? Es wird dauern, aber so könnte es gehen. Und: Es beginnt im Kleinen, bei den Einzelnen und wird wirkmächtig, wenn sie sich zusammentun.
Die folgenden Geschichten erzählen von Anfängen im Kleinen – zum Lesen und Vorlesen. Die (Vor-) Leselänge ist angegeben.
Ludwigshafen 2024 Michael Gärtner
Advent an der Kaffeemaschine
Kaffee ist ein soziales Getränk – in dem Sinne, dass er Menschen zusammenbringt. Ob er auch als sozial in Bezug auf die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung derjenigen genannt werden kann, die die Kaffeebohnen anbauen und ernten, soll an dieser Stelle dahingestellt, aber als Problematik nicht unerwähnt bleiben.
Kaffeetrinken ist zumeist ein soziales Unterfangen – vielleicht abgesehen von dem einsamen Schriftsteller, der versucht, sich und sein Schreibgerät durch die Zufuhr von Koffein in Gang zu halten. »Lass uns doch einen Kaffee trinken gehen!« oder: »Möchtest du nicht morgen Nachmittag zum Kaffee kommen?« sind nahezu feststehende Redewendungen, die ein Treffen meinen, bei dem keineswegs immer alle Beteiligten Kaffee trinken. Es könnte auch Tee oder Kakao sein. Manche bevorzugen je nach Jahres- oder Tageszeit alkoholische oder andere nicht alkoholische Getränke. In der Weihnachtszeit ist auch Punsch, Grog oder Glühwein angesagt. Auf jeden Fall: Bei dem Ausdruck ‚Kaffeetrinken‘ denkt man an gemütliche Stunden im Kreise lieber Menschen.
Daneben gibt es die weniger formalisierten Formen des gemeinsamen Kaffeetrinkens, wobei auch die selbstverständlich unausgesprochenen Regeln des Miteinanders unterliegen.
In Betrieben, Büros und Lehrerzimmern sind die Kaffeemaschinen der Ort, an dem man sich trifft. Manche lugen, bevor sie sich auf den Weg zu besagter Maschine machen, zunächst verstohlen dorthin, um sicherzustellen, dass sich am Ort ihrer Begierde niemand befindet, den sie nicht treffen möchten. Sollte dies der Fall sein, geht man voller Vorfreude an das Gerät, nimmt seinen Kaffeebecher mit oder – je nach Arrangement – einen frischen aus dem Regal und bedient sich. In früheren Zeiten stand da eine Thermoskanne, aus unerfindlichen Gründen bis heute in manchen Fernsehserien noch beliebt. Auf sie folgte die Kaffeemaschine mit Durchlauferhitzer und Filterkaffee. Heute haben sich weitgehend die Vollautomaten durchgesetzt. Einige behaupten, der Kaffee sei besser, auf jeden Fall machen diese in der Regel dekorativen Maschinen mehr her – andererseits auch mehr Krach. In größeren Einheiten findet man den Automaten, der von einer Fremdfirma befüllt wird, in kleineren – zumeist bei kreativen Menschen – die klassische italienische Espressomaschine mit Siebträger und manuellem Milchaufschäumer.
Im Lehrerzimmer des altsprachlichen Gymnasiums stand der Vollautomat eines bekannten schweizerischen Herstellers. Der freundliche Studiendirektor, der auch ansonsten das ‚Mädchen für alles‘ an dieser Schule war, hatte die Wartung übernommen. Er sorgte in den erforderlichen Intervallen für das Entkalken und die Reinigung. Wasser und Kaffeebohnen nachfüllen konnten inzwischen die meisten Mitglieder des Kollegiums. Nur mit dem Reinigen des Milchsystems gab es immer wieder Probleme. Keiner fühlte sich zuständig und vor allem die Vertreter der Geisteswissenschaften verstanden den Ablauf nicht so richtig. Ein einzelner lang gedienter Altphilologe – er zeichnete sich durch eine gewisse Misogynie aus – kam gar nicht mit dem Gerät zurecht. Er stellte seine Tasse konsequent unter den jeweils falschen Auslauf, wusste oft nicht, welche Taste die richtige war, und musste immer wieder – sich selbst erniedrigend, aber vom Verlangen nach Kaffee getrieben – eine der jungen Kolleginnen fragen, was er denn nun tun müsse, um an das begehrte Gebräu zu kommen. So sorgte der technische Fortschritt für eine neue Variante der Geschlechtergerechtigkeit.
Die letzten Wochen vor Weihnachten sind – ähnlich den letzten vor den Sommerferien – die Zeit in einer Schule, in der man klugerweise jedem möglichen Konflikt aus dem Weg geht. Auch Ehegatten und Kinder von Lehrerinnen und Lehrern wissen, dass spätestens ab Mitte Dezember die kleinste Kleinigkeit genügt, um das blank liegende Nervenkostüm eines Lehrers oder einer Lehrerin blitzartig – sowohl was die Geschwindigkeit als auch was die Höhe der sich entladenden Spannung betrifft – zusammenbrechen zu lassen, begleitet von dem Donner eines Schreis, einer Faust auf dem Tisch oder eines Tellers an der Wand. Entsprechend vorsichtig geht man in den Lehrerfamilien miteinander um, versucht unnötige Diskussionen zu vermeiden und alle Probleme auf die Zeit zwischen den Jahren zu verschieben – was nicht immer gelingt, da man sich zumindest über das Essen an den Weihnachtsfeiertagen einigen muss.
Auch in jenem Lehrerzimmer versuchte man in diesen Wochen einfühlsam miteinander umzugehen. Das schafften die meisten, nur die allgegenwärtigen Egomanen und Narzissten ließen ihre Anspannung an den Kolleginnen und Kollegen aus – manche sogar an den Schülerinnen und Schülern.
Jener altgediente Altphilologe hatte in diesen sensiblen Wochen ebenfalls gelegentlich das Bedürfnis nach Kaffee, jedoch ohne die vorweihnachtliche Erleuchtung, wie die Maschine richtig zu bedienen sei.
Nun hatte er einmal eine Freistunde und das Lehrerzimmer war leer. Eine Krankheitswelle hatte das Lehrerkollegium heimgesucht und jede verfügbare Lehrkraft musste Vertretungsstunden übernehmen. Fast jede, denn den Altphilologen hatte es nicht getroffen und auch nicht die junge Biologielehrerin. Sie war Anfang dreißig, hübsch und dem Altphilologen ein Dorn im Auge. Die Ursache seines Unmuts war jetzt bei den winterlichen Temperaturen nicht zu erkennen. Im Sommer jedoch, wenn die Ärmel und die Röcke kürzer wurden, war der Grund seines Missfallens unübersehbar. Die junge Biologielehrerin war tätowiert – sowohl der linke Arm als auch das linke Bein, nur Hand und Fuß waren ausgenommen. Offenbart hatte sie diese Verzierungen ihres auch ohnedies hübschen Körpers klugerweise erst nach der Verbeamtung auf Lebenszeit – man wusste doch nie, was der Schulleiter darüber dachte, oder ob ein Kollege sie aus unerfindlichen Gründen anschwärzen würde. Immer wenn unser Altphilologe diese Kollegin sah, musste er an ihre Tattoos denken, auch jetzt noch, wo sie unter der wärmenden Kleidung verborgen waren. Die Kollegin war an diesem Tag im Advent die Einzige, die ihm zu dem erwünschten Getränk verhelfen konnte. Das war unter seiner Würde, also versuchte er es alleine. Ein Latte macchiato sollte es sein, seine Lieblingsvariante des Kaffeetrinkens. Der Milchbehälter war gefüllt, das konnte er erkennen. Kaffee war sicher genug in der Maschine, dafür sorgten schon die Kolleginnen. Jetzt musste er nur noch den Becher unter den richtigen Auslauf stellen. Davon gab es zwei. Wenn er den falschen wählte, würde die Milch daneben laufen und die Maschine verschmutzen. Alle Kolleginnen und Kollegen wüssten dann, dass er an dieser Maschine gewesen war. Trotz seines fortgeschrittenen Alters würden sie ihm die eine oder andere kleine Bemerkung nicht ersparen. Sollte er sie doch fragen, die Tätowierte? Dann müsste er auf sie zugehen, zu ihr hingehen im wahrsten Sinne des Wortes. Er war gezwungen, eine Güterabwägung vorzunehmen, wie er es bei Sokrates gelernt hatte. Blamage vor den Kollegen oder Demütigung vor der Kollegin. Oder auf den Kaffee verzichten. Na ja, vielleicht war das zu vermeiden. Vielleicht sollte er doch die Kollegin fragen. Er hatte ihr ja noch nie gesagt, was er über sie dachte. Nur einigen anderen im Kollegium.
Er konnte sich nicht entscheiden.
Die Kollegin widmete sich unterdessen der Korrektur einer Hausaufgabenüberprüfung: der Blutkreislauf des Menschen, Klasse 8b. Die Freistunde müsste für die Korrektur reichen, wenn sie sich beeilte. Dann könnte sie den Test noch vor Weihnachten zurückgeben und einigen in der Klasse damit eine Freude machen, anderen eher nicht. Sie war äußerst konzentriert und registrierte den hilflosen Kollegen kaum. Ohnehin hatte sie keinen Kontakt zu ihm, er schien ihr immer aus dem Weg zu gehen. Zudem hatte er den Ruf, auf Frauen herabzuschauen. Das musste sie sich nicht antun. Bisweilen sah sie auf und bemerkte, dass der Kollege nun schon einige Minuten vor der Kaffeemaschine stand. Vielleicht kann er sich nicht entscheiden, was er will, dachte sie. Zunächst. Dann aber fiel ihr ein, dass sie gehört hatte, er wäre der Einzige im Kollegium, der nicht mit der Maschine zurechtkäme. Er stand immer noch dort. Die ganze Stunde über den Tisch gebeugt zu sitzen, ist ungesund, dachte sie. Mache ich halt die paar Schritte. Sie stand auf und ging auf ihn zu. Wie sage ich es meinem Kinde?, fragte sie sich auf dem Weg. Und wie einem altgedienten Kollegen von der etwas störrischen Art?
»Ist die Maschine kaputt?«, fragte sie und war überzeugt, dass dies ein unverfänglicher, den Kollegen nicht festlegender Anfang sei, den er nicht übel nehmen könnte.
»Defekt, meinen Sie?«, fragte er zurück
Oje, so einer ist der also. Was hat der gegen das schöne deutsche Wort ‚kaputt‘? Na ja, ein Altphilologe eben, der liebt Wörter mit lateinischem Ursprung.
»Das eine wie das andere, mir doch egal«, sagte sie und lächelte ihn an.
»Das sehe ich anders«, antwortete er.
Stur und rechthaberisch ist er auch noch. Das haben die anderen schon von ihm gesagt, keine neue Erfahrung also.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte sie und lächelte ihn weiterhin an. Die Vorweihnachtszeit ist die Zeit beharrlicher Deeskalation, sagte sie sich.
»Vielleicht«, antwortete er.
Ein erstes Erweichen seines Widerstandes, sagte sie unhörbar zu sich selbst. Der Kaffeedurst muss groß sein. Gleich hab’ ich ihn.
»Wie denn?«, fragte sie fast ein wenig zu süßlich.