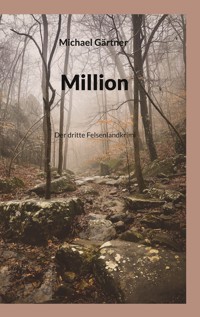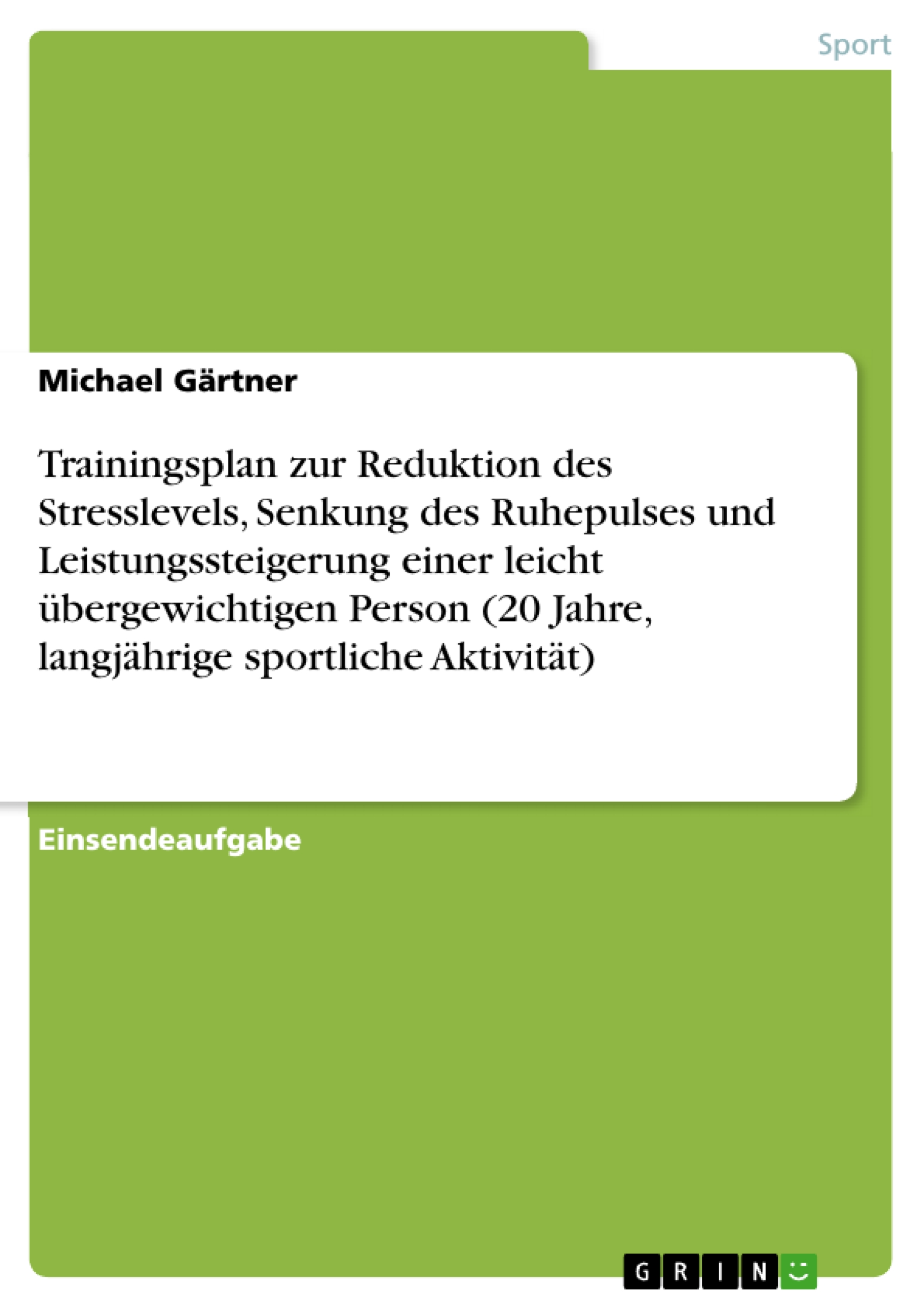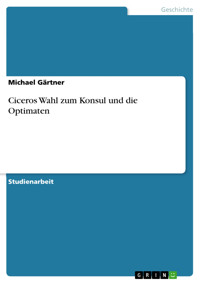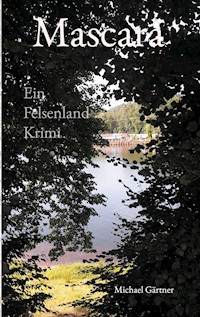
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die schöne Weißrussin Ludmilla liegt tot im Saarbacher Mühlweiher. Die Kommissare Bernd Peters und Klaus Scheller aus Pirmasens wissen zunächst nicht, wo sie nach dem Mörder des Zimmermädchens suchen sollen. Ist er in dem neu ausgebauten Wellnesshotel, in dem Ludmilla gearbeitet hat, zu finden? Oder auf dem Campingplatz auf der anderen Seite des Weihers? Ihnen zur Seite stehen Professor Alfred von Boyen, emeritierter Historiker und Politikberater, sowie Pfarrerin Barbara Fouquet. Die Personalakquise des Hotels ist undurchsichtig, die Fremdenfeindlichkeit einiger Camper unerträglich. Und war Ludmilla die, für die sie sich ausgab? Es bedarf einiger raffinierter Täuschungen, um die Täter zu ermitteln. Der zweite Felsenland-Krimi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Never underestimate the Power of a good Mascara«
»Give me red Lipstick and I will run the World.«
(Werbeslogans in einer Parfümerie)
Personen
Alfred von Boyen
Professor, Politberater
Barbara Fouquet
Pfarrerin von Schönbach
Anna Hoger
Bäckersfrau
Bernd Peters
Kriminalkommissar
Klaus Scheller
Kollege von Peters
Anne Matthissen
Ministerin für Europaangelegenheiten
außerdem
Nicole Berner
Hausdame
Ein Concierge
Jean Dallmann
Hotelier
Jenny
Kommissariatssekretärin
Karl, der Camper
Ludmilla Herzegowina Zimmermädchen
Zwei estnische Geschäftsleute
und einige andere
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
1
Die junge Frau, die im Gras neben dem Saarbacher Mühlweiher lag, war auch jetzt noch von außergewöhnlicher Schönheit. Man war geneigt zu sagen, dass die blasse Haut ihres Gesichtes sich in besonders reizvoller Weise von den schwarzen Haaren und den dunklen Augen abhob. Diese starrten in den trüben Morgen. Ihre Kleider waren nass, das ließ ihre ausgesprochen gute Figur mit den festen Brüsten, der schmalen Taille und den wohlgestalteten Proportionen ihrer Hüften und Beine erkennbar werden. Klaus Scheller betrachtete sie eingehend und erwischte sich dabei, wie er sich diese Frau mit hochhackigen Schuhen auf einem Laufsteg oder mit einem eng anliegenden Abendkleid bei einer Essenseinladung vorstellte. Er konnte nicht anders. Beim Anblick einer schönen Frau ging seine Fantasie ihre eigenen Wege. Normalerweise ließ er ihr ihren Lauf und genoss die leichte Erregung, die dann in ihm aufstieg. Aber heute Morgen schämte er sich für seine Gedanken, denn diese junge Frau war tot, und vieles sprach dafür, dass sie nicht eines natürlichen Todes gestorben war.
Die Kindergruppe und ihre Betreuerinnen waren früh vom Zeltplatz in der Nähe der Sportanlagen zwischen Fischbach und Gebüg aufgebrochen. Zum Leidwesen der vier jungen Frauen hielten ihre Schützlinge nicht viel davon, morgens lange zu schlafen. Für eine gute Woche waren sie als Betreuerinnen mit den rund zwanzig Kindern aus Ludwigshafen zu einer Freizeit ins Dahner Felsenland aufgebrochen. Spätestens um sechs Uhr waren die Ersten wach und sorgten dafür, dass die anderen es bald auch waren. Dann hieß es, sich darum zu kümmern, dass sie die Zähne putzten, nicht wieder die schmutzigen und oft noch feuchten Klamotten des Vortags anzogen, Kakao zu kochen und die langen Tische unter den Kiefern zu decken. Sie hatten zwei Tage gebraucht, die Kinder dazu zu bringen, dass jeweils eine Gruppe von fünfen bei der Vorbereitung half. Als Erstes aber musste sich jeden Morgen eine der Betreuerinnen ein Fahrrad schnappen und hinunter nach Fischbach fahren, um die Brote und Brötchen zu holen, die am Vortag bestellt worden waren. Alle anderen Lebensmittel wie Milch, Kakao, Wasser, Marmelade, Butter hatten sie schon am ersten Abend in der Wasgau Filiale eingekauft und mit ihrem VW Caddy zum Zeltplatz gefahren.
An diesem Morgen sollte der normale Tagesablauf unterbrochen werden. Vor dem Frühstück bereits waren sie mit den Kindern den Saarbach entlang Richtung Saarbacher Mühlweiher aufgebrochen. Dort sollte ein Picknick stattfinden und anschließend wollten sie zum Barfußpfad und zum Spielplatz nach Ludwigswinkel gehen. Alles war am Vorabend gepackt worden. Jedes Kind trug sein Frühstück und die Trinkflasche in einem kleinen Rucksack, die Betreuerinnen hatten noch eine süße Überraschung dabei. Die Vorfreude hatte dazu geführt, dass die Ersten schon um fünf Uhr wach geworden waren. So war man bereits kurz vor sechs aufgebrochen und gegen sieben am Saarbacher Mühlweiher angekommen. Das frühe Aufstehen hatte den Vorteil, dass es noch nicht so warm war, dass sie zwei Rehe auf einer Lichtung entdeckten und beobachten konnten, wie die Fische im Saarbach aus dem Wasser sprangen, um ihr Frühstück in Gestalt von Wasserläufern und anderen Insekten zu fangen.
Je näher sie dem Saarbacher Mühlweiher kamen, desto ungestümer und lauter wurden die Kinder. Eine der Betreuerinnen lief ganz nach vorne, denn vor dem Weiher würden sie noch eine Straße überqueren müssen. So früh am Morgen war es nicht auszuschließen, dass ein Auto aus dem Wald hervorgeschossen käme, war es doch die Zeit des morgendlichen Berufsverkehrs. Der mochte hier zwar nicht so intensiv wie in Ludwigshafen mit seinen allmorgendlichen Staus sein, aber die Einheimischen hatten einen Fahrstil, der sportlich genannt werden konnte. Keiner von den Pendlern würde um diese Zeit mit einer Kindergruppe auf der Straße rechnen. Also sammelten die Betreuerinnen ihre Schützlinge am Straßenrand, um dann geschlossen mit der ganzen Gruppe über die Fahrbahn zu gehen. Kaum auf der anderen Seite angekommen, stürmten die Kinder in Richtung Liegewiese los, denn hier sollte nun das Picknick stattfinden.
Markus Renner, der Platzwart der Campinganlage am Sägmühlweiher, war der Erste, der das Geschrei vernahm und sich darüber ärgerte. Seine Gäste auf dem Campingplatz wollten um diese Zeit ihre Ruhe haben, denn schließlich verbrachten sie hier ihren Urlaub, die wertvollsten Wochen des Jahres. Er ging gerade in sein kleines Büro am Empfangshäuschen, um wie jeden Tag die morgendliche Brötchenlieferung aus Fischbach zu kontrollieren. Der Fahrer der Wasgau-Bäckerei hatte sich angewöhnt, den großen Sack mit dem Brot und den Brötchen unter dem Vordach abzulegen, ohne ihm Bescheid zu sagen. Genau genommen war ihm das ganz recht, denn der Bäckereiwagen kam oft schon um sechs Uhr, und da schlief sogar Markus Renner noch. Erst recht seine Gäste, wie er sie immer nannte, obwohl viele von ihnen einen Dauerstellplatz hatten und zumindest in den frostfreien Monaten an jedem Wochenende und im Sommer durchgehend für einige Wochen da waren. Seine Gäste liebten es zu feiern: Grillen, Bier trinken oder auch Wein, bis in die laue Nacht hinein. Da konnten sie morgens um sieben noch keinen Krach vertragen. Markus Renner wollte gerade um den kleinen See herumgehen, um den Kindern drüben einmal ordentlich die Meinung zu sagen, als er einen lauten Schrei vernahm und sah, wie die ganze Gruppe auf der gegenüberliegenden Seite in Bewegung kam.
In dem luxuriösen Hotel oberhalb der Liegewiese bemerkte er Licht im Keller und in der Küche. Die dienstbaren Geister des Hauses waren bereits bei der Arbeit, die Liegestühle für die Gäste wurden gereinigt und auf die Wiese gebracht, das Frühstück vorbereitet. In den beiden letzten Jahren hatte es immer wieder Konflikte mit dem Hotelbesitzer gegeben. Der Campingplatz auf der anderen Seite des Weihers störte in dessen Augen den sonst so schönen Ausblick vom Hotel auf das Wasser. Seit er das Anwesen gekauft hatte, empfand er es außerdem als ärgerlich, dass die Liegewiese zum See hin öffentliches Gelände war. Nach zähen Verhandlungen mit der Ortsgemeinde und erst unter Einschaltung des Landrates war es ihm gelungen, zumindest den westlichen Teil der Wiese am Zulauf des Wassers exklusiv für seine Gäste nutzen zu können. Markus Renner und den Campern auf der anderen Seite war es egal, wer sich da drüben auf der Wiese tummelte, denn die hatten ihren eigenen Zugang zum See. Den Menschen aus der Umgegend aber, die in ihrer Freizeit die Liegewiese nutzten, war es keineswegs egal. Die Leserbriefseiten in der Pirmasenser Zeitung und in der Rheinpfalz waren über Wochen mit dem Thema belegt. Dann soll der Hotelbesitzer einen Berater engagiert haben, erzählte man sich. Der habe ihm empfohlen, sich einer Gemeindeversammlung zu stellen, zuzuhören und die Menschen um Verständnis für die Bedürfnisse seiner Gäste nach einem Raum des Rückzugs zu bitten. Zugleich sollte er jeden Samstag und Sonntag gratis Eis aus der Küche des Hotels auf der Liegewiese verteilen. Danach hatten sich die Wogen geglättet. Der Berater soll dem Hotelier gesagt haben, dass die Kosten für das Gratiseis verglichen mit dem Imageschaden und einer Pachtzahlung für die Liegewiese vergleichsweise gering wären.
Der Sous-Chef der Küche, Frank Mattheis, der für das bekannt opulente Frühstücksbuffet verantwortlich war, hatte einen Schrei gehört und war vor das Haus getreten. Er sah die Betreuerinnen mit einem Teil der Kinder am Wehr beim Ablauf des Sees stehen und beobachtete, wie die jungen Frauen sich bemühten, ihre Schützlinge zurück auf die Liegewiese zu drängen. Es schien nichts Schlimmes passiert zu sein, denn das Geschrei ließ nach und die Kinder folgten den Anweisungen. Er ging wieder in die Küche, um die Arbeiten zu kontrollieren, besonders die Zubereitung des begehrten Mühlenweihermüslis, dessen Geheimnis in einer kleinen Prise Zimt und Koriander bestand. Man schmeckte sie nicht heraus, sie verlieh dem Müsli aber einen unvergleichlichen Geschmack.
Nach und nach wachten die Dörfer des Felsenlandes auf, und Barbara Fouquet ging wie jeden Morgen in die kleine Bäckerei von Schönbach. Hinter der Theke stand – auch wie immer wohlgelaunt – die Bäckersfrau, ihre Freundin Anna Hoger. Die sang gerade vor sich hin: »Geh aus mein Herz und suche Freud, in dieser schönen Sommerzeit…«
Sie schaute auf, erblickte Barbara Fouquet und fragte erstaunt: »Was treibt dich denn so früh aus deinem Bau?«
»Na ja, die schöne Sommerzeit halt – und die Baustelle vor meinem Haus. Die armen Kerle müssen schon um sechs Uhr anfangen zu arbeiten und ihre Maschinen mit ihnen. Da ist nichts mit schlafen. Also habe ich mich lieber an den Schreibtisch gesetzt und die Beerdigung in Dahn heute Nachmittag vorbereitet.«
»Was machst du in Dahn? Das ist doch gar nicht deine Gemeinde?«
»Wiederum die schöne Sommerszeit und ihre Ferien. Die Kollegen mit Kindern sind in Urlaub und ich darf für zwei Pfarrstellen die Vertretung machen.«
»Das hat man davon, wenn man nicht verheiratet ist und keine Kinder hat. Aber du bist selbst schuld. Die Namen deiner Verehrer sind zahlreich, sie passen nicht in ein Telefonbuch. Aber gnädige Frau sind halt wählerisch.«
»Nicht wählerisch, nur vorsichtig«, gab Pfarrerin Fouquet zurück. »Wie heißt es doch im Volksmund: Drum prüfe, wer sich ewig bindet…«
»Ob sie nicht noch was Bess‘res findet«, ergänzte Anna.
»Genau, so ist es. Und nun: the same procedure as every morning!« Anna Hoger füllte eine Papiertüte. »Aber um noch einmal zum Wesentlichen zu kommen: Ist da nichts mehr mit diesem gut aussehenden Polizeikommissar aus Pirmasens? Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen.«
»Der ist auf einem Lehrgang in Hannover, aber nicht mehr lange.«
»Prima«, lächelte Anna. »Aus dem Inhalt deiner Antwort schließe ich, dass du weiterhin mit ihm in Kontakt bist. Aus dem hoffnungsvollen Ton schließe ich, dass ein gewisses Sehnen in deinem Herzen ist.«
Barbara lachte. Mit Anna war es einfach schön. Sie war klug und humorvoll. Anna Hoger hatte ihren Beruf als Lehrerin an den Nagel gehängt, um mit ihrem über alles geliebten Mann diese kleine Bäckerei zu führen. So konnten sie sich oft sehen, und mit der Erziehung der beiden Kinder war es auch einfacher. Sie hatte auf viel verzichtet, aber war nach wie vor der Meinung, dafür mehr gewonnen zu haben, und bereute ihren Entschluss nicht.
»Okay, du hast mich erwischt. Wieder einmal. Ich scheine für dich ein offenes Buch zu sein.«
In diesem Moment fuhr mit ohrenbetäubender Lautstärke ein Rettungswagen an der Bäckerei vorbei und verschwand in Richtung Ludwigswinkel. Als Anna gerade wieder anfangen wollte zu reden, ertönte das Martinshorn erneut, und ein Polizeiwagen folgte.
»Rettungswagen bedeutet Krankheit oder Tod, Polizeiwagen bedeutet Verbrechen«, sagte Anna.
»Rettungswagen könnte Wespenstich an der Fußsohle und Polizeiwagen könnte Fahrradunfall bedeuten«, sagte Barbara.
»Ja, ja, Rettungswagen bedeutet dehydrierte Seniorin oder ein im Wald verirrter Mann«, sagte Anna.
»So oder so, ich glaube, du bist auf der richtigen Spur.«
»Und du redest dir die Welt schön, meine Liebe. Wir werden sehen, wer recht hat.«
Zur gleichen Zeit stand Alfred von Boyen auf der Wiese seines Hauses im Gebüg und machte seine allmorgendlichen Kyudo-Übungen. Er hatte sich auf das richtige Atmen konzentriert und trat ins taunasse Gras hinaus. Er wollte die acht Stufen beschreiten, schritt an die Vorbereitungslinie, den Bogen in der Linken, in der Rechten zwei Pfeile und verneigte sich zum Ziel hin. Dann ging er die drei Schritte zur Schießposition vor und nahm die Grundhaltung ein. Er setzte die untere Bogenspitze auf sein linkes Knie und führte den Pfeil von vorne gegen den Bogen. Aufrecht stehend bildete er eine Verbindung von Himmel und Erde. Er hatte das Gleichgewicht von Körper und Geist erreicht. Die Kraft schien aus dem Bauch heraus in den ganzen Körper zu fließen, als er beide Arme auseinander bewegte, den Bogen spannte und den Pfeil auf Augenhöhe senkte. Er fixierte die Scheibe über die Wurzel seines linken Zeigefingers, bevor sich das Geschoss wie von selbst löste und ins Ziel flog. Alfred von Boyen blieb stehen, als ob sich der Pfeil noch im Bogen befände und wartete, bis die Resonanz des Schusses in ihm verhallt war. Dann löste er seine Haltung und trat die drei Schritte wieder zurück.
Von seinem Wohnzimmer aus hatte man einen wunderbaren Blick über ein Tal, das nach Fischbach hin abfiel. Wenn der Wind von Nordosten kam, hatte er in den vergangenen Tagen immer wieder das fröhliche Schreien der Kinder auf dem Zeltplatz nahe den Sportanlagen hören können. Das war ihm wesentlich lieber als der Krach des alljährlichen Sandbahnrennens mit Motorrädern oder die laute abendliche Musik, wenn eine Jugendgruppe dort unten zeltete. Das Geschrei von Kindern war das einzige von Menschen und ihren Kreationen geschaffene Geräusch, das ihn wirklich nie störte.
Sein Tagesablauf war von einer großen Regelmäßigkeit bestimmt. Nach den Kyudo-Übungen am Morgen trank er eine Tasse starken Kaffee oder Tee und setzte sich an seine Arbeit im Dachgeschoss des Hauses. Sein Arbeitszimmer wirkte wie der Raum einer Bibliothek, voller Regale, zwischen die sich ein Mensch nur mühsam hindurchzwängen konnte. So hatte er alle seine Schätze und die vielen gesammelten Unterlagen zu den verschiedensten Themen unterbringen können. Sein Schreibtisch war aufgeräumt und wurde von der Tastatur und dem großen Bildschirm eines PCs dominiert. Nachdem er seine Professur und seine Tätigkeit als internationaler Berater an den Nagel gehängt hatte, wollte er von hier aus mit seinen Büchern und Aufsätzen die Welt verändern – oder zumindest seinen kleinen Teil dazu beitragen, dass diese Welt eine bessere würde, allen gegenläufigen Tendenzen zum Trotz. Zurzeit arbeitete er an einem Buch über – na ja, wie sollte er sein Thema genau bezeichnen? Er wollte darüber schreiben, wieso Menschen immer wieder bestimmte Gruppen, Rassen oder Nationalitäten, manchmal auch Glaubensrichtungen zu Sündenböcken machten. Also im Kern ging es um den Sündenbockmechanismus.
Aber wie sollte er das vermitteln? Deshalb musste er sich um die richtige Sprache bemühen. Hinzu kam das Problem, dass viele Menschen selten Bücher lasen. Letztlich konnte er sein Ziel nur über die Medien erreichen, vor allem über das Fernsehen, und da am besten über die Privatsender. Aber wie sollte er es schaffen, dass dies Thema dort aufgenommen wurde? Vielleicht musste er provozieren, beleidigen, skandalisieren? Er war noch bei den Vorarbeiten, dachte aber jeden Tag über die richtige Form des Buches nach und über einen guten Titel.
Vielleicht musste der reißerisch sein, so nach dem Motto »Anleitung zur Zerstörung der Welt – oder wie kann ich möglichst effektiv einen dritten Weltkrieg herbeiführen.« Oder eher so: »Wie ich mich und andere ins Unglück stürzen kann«. Oder: »Wie ich mein Glück auf dem Unglück anderer aufbaue«. Vielleicht sollte er auch sachlich bleiben und formulieren: »Die Sündenböcke – wie wir unsere Probleme auf dem Rücken anderer austragen«. Er war sich noch völlig unsicher. Vor allem zweifelte er immer wieder daran, ob das ganze Projekt überhaupt etwas bringen würde. Er konnte nur tun, was er tun konnte. Er gehörte nicht zu den A-Promis, eher schon zu den Geheimtipps. Mit einem gelungenen Titel allein würde er es nicht in die Schlagzeilen oder die Fernsehshows schaffen.
Für diesen Morgen hatte er sich noch einmal das Buch von Carl Gustav Jung über die Archetypen vorgenommen. Er wollte zunächst die Lehre von den Schatten, den verdrängten negativen Seiten des eigenen Wesens, in eine allgemein verständliche Sprache bringen. Dies würde ein erster wichtiger Arbeitsschritt sein. Gerade als er das Buch aufschlug, hörte er in der Ferne unten im Sauertal die Martinshörner zweier Fahrzeuge, die kurz nacheinander durch Fischbach fuhren.
Ein Weiterer wurde an diesem Morgen durch den Rettungswagen und den Polizeiwagen aufgeschreckt. Er lag noch in seinem Bett und kämpfte mit sich selbst, ob er aufstehen sollte oder nicht. Jean Dallmann gehörte das Hotel am Saarbacher Mühlweiher, wobei ihm die Bezeichnung ‚Hotel‘ für das, was er bereits daraus gemacht hatte, und vor allem, was er noch daraus machen wollte, völlig unangemessen schien. Im Moment war die Formulierung ‚Spa Residenz am Saarbacher Mühlweiher‘ sein Favorit für die nächste Werbeaktion, wobei ihm jedoch das Wort ‚Saarbacher Mühlweiher‘ irgendwie zu profan und platt erschien, aber er konnte den Namen nicht einfach ändern. Vielleicht sollte er es mit ‚Étang du Moulin‘ versuchen. Das wäre nicht falsch, hätte aber besser zehn Kilometer weiter südlich ins Elsass gepasst. Vielleicht transportierte jedoch bereits der Ausdruck ‚Saarbacher Mühlweiher‘ für seine Zielgruppe genügend ins Romantische gehende Emotionen. Die Schönen und Reichen aus den großen Städten und ihren Speckgürteln suchten nach exklusiver Ruhe, gutem Essen in gediegener Atmosphäre, Wellness, Massage durch schöne Menschen, damit sie wieder einmal ihren Körper spürten, nach diskreten Bekanntschaften und kleinen Abenteuern, einer Umgebung, in der man sie nicht kannte, aber sofort erkannte, dass sie nicht zu jenen gehörten, denen die Investition in eine neue Waschmaschine oder einen Gebrauchtwagen Kopfzerbrechen bereiten würde.
Jean Dallmann wusste, dass er sich ein hohes Ziel gesetzt und bereits einen Fehler gemacht hatte. Der bestand darin, sich in dieses alte Hotel am Saarbacher Mühlweiher, unweit seiner Heimatstadt Pirmasens, verliebt zu haben. Die Schuhfabrikation hatte seine Familie reich gemacht. Sein Vater schaffte gerade noch rechtzeitig den Absprung und verkaufte die Fabrik, bevor es mit der Schuhindustrie in Deutschland bergab ging, weil die Italiener billiger waren. Heute waren auch die zu teuer und die Schuhe kamen in großen Containern aus der Türkei oder aus Asien. Sein Vater hatte einen guten Preis erzielt, und er und seine Kinder konnten bis jetzt mehr als gut davon leben. Die beiden Geschwister von Jean hatten ihr Geld in Aktienpaketen angelegt. Er selbst jedoch sah sich als Luxushotelier und hatte diese Gegend ausgesucht. Es war ein Fehler, dachte er immer wieder, aber es waren die Wälder und Weiher seiner Kindheit, die mit glücklichen Erinnerungen an schöne Stunden mit der Familie verbunden waren und an den Duft der Bäume und Kräuter und die morgendlichen Nebelschwaden über den Tälern. Seine Geschwister hatten ihn einen Romantiker genannt und aus wirtschaftlicher Perspektive hatten sie recht.
An diesem Morgen plagten ihn solche Gedanken nicht, sondern vielmehr die Rückenschmerzen, die der Stehempfang des gestrigen Abends bei ihm hinterlassen hatte. Den Landrat, die Verbands- und Ortsbürgermeister der Gegend sowie andere Honoratioren hatte er eingeladen, um ihnen seine Pläne vorzustellen. Winzersekt, guter Wein und Pirmasenser Bier waren ausgeschenkt worden, dazu Fingerfood vom Feinsten. Die Küche übertraf sich selbst, seine bebilderte Präsentation und der für teures Geld in Auftrag gegebene Imagefilm für das Felsenland und das Sauertal schlugen wie eine Bombe ein. Die letzten Gäste gingen euphorisiert durch den Alkohol und das Gefühl, im schönsten Teil der Welt zu leben, erst gegen zwei Uhr morgens. Nun wurde Jean Dallmann durch die Martinshörner und das in die Fenster dringende Blaulicht in die schmerzhafte Wirklichkeit geholt. Die beiden Wagen hatten ganz in der Nähe seines Hotels angehalten.
Die meisten Kinder der Gruppe waren auf der Liegewiese angekommen, die ersten hatten auch ihre Rucksäcke aufgerissen und waren dabei, die Papiertüten mit dem Frühstück herauszuholen. Es waren wieder einmal Mia und Tom, die trödelten. Sie hatten offenbar keinen so großen Hunger wie der Rest der Truppe und wollten sich lieber den Weiher angucken und schauen, ob da wohl Fische drin waren. Die Betreuerin, die den Schluss bildete, war ein paar Schritte vor ihnen und rief, sie sollten nachkommen. Doch Mia und Tom fanden den Weiher interessanter und ließen sich nicht stören. Auf der anderen Straßenseite hatten sie gesehen, dass ein Bach unter der Straße hervorkam, und nun wollten sie schauen, wo er denn auf dieser Seite unter der Fahrbahn verschwand. Sie gingen an den höchsten Punkt des Ufers, denn hier musste es sein. Mia hatte ein paar Eisenteile gesehen, vielleicht war da ein Tunnel. Bei dem Wehr angekommen, nahmen sich die beiden bei der Hand und hofften, auf diese Weise nicht so schnell ins Wasser zu fallen, wenn sie sich vorbeugten, um nachzuschauen, wo denn der Weiher unter der Straße verschwand.
»Guck mal, da hat jemand Kleider ins Wasser geworfen«, sagte Tom ganz zaghaft.
»Frauenkleider, glaube ich«, sagte Mia.
»Frauenkleider?«
»Da sind doch Rüschen an der Bluse. So was hat meine Mama auch.«
»Stimmt«, sagte Tom.
»Aber da ist ein Arm in der Bluse«, sagte Mia.
»Und ein Kopf.«
»Ich glaube, wir rufen besser die Jessica.«
»Du hast recht«, sagte Tom, und beide riefen wie aus einem Mund: »Jeeeesssiiiicaaaa!«
Die Betreuerin kam, schaute nach unten, erschrak und zog die Kinder vom Ufer weg.
»Lauft schnell zur Wiese und hole Beate«, sagte sie mit brüchiger Stimme.
Beate war die Leiterin der Freizeit. Als sie die tote Frau im Wasser sah, stieß sie einen lauten Schrei aus. Alle Kinder auf der Wiese schauten überrascht zu den beiden Betreuerinnen. Jessica hielt Beate den Mund zu und zog sie vom Ufer weg. Dann holte sie das Handy aus der Gesäßtasche ihrer Hose und wählte eine kurze Nummer.
Die Betreuerinnen konnten nicht verhindern, dass einige Jungen und Mädchen zum Wehr hinliefen, an dem Jessica und Beate standen. Aber während Beate noch wie versteinert herumstand, versuchte Jessica die Kinder zurück zur Wiese zu drängen. Dann sah sie einen Mann aus dem Untergeschoss des Hotels kommen, und gleichzeitig näherte sich ein anderer aus der Richtung des Campingplatzes am gegenüberliegenden Ufer.
Als die beiden bei Jessica angekommen waren, beugten sie sich wie zwei Pinguine hinunter.
»Ich habe die Polizei schon angerufen«, sagte Jessica.
»Das wird eine Weile dauern, wenn die aus Dahn kommen müssen«, meinte der Mann vom Campingplatz.
»Hoffentlich bekommen unsere Gäste nichts mit«, sagte der Mann aus dem Hotel und ging davon.
Die Gäste des Hotels schienen wirklich nichts mitzubekommen. Aber vom Campingplatz her näherten sich durch den morgendlichen Dunst des Weihers einige Gestalten. Schnell bildete sich eine kleine Gruppe am Wehr. Einer wollte ins Wasser steigen, um die Leiche herauszuholen, aber die anderen hinderten ihn daran. Einigen sah man ihr Entsetzen am Gesicht an. Andere schauten äußerst interessiert und durchaus ein wenig erfreut. Den Tod kannten sie alle nur aus dem Fernsehen. Jetzt erlebten sie ihn wirklich. Ein Urlaub mit einem Leichenfund! Sie würden etwas zu erzählen haben. Man beugte sich hinunter, um das Gesicht zu erkennen. Vielleicht kannte man sie ja. Vielleicht war sie eine vom Campingplatz. Nein, das konnte nicht sein. Da trug man keine Rüschenblusen. Einer machte Fotos mit seinem Handy, ein anderer rannte los, um auf dem Platz Bescheid zu sagen und seine Kamera zu holen. Vielleicht würde er die Bilder an die Presse oder ans Fernsehen verkaufen können. Es wurde langsam laut am Wehr des Sägmühlweihers, aber die Gäste im Hotel erwachten erst, als der Rettungswagen und die Polizei sich lautstark näherten.
2
Es gab Zeiten, da hatte Pirmasens die höchste Dichte an Automobilen der Marke Jaguar in ganz Deutschland. Das lag nicht daran, dass sich vor den Toren der Stadt einer der wenigen Jaguarhändler angesiedelt hatte. Vielmehr war das die Folge der eigentlichen Ursache gewesen, nämlich der zahlungskräftigen Kundschaft in dieser Stadt, der es wichtig war, ihren Reichtum sichtbar zur Schau zu stellen.
Man hätte auch Mercedes oder BMW fahren können – diese Marken waren selbstverständlich auch mit Autohäusern vertreten –, aber diese beiden Hersteller hatten keine Modelle mit Zwölfzylindermotoren im Angebot. Wenn man jedoch schon so richtig Geld hatte, dann sollte es nur das Beste vom Besten sein, auf jeden Fall sollte der Motor einer der größten auf dem Markt sein. Nur mit einem Jaguar konnte man einen Mercedes oder einen BMW übertreffen, wenn auch nicht unbedingt in der Qualität und Bequemlichkeit, so doch aber im Design und eben in der Anzahl der Zylinder.
Das Gesetz des Stärkeren, das die Menschheit mit ihren tierischen Verwandten teilt, hatte sie lediglich etwas verfeinert und je nach Kulturstufe mehr ins Symbolische erhoben. Was dem Gorilla sein Silberrücken und dem Hirsch sein Geweih, das war dem Menschen seine Krone, sein großes Auto, sein Haus, seine Schar Leibwächter oder seine Jacht. Nur im Bereich des Bodybuildings hatten sich die archaischen Ausdrucksformen in Reinform erhalten.
Klaus Scheller lebte und arbeitete in Pirmasens, aber er konnte weder ein großes Auto noch eindrucksvolle Muskeln vorweisen. Allerdings hatte er eine Schusswaffe, qua Amt sozusagen, und deren Wirkung versuchte er immer wieder beim weiblichen Geschlecht einzusetzen – wie andere ihren Wagen oder ihre Muskeln. Klaus Scheller lebte das Leben eines männlichen Singles, der durch seine Hormone getrieben den heutzutage völlig hoffnungslosen Versuch unternahm, seine Gene möglichst weit zu streuen und sie in Gestalt seiner Spermien an viele Nachkommen weiterzugeben. Dass dies in der Regel an Barrieren aus Latex scheiterte oder auf andere Weise an einer Menschwerdung gehindert wurde, wusste sein Großhirn. Sein Kleinhirn jedoch trieb ihn weiter von Frau zu Frau als einen hoffnungsfrohen, aber nie erfolgreichen Sklaven des männlichen Fortpflanzungstriebes.
Für Bernd Peters, seinen direkten Vorgesetzten, war dieser Lebensstil lange Zeit die Ursache für grundsätzlichen Argwohn gegenüber der Leistungsfähigkeit von Schellers Großhirn gewesen. Er erkannte im Laufe der Zusammenarbeit, dass ein solches Misstrauen nicht angebracht war, er jedoch immer wieder einmal mit Eskapaden im Bereich ungezügelter Kreatürlichkeit rechnen musste. Die waren ihm solange egal, wie sie nicht die Arbeit störten. Bernd Peters war auf einem Lehrgang und würde erst in zwei Tagen zurückkehren. Bis dahin musste sich Scheller alleine um die junge Frau kümmern, die ihm lebend deutlich lieber gewesen wäre als tot.
Als er am Fundort der Leiche angekommen war, hatten die Kollegen den Bereich schon abgesperrt. Bis zum Abend musste der Verkehr von und nach Ludwigswinkel über Fischbach umgeleitet werden, was dafür sorgte, dass am Ende des Tages alle in der Gegend darüber Bescheid wussten, was man da im Saarbacher Mühlweiher gefunden hatte.
Als Erstes wollte er herausfinden, wer diese junge Frau war. Dass sie nicht vom Campingplatz war, hatte man ihm schon zugerufen, als er über die Absperrung getreten war.
»Das ist keine von uns«, rief ihm ein Camper in kurzen Hosen und zu kurzem T-Shirt, unter dem das Ergebnis vieler schöner Grillabende hervorquoll, zu.
»Mit so etwas laufen wir hier nicht herum«, ergänzte eine Frau im knappen Bikini, der kaum das halten konnte, was er verbergen sollte.
»Da müssen Sie wohl drüben im Hotel suchen«, sagte ein Muskelshirt, was Scheller unmittelbar plausibel erschien. Er schickte einen der beiden Polizisten hinüber, um jemanden herzuholen, der die junge Frau möglicherweise kannte.
Der gut aussehende Mann mittleren Alters mit den leicht affektierten Gesten und der kleinen, nach oben gehaltenen Nase hatte dem Beamten bedeutet, dass er im Moment an der Rezeption unabkömmlich sei. Er schickte ein junges Mädchen von vielleicht siebzehn Jahren, das erst vor wenigen Monaten seine Lehre begonnen hatte, nach draußen. Sie steckte mit einer nicht zu übersehenden Schüchternheit und Unsicherheit in einer deutlich zu großen Livree und ging einige Schritte hinter dem Polizeibeamten auf die im Gras liegende Leiche zu.
In diesem Falle waren Schellers Gefühle gegenüber der jungen Frau eher väterlicher Art, was auf einen sich abzeichnenden Reifungsprozess seines Charakters hindeutete. Er nahm sie vorsichtig beim Arm und führte sie so weit an den Leichnam heran, dass sie das Gesicht erkennen konnte.
»Kennen Sie die Frau?«, fragte er leise.
Das Mädchen zitterte ein wenig, was sicher nichts mit der morgendlich Kühle zu tun hatte, und machte nur kleine Schritte. Scheller drehte sie so, dass sie nicht vom Kopfende auf die Tote schauen musste.
»Es ist eines der Zimmermädchen«, sagte die junge Frau nahezu unhörbar.
»Wissen Sie, wie sie heißt?«, fragte Scheller bedächtig.
»Ludmilla.«
»Und weiter?«
»Wir nennen sie immer nur Ludmilla.«
»Wer könnte mir mehr sagen?«
»Der Empfangschef oder die Hausdame. Die ist aber noch nicht da.«
»Sonst noch jemand?«
»Herr Dallmann, unser Chef.« Sie drehte sich um und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. »Sie durfte oft auch bei Empfängen helfen. Weil sie so schön ist.«
»Wo ist der Chef?«
Sie zeigte zitternd mit dem Arm auf das Hotel. »Er wohnt da oben.«
Die Beine der jungen Frau begannen zu wanken und Scheller wäre über eine weibliche Kollegin froh gewesen. Aber die Polizisten aus Dahn waren zwei Männer. Zum Glück war einer der beiden Rettungssanitäter eine Frau. Er führte das Mädchen zu ihr und bat sie, sich um es zu kümmern.
Normalerweise waren junge Frauen für Scheller eher Gegenstände seiner Begierde als seiner Fürsorge, aber in diesem Fall fühlte er deutlichen Zorn in sich aufsteigen. Wie hatte man vonseiten des Hotels eine Auszubildende schicken können, um eine Leiche zu identifizieren?! Er bat die Polizisten, weiterhin die Stellung zu halten, bis der Arzt und die Spurensicherung gekommen seien, und machte sich zum Hotel auf.
Er wählte nicht den Weg über die Liegewiese, sondern ging zur offiziellen Zufahrt, um einen Eindruck davon zu bekommen, welche Anmutung der Gast haben sollte, wenn er sich näherte. Die Straße nach Ludwigswinkel, von der die Einfahrt abzweigte, war eine Kreisstraße einfacher Ordnung, intakt, aber nicht besonders breit. Sobald man jedoch die Zufahrt zum Hotel betrat, hatte man den Eindruck, in eine andere Welt versetzt zu sein. Man glaubte, auf ein Luxushotel in der Toskana zuzugehen. Die Auffahrt war zweispurig und rötlich gepflastert. Rechts und links standen schlanke, zypressenähnliche Nadelbäume, in der Mitte Kübel mit üppig blühenden Hibiskuspflanzen in Rot- und Gelbtönen. Vor dem Hotel, das in zarten, zwischen Rot, Gelb und Ocker spielenden Tönen gehalten war, weitete sich die Einfahrt zu einem großen Platz, dessen Pflaster einen Kreis andeutete. Am Hauptgebäude angebaut verband ein Torbogen dieses mit einem Nebengebäude, dessen Zweck nicht sofort ersichtlich war. Vermutlich verschwanden dahinter die Wagen der Gäste. Das ausladende Vordach wurde von zwei Säulen getragen, deren Längsrillen vergoldet schienen. Neben den Pfeilern wachten zwei steinerne Löwen, die ein Relikt aus der bayrischen Zeit der Pfalz sein mochten, es vermutlich jedoch nicht waren. Vor der modernen Automatiktür stand einer dieser aus Messing gefertigten Gepäckwagen. Wenn man mit dem Auto vorführe, würde man einen livrierten Portier erwarten. Scheller pfiff durch die Zähne und stellte sich gleichzeitig die Frage nach dem Unterschied zwischen Sein und Schein. Er würde noch genügend Zeit haben, dem nachzugehen.
Der Haupthalle des Hotels sah man an, dass sich hier die Architekten und Raumgestalter hatten austoben können. Die Lichter waren in die Deckenverkleidung oder die Wände integriert, der dunkelblaue Teppichboden mit gelben Sternen durchsetzt. Ein Springbrunnen und eine üppige Pflanzendekoration verströmten eine Atmosphäre der Frische und Geborgenheit. Moderne helle Sessel, eine Couchlandschaft, die nie benutzt wurde, eine kleine Bar mit Wasser, Säften und Früchten, eine große Fensterfront mit Blick auf den Weiher, der überwältigend gewesen wäre, hätte man die Wohnwagen am anderen Ufer ausblenden können. Damit war eine Antwort schon gegeben: Spätestens am anderen Ufer ging der Schein in ein unspektakuläres Sein über. Blieb man aber mit den Augen in der Halle, so weckten Hinweisschilder auf den Spa-Bereich, den Pool, die Sauna und das Restaurant innere Bilder von schönen Urlaubstagen. Als die exotischen Düfte aus jener Ecke, in der der Spa-Bereich liegen sollte, an Schellers Nase drangen und er die angenehm leise Musik vernahm, fühlte er sich in einer anderen Welt als draußen in der Kühle des morgendlichen Pfälzerwaldes.
An der Rezeption war nichts los. Zum Auschecken war es zu früh. Die Gäste, die schon aufgestanden waren, nahmen gerade ihr Frühstück zu sich oder – falls es ihnen gelungen war, den inneren Schweinehund zu überwinden – schwammen ein paar Runden im Pool. Jetzt kam für Scheller Punkt zwei des Hoteltests an die Reihe: das Personal an der Rezeption. Der gut aussehende Mann mittleren Alters hinter dem Schalter hatte Scheller bereits erblickt. Er ging auf ihn zu, zeigte ihm seinen Ausweis und meldete sich mit »Scheller, Kripo Pirmasens« an. Der Mann zog die Augenbrauen hoch und richtete die Nasenspitze in Richtung Decke.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte er, und Scheller meinte, ein leichtes Näseln zu hören, fragte sich jedoch, ob dieser Eindruck daher käme, dass seiner Erwartung nach ein Mann mit einem solchen Auftreten einfach näseln müsste.
»Wir haben draußen am Wehr des Weihers eine Leiche gefunden und Ihre Kollegin hat sie freundlicherweise als Ihr Zimmermädchen Ludmilla identifiziert. Ich brauche nun noch ein paar mehr Angaben.«
»Meine Kollegin? Sie meinen unsere Auszubildende.«
»Ja, offensichtlich hat den anderen Mitarbeitern der Rezeption der Mut gefehlt, diese Aufgabe zu übernehmen.« Der Mann hinter dem Schalter drehte irritiert den Kopf zur Seite. Scheller fuhr fort: »Sie ist jetzt in der Obhut einer Sanitäterin und wird für die nächsten Stunden ausfallen.«
»Ach je«, sagte der hinter dem Schalter.
»Ein gestandener Mann wie Sie hätte das sicher besser verkraftet«, lächelte Scheller ihn an.
Wieder drehte der Rezeptionist seinen Kopf zur Seite.
»Ich brauche den Nachnamen von Ludmilla und jemanden, der mir Auskunft geben kann.«
»Ludmilla Herzegowina, aber wir sagen alle nur Ludmilla zu ihr.«
»Sie ist aber keine Schwester von…?« Scheller suchte nach dem Vornamen des berühmten Models.
»Sie meinen wohl Eva Herzigova«, näselte der Mann, und jetzt war sich Scheller sicher, dass er näselte.
»Ach richtig, die heißt Herzigova. Na ja, aber zum Model hätte es bei Ihrer Ludmilla auch gereicht.«
»Ja, sie ist sehr schön«, sagte der Mann und verbesserte sich: »Sie war sehr schön.«
»Wer kann mir nähere Auskünfte über sie geben?«, fragte Scheller.
»Die Hausdame, die für die Zimmermädchen zuständig ist. Aber die ist noch nicht da.« Der Mann schaute auf seine Uhr. »Sie wird erst in einer Stunde kommen.«
»Wann haben Sie Ludmilla zum letzten Mal gesehen?«
»Ich achte nicht auf die Zimmermädchen.«
»Aber ich nehme an, Sie haben sie schon einmal gesehen, sonst wüssten Sie nicht, dass sie schön ist.«
Wiederum drehte der Mann für kurze Zeit seinen Kopf zur Seite.
»Also, wann haben Sie sie zuletzt gesehen?«
»Gestern Abend bei der Übergabe an den Nachtportier. Wir hatten einen Empfang. Da durfte Ludmilla beim Servieren helfen.« Der Gesichtsausdruck des Mannes spiegelte deutlich, dass er diesen Personaleinsatz für einen Fauxpas hielt. »Herr Dallmann war wohl der Meinung, dass sie sich bei solchen Gelegenheiten gut machte. Wegen ihres Aussehens selbstverständlich nur.«
»Dann würde ich gerne als Erstes mit Herrn Dallmann sprechen«, sagte Scheller.
»Ich werde schauen, ob Herr Dallmann abkömmlich ist. Wie gesagt, wir hatten gestern Abend einen Empfang. So etwas zieht sich oft bis spät in die Nacht hinein.«
»Nun, ich denke, in diesem Hotel schläft niemand mehr. Wir haben versucht, mit unseren Martinshörnern alle Menschen um den Weiher herum aus Morpheus Armen zu befreien«, grinste Scheller.
»Ich befürchte, das ist Ihnen gelungen. Bitte nehmen Sie doch da vorne in unserer Lounge Platz. Ich werde nach Herrn Dallmann suchen lassen. Selbstverständlich können Sie sich bei den Getränken bedienen.«
Der Mann hinter dem Schalter griff zum Telefon, und Scheller ließ sich in einem der modernen Sessel nieder, die, wie er feststellte, nicht nur gut aussahen, sondern auch einen überraschenden Sitzkomfort boten.
Der Mann an der Rezeption hatte Schellers Test nicht bestanden. Hier war eindeutig mehr Schein als Sein. Arroganz ist ein Zeichen von Unsicherheit. Wer diesen Mann eingestellt hatte, war dem alten Irrtum verfallen, Arroganz mit Anspruch zu verwechseln, und zugleich dem zweiten, dass mit derart distanziert wirkenden Mitarbeitern an der Rezeption das Niveau eines Hotels steige. Das war eine überholte Ansicht, wenn sie jemals gestimmt haben sollte. Man lebte nicht mehr im neunzehnten Jahrhundert, sondern bereits im einundzwanzigsten.
Scheller hielt es trotz allen Komforts nicht in dem Sessel und er stand auf, um sich die Halle genauer anzuschauen. Die Skulpturen aus Holz waren ihm auf den ersten Blick nicht aufgefallen. Er schaute sie sich näher an. Ein kleines Schild verriet, dass sie aus einer Werkstatt in Petersbächel stammten. Den Namen, der unter den drei abstrakten Bildern stand, die er danach entdeckte, konnte er nicht lesen. Sie sprachen ihn durchaus an, soweit man das bei abstrakten Gemälden sagen kann. Ein Mann und eine Frau in weißen Bademänteln kamen aus Richtung Pool, und Scheller fragte sich, ob das Vater und Tochter wären oder ein Paar. Als die Frau dem Mann einen leichten Kuss auf den Mund gab und dann zur Rezeption eilte, war diese Frage beantwortet. Ob so ein Altersunterschied sein musste? Er trieb sich ja auch nicht mit Teenagern herum. Obwohl, in zwanzig Jahren – und der Mann war deutlich mehr als zwanzig Jahre älter als Scheller, da war er sich ganz sicher – in zwanzig Jahren würde er sich vielleicht über die Begleitung einer wesentlich jüngeren Frau freuen. Er hoffte, dann noch so volle, wenn auch graue Haare zu haben wie dieser Typ. Wenn er in dem Alter auch noch dessen Figur haben wollte, müsste er endlich mit regelmäßigem Sport beginnen. Bei seinem Gehalt würde er sich jedoch selbst in zwanzig Jahren nicht ein solches Hotel leisten können. Da musste er schon Polizeipräsident werden. Oder vielleicht sollte er in die Politik gehen? So ein Landtagsmandat wurde nicht schlecht vergütet.
Er wurde aus diesen Gedanken gerissen, weil man seinen Namen rief. Eine Mitarbeiterin der Rezeption, die er vorhin im Backoffice gesehen hatte, ging auf ihn zu.
»Herr Dallmann bittet Sie, zu ihm in den Frühstücksraum zu kommen, wenn es Ihnen recht ist.«
Er folgte ihr zu einem durch einen Paravent abgeschirmten Tisch im gut gefüllten Speisesaal. Auf dem Weg dorthin konnte er einen kurzen Blick auf das Buffet werfen und kam zu dem Urteil, dass sich bezüglich des Frühstücksangebotes Schein und Sein die Waage hielten.
Jean Dallmann war ungefähr in seinem Alter, also eher noch ein junger Mann. Die Jeans saß perfekt, das weiße Hemd mit den aufgekrempelten Ärmeln und den zwei geöffneten obersten Knöpfen spannte jedoch ein wenig über dem Bauch. Kein Goldkettchen, keine protzige Uhr, der Mann hatte Stil oder einen guten Berater – oder Beraterin.
»Ich würde mich freuen, wenn wir unser Gespräch hier führen könnten«, sagte Dallmann mit einem durchaus charmanten Lächeln. »Und falls Sie noch nicht gefrühstückt haben, lade ich Sie gerne ein.«
Scheller zögerte nicht, das Angebot anzunehmen, denn tatsächlich hatte die Einsatzzentrale ihn aus dem Bett geklingelt, in dem er die Nacht zwar alleine verbracht hatte, die aber doch kurz gewesen war.
»Was wünschen Sie? Wir werden es Ihnen bringen. Deftig? Englisch? Fitness?«
»Eher französisch – viel starken Kaffee, Croissant, Brötchen, Marmelade, Honig.«
»Kein Problem!« Er wandte sich an eine der jungen Frauen, die von Tisch zu Tisch schwirrten, Kaffee brachten und Teller abräumten. »Ich habe gehört, dass Sie Ludmilla gefunden haben«, begann Dallmann das Gespräch. »Tot. Das ist schrecklich!«
Seinem Appetit schien dieser Schrecken aber keinen Abbruch zu tun. Er schaufelte eine große Portion Rührei mit Garnelen in sich hinein.
»Ludmilla Herzegowina. Woher stammt sie?«, fragte Scheller.
»Nicht aus Bosnien, auch nicht aus der Herzegowina. Sie stammt aus Weißrussland. Aber fragen Sie mich nicht, wie sie zu diesem Namen gekommen ist.«
»Das ist ihr wirklicher Name gewesen? Er klingt wie ein Künstlername,« fragte Scheller.
»Er stand in ihren Papieren. Ich habe sie selbst gesehen. Vielleicht müssen Sie an Eva Herzigova denken. Ging mir am Anfang auch so.«
Eine der Servicemitarbeiterinnen brachte das Frühstück für Scheller. Nicht nur der Kaffee duftete verlockend. Alles war zudem äußerst geschmackvoll angerichtet. Drei Marmeladen in kleinen Glasschälchen, der Honig in einem essbaren Förmchen, das Croissant und die beiden Brötchen in einem Weidenkörbchen. Man sah ihnen an, dass es sich nicht um Tiefkühlware handelte. Die Butter auf einem kleinen Tellerchen und dann noch ein Schälchen mit Früchten.
Dallmann zeigte auf das Brotkörbchen. »Ich habe extra einen französischen Bäcker engagiert, damit die Croissants wirklich gut sind. Sie sollten mal sein Baguette probieren! Alles ist regionale Ware. Produkte der Westpfalz. Auch der Kaffee ist von einer lokalen Rösterei. Wir legen Wert auf Qualität und kurze Lieferwege. Nur auf diese Weise kann man sich von der Konkurrenz abheben und sich so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal erarbeiten.«
Scheller nahm einen Schluck von dem Kaffee. Er war wirklich gut. Dann wandte er sich an sein Gegenüber: »Sie hat hier als Zimmermädchen gearbeitet und gelegentlich bei Empfängen geholfen, wurde mir gesagt.«
»Ja, sie ist eine ausgesprochen hübsche Person. Sie hat sich da wirklich gut gemacht. Mit dem Deutschen hat es noch nicht perfekt geklappt, aber dieser Akzent und das gebrochene Deutsch, das hatte schon was.«
»Haben Sie sie näher gekannt?«
Jean Dallmann legte seine Gabel beiseite und schaute Scheller in die Augen. »Dass hier gar keine Missverständnisse aufkommen. Meine Mitarbeiterinnen sind für mich tabu. Das galt auch für Ludmilla.«
»Ich glaube, das Missverständnis liegt auf Ihrer Seite«, gab Scheller nicht ganz ohne Schärfe zurück. »Ich dachte da eher an Familienverhältnisse, Freunde, Freizeitverhalten, Verhältnis zu den Kolleginnen und so weiter.«
»Nein, da weiß ich nichts. Da müssen Sie die Hausdame fragen und ihre Kolleginnen. Aber bitte diskret. Bringen Sie mir keine Unruhe ins Haus! Die Gäste wollen sich hier erholen. Ich bin dabei, dieses Hotel aufzubauen und auf dem Markt zu platzieren. Das ist schwer genug.«
Scheller verteilte sorgfältig etwas Butter auf die Hälfte seines Croissant und strich ein wenig von der Blaubeermarmelade darüber.
»Seit wann gehört Ihnen das Hotel?«
»Seit zwei Jahren und ich beabsichtige, es zu einem der führenden Wellness-Hotels zu machen.«
»Das dürfte nicht leicht werden, bei dieser Lage«, sagte Scheller leise schmatzend.
»Wenn es leicht wäre, hätte ich mir dieses Projekt nicht vorgenommen. Leichtes ist etwas für die anderen. Ich suche die Herausforderung.« Dallmann hielt kurz inne. »Und ich möchte etwas für meine Heimat machen, für diese Gegend, die ich so liebe.«