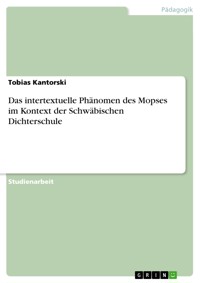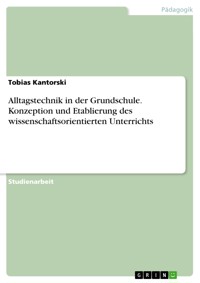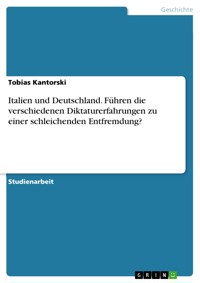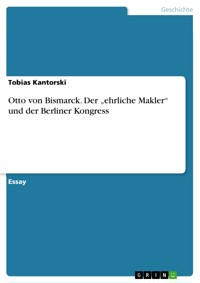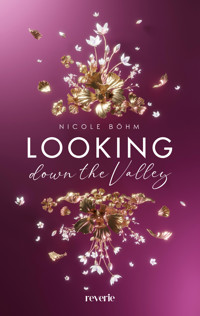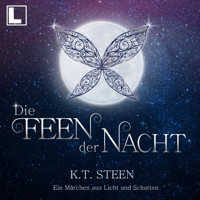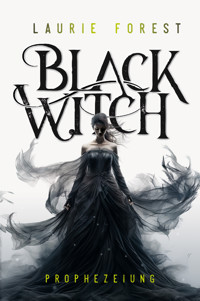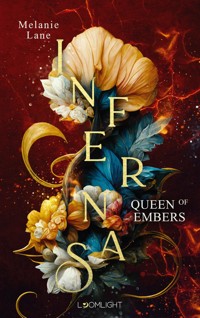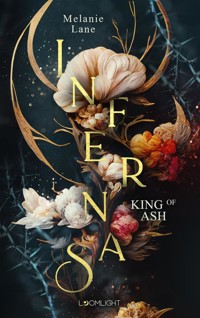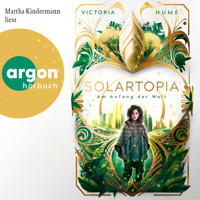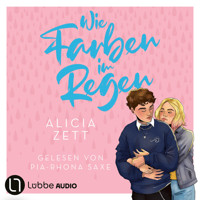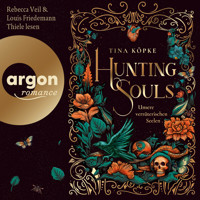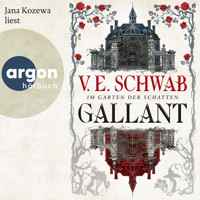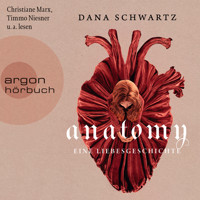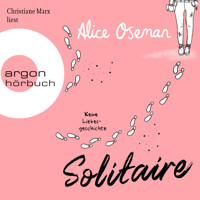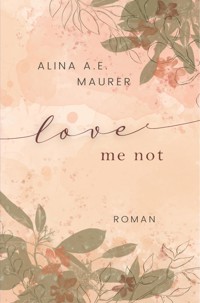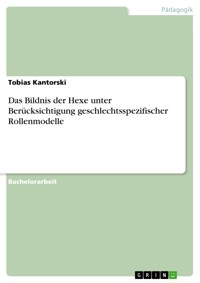
Das Bildnis der Hexe unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Rollenmodelle E-Book
Tobias Kantorski
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Didaktik für das Fach Deutsch - Literaturgeschichte, Epochen, Note: 2,1, Universität Hildesheim (Stiftung) (Deutsche Sprache und Literatur), Veranstaltung: Bachelorarbeit, Sprache: Deutsch, Abstract: „Das Bild der Hexe, wie wir es aus bekannten Märchen kennen, ist sehr einseitig. Als Kinderschreck ist sie alt, hässlich und böse“ (Früh 1986, S. 7). Dieses Zitat von Früh verweist auf eine deutlich vorhandene Bildreferenz der magischen Persönlichkeit. Auch Lindauer gibt an, dass unweigerlich ein bestimmtes Vorstellungsbild der physischen Erscheinung vorliegt, wenn sich eine Hexe vorgestellt wird. Dies trifft ebenso auf ihr männliches Pendant, dem gutmütigen sowie weisen Magier, zu. Dahingehend wurde im Titel der Bachelorarbeit der Begriff des Bildnisses gewählt, welcher der Kunstwissenschaft zu entnehmen ist und ursprünglich ein Gemälde kennzeichnet. Stattdessen wird in der vorliegenden Ausarbeitung auf ein geistiges bzw. imaginäres „Gemälde“ referenziert, das sich im Verlauf der Jahrhunderte festigte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2 Begrifflichkeiten
2.1 Das Rollenmodell
2.2 Die Hexe
3. Die Vernichtung der weisen Frau
3.1 Historischer Wandel des Hexenbildes
3.2 Die Hexenbilder des 15. Jahrhunderts
3.2.1 Die Festigung von „Sex- Establishments“
3.2.2 Der „Hexenhammer“
3.2.3 Die „reale“ Hexe
4. Das Böse im Märchen: die Hexe
4.1 Die Grimmsche Märchensammlung
4.2 Darstellung der Hexe
4.2.1 Die böse Hexe
4.2.1 Die gute Hexe
4.3 Das Motiv der Sexualität
4.4 Das Motiv der Stiefmutter
5. Das Erbe Merlins: der Erzmagier
5.1 Historische Einordnung des Schwarzkünstlers
5.2 Doktor Faustus als Prototyp des Hexers
5.2.1 Der historische Faust
5.2.2 „Die Historia des D. Johann Fausten“: der „Urfaust“
5.2.3 „Die tragische Historie vom Doktor Faustus“ nach Marlowe
5.2.4 Die Genossin der Hexe: Gretchen und das Motiv der Kindstötung
6. Der moderne Grimm: Walt Disney und die Reinkarnation der Märchenhexe?
6.1 Die Dämonologie des Bösen im „Duell der Magier“
6.2 Auswertung der Farbsymbolik unter Berücksichtigung filmsprachlicher Kameratechniken
6.2.1 Das ambivalente Blau
6.2.2 Das dämonische Rot
7. But I thought all witches were wicked?
7.1 Der Wandel des Hexentypus
7.2 Die „neuen“ Hexen und Hexer?
7.3 Vergleich der Nationen
8. Fazit
9. Anhang
9.1 Die Rahmenhandlung vom Film „Duell der Magier“
9.2 Intertextualität im Film „Duell der Magier“
9.3 Filmausschnitte
9.3.1 Die Tiere
9.3.2 Amerikanische Duellszene
9.3.3 Kameraperspektive Normalsicht
9.3.4 Die blaue Magie Morganas
9.3.5 Der weißmagische Schutzschild
9.3.6 Die schattenhaften Züge Morganas
9.3.7 Froschperspektive
9.3.8 Der Schönheitsaspekt Morganas
10. Verzeichnisse
10.1 Literaturverzeichnis
10.2 Filmverzeichnis
1. Einleitung
„Das Bild der Hexe, wie wir es aus bekannten Märchen kennen, ist sehr einseitig. Als Kinderschreck ist sie alt, hässlich und böse“(Früh 1986, S. 7).
Dieses Zitat von Früh verweist auf eine deutlich vorhandene Bildreferenz der magischen Persönlichkeit. Auch Lindauer gibt an, dass unweigerlich ein bestimmtes Vorstellungsbild der physischen Erscheinung vorliegt, wenn sich eine Hexe vorgestellt wird. Dies trifft ebenso auf ihr männliches Pendant, dem gutmütigen sowie weisen Magier, zu (Vgl. Lindauer 2012, S. 16- 19). Dahingehend wurde im Titel der Bachelorarbeit der Begriff des Bildnisses gewählt, welcher der Kunstwissenschaft zu entnehmen ist und ursprünglich ein Gemälde kennzeichnet. Stattdessen wird in der vorliegenden Ausarbeitung auf ein geistiges bzw. imaginäres „Gemälde“ referenziert, das sich im Verlauf der Jahrhunderte festigte (Vgl. Rudolph 2004, S. 10- 12).
Diesbezüglich stellt sich die Frage, wie jene diffamierenden Assoziationsketten entstanden und wie Figuren demgemäß in der Literatur dargestellt werden. Ist womöglich ein Archetypus zu markieren, der diverse Attribute der satanischen Zauberin umfasst? Um jene Aspekte zu eruieren, widmet sich ein thematischer Schwerpunkt zunächst der Historie. Obgleich die Dienerin der Dämonen seit der Antike vorzufinden ist, begrenzt sich jenes Segment jedoch auf die Anfänge der Hexenverfolgung im Spätmittelalter. Warum diese zeitliche Einteilung gewählt wurde und inwiefern die Epoche das Hexenbild im Schriftgut zeichnete, klärt der dritte Abschnitt.
Im Rahmen der erwähnten Inquisition entstand die Bezeichnung Märchenhexe. Aus diesem Grunde betrachtet das Segment 4 die mediävalen Auswirkungen anhand des Märchen Genres. Bedeutsame Größen repräsentieren hierbei die Gebrüder Grimm (Vgl. Turner 2014, S. 7-9). Ihre Relevanz für die Literaturwissenschaft wird in einem separaten Unterpunkt hervorgehoben. Es soll abgewogen werden, ob mittelalterliche Normen, Ideale oder Habitusformen in den „Kinder- und Hausmärchen“ enthalten sind. In diesem Kontext konstatiert Röhrich, dass „es festgelegte spezifische Geschlechterrollen und bestimmte Rollenerwartungen im Märchen gibt“ (Röhrich [1] 2002, S. 11). Angesichts dieser These berücksichtigt die Bachelorarbeit innerhalb der sieben inhaltlichen Gebiete stets im besonderen Maße geschlechtsspezifische Rollenmodelle, die vom Terminus vorab geklärt werden. Demgemäß liegt auch eine Differenzierung vor, weshalb der männliche Zauberer durch das Beispiel des „Faust“- Typus im Kapitel 5 von der Hexe unterschieden wird.
Ferner gibt Rudolph aber an, dass sich im zeitgenössischen Sozialisationsprozess aufgrund der Etablierung des Fernsehens sowie Films, eines historischen Erkenntniserwerbs sowie weiteren Gegebenheiten ein Wandel vollzog (Vgl. Rudolph 2004, S. 10- 12).Ob dieser auch im geschlechtsabhängigen Hexenbild zu identifizieren ist, analysieren die Abschnitte 6 sowie 7. Speziell der zuerst genannte betrachtet mediendidaktisch den Film „Duell der Magier“ und ergründet, ob sich ein Archetypus nur durch physische Gestaltungselemente der Figur zeigt oder ob allein die Farbsymbolik schon Aufschluss ermöglicht.
2 Begrifflichkeiten
2.1 Das Rollenmodell
„Gender is a constitutive element of social relationships based on perceived differences between the sexes, and gender is a primary way of signifying relationships of power”(Mathes 2001, S. 25).
Dieses Zitat von Mathes basiert auf poststrukturalistischen Doktrinen, welche unter anderem dem Anthropologen Ralph Linton zuzuordnen sind. Sie typisieren Aussagen eines subjektiven Diskurses in der Öffentlichkeit nach „sex“. Obgleich supponiert Foucault, dass jegliche gesellschaftliche Auseinandersetzungen die Wirklichkeit konstruieren. So ist auch das Konzept der Zweigeschlechtlichkeit auf diese Aspekte zurückzuführen. Jenes umfasst Vorstellungen von der Existenz eines männlichen und weiblichen Individuums, welches sich seiner biologischen Disposition fügt (Vgl. Lehnert 1996, S. 5- 9).
In Anbetracht des Belegs Mathes‘ kritisiert Schubert, dass Geschlecht weder natürlich, noch von Geburt an gegeben ist. Dahingehend liegt der Bachelorarbeit die sozialwissenschaftliche Theorie des Rollenmodell Konstruktes zu Grunde, welches besagt, dass lebenslange Interaktionsketten geschlechtsspezifische Handlungsweisen erzeugen. In diesem Kontext definiert der Terminus Rolle zunächst ein Bündel von Verhaltenserwartungen, welche mit einer speziellen Position verbunden sind (Muss-, Soll- und Kann- Erwartungen, Intrarollen- sowie Interrollenkonflikteetc.). Voraussetzungen bestehen anhand gesellschaftlicher Ordnungsprinzipien, die durchRegularitäten aufrechterhalten werden. Diesbezüglich vermittelt ein Sozialisationsprozess Regelwissen, welches einer Person ermöglicht, die in ihrem Umfeld geltenden Vorstellungen zu identifizieren und sich entsprechend (regelkonform oder ggf. abweichend) zu verhalten(Vgl. Schubert u. Klika 2013, S. 64- 67).
„Zur Herstellung von Geschlecht ist [ungeachtet dessen] eine hohe Kompetenz des Individuums in Darstellung und Wahrnehmung notwendig, [da die Rollenanforderungen stets interpretationsbedürftig sind]“ (Lehnert 1996, S. 5). Für jene Fähigkeit muss ein inkorporierter Habitus vorliegen, damit sie routiniert erfolgt. Die Produktion von Geschlecht ereignet sich infolgedessen präreflexiv und umfasst des Weiteren vermeintlich biologisch bedingte Idealbilder von normativen Geschlechtscharakteren. Jene weisen historische Bezüge auf. So beansprucht das Weibliche die Bereiche Passivität, Empfindung, Orientierung nach Innen, Abhängigkeit, Anmut, Anpassung und Betriebsamkeit, das Männliche dagegen die Eigenschaften Aktivität, Vernunft, Logik, Würde, Orientierung nach Außen, Selbstständigkeit sowie rationales Durchsetzungsvermögen (Vgl. Schubert u. Klika 2013, S. 67- 72). „[Das Rollenmodell] über die polaren Geschlechtscharaktere führt mit dem ‚Wesen‘ der Geschlechter zur Verteilung der Menschen auf die Öffentlichkeit und Privatheit eine neue Legitimation für die Vorherrschaft des Mannes über die Frau ein“ (Vgl. Lehnert 1996, S. 6). Die inhaltliche Ausrichtung der Rollen Mann sowie Frau ist dabei kein stabiler Faktor, sondern kann modifiziert werden. Lediglich die grundlegende Geschlechtstrennung stellt eine Konstante dar (Vgl. ebd., S. 5- 11).
Das Rollenmodell ist zusammenfassend ein bedeutungsstiftendes Dogma. Deshalb besteht erst die Möglichkeit von der Existenz männlicher und weiblicher Attribute (in der christlich- abendländischen Kultur) zu sprechen, welche für die Darlegung des Hexenbildnisses essentiell erscheinen (Vgl. Mathes 2001, S. 25).
2.2 Die Hexe
Zunächst ist laut Forschungsstand Turners anzugeben, dass die Bereiche Herkunft als auch Bedeutung des Begriffes Hexe gegenwärtig noch nicht hinreichend erforscht wurden. Es erscheint ihr dahingehend äußerst spekulativ, ob es sich bei dem Terminus ausschließlich um ein Kompositum der Wörter „hag“ sowie „zussa“ („hagazussa“) handelt (Vgl. Turner 2014, S. 4). Um die Validität dieser These festzustellen, wurden Kommentare diverser Autoren wie Gerlach berücksichtigt, welche jene Ansicht teilen. Ungeachtet dessen ist der Ursprung auf eine etymologische Perspektive zurückzuführen (Vgl. Gerlach 1990, S. 962).