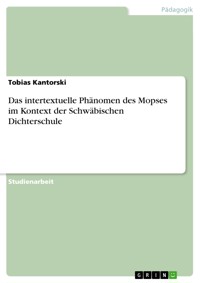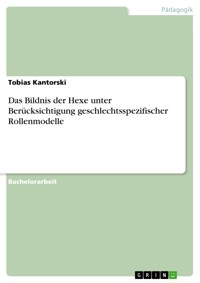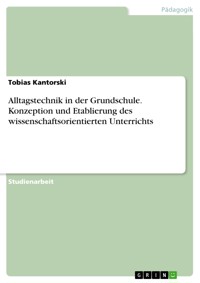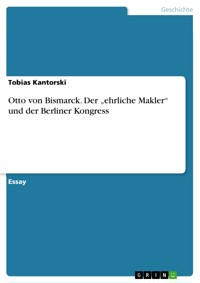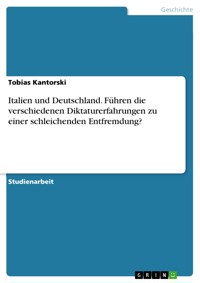
Italien und Deutschland. Führen die verschiedenen Diktaturerfahrungen zu einer schleichenden Entfremdung? E-Book
Tobias Kantorski
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Geschichte Deutschlands - Neuere Geschichte, Note: 2,0, Universität Hildesheim (Stiftung) (Geschichte), Veranstaltung: Europagespräche, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Reflexion, welche dem Kolloquium Europagespräche des Wintersemesters 14/15 zu Grunde liegt, befasst sich in den folgenden Segmenten mit dem Expertenvortrag, der die verschiedenen Diktaturerfahrungen sowie deren Umgang in den Ländern Deutschland und Italien thematisierte. In jenem wurde prononciert erläutert, dass die nunmehr über mehrere Jahrzehnte andauernde kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalismus und Faschismus entscheidend zum Entstehen der politischen und demokratischen Kultur der genannten Staaten beigetragen hat. Jedoch besteht nach Meinung des Referenten ein wesentlicher Unterschied in der Art und Weise, wie sich die Nationen mit ihren wechselseitigen Wahrnehmungen den totalitären Erfahrungen stellen. Die deutschen Bürger beispielsweise leiten meist ihre unmittelbare Identität von den Gewalttaten aus der Zeit des zweiten Weltkrieges ab. In diesem Kontext wird gemeinhin der Terminus Vergangenheitsbewältigung gebraucht, welcher in Italien dagegen die Geschichte der antifaschistischen Resistenza versinnbildlicht. Diese Aspekte werden in der Reflexion aufgegriffen und mit der weiterführenden Thematik der vermeintlich schleichenden Entfremdung facettenreich geschildert. In diesem Zusammenhang muss dennoch berücksichtigt werden, dass es sich um eine „heiße Geschichte“ handelt, welche die Gesellschaft nach wie vor beschäftigt und dessen Bewertung noch nicht gänzlich abgeschlossen sondern von hoher Emotionalität geprägt ist. Dementsprechend finden sich in dieser Ausarbeitung der Studienleistung vereinzelnd stereotypische Darstellungen der selbst gewählten Autoren wieder. Um eine annähernde Multiperspektivität zu erlangen, wurde italienische (übersetzte) sowie im deutschen verfasste Literatur genutzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Hauptteil
2.1 Politische/ wirtschaftliche Dimension
2.2 Historische Dimension
2.3 Perspektiven
3. Fazit
4. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die vorliegende Reflexion, welche dem Kolloquium Europagespräche des Wintersemesters 14/ 15 zu Grunde liegt, befasst sich in den folgenden Segmenten mit dem Expertenvortrag, der die verschiedenen Diktaturerfahrungen sowie deren Umgang in den Ländern Deutschland und Italien thematisierte.
In jenem wurde prononciert erläutert, dass die nunmehr über mehrere Jahrzehnte andauernde kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalismus und Faschismus entscheidend zum Entstehen der politischen und demokratischen Kultur der genannten Staaten beigetragen hat. Jedoch besteht nach Meinung des Referenten ein wesentlicher Unterschied in der Art und Weise, wie sich die Nationen mit ihren wechselseitigen Wahrnehmungen den totalitären Erfahrungen stellen. Die deutschen Bürger beispielsweise leiten meist ihre unmittelbare Identität von den Gewalttaten aus der Zeit des zweiten Weltkrieges ab. In diesem Kontext wird gemeinhin der Terminus Vergangenheitsbewältigung gebraucht, welcher in Italien dagegen die Geschichte der antifaschistischen Resistenza versinnbildlicht.
Diese Aspekte werden in der Reflexion aufgegriffen und mit der weiterführenden Thematik der vermeintlich schleichenden Entfremdung facettenreich geschildert. In diesem Zusammenhang muss dennoch berücksichtigt werden, dass es sich um eine „heiße Geschichte“ handelt, welche die Gesellschaft nach wie vor beschäftigt und dessen Bewertung noch nicht gänzlich abgeschlossen sondern von hoher Emotionalität geprägt ist.[1]
2. Hauptteil
2.1 Politische/ wirtschaftliche Dimension
Diverse wissenschaftliche Publikationen warnen derzeit von einem Auseinanderdriften der beiden Länder. Die Hausarbeit tituliert jenen Sachverhalt in Anlehnung an einen Beitrag von Gian Enrico Rusconi mit der Überspitzung beziehungsweise Dramatisierung der schleichenden Entfremdung. Obwohl die Behauptung auf heftigen Wiederspruch stößt, besitzen dennoch viele Mitglieder der politischen Klasse der Bundesrepublik eine äußerst einseitige Betrachtung von Italien. Jenes präsentiert sich ausschließlich wirtschaftlich interessant sowie kulturell anziehend. Phänomene wie die Renaissance von Fiat oder die Hegemonie des „saper vivere“ lassen sich zur Begründung nutzen. „Ob es nun um Kleidung, Kochkunst, Design, Architektur oder Musik geht, überall wirken Italiener in der Bundesrepublik stilbildend, von Armani über Illy Espresso bis hin zu Zucchero“.[2] Nur im politischen Bereich scheint die Attraktivität aufgrund der Substanzlosigkeit nicht im selben Maße vorzuherrschen. Derartige Ansichten sind in keinen parteilichen Manifesten schriftlich festgehalten, jedoch handeln dessen Repräsentanten und Repräsentantinnen in diesem Sinne.[3] „Was [in Italien] fehlt, ist eine politische Kultur, die den Namen wirklich verdient“.[4]
Somit ist eine grundlegende Asymmetrie mit deutlicher Extrempolarisierung der beiden Staaten, welche sich auf fundamentale Bereiche bezieht, vorhanden. Auf der einen Seite etablierte sich in den letzten Jahrzehnten das Bild eines wirtschaftlich stabilen Deutschlands, das größtenteils in der Lage ist, soziale Problematiken ohne äußere Unterstützung zu bewältigen und im europäischen Vergleich eine zentrale Position einnimmt. Auf der anderen Seite dagegen befindet sich Italien, welches durch chronische Defizite in der politisch- institutionellen Stabilität verhäuft in den Medien emergierte, was dessen Bedeutungsträchtigkeit im europäischen Raum erschwerte. Die EU stellt eine „Einrichtung der Großen“ dar. Bei relevanten Themen konnte sich Italien zu wenig im Entscheidungsprozess involvieren, obwohl es sich beispielsweise bei der militärischen Verpflichtung in den Regionen Libanon und Afghanistan nicht zu unterschätzeneinbrachte. „Zeitweise fühlten sich die Italiener auch von den Deutschen aus der Krisendiplomatie ausgeschlossen und […] wie ein B- Land behandelt. Dieses zum Teil berechtigte Gefühl der Zurücksetzung tauchte in den folgenden Jahren und bis in die heutige Zeit immer wieder auf“.[5] Deutschland hingegen wurde zum Sinnbild der Staatengemeinschaft und erlangte zunehmend an maßgebender Gewichtung.[6]
Zusammenfassend kann jedoch die Beständigkeit und Flexibilität eines politischen Systems nicht das einzige Wertmaß für ein Land sein, indem die komplexe politische, soziale sowie kulturelle Realität reduziert betrachtet wird. Es ist zudem zu hinterfragen, warum von Italien ein Bild der Armut und Rückständigkeit vorliegt, obwohl es unter den Industriestaaten weltweit auf dem sechsten Platz rangiert. Es ist nicht einzig das Land der Camorra sondern auch eines der führenden Technologie, Forschung und Industrieproduktion. Im Jahre 2006 wurden Waren im Wert von 5,5 Milliarden Euro nach Baden- Württemberg expandiert, was dem chinesischen Niveau entspricht. Demnach beruhen die Ursachen für die Entstehung einer bilateralen Beziehungsfront auf anderen Gegebenheiten, die im Folgenden näher erörtert werden.[7]
2.2 Historische Dimension
Italien und Deutschland besaßen nach 1945 erhebliche Mühe den Schatten ihrer politischen Systeme Faschismus beziehungsweise Nationalismus abzulegen und in die europäische Gemeinschaft zurückzukehren. Sie waren militärisch, moralisch und auch ökonomisch denunziert.[8] „[Dadurch besaßen sie] Probleme verschiedener Natur, doch beide versuchten diese Probleme gleichermaßen durch die Verankerung im Westen (insbesonders durch die Anbindung an die Vereinigten Staaten) und durch die Einigung Europas zu lösen. Daraus erklärt sich die enge Zusammenarbeit, die in den Jahren 1951/ 52 ihren Höhepunkt erreichte“.[9] Dank dieses politischen Einverständnisses einer kulturellen Wahlverwandtschaft entstand in den sechziger Jahren ein äußerst diplomatischer und intellektueller Dialog, da die Länder in der europäischen Idee einen Ersatz für ihre zurückentwickelte nationale Identität suchten.[10]
Es gab jedoch eine entscheidende Zäsur durch den Fall der Mauer beziehungsweise dem damit verbundenen Zusammenbruch des Ostblocks (die Bedrohung der Sowjetunion fiel weg und Deutschland war ein vollwertiges Mitglied der internationalen Gemeinschaft), welche eine Auswirkung auf das deutsch- italienische Verhältnis besaß und jenes deutlich veränderte. Wie in den vorigen Abschnitt skizziert, bestand bis dato eine gemäßigte Hierarchie, da beide Nationen ein zwar nicht dauerhaft spannungsfreies aber dennoch gefestigtes materielles als auch ideelles Interesse besaßen und im positiven Sinne abhängig voneinander waren. Jene politische Verflechtung sorgte für eine gleichwertige Teilnahme an europäischen Einigungsprozessen mit dem Ziel der Integration.[11]
„[Die Wiedervereinigung weckte nun] Ängste vor einem übermächtigen und eigenwilligen Deutschland im Zentrum Europas. 45 Jahre [des] Zusammenlebens reichten nicht aus, solche Ängste zu vertreiben. Jene Ansichten wurden in der Bundesrepublik zumeist im politischen Sektor irritiert aufgenommen und mündeten im Satz vom ehemaligen Außenminister Hans- Dietrich Genscher gegenüber Gianni De Michelis: „You are not part of the game““.[12] Jene drastische Ausprägung eines belastenden Wahrnehmungsschematas ist auf kulturelle Verarbeitungsprozesse von großer zeitlicher Ausprägung zurückzuführen. Bis Mitte der neunziger Jahre verbanden viele italienische Bürger mit der „verspäteten Nation“ einen bedrohlichen Turnus des deutschen Nationalsozialismus. Anschläge beziehungsweise Ausschreitungen gegenüber Asylbewerbern in jener Zeit intensivierten die Befürchtungen des narrativen Revisionismus.[13] Der Historiker Rudolf Lill fasste es mit der knappen Aussage, dass so manche skeptische italienische Reaktionen auf den Erinnerungen des Machtmissbrauchs und der Besorgnis vor der Germanisierung des eigenen Landes beruhen, zusammen.[14]
Dies hatte darüber hinaus zur Folge, dass sich die Euphorie beziehungsweise der Enthusiasmus über das Ende des kalten und definitiven Abschluss des zweiten Weltkrieges zunächst nicht in gleicher Ausprägung auf europäischer Ebene übertrug. Genannte Vorbehalte waren noch nicht vollends überwunden. Doch trotz Bedenken einer Störung des innereuropäischen Gleichgewichts kam die EU bekanntlich Helmuth Kohl deutlich entgegen.[15]
Die sich hierdurch abzeichnenden Spannungen marginalisierten Italien konträr dazu aus demographischen, ökonomischen und geopolitischen Ursachen.[16] „Anfang der neunziger Jahre implodierte das italienische Parteiensystem im Zuge einer beispiellosen politisch- moralischen Krise. Italien verlor danach immer mehr das Interesse für das wiedervereinigte Deutschland“.[17] Implizit wird dadurch ein konjunkturabhängiges Wahrnehmungsbild dargelegt, welches eine Kultur der Distanziertheit mit einer persistenten Genese von Stereotypen ermöglichte.[18] Deutschland wiederrum gewann an Selbstsicherheit und konnte sich dadurch behaupten. Das Fundament der gemeinsamen Axiome und die Tradition des Austausches beziehungsweise Kooperation verloren an Stabilität.[19]
Dieses Defizit konnte seinerzeit Silvio Berlusconi mit Hilfe einer Mitte- Rechts- Koalition ausnutzen. Sein demokratischer Populismus zielte darauf die Parteiendemokratie zu ersetzen.[20] In Anbetracht des geschichtlichen Hintergrunds besitzt Deutschland ein ausgeprägtes Verständnis zur Gewaltentrennung. Durch den Sonderfall des flamboyanten Medienzars mit dessen Machtkonzentration entstand ein Misstrauen, welches durch kritische stereotypische Äußerungen in Anlehnung an das dritte Reich verstärkt wurde.[21] So titulierte man die Bundesbank verhäuft als Herrscher Europas oder karikierte die spätere Bundeskanzlerin als Reinkarnation Hitlers. Jene Anspielungen sind keine emotionalen Augenblicke sondern beruhen auf einen historischen Resonanzboden, der in einer negativ zu beurteilenden Kontinuität stetig auftritt.[22] Er zeigte insofern, dass überwunden geglaubte Animositäten wieder hervorbrechen konnten. „Daher konnten und können viele Deutsche nur schwer akzeptieren, dass eine Mehrheit der Italiener Berlusconi so viel Macht zugestand und sein problematisches Verhältnis zur Justiz hinnahm“.[23]
Seitdem häuften sich Störungen, welche sich zunächst im Bezug zum Eurobeitritt Italiens oder dem Argwohn gegenüber der deutschen Anerkennungspolitik jugoslawischer Balkanregionen zeigten.[24] Es war die Zeit der Mediendemokratien, in der das politische Geschehen stark personalisiert und mit der Bezeichnung der frostigen Berlusconi- Schröder- Jahre deklariert wurde. Das mangelnde Europaengagement der beiden Politiker wirkte sich negativ auf das deutsch italienische Verhältnis aus.[25]
2.3 Perspektiven
Das Finitum bestand in einer Imageschädigung der gesamten italienischen Nation. Auch nach der Wahlniederlage Berlusconis im Jahre 2006 und der Ankündigung eines Revitalisierungsschubes durch Romano Prodi gab es keine signifikanten Veränderungen.[26] Demungeachtet besitzen die Länder grundsätzlich aber seit der Abwahl des Medienzars wieder ähnliche Perspektiven. Die Staaten verfügen über keine Machtsignien und müssen sich durch eine ständige Besetzung im Sicherheitsrat in besonderer Form engagieren. Durch die Globalisierung, insbesondere die des Aufschwungs der Konkurrenz aus Asien, sind Herausforderungen für beide Länder entstanden, um eine europäische Identität zu bewahren. Auch im außenpolitischen Bereich in Bezug auf die Iran Politik sind gemeinsame Ansichten festzustellen. In der Theorie wären sie somit ideale Partner, da eben genannte Dimensionen übereinstimmen. Jedoch sind kooperative Initiativen unter Prodi nicht umgesetzt wurden. Damalige Amtsträger wie Sarkozy oder Blair wirkten sichtbarer an der Seite Angela Merkels.[27]
Die nationalen Interessen sind nicht mehr kompatibel. Eine Festigung des Axiomes der Koinzidenz scheiterte aufgrund wirtschaftlicher Nützlichkeitserwägungen. Eine Verbesserung des Verhältnisses ist in summa schwierig geworden. Kulturpolitische Aktivitäten sowie das gemeinsame wissenschaftliche Engagement könnten als erste Schritte gefördert werden, um eine Annäherung zu ermöglichen.[28]
Dies ist im universitären Rahmen schon gegeben, wo neue Höchststände der Erasmus Nutzer festzustellen sind. Jene teilnehmenden Institutionen mit dem Ziel des universitären Austausches begünstigen die Europäisierung des Studiums.[29] Diese Initiative zeigt, dass das italienische Interesse an Deutschland nicht verloren gegangen ist.[30] Neben der Möglichkeit der Etablierung von Erasmus als Studienangebot wird darüber hinaus gefordert das Netz der Zusammenarbeit zwischen Lektoren und Lektorinnen zu erweitern. „Derzeit arbeiten rund 150 Deutschlektorinnen und- lektoren als sogenannte freie Lektoren an italienischen Universitäten“.[31] Das Äquivalenzabkommen von 1998 regelt jenen Sachverhalt. Stipendien und weitere Angebote unterstützen zudem das deutsch- italienische Verhältnis.[32]
3. Fazit
„Italiener und Deutsche sind überzeugt davon, einander bestens zu kennen […]“[33], da die Beziehung der Nationen eine weitreichende Tradition besitzt. Ihre Verbindung existiert schon zu Zeiten des römischen Reiches.[34] Seit jener periodischen Einordnung besteht fortwährend eine Kluft zwischen gegenseitiger Bewunderung und hartnäckigen Ressentiments.[35]
Dennoch sind die Fortschritte bei der europäischen Einigung der engen kooperativen Zusammenarbeit beider Staaten zurückzuführen. Nach der Wiedervereinigung dagegen kam es allerdings zu vielen Auseinandersetzungen wie beispielsweise dem bilateralen Streit um eine Reform des Sicherheitsrates der Vereinten Nation. „In [diesen] Momenten der Spannung oder Meinungsverschiedenheiten tauchen dann plötzlich Bruchstücke der unreflektierten kollektiven Erinnerung auf. Einige gravierende Missstände oder Reibungen reichen aus, um eine Vergangenheit voll hässlicher Bilder des anderen wiederauferstehen zu lassen“.[36] Jenes entfremdete Potential ist nun in einer Phase spürbar, in welcher Europa auf nationale Egoismen zurückfällt und gewissermaßen die Initiativen philo- europäischer Staaten benötigt. Trotz Einführung des Euros fordern einzelne Staaten gleichwohl ihre Interessen ein, was eine schwindelnde Anziehungskraft des Projektes Europa beziehungsweise dem Verhältnis Deutschland- Italien hervorbringt.[37]
Ungeachtet dessen weisen Prodi und ältere italienische Staatschefs auf ein Kerneuropa mit Integrationsgedanken hin. „Dies setzt voraus, dass Deutschland den Wert Italiens als Partner neu schätzen lernt und sich nicht zu sehr auf Frankreich und Großbritannien fixiert, dass Italien historisch bedingte Vorbehalte und Ängste gegenüber Deutschland überwindet und sein politisches System stärkt“.[38]
Somit ist auch der erste Satz des Fazits ein Trugschluss. „Zu wenig weiß der eine von der Geschichte des anderen- einer Geschichte, die in ebenso einseitigen wie umstrittenen Ereignissen fortlebt. Gemeint sind hier vor allem die politischen Ereignisse der vergangenen einhundertfünfzig Jahre, die ausschlaggebend dafür sind, wie sich die beiden Nationen heute wahrnehmen“.[39]
4. Literaturverzeichnis
Angelo Bolaffi, Die Bühne der großen Politik. Eine unendliche Geschichte als Fortsetzungsroman?, in: Zeitgeschichte im Gespräch. Schleichende Entfremdung? Deutschland und Italien nach dem Fall der Mauer, hrsg. v. Gian Enrico Rusconi/ Thomas Schlemmer u.a., München 2008, S. 35- 42.
Bernd Roeck/ Christiane Liermann, Zu den Perspektiven der deutschen Kulturpolitik in Italien, in: Deutsche Kulturpolitik in Italien. Entwicklungen, Instrumente, Perspektiven. Ergebnisse des Projektes „Italia Germania“, hrsg. v. Bernd Roeck/ Charlotte Schuckert u. a., Tübingen 2002, S. 3- 50.
Christoph Kühberger, Metaphern der Macht. Ein kultureller Vergleich politischer Feste im faschistischen Italien und im nationalsozialistischen Deutschland, Berlin 2006.
Gian Enrico Rusconi, Deutschland- Italien, Italien- Deutschland. Geschichte einer schwierigen Beziehung von Bismarck zu Berlusconi, Paderborn 2006.
Gian Enrico Rusconi, Die Nachkriegsjahre sind vorbei, in: Parallele Geschichte? Italien und Deutschland 1945- 2000, hrsg. v. Gian Enrico Rusconi/ Hans Woller, Berlin 2006, S. 11- 26.
Gian Enrico Rusconi, Die politischen Wurzeln der schleichenden Entfremdung, in: Zeitgeschichte im Gespräch. Schleichende Entfremdung? Deutschland und Italien nach dem Fall der Mauer, hrsg. v. Gian Enrico Rusconi/ Thomas Schlemmer u.a., München 2008, S. 9- 16.
Hans Woller, Vom Mythos der schleichenden Entfremdung, in: Zeitgeschichte im Gespräch. Schleichende Entfremdung? Deutschland und Italien nach dem Fall der Mauer, hrsg. v. Gian Enrico Rusconi/ Thomas Schlemmer u.a., München 2008, S. 17- 24.
Henning Klüver, Wirtschaft und Gesellschaft. Stereotype und Perzeptionen. Impressionen eines deutschen Journalisten in Italien, in: Zeitgeschichte im Gespräch. Schleichende Entfremdung? Deutschland und Italien nach dem Fall der Mauer, hrsg. v. Gian Enrico Rusconi/ Thomas Schlemmer u.a., München 2008, S. 55- 64.
Stefan Ulrich, Die Bühne der großen Politik. Ähnliche Idee, wenige Probleme- und kein gemeinsames Projekt. Die politische Beziehungen seit der Wiedervereinigung, in: Zeitgeschichte im Gespräch. Schleichende Entfremdung? Deutschland und Italien nach dem Fall der Mauer, hrsg. v. Gian Enrico Rusconi/ Thomas Schlemmer u.a., München 2008, S. 25- 34.
Susanne Höhn, Stand und Perspektiven des Kulturrausches. Beharrlichkeit im Wandel, Lücken im Gesamtbild. Deutsche und Italiener in der gegenseitigen Wahrnehmung, in: Zeitgeschichte im Gespräch. Schleichende Entfremdung? Deutschland und Italien nach dem Fall der Mauer, hrsg. v. Gian Enrico Rusconi/ Thomas Schlemmer u.a., München 2008, S. 75- 82.
Ulrike Sepp, Stand und Perspektiven des Kulturrausches. Im Zeichen von „Erasmus“. Deutsch- italienischer Universitätsaustausch und europäische Integration, in: Zeitgeschichte im Gespräch. Schleichende Entfremdung? Deutschland und Italien nach dem Fall der Mauer, hrsg. v. Gian Enrico Rusconi/ Thomas Schlemmer u.a., München 2008, S. 73- 95.
[1]Christoph Kühberger, Metaphern der Macht. Ein kultureller Vergleich politischer Feste im faschistischen
Italien und im nationalsozialistischen Deutschland, Berlin 2006, S. 18.
[2]Stefan Ulrich, Die Bühne der großen Politik. Ähnliche Idee, wenige Probleme- und kein gemeinsames Projekt.
Die politische Beziehungen seit der Wiedervereinigung, in: Zeitgeschichte im Gespräch. Schleichende
Entfremdung? Deutschland und Italien nach dem Fall der Mauer, hrsg. v. Gian Enrico Rusconi/ Thomas
Schlemmer u.a., München 2008, S. 25- 34, hier S. 32.
[3]Gian Enrico Rusconi, Die politischen Wurzeln der schleichenden Entfremdung, in: Zeitgeschichte im Gespräch.
Schleichende Entfremdung? Deutschland und Italien nach dem Fall der Mauer, hrsg. v. Gian Enrico Rusconi/
Thomas Schlemmer u.a., München 2008, S. 9- 16, hier S. 7- 14.
[4] Ebd., S.11.
[5]Stefan Ulrich, Die Bühne der großen Politik. Ähnliche Idee, wenige Probleme- und kein gemeinsames Projekt.
Die politische Beziehungen seit der Wiedervereinigung, in: Zeitgeschichte im Gespräch. Schleichende
Entfremdung? Deutschland und Italien nach dem Fall der Mauer, hrsg. v. Gian Enrico Rusconi/ Thomas
Schlemmer u.a., München 2008, S. 25- 34, hier S. 28.
[6]Gian Enrico Rusconi, Die politischen Wurzeln der schleichenden Entfremdung, in: Zeitgeschichte im Gespräch.
Schleichende Entfremdung? Deutschland und Italien nach dem Fall der Mauer, hrsg. v. Gian Enrico Rusconi/
Thomas Schlemmer u.a., München 2008, S. 9- 16, hier S. 9- 11.
[7]Angelo Bolaffi, Die Bühne der großen Politik. Eine unendliche Geschichte als Fortsetzungsroman?, in:
Zeitgeschichte im Gespräch. Schleichende Entfremdung? Deutschland und Italien nach dem Fall der Mauer,
hrsg. v. Gian Enrico Rusconi/ Thomas Schlemmer u.a., München 2008, S. 35- 42, hier S. 37.
[8]Hans Woller, Vom Mythos der schleichenden Entfremdung, in: Zeitgeschichte im Gespräch. Schleichende
Entfremdung? Deutschland und Italien nach dem Fall der Mauer, hrsg. v. Gian Enrico Rusconi/ Thomas
Schlemmer u.a., München 2008, S. 17- 24, hier S. 19.
[9]Gian Enrico Rusconi, Die Nachkriegsjahre sind vorbei, in: Parallele Geschichte? Italien und Deutschland 1945-
2000, hrsg. v. Gian Enrico Rusconi/ Hans Woller, Berlin 2006, S. 11- 26, hier S. 19.
[10]Angelo Bolaffi, Die Bühne der großen Politik. Eine unendliche Geschichte als Fortsetzungsroman?, in:
Zeitgeschichte im Gespräch. Schleichende Entfremdung? Deutschland und Italien nach dem Fall der Mauer,
hrsg. v. Gian Enrico Rusconi/ Thomas Schlemmer u.a., München 2008, S. 35- 42, hier S. 38- 41.
[11]Gian Enrico Rusconi, Die politischen Wurzeln der schleichenden Entfremdung, in: Zeitgeschichte im
Gespräch. Schleichende Entfremdung? Deutschland und Italien nach dem Fall der Mauer, hrsg. v. Gian Enrico
Rusconi/ Thomas Schlemmer u.a., München 2008, S. 9- 16, hier S. 12- 13.
[12]Stefan Ulrich, Die Bühne der großen Politik. Ähnliche Idee, wenige Probleme- und kein gemeinsames
Projekt. Die politische Beziehungen seit der Wiedervereinigung, in: Zeitgeschichte im Gespräch. Schleichende
Entfremdung? Deutschland und Italien nach dem Fall der Mauer, hrsg. v. Gian Enrico Rusconi/ Thomas
Schlemmer u.a., München 2008, S. 25- 34, hier S. 27.
[13]Gian Enrico Rusconi, Deutschland- Italien, Italien- Deutschland. Geschichte einer schwierigen Beziehung von
Bismarck zu Berlusconi, Paderborn 2006, S. 261.