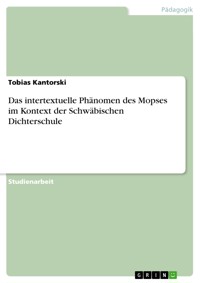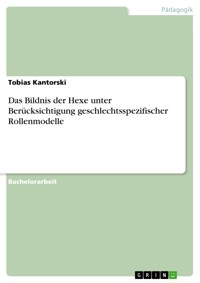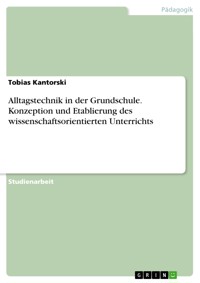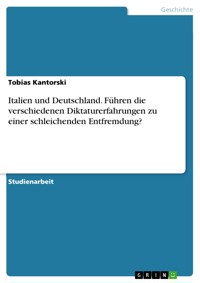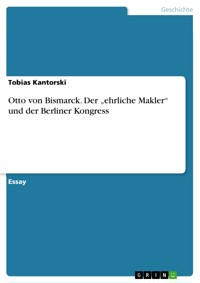Ungewollte Kinderlosigkeit. Gesellschaftliche Einflüsse, Bewältigungsversuche und Dominanz der Medizin E-Book
Tobias Kantorski
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Soziologie - Beziehungen und Familie, Note: 1,0, Universität Hildesheim (Stiftung) (Soziologie), Veranstaltung: Gleichheit und Differenz: Zum Diskurs von Lebens- und Familienformen im Wandel, Sprache: Deutsch, Abstract: Seit den 1970er Jahren besteht die Möglichkeit reproduktive Maßnahmen in Anspruch zu nehmen, um eine ungewollte Kinderlosigkeit zu vermeiden. Inzwischen gelten sie als medizinische Standartverfahren. 2012 wurden in Deutschland 1,9% aller Geburten durch die assistierende Reproduktionsmedizin ermöglicht. Eine Behandlung ist jedoch nicht erfolgssicher sondern äußerst vage. Trotzdem versprechen sich viele Paare beim Ausbleiben der Schwangerschaft große Hoffnungen an die Fortpflanzungsmedizin. Wenn jedoch das Vorhaben endgültig ausbleibt, hat dies Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Eine ganze Zukunftsperspektive zerbricht daran. Besteht ein Verhältnis zwischen Bezugspersonen/-gruppen mit dessen normativen/ sozialen Erwartungen und der Entscheidung, assistierende Reproduktion oder im Falle einer Behinderung eine gesetzlich legale Abtreibung in Anspruch zu nehmen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2. Hauptteil
2.1 Die Fokussierung auf die Kinderwunschbehandlung - Der generelle Einfluss sozialer Bezugspersonen
2.2 Die Dominanz der Medizin - Der Einfluss der Ärzte
2.3 Die Pränataldiagnostik - Auswirkungen auf die Akzeptanz von Behinderung
3 Reflexion (der Literatur von Monika Fränznick und Brigitte Sorg)
4. Literaturverzeichnis
4.1 Anhang
1 Einleitung
Seit den 1970er Jahren besteht die Möglichkeit reproduktive Maßnahmen in Anspruch zu nehmen, um eine ungewollte Kinderlosigkeit zu vermeiden. Inzwischen gelten sie als medizinische Standartverfahren. 2012 wurden in Deutschland 1,9% aller Geburten durch die assistierende Reproduktionsmedizin ermöglicht. Eine Behandlung ist jedoch nicht erfolgssicher sondern äußerst vage (vgl. Hoffmann 2013, S. 210- 211). Trotzdem versprechen sich viele Paare beim Ausbleiben der Schwangerschaft große Hoffnungen an die Fortpflanzungsmedizin. Wenn jedoch das Vorhaben endgültig ausbleibt, hat dies Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Eine ganze Zukunftsperspektive zerbricht daran. „Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen gibt es kaum“ (Enchelmaier 2004, S. 8).
Angesichts des zuletzt angeführten Aspektes befasst sich die vorliegende Hausarbeit im weiteren Verlauf mit der Fragestellung, welche dem Seminar Gleichheit und Differenz: Zum Diskurs von Lebens- und Familienformen im Wandel SoSe 2014 zu Grunde liegt:
Ungewollte Kinderlosigkeit
-Gesellschaftliche Einflüsse, Bewältigungsversuche und Dominanz der Medizin-
„Besteht ein Verhältnis zwischen Bezugspersonen/- gruppen mit dessen normativen/ sozialen Erwartungen und der Entscheidung, assistierende Reproduktion oder im Falle einer Behinderung eine gesetzlich legale Abtreibung in Anspruch zu nehmen?“
Die Ausarbeitung schildert allgemeine Facetten der Reproduktionsmedizin, welche heutzutage als selbstverständlich gilt und definiert in diesem Kontext mögliche Ursachen für jenen Sachverhalt. Es soll herausgestellt werden, dass die Perspektive der Frau, welche durch die assistierende Methodik eine biologisch unabhängige Gleichberechtigung beziehungsweise Selbstbestimmung erlangt, trotzdem von diversen Bezugsgruppen wie dem Freundeskreis, der Familie oder den Ärzten geprägt und beeinflusst wird. Zudem werden weiterführende Informationen und Daten beziehungsweise Statistiken angegeben.
Die grundlegenden Gegebenheiten beruhen primär auf dem Seminartext „Frauen in der Reproduktionsmedizin: Hoffnungen – Entscheidungszwänge – Behandlungsspiralen“ von Monika Fränznick und Brigitte Sorg aus dem Jahr 2002. Jene schildern die Dimension der Verfahren kritisch in jeweils eigenen Kapiteln. Dabei unterscheiden sie zwischen der In- vitro- Fertilisation (IVF), der Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI), der Pränataldiagnostik (PND) und der Präimplantationsdiagnostik (PID). Da in modernen elektronischen Medien wie dem Fernsehen fast ausschließlich nur eine enthusiastische Berichterstattung vorliegt, versuchen die Autorinnen dem potentiellen Leser einen Überblick über Chancen und vor allem Risiken der genannten Verfahren zu ermöglichen.