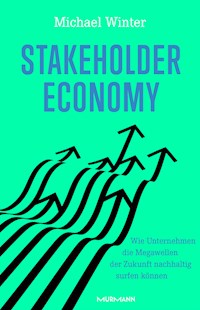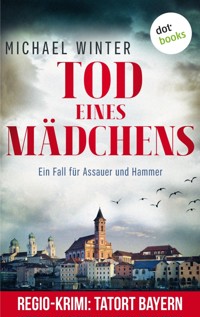Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Vergangenheit stirbt nie: Der fesselnde Thriller »Das Böse stirbt nie« von Michael Winter jetzt als eBook bei dotbooks. Buenos Aires, Argentinien. Sie sind weiblich, jung und tot. Aber wer hat die Frauen, deren Leichen man wie Abfall weggeworfen hat, auf dem Gewissen: Ist es die Organ-Mafia, wie der ermittelnde Kommissar vermutet? Von all dem ahnt der deutsche Journalist Peter Aschmann nichts, als er auf einem Münchner Friedhof Zeuge einer unfassbaren Szene wird: ein ehemaliger KZ-Häftling enttarnt eine Trauerfeier als Beerdigung eines alten Nazi-Verbrechers, der es nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geschafft hat, seine Weste rein zu waschen. Wie konnte es dazu kommen? Aschmann beginnt zu recherchieren – und stößt auf eine Spur, die ihn über Berlin, Wien und Madrid bis nach Buenos Aires führt – und zu einer Verschwörung, die seit Jahrzehnten die höchsten Kreise der Macht infiltriert und das Tausendjährige Reich wiederauferstehen lassen will … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der beklemmende Thriller »Das Böse stirbt nie« von Michael Winter wird alle Fans von Marc Elsberg und Mark Dawson begeistern wird. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Buenos Aires, Argentinien. Sie sind weiblich, jung und tot. Aber wer hat die Frauen, deren Leichen man wie Abfall weggeworfen hat, auf dem Gewissen: Ist es die Organ-Mafia, wie der ermittelnde Kommissar vermutet? Von all dem ahnt der deutsche Journalist Peter Aschmann nichts, als er auf einem Münchner Friedhof Zeuge einer unfassbaren Szene wird: ein ehemaliger KZ-Häftling enttarnt eine Trauerfeier als Beerdigung eines alten Nazi-Verbrechers, der es nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geschafft hat, seine Weste rein zu waschen. Wie konnte es dazu kommen? Aschmann beginnt zu recherchieren – und stößt auf eine Spur, die ihn über Berlin, Wien und Madrid bis nach Buenos Aires führt – und zu einer Verschwörung, die seit Jahrzehnten die höchsten Kreise der Macht infiltriert und das Tausendjährige Reich wiederauferstehen lassen will …
Über den Autor:
Michael Winter wurde 1946 in Frankfurt am Main geboren. Nach seinem Studium in München arbeitete er bei Siemens im Bereich Informatik. 1975 wechselte Michael Winter zum Bayerischen Rundfunk, wo er 35 Jahre lang Sprecher und Moderator war. Bis heute ist er außerdem als Regisseur und Drehbuchautor für Werbe- und Industriefilmproduktionen in Europa und Übersee erfolgreich.
***
Neuausgabe Dezember 2019
Dieses Buch erschien schon 2018 unter dem Titel »DNA des Todes« bei dotbooks GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe 2018 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf - auch teilweise - nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Agentur Scripta, München.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Malivaan Luliia, Shutterstock/saiko3p
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96148-317-4
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Das Böse stirbt nie an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können - danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Michael Winter
Das Böse stirbt nie
Thriller
dotbooks.
Für Leon
Prolog
2005
Buenos Aires, Argentinien, Morgue Judicial, 15. August 2005
Die Schritte hallten laut auf dem langen, gefliesten Gang im Untergeschoss der Morgue Judicial, des Gerichtsmedizinischen Instituts von Buenos Aires, während er dem Mann mit dem Namenschild Dr. Javier Maduro im weißen Kittel folgte.
Angestellte, denen sie begegneten, mieden seinen Blick und tauschten mit seinem Führer nur ein stilles Kopfnicken als Gruß. Offenbar wusste jeder, dass, wenn Maduro in Begleitung eines Fremden hier unten auftauchte, jemand gekommen war, um einen toten Angehörigen zu identifizieren. Und er war ein Fremder hier, wenn auch kein Unbekannter. Sein rasant expandierender Biotechnologie-Konzern ARGEN erhob sich wie der Morgenstern über der darniederliegenden Wirtschaft Argentiniens, und sein Bild war allgegenwärtig in den Zeitungen und den Fernsehnachrichten.
Zwei junge Frauen in weißem Kittel machten respektvoll Platz, als sie ihn erkannten, und er hörte sie hinter seinem Rücken tuscheln: »War das nicht Siegfried Kemmler?«
Die Kunde von dem Unglück, das ihn ereilt hatte, würde sich in Windeseile verbreiten. Binnen Stunden würden es alle Radio- und TV-Kanäle senden, und morgen früh würde es die Titelseiten der Zeitungen füllen.
Vor einer Doppeltür, durch deren schmale Glaseinsätze man in einen weiß gefliesten, hell erleuchteten Raum blicken konnte, blieb Dr. Maduro stehen.
»Sind Sie bereit?«, fragte er sanft und drückte nach einem stummen Nicken Kemmlers die Tür auf.
Das grelle, grünliche Neonlicht in dem gekachelten Raum, das in hartem Kontrast zur warmen Beleuchtung des Gangs stand, ließ Kemmler beim Eintreten unwillkürlich die Augen zukneifen. Erst einen Moment später, als er sich an das Licht gewöhnt hatte, sah er scharf, was beim Eintreten nur schemenhaft zu erkennen gewesen war: einen Seziertisch aus poliertem Edelstahl in der Mitte des Raums, darauf der mit einem weißen Laken abgedeckte Körper eines Menschen. Neben dem Tisch stand, Klemmbrett in der Hand, eine schmale Frau mittleren Alters in Kopfhaube und langem, grünem Kittel. Nach dem Namensschild Dr. Lupe Velasquez handelte es sich um eine Kollegin Maduros.
»Guten Tag, Señor Kemmler«, begrüßte sie ihn, obgleich sie einander noch nie begegnet waren. »Es tut mir sehr leid.«
Sein Begleiter blieb zwei Schritte vom Tisch entfernt mit ihm stehen. »Können wir?«
Kemmler atmete durch. »Bitte«, sagte er dann entschlossen, und Maduro gab der Frau ein Zeichen.
Behutsam schlug sie daraufhin das Laken so weit zurück, dass Kopf und Schultern der Gestalt auf dem Tisch zum Vorschein kamen. Kemmler zwang sich hinzusehen, blickte unbewegt auf das vertraute Gesicht, das hier, wächsern im kalten Neonlicht, so fremd wirkte.
Dr. Maduro ließ einige Sekunden verstreichen, bis er leise fragte: »Ist das Ihre Frau, Señor Kemmler?«
Kemmler nickte.
»Ich bedaure«, sagte Dr. Maduro. »Sie müssen es laut sagen fürs Protokoll.«
»Ja, das ist meine Frau«, erwiderte Kemmler tonlos.
Maduros Kollegin trug daraufhin etwas in ein Formular auf dem Klemmbrett ein und reichte es ihm zur Unterschrift. »Es tut mir sehr leid, Señor Kemmler«, sagte sie noch einmal, während er mit fahriger Schrift unterzeichnete.
»Könnte ich ein paar Augenblicke mit ihr allein sein?«, bat er dann.
»Selbstverständlich«, antwortete Maduro und ging mit der Kollegin nach draußen.
Allein im Raum, trat Kemmler näher an den breiten Stahltisch mit dem toten Körper seiner Frau heran.
Zwei Polizisten mit steinernen Gesichtern waren eine Stunde zuvor mit der Nachricht in seinem Büro erschienen, Hildegard sei auf dem Weg in die Stadt mit einem Colectivo, einem der bunten Linienbusse, die sich stets ohne Rücksicht auf Verluste durch den chaotischen Verkehr der Hauptstadt boxten, zusammengestoßen.
Mit dem Zeigefinger strich Kemmler zwei Strähnen des langen blonden Haars aus Hildegards Stirn und betrachtete ihr bleiches, starres Gesicht. Der Tod hatte ihre Schönheit noch nicht angetastet, aber da war nichts mehr von der quirligen, fröhlichen Person, die ihm im Leben so vertraut gewesen war. Vor ihm lag nicht der Mensch, den er gekannt hatte, sondern nur eine leere Hülle, die seiner Frau nicht mehr glich als eine seelenlose Wachsfigur.
Unbewegt und mit ausdruckslosem Gesicht verharrte er an Hildegards Leichnam und horchte in sich hinein. Warum war da keine Spur von Trauer? Sie hatten sich immerhin einmal geliebt. Hatte der Hass selbst den letzten Funken Zuneigung getötet? Ja, das war die bittere Wahrheit, gestand er sich ein.
Die Ehe war nicht gut gegangen. Der letzte, laut ausgetragene Krach vor drei Tagen gellte ihm noch in den Ohren. Der wievielte um immer um dasselbe Thema: Beide hatten sie sich so sehr Kinder gewünscht, Kemmler vor allem einen Sohn, der einst sein Erbe antreten würde. Doch es wollten keine Kinder kommen, und das vergebliche Bemühen zerfraß ihre Ehe, bis am Ende nur noch Hass und Verachtung blieben. Dass er frustriert ein Verhältnis mit Carlota Quiroga, einer Angestellten von ARGEN einging - was Hildegard nicht verborgen blieb -, versetzte der Ehe endgültig den Todesstoß.
»Ich habe genug, ich verlasse dich!« Hildegards letzte wütende Worte bei ihrem Streit vor drei Tagen. Seitdem hatte sie in einem der vielen Gästezimmer geschlafen.
Scheidung war jedoch keine Option. Nicht nur wegen des gesellschaftlichen Skandals. Gewichtiger war, dass eine Kommission der Regierung, welche die Geldströme während der Wirtschaftskrise untersuchte, sich anschickte, ihre Nase auch in die Geldquellen von ARGEN zu stecken. Die wildesten Gerüchte blühten über diese Quellen, und im Fall einer Scheidung hätte man sich unweigerlich auf seine Frau gestürzt. Zwar war Hildegard nicht unmittelbar in die Geschäfte eingebunden, dennoch hätte sie genug zu erzählen gehabt, um die Nasen der Schnüffler auf die richtige Spur zu lenken. Das musste unter allen Umständen verhindert werden.
Biotechnologie konnte die Welt verändern, und nichts weniger als das hatte er vor. Er würde sich nicht von Krämern aufhalten lassen.
Ein Frösteln lief über seinen Rücken. War es die Kälte im Raum, die ihn schaudern ließ, oder war es der Anblick des toten Körpers seiner Frau, der ihn daran gemahnte, dass er nicht unbegrenzt Zeit hatte? Zwar war er erst Mitte 40, doch es gab noch so unendlich viel zu tun. Unwillig schüttelte er die düsteren Gedanken ab. Tief durchatmend zog er das Laken wieder über das Gesicht seiner toten Frau.
Maduro und Velasquez, die ihn durch die verglasten Ausschnitte in der Tür beobachtet hatten, kamen daraufhin wieder herein.
»Den Aussagen von Zeugen zufolge ist Ihre Frau am Steuer tot zusammengebrochen«, sagte Maduro mit leiser Stimme. »Laut Polizei herrschte zu dem Zeitpunkt Stop-and-go-Verkehr, und sie fuhr kaum mehr als Schritttempo. Zudem war sie angeschnallt und der Airbag hat ausgelöst. Dennoch hat der Notarzt bei seiner Ankunft nur noch den Tod feststellen können.«
»Sehr ungewöhnlich bei einer so jungen Frau«, bemerkte seine Kollegin. »Aber ich verspreche Ihnen, dass wir die Ursache finden werden.«
Dieses Versprechen, dachte Kemmler, während er ihr zum Abschied die Hand drückte, würde sie nicht halten können.
Kapitel 1
2012
Buenos Aires, Stadtteil Palermo, Campo Argentino de Polo, Donnerstag, 25. Oktober, 10 Uhr
Die Tribüne vor der imposanten Hochhauskulisse, die sich hinter dem Campo Argentino de Polo an der Avenida del Libertador erhob, war bereits am Vormittag gut besetzt. Das große Benefizturnier der Asociatión Argentina de Polo, das alljährlich in der Zeit vor den offenen argentinischen Meisterschaften - dem Wimbledon des Polo - ausgetragen wurde, lockte wie jedes Jahr den Geldadel der argentinischen Hauptstadt auf die Ränge. Zwar war der Kreis der Gutbetuchten in der Wirtschaftskrise, die das Land nach der Jahrtausendwende fast erwürgt hatte, zusammengeschmolzen, doch in den letzten zwei, drei Jahren hatte ihre Zahl wieder zugenommen.
Nur ein paar besonders Gerissene hatten das Jammertal unbeschadet durchschritten. Entweder weil sie - durch Freunde in der Regierung vor der Schließung der Banken gewarnt - ihr Vermögen rechtzeitig außer Landes geschafft oder es fertiggebracht hatten, an der Krise zu verdienen. Rodriguez Durán gehörte zur letzten Kategorie. Skrupellos hatte er die Leichen bankrotter Unternehmen gefleddert und deren Reste an die verhassten Amerikaner verkauft. Binnen weniger Jahre war er so in den arg geschrumpften Klub der argentinischen Superreichen aufgestiegen.
Wie jeder Argentinier hatte er eine Leidenschaft für Polo - ein Spiel, das ebenso wie sein Geschäft den ganzen Mann und den vollen Einsatz forderte. Sein Team rangierte unter den Top Ten in Argentinien und stand damit in unmittelbarer Konkurrenz zu dem von Siegfried Kemmler.
Dessen Biotechnologie-Konzern, gegründet ausgerechnet auf dem Höhepunkt der Krise 2001 mittels scheinbar unerschöpflicher Geldquellen, war unbeeindruckt von den Turbulenzen um ihn herum rasant gewachsen, wurde mittlerweile in einem Atemzug genannt mit den fähigsten Unternehmen der Biotech-Branche wie Gilead Sciences, Novo Nordisc und Amgen und machte Konzernen wie Monsanto und Nestlé auf dem Markt für Saatgut und Nahrungsmittel Konkurrenz.
Es waren die Teams dieser beiden Superreichen, die das Eröffnungsspiel bestritten. Die Charaktere der Kapitäne - rabiater Ellenbogentyp der eine, kühl kalkulierend der andere - waren so unterschiedlich wie ihr Äußeres. Durán, mit dunklem Teint, der das Indioblut in seinen Adern verriet, Anfang 40, volles, dunkles Haar, klein, stämmig, mit breitem Gesicht, aus dem stets wachsame, listige, dunkle Augen blickten - Kemmler, zehn Jahre älter, groß gewachsen, blond, schlank und athletisch. Gemeinsam hatten ihre Charaktere nur eines: den unbedingten Willen zum Erfolg. Entsprechend verbissen kämpften sie an der Spitze ihrer Mannschaften - trotz des sozialen Anlasses, bei dem der sportliche Erfolg Nebensache war.
Kemmlers Miene verdüsterte sich im Laufe der Partie immer mehr, denn er musste erleben, wie seine Mannschaft ins Hintertreffen geriet. Endlich, fünf Minuten vor Ende des zweiten Chuckas, beim Stand von zwei zu null für Duráns Team, sah Kemmler die Chance für den Anschlusstreffer, trieb den Ball Richtung gegnerisches Tor und jagte ihm, den Kopf weit nach vorne über den Hals seines Ponys gebeugt, hinterher - niemand zwischen ihm und dem Tor!
Durán bemerkte er zu spät. Sein Rivale schoss von rechts heran, kreuzte die Linie des Balls unmittelbar vor ihm - ein klassisches Foul - und riss zum Schlagen auch noch sein Pony so abrupt herum, dass Kemmler nicht mehr ausweichen konnte und Pferde und Reiter ineinander krachten. Der Pfiff des Schiedsrichters ging im Aufschrei der Zuschauer auf der Tribüne unter, Kemmler und Durán flogen aus dem Sattel, die Pferde stürzten und bildeten ein zappelndes Knäuel aus verdrehten Körpern und schlagenden Beinen. Wütend sprang Kemmler hoch und hob sein Mallet auf. Er hatte gute Lust, Durán den Schläger über den Kopf zu ziehen.
»Caramba, Rodriguez!«, fuhr er ihn an. »Was soll das? Willst du, dass ich mir den Hals breche? Das hier ist bloß ein Benefizturnier!«
»Deine Reaktionen waren schon mal besser«, konterte Durán hämisch, während er sich den Dreck von der Hose klopfte.
»Du bist und bleibst ein verfluchter Pitbull!«, schimpfte Kemmler und sah sich nach den Ponys um. Die Tiere hatten sich wieder aufgerappelt und schienen Gott sei Dank unverletzt. Er setzte zu ein paar weiteren scharfen Worten in Richtung seines Gegners an, doch ein kleiner, rundlicher Mann, der sich eilig vom Spielfeldrand her näherte, zog seine Aufmerksamkeit auf sich: Helder Ordoñez, der Chefbiologe von ARGEN und sein Stellvertreter an der Konzernspitze.
Das gerötete Gesicht und der eilige Gang, der dem hastigen Watscheln einer Ente glich, verrieten, dass er in einer dringlichen Angelegenheit kam.
»Wo brennt’s denn?«, fragte er, als Ordoñez ihn erreichte.
Der gab ihm sein Mobiltelefon. »Sie sollen Ihren Vater zurückrufen. Umgehend!«
Verwundert nahm Kemmler ihm das Handy ab. Zwar stand er per eMail regelmäßig mit dem Vater in Kontakt, aber telefoniert hatten sie ewig nicht mehr. Schnell drückte er die Kurzwahltaste, unter welcher der Anschluss seines Vaters gespeichert war, und wartete ungeduldig, bis es läutete. Schon nach dem ersten Klingeln wurde abgehoben.
»Siegfried?«
»Ja, Vater. Ich bin’s.«
»Du musst nach Granada kommen. Sofort. Ich muss mit dir reden.« Die Stimme klang seltsam rau und leiser als sonst, der Tonfall aber war militärisch knapp wie gewohnt.
»Was ist los?«, fragte er.
»Komm einfach her!«, beharrte sein Vater. »Und mach schnell. Die Zeit drängt.«
Kemmler zögerte - die beiden wichtigsten Projekte von ARGEN standen kurz vor dem Abschluss, der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, nach Europa zu fliegen. Andererseits konnte man heutzutage einen Konzern von überall auf der Welt mit nichts als einem Laptop und einem Handy leiten, und auf Ordoñez war Verlass.
»Wie du willst, ich lasse alles stehen und liegen«, versprach er. »Ich fliege heute noch.«
Statt einer Antwort wurde am anderen Ende einfach aufgelegt. Stirnrunzelnd reichte er Ordoñez das Handy zurück. Sein Vater war über 90. Wenn er ihn so aus heiterem Himmel zu sich zitierte, konnte das nichts Gutes bedeuten.
»Pino, komm!«, rief er und gab seinem Hund, der am Spielfeldrand im Schatten lag, ein Handzeichen. Augenblicklich stand das Tier, ein halbhoher schwarzer Mischling mit vorstehendem Unterkiefer, zerzausten Hängeohren und zottigem Fell, auf, kam auf einem Bein hinkend zu ihm gelaufen und folgte ihm bei Fuß. Kemmler hatte den Hund vor Jahren am Straßenrand aufgelesen, wo er vermutlich nach dem Zusammenprall mit einem Auto mit gebrochenem Bein gelegen hatte.
»Was findest du nur an diesem hässlichen, halb toten Köter?«, rief Durán ihm nach.
Kemmler drehte sich nicht um. »Mach dir nichts draus«, murmelte er und kraulte seinem Hund im Gehen den Kopf. »Nicht mehr lange, und du wirst auf das Grab dieses Indiobastards pinkeln.«
Andalusien, Spanien, Freitag, 26. Oktober, 7 Uhr
Die schwere Mercedes-Limousine verließ die A44 nördlich von Granada, fuhr auf der N323 nach Westen und erreichte bald darauf den Embalse del Cubillas. Kemmler blickte auf das Wasser des Stausees, das durch die dunkel getönten Panzerglasscheiben fast schwarz aussah. Ein paar Wolken spiegelten sich in der glatten Oberfläche, die kein Windhauch kräuselte. Ein Blick auf die Uhr zeigte ihm, wie früh es noch war. Man würde ihn sicher nicht vor acht erwarten. Ob der alte Weg zum See noch da war?
»Da vorne rechts muss eine Abzweigung sein«, sagte er zu seinem Chauffeur. »Bieg da ab und fahr runter zum Ufer.«
Der Fahrer nahm den Fuß vom Gas und bog kurz darauf von der Straße auf den schmalen, unbefestigten Weg ab, der tatsächlich noch da war. Behutsam lenkte er den schweren Wagen über die ausgefahrene Spur bis nah ans Wasser. Von dem Hummer, der dem Mercedes in knappem Abstand folgte, kam hektisches Blinken und energischer Protest über Funk ob dieser unvorhergesehenen Abweichung von der geplanten Route. Kemmlers Bodyguards schätzten solche spontanen Manöver nicht, schon gar nicht hier auf unbekanntem Terrain.
Kaum hatten die Fahrzeuge gehalten, sprangen die zwei kräftigen Männer in dunklen Lederjacken aus dem Hummer und sahen sich sichernd um. Erst nachdem sie sich vergewissert hatten, dass keine Gefahr drohte, gab einer von ihnen dem Chauffeur ein Zeichen, und der öffnete die rechte hintere Tür des Mercedes.
Kemmler stieg aus und sog die frische Morgenluft ein. Herrlich, dieser Duft der taufeuchten Wiesen und des Wassers! Auf dem breiten Grün zwischen Straße und See standen ein paar knorrige Eichen, an deren Zweigen nur noch wenige Blätter hingen. Er erinnerte sich noch gut an diese uralten Bäume mit ihren knotig verwachsenen Stämmen und den wenigen dicken Ästen, die ihm schon früher alt und leblos vorgekommen waren. Dass die noch standen! Mein Gott, fast 40 Jahre war er nicht mehr hier gewesen!
In der Ferne, weit hinter den Bäumen am gegenüberliegenden Ufer, zeichneten sich vor der tief stehenden Morgensonne die hohen Berge der Sierra Nevada ab, die schon frühen Schnee auf den Spitzen trugen. Ein Anblick, den er nie vergessen hatte. Die Namen der Gipfel jedoch wollten ihm nicht mehr einfallen. Er wandte den Blick zum Seeufer neben der Straße zurück und versuchte, dort Vertrautes zu entdecken, aber die Landschaft hatte sich verändert. Üppige Vegetation überwucherte die einst kahlen Ufer rechts und links von ihm und die vielen schmalen Pfade zwischen großen Steinen, die er als Kind entlanggelaufen war. Für einen Moment schloss er die Augen, um sich besser in Erinnerung zu rufen, wie es hier früher ausgesehen hatte, aber das Bild war über die Jahre verblasst. Dennoch erschien ihm der Ort noch immer vertraut. In dieser Gegend hatte er die sorglosesten Jahre seines Lebens verbracht.
Wie oft hatte er mit dem Vater hier am Ufer gestanden und darum gewetteifert, wer einen flachen Stein öfter übers Wasser springen lassen konnte? Und wie stolz war er gewesen, als er den Vater zum ersten Mal überflügelt und dieser anerkennend genickt hatte. Es war ein verdienter Sieg gewesen. Seinem Vater wäre es nie in den Sinn gekommen, ihn gewinnen zu lassen.
Einzelne Fischer waren früh mit ihren Booten draußen, und Kemmler erinnerte sich daran, wie er selber mit seinem Vater in dem blaugrünen Holzboot mit den quietschenden Dollen frühmorgens hinausgefahren war, um zu angeln. Mit gedämpfter Stimme hatte sein Vater ihm, während sie warteten, dass ein Fisch anbiss, oft von früher erzählt. Von München, seiner geliebten Heimatstadt, die er nie wiedergesehen hatte, von Ostpreußen, wo die Felder bis zum Horizont reichten, von der Ausbildung an der NAPOLA in Köslin und von seiner Zeit als Junker an der NS-Ordensburg am Krössinsee in Pommern, von den Prinzipien der Rassenlehre und den Idealen der SS und ihrer unvollendeten Mission. Gebannt hatte er ihm zugehört, wenn er vom Führer sprach, dem tragischen Helden, der für sein Volk alles gewagt und alles verloren hatte.
Im Boot, draußen auf dem See, war es auch gewesen, wo sein Leben die jähe Wendung genommen hatte, die ihn zum Herrn eines globalen Biotech-Imperiums machen sollte. Trotz der langen Zeit, die seitdem verstrichen war, sah er die Szene noch so lebendig vor sich, als hätte sie sich erst gestern abgespielt. Am Morgen seines sechzehnten Geburtstags waren sie wieder zum Angeln hinausgerudert. »Du bist jetzt sechzehn, Siegfried, fast erwachsen«, hatte sein Vater begonnen, nachdem die Angeln ausgeworfen waren. »Es ist an der Zeit, Abschied zu nehmen von der Spielerei der Jugend und die Pflichten zu übernehmen, die dir als meinem Sohn zukommen.«
Das Surren einer Angelleine hatte ihn unterbrochen. Erst als der Fisch nach kurzem, heftigem Kampf aus dem Wasser gezogen war und im Boot lag, hatte er weitergesprochen: »Morgen Abend wirst du nach Argentinien fliegen. Die Möglichkeiten dort sind ungleich besser als hier im verstaubten Spanien. Meine alten Kameraden erwarten dich in Buenos Aires und werden dich unter ihre Fittiche nehmen, bis du ein Mann bist.«
»Nach Argentinien?«, hatte er entsetzt hervorgestoßen. »Morgen schon? Was ist mit meinen Freunden, meinen Schulkameraden, meinem Pferd, dem Reitklub und mit …« Den Namen seiner heimlichen Freundin auszusprechen, hatte er sich gerade noch verkniffen. Egal, er redete ohnedies gegen taube Ohren. Sein Protest verhallte ungehört. Auch alles spätere Betteln, alles Flehen um wenigstens ein paar Tage Aufschub hatten nichts geholfen. Sein Vater war nicht der Mann, der einen einmal gefassten Entschluss zurücknahm. Es war ihm nichts übrig geblieben, als sich zu fügen.
Überhastet hatte er Abschied nehmen müssen von der Heimat, der Jugend und von Rita, der Tochter der Haushälterin, seiner ersten, schüchternen Liebe.
Ein halbes Leben war das alles jetzt her, er war nie nach Andalusien zurückgekehrt. Sein Vater hatte das nicht gewollt.
Dichte Bäume überspannten die lange Auffahrt zur Villa Kemmler, und so sah er die Frau, die ihn am Kopf der langen Treppe zum Hauseingang erwartete, erst, als der Mercedes vor dem Haus ausrollte. Sie war in seinem Alter, die Figur schlank, und ihre Bewegungen, als sie die Treppe herunterkam, waren geschmeidig und elegant. Mit dunklem Teint, langem schwarzen Haar und tiefschwarzen Augen entsprach sie ganz dem Idealbild einer Andalusierin. Der Chauffeur öffnete die Wagentür, Kemmler stieg aus und wartete, bis die Frau unten bei ihm angekommen war. Rita? Ihr Lächeln - dasselbe, leicht spöttische Lächeln wie früher - verriet es: Vor ihm stand das schüchterne, ungelenke Mädchen von einst: Rita, die Tochter der Haushälterin seines Vaters - und seine erste Jugendliebe. Ihr Vater, ein Reitlehrer aus Jerez de la Frontera, hatte Ritas Mutter sitzen lassen, als sie mit ihr schwanger war - eine Katastrophe für eine Frau im erzkonservativen, stockkatholischen Spanien der Fünfzigerjahre. Der Job bei Kemmlers Vater war ihre Rettung gewesen, und sie hatte es ihm mit unerschütterlicher Treue gedankt.
»Willkommen zu Hause, Siegfried, es ist schön, dich zu sehen«, begrüßte ihn Rita auf Deutsch, in der Sprache, die sie gesprochen hatten, als sie hier zusammen aufwuchsen. Ritas Mutter hatte ihm die eigene Mutter ersetzen müssen, die bei seiner Geburt gestorben war.
Er erwiderte ihr Lächeln. »Es ist auch schön, dich wiederzusehen, Rita«, sagte er ebenfalls auf Deutsch, und sie stiegen hoch zum Haus. Er musterte sie von der Seite, was Rita mit einem selbstbewussten Lächeln quittierte. Sie wusste um ihre Wirkung auf Männer, das war offensichtlich.
»Du hast nie etwas von dir hören lassen in all den Jahren«, sagte sie. Es war eine Feststellung, kein Vorwurf.
»Es war eine andere Welt dort«, antwortete er. »Alles hier war auf einmal unendlich weit weg. Es war schwer in den ersten Jahren. Und später …« Er zuckte mit den Schultern.
»Schon gut«, meinte sie und legte ihm die Hand auf den Arm. »Dein Vater hat viel von dir gesprochen, und in den letzten Jahren stand ja öfter mal was in den Zeitungen über dich.«
Oben angekommen, deutete Rita auf Kemmlers drei stämmige Begleiter, die unten die Koffer ausluden. »Du bist ein wichtiger Mann geworden, scheint es.«
»Erfolg hat auch weniger angenehme Seiten, man schafft sich unwillkürlich Feinde«, antwortete er mit einer entschuldigenden Geste.
»Dein Vater ist jedenfalls mächtig stolz auf dich.«
»Ist er schon auf?«, erkundigte sich Kemmler.
Sie wich seinem Blick aus. »Der Arzt war heute früher da als sonst und hat ihm ein paar Spritzen gegeben. Er wollte fit sein, wenn du kommst. Im Augenblick geht es ihm gut.«
Kemmler trat so vor sie, dass sie stehen bleiben und ihm in die Augen sehen musste.
»Er ist also krank«, stellte er fest. »Will er mich deshalb sprechen? Sag mir ehrlich, wie es um ihn steht, Rita.« Er fasste ihre Schultern mit den Händen. »Bitte.«
Er sah, wie Rita stutzte. »Du weißt es nicht? Er hat dir nichts gesagt?«
Kemmler verneinte.
»Dein Vater hat Krebs im Endstadium«, sagte sie schließlich mit zum Boden gerichtetem Blick. »Wir geben ihm zwar Infusionen gegen die Schmerzen, aber gelegentlich hat er trotzdem Anfälle. Und seine Nächte sind schlimm. Er fantasiert wild im Schlaf, schreit wirre Befehle auf Deutsch und wacht davon auf. Die Nachtschwester ist heute früh ganz verstört nach Hause gegangen.«
»Hat sie dir gesagt, was er da ruft?«, fragte Kemmler.
Rita schüttelte den Kopf. »Nein, sie versteht kaum ein Wort Deutsch. Aber es ist schlimmer geworden, seit vor zwei Tagen ein Brief kam. Ich glaube, der ist der Grund, warum er dich sehen will, er war ganz aufgeregt, nachdem er ihn gelesen hatte. Ich musste ihm den Laptop bringen, und er hing stundenlang im Internet. Auch gestern wieder.«
»Weißt du, was in dem Brief steht?«
Rita schüttelte den Kopf. »Er hat es mir nicht verraten, und er trägt den Brief ständig in der Jackentasche. Und auch wenn nicht, hätte ich ihn nicht gelesen.« Die letzten Worte klangen wie die Erwiderung auf einen unausgesprochenen Vorwurf.
Kemmler ignorierte es.
Rita ging weiter. »Der Arzt meint, er hat vielleicht noch ein paar Wochen.«
»Du hättest mich viel früher informieren sollen«, sagte Kemmler vorwurfsvoll.
»Das wollte ich ja, aber er hat es mir strikt verboten«, erwiderte sie.
»Wo ist er jetzt?«
»Hinten auf der Ostveranda. Geh zu ihm, er erwartet dich. Ich kümmere mich um ein Frühstück für deine Leute.« Sie ging zur Tür, drehte sich dort aber noch einmal um. »Soll ich dir auch etwas bringen?«
»Nein, lass mich nur mit ihm allein. Wir reden später noch.«
Kemmler zögerte einen Moment, atmete durch und ging zur Ostveranda. Als er um die Ecke kam, sah er seinen Vater in einem mächtigen Ledersessel sitzen, die Füße auf einem Schemel. Ein Rollstuhl stand daneben. Die Leitung eines Tropfs führte zu seinem linken Arm. Gegen die kühle Morgenluft war er in dicke Decken gehüllt, und er hielt das Gesicht, die Augen geschlossen, in die wärmenden Strahlen der Morgensonne. Der Blick von hier oben reichte weit über die Landschaft bis zu den Bergen der Sierra Nevada, die im Morgendunst nur schemenhaft auszumachen waren.
Ein friedliches Bild, wie er so dasaß, aber Kemmler erschrak von dem Anblick. Diese schmächtige, zusammengesunkene Gestalt war sein Vater? Das da war der Mann, den er nur als hochgewachsenen, breitschultrigen, kraftstrotzenden Hünen gekannt hatte?
Die Haare waren schütter und schlohweiß, die Haut der Hände durchsichtig, sodass die Adern blau hervortraten, die Wangen eingefallen. Er wirkte, so wie er da klein und zusammengesunken im Sessel saß, wie ein Schatten seiner selbst. Es tat weh, ihn so zu sehen.
Kemmler wartete, bis er sicher war, dass seine Bestürzung sich nicht mehr auf seinem Gesicht abzeichnete, dann ging er zu ihm hin und berührte ihn behutsam an der Schulter. »Vater«, sagte er leise.
Der alte Mann öffnete die Augen, sah zu ihm auf und streckte ihm lächelnd die Hände entgegen. Kemmler ergriff sie und erschrak darüber, wie sie sich anfühlten. In den einst so geschmeidigen, gepflegten Händen des leidenschaftlichen Klavierspielers war keine Kraft mehr. Die vormals schlanken, geschickten Finger waren knotig und steif, die Nägel gelb und brüchig, der Griff schlaff. Er schluckte und versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, während sie einander lange in die Augen sahen.
»38 Jahre«, sagte Hagen Kemmler schließlich leise. »38 Jahre. Wir haben uns viel zu lange nicht gesehen.« Die einst feste, befehlsgewohnte Stimme klang rau und schwach.
»Du hast mich fortgeschickt damals«, erwiderte Kemmler, »und du hast nie zugelassen, dass ich wieder herkomme.«
Es sollte nicht wie ein Vorwurf klingen, aber sein Vater erwiderte zornig: »Und wo wärst du heute, wenn ich das nicht getan hätte?« In seiner Stimme flammte plötzlich wieder die alte Stärke auf. »Was wäre aus den Plänen geworden, für die meine Kameraden und ich das Leben riskiert haben?«
Kemmler zog einen Stuhl aus einer nahen Sitzgruppe heran, setzte sich neben ihn und legte ihm versöhnlich die Hand auf den Arm.
»Lass gut sein, du hattest recht damals, Vater«, sagte er in sanftem Ton. »Ich habe es nur erst viel später begriffen.«
»Ich wusste, du würdest es irgendwann verstehen«, erwiderte der Alte.
»Rita hat mir gesagt, wie es um dich steht«, sagte Kemmler vorwurfsvoll. »Warum hast du mich nicht viel früher verständigt?«
»Wozu? Damit du mir beim Sterben zusiehst?«, versetzte der Alte mit verächtlich heruntergezogenen Mundwinkeln, doch dann wurde seine Miene ernst, und er blickte sich um, ob jemand in Hörweite war, bevor er weitersprach: »Ich habe dich hergerufen, weil ich vor zwei Tagen etwas erfahren habe, das sich äußerst günstig auf unsere Pläne auswirken könnte.«
Kemmler runzelte die Stirn. »Was für eine Information?«
Sein Vater zog einen Briefumschlag aus der Jackentasche und hielt ihn ihm hin. »Lies selbst.«
Kemmler nahm den Umschlag und zog das Schreiben heraus.
Der Absender war laut aufgedrucktem Briefkopf ein Erich Rademann aus Siegen. Die Zeilen darunter waren in krakeliger, schwer lesbarer Handschrift abgefasst:
Siegen, 19.10.2012
Lieber Kamerad Hagen,ich hoffe Dich wohlauf in Spanien und nicht allzu sehr geplagt von den Beschwerlichkeiten des Alters. Was mich selbst betrifft, sind meine Tage gezählt. Das Hospiz, in dem ich seit drei Wochen liege, werde ich nur noch mit den Füßen voraus verlassen. Keine Angst, ich will Dir nicht die Ohren volljammern. Ich hadere nicht damit, dass es zu Ende geht. Wer den Tod in so mannigfaltiger Form kennengelernt hat wie Du und ich, für den hat er den Schrecken verloren. Der Zweck dieser Zeilen ist vielmehr, Dir von einer Begebenheit zu berichten, von der mir ein alter SS-Kamerad kürzlich bei einem Besuch an meinem Krankenbett erzählt hat, als wir über alte Zeiten geplaudert haben. In russischer Gefangenschaft, unmittelbar nach Kriegsende, habe ihm ein Hauptsturmführer aus der 1. SS-Panzer-Division Leibstandarte SS Adolf Hitler weismachen wollen, er habe nach der Flucht der Besatzung des Bunkers unter der Reichskanzlei den nur unvollkommen verbrannten Leichnam des Führers aus einem Granattrichter im Garten der Reichskanzlei ausgegraben und in Sicherheit gebracht, um ihn nicht der Schande einer Zurschaustellung durch die Bolschewisten auszusetzen. Anstelle des Führers habe er die Leiche eines in seinem Kübelwagen verbrannten Hauptmanns in dem Granattrichter neben Eva Brauns Leiche verscharrt.
Als mein Kamerad ihn auslachte, habe ihm der Hauptsturmführer bei seiner Ehre als Offizier geschworen, die Geschichte sei wahr.
Was von dieser Offiziersehre zu halten war, hat der Kamerad nicht lange danach erfahren: Dieser ehrenwerte Hauptsturmführer - leider erinnerte sich mein Kamerad nicht an seinen Namen - hat sich nämlich bei erster Gelegenheit den Russen als Dolmetscher angedient.
Doch auch wenn dieser Offizier von zweifelhaftem Charakter war und ich bezüglich seiner Angaben ebenso skeptisch bin wie mein Kamerad, sehe ich es als meine Pflicht an, die Geschichte vor meinem Tod weiterzugeben. Denn sollten die sterblichen Überreste des Führers tatsächlich noch irgendwo verborgen liegen, wer weiß, welcher Funke sich an ihnen entzünden ließe, wenn man sie fände.
Verfahre mit dieser Information, wie Du es für richtig hältst, lieber Hagen, und lebe wohl.
Dein Kamerad aus besseren TagenErich.
Verärgert blickte Kemmler auf, als er zu Ende gelesen hatte. »Dafür hast du mich über den Atlantik gehetzt?«, fragte er schmallippig.
Klatschend schlug seines Vaters Hand auf die Lehne des Sessels. »Begreifst du denn nicht«, rief er wütend, »was es hieße, die sterblichen Überreste des Führers zu besitzen?«
»Natürlich, ich bin ja nicht dumm«, versetzte Kemmler ärgerlich. »Aber was da steht, ist doch barer Unsinn, nichts als die Prahlerei eines Geltungssüchtigen!« Zornig warf er das Schreiben auf den Beistelltisch mit Medikamenten neben dem Sessel. »Es ist doch allgemein bekannt«, fügte er hinzu, »dass die Russen den Leichnam des Führers in der Nähe des Bunkers gefunden haben.«
»Die Russen haben behauptet, dass sie ihn hätten«, entgegnete Hagen Kemmler mit erhobenem Zeigefinger.
»Was heißt behauptet?«, fragte Kemmler irritiert. »Sie haben doch sicher Beweise dafür vorgelegt?«
»Allerdings, eine ganze Reihe.«
»Aber?«, fragte Kemmler mit schmalen Augen.
»Sie haben nie den entscheidenden Beweis präsentiert«, antwortete sein Vater und reichte ihm den Brief wieder zurück. »Den Leichnam des Führers selbst.«
Buenos Aires, Freitag, 26. Oktober, 9 Uhr
Der Hubschrauber mit dem ARGEN-Logo donnerte dicht über die Dächer der Innenstadt von Buenos Aires nach Norden. Ordoñez wischte sich im Cockpit den Schweiß von der Stirn. So sehr er es sonst genoss, dem Lärm und der Hektik der Metropole am Steuer eines ARGEN-Helikopters zu entschweben, diesmal hatte er keinen Blick für die Schönheit der Stadt, die unter ihm im Licht der hochstehenden Sonne glänzte. Der Anruf von Velasco Navarrete, des Leiters der Abteilung für Reproduktionsmedizin aus der ARGEN-Klinik in San Isidro, hatte ihn aufs Höchste alarmiert.
»Wir haben ein Problem, es gibt Komplikationen bei zwei Schwangeren im Forschungsprojekt«, hatte Navarrete nur gesagt, wobei ein Zittern in seiner Stimme verriet, dass er ernstlich besorgt war. »Ich denke, Sie sollten herkommen.«
Hastig war Ordoñez daraufhin zum Hubschrauber auf dem Dach des ARGEN-Hochhauses geeilt und hatte abgehoben, kaum dass der Motor warmgelaufen war.
»ARGEN zwei, Sie unterschreiten die Mindestflughöhe«, meldete sich, überlagert von Rauschen, die Flugkontrolle im Kopfhörer. Fluchend zog Ordoñez die Maschine höher. »Tut mir leid, kommt nicht wieder vor«, versprach er und zwang sich, sich aufs Fliegen zu konzentrieren. Vergeblich. Während die Minuten in der Luft dahinkrochen, zermarterte er sich das Hirn, was Navarrete da wohl entdeckt haben mochte. Wie hochkomplex und sensibel genetische Reproduktionsmethoden waren, hatten ihn zahllose Fehlschläge über die Jahre gelehrt. Doch das Projekt, für das ihm Kemmler die persönliche Verantwortung übertragen hatte, lieferte schon seit 18 Monaten einwandfreie Resultate: eine Schar quirliger, kerngesunder Babys. Woher nun aus heiterem Himmel Komplikationen? Ordoñez spürte, dass das Hemd an ihm klebte und die Hand am Steuerknüppel feucht war. Er hatte kein gutes Gefühl bei diesem Projekt, zumal ihn Kemmler im Unklaren darüber ließ, welchem Zweck es diente.
Das Landekreuz auf dem Gelände der Klinik in San Isidro tauchte vor ihm auf. Das noble Krankenhaus, das zum medizinischen Geschäftszweig von ARGEN gehörte, war eine Spezialklinik für plastische Chirurgie, in der sich zahlungskräftige Prominente ein paar Jahre Jugend zurückkauften. Eine Goldgrube.
Nachdem die Maschine aufgesetzt hatte und der Motor aus war, hastete er zu einem Gebäude, das durch eine hohe Mauer vom übrigen Klinikkomplex getrennt war.
Navarrete erwartete ihn am Eingang. »Es sind nur zwei Fälle, ich habe sie bei der turnusmäßigen Untersuchung bemerkt«, erklärte er nach der Begrüßung. »Da habe ich Sie sofort verständigt.«
»Das war gut so. Ich möchte es mir selber ansehen«, erwiderte Ordoñez schnaufend.
»Kommen Sie mit«, bat Navarrete und ging durch eine luxuriös mit Marmor und Mosaiken ausgestaltete Lobby voraus. »Es ist schon alles vorbereitet.«
Am hinteren Ende der Empfangshalle mussten sie eine Zugangskontrolle passieren, ehe sie einen vollständig von der übrigen Klinik abgetrennten Bereich betreten konnten.
Im Innenhof, einem weitläufigen, von Arkaden gesäumten Blumengarten, kamen sie an einer Gruppe fröhlich plaudernder junger Frauen vorbei, die, ihren Bäuchen nach, in verschiedenen Stadien der Schwangerschaft waren. Gut bezahlte Leihmütter, die Kinder für Millionärsfrauen aus ganz Südamerika austrugen, denen eine Schwangerschaft zu mühsam war, zu riskant für die Figur oder aus gesundheitlichen Gründen zu gefährlich. Die beinahe klösterliche Abgeschiedenheit garantierte jene strikte Diskretion, die die Kundschaft verlangte. Es war ein gutes Geschäft für ARGEN - und für die jungen Frauen aus armen Verhältnissen, die nie in ihrem Leben wieder so viel Geld verdienen würden.
Am rückwärtigen Teil des Gartens erwartete sie eine weitere Zugangskontrolle. Der Zutritt zu dem mit Biogenetisches Laboratorium gekennzeichneten Bereich, der hinter der bewachten Schleuse aus mattem, schusssicherem Glas lag, war nur einem kleinen Kreis autorisierter Mitarbeiter gestattet und wurde von ARGENs uniformiertem und bewaffnetem Wachdienst rigoros kontrolliert. Selbst Ordoñez, dessen Gesicht jeder im Unternehmen kannte, musste sich mit seinem biometrischen Ausweis legitimieren, ehe ihm der Wachmann die Schleuse öffnete.
Die Atmosphäre in den Räumen hier war eine völlig andere als in dem Bereich, den sie gerade durchschritten hatten. Alles wirkte unpersönlich, steril. Die Gänge waren schmucklos, in Weiß und Grau gehalten, das Licht kalt, es roch nach Desinfektionsmitteln, und man hörte kein fröhliches Lachen oder Geplauder, nur das leise Rauschen der Klimaanlage.
Sie folgten einer gelben Linie auf dem fugenlosen Boden der Korridore bis zu einer Milchglastür mit der Aufschrift Ultraschall. Als sie hineingingen, schraken die zwei Frauen auf, die hier drinnen auf weiß bezogenen Liegen lagen. Sie waren etwa Mitte 20, trugen grüne Krankenhauspyjamas und machten einen gepflegten, wohlgenährten Eindruck. Aber die Angst, die in ihren Blick trat, als Ordoñez und Navarrete eintraten, war nicht zu übersehen.
»Kein Grund zur Sorge, wir machen nur eine zweite Ultraschalluntersuchung, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist«, versuchte Navarrete die beiden Frauen zu beruhigen. Die Besorgnis verschwand jedoch nicht aus den Mienen. Der Arzt ließ sich auf einen Schemel nieder, öffnete behutsam die Pyjamajacke einer der Frauen, zog ihren Hosenbund ein wenig hinunter und entblößte den prallen Bauch. Sie war im siebten Monat schwanger. Navarrete nahm die Sonde des Ultraschallgeräts neben der Liege aus der Halterung, gab Gel darauf, fuhr mit der Sonde langsam über den Bauch der Schwangeren und behielt dabei das grünliche Abbild des Fötus im Leib der Frau auf dem Monitor im Auge.
Ordoñez blickte ihm über die Schulter. Nach ein paar Augenblicken hielt Navarrete inne und zeigte auf einen Punkt am Schwarz-Weiß-Monitor. »Da, sehen Sie.« Er hätte nicht darauf zu deuten brauchen; die Anomalie an dem Fötus war für Ordoñez’ geschultes Auge unübersehbar. Er sagte nichts, um die Frau nicht zu beunruhigen. Es bedurfte auch keiner Worte, der Befund war eindeutig.
Navarrete druckte ein Standbild aus, steckte die Sonde ins Gerät zurück und griff zur Sonde einer Doppler-Ultraschalleinheit, die danebenstand. Als er sie richtig platziert hatte, fand Ordoñez in der Farbdarstellung der Blutzirkulation den ersten Befund bestätigt: Das Herz des Ungeborenen war besorgniserregend vergrößert.
Das Summen der Apparate blieb das einzige Geräusch im Raum, während er auf das Monitorbild starrte und fieberhaft nach einer Erklärung suchte für das, was er da sah. Schließlich reichte Navarrete der Frau Kleenex-Tücher, um das Gel abzuwischen. »Fein, alles in Ordnung«, sagte er freundlich lächelnd zu ihr. »Sie können in Ihr Zimmer zurückgehen.« Eilends erhob sich die Frau und huschte ängstlich geduckt aus dem Raum.
Als sie draußen war, wandten sich Ordoñez und Navarrete der anderen Schwangeren zu. Stumm und mit angstvoll geweiteten Augen ließ sie die Untersuchung über sich ergehen. Navarretes Bemühen, ihr durch ein Lächeln die Furcht zu nehmen, blieb fruchtlos. Eilends verließ auch sie den Raum, sobald Navarrete mit ihr fertig war.
Der Befund war derselbe. Ordoñez biss sich auf die Lippe und überlegte fieberhaft.
»Nur diese beiden, sind Sie sicher?«, fragte er schließlich und ließ sich auf der Kante einer der Liegen nieder.
»Nur diese beiden«, versicherte Navarrete.
»Verdammt noch mal«, fluchte Ordoñez. »Was haben wir übersehen?« Er wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Erst letzte Woche hatte er Kemmler vorgeschlagen, das Projekt endlich einzustellen und die frei werdenden Kapazitäten anderswo im Unternehmen einzusetzen. Ohne Gründe zu nennen, hatte Kemmler abgelehnt. Ahnte er, dass es noch Risiken gab? Womöglich.
»Was haben wir übersehen?«, wiederholte er mehr zu sich selbst.
Navarrete aber bezog die Bemerkung auf sich. »Was fragen Sie mich?«, knurrte er gereizt. »Mir sagt man weder, wo die Embryonen herkommen, die man den Frauen einpflanzt, noch was später mit den Babys geschieht.«
»Das hat Sie auch nicht zu interessieren«, blaffte Ordoñez. »Sie haben einzig und allein dafür zu sorgen, dass die Schwangerschaften der Frauen auf dieser Station ohne Komplikationen verlaufen.«
»Ich lasse mir das hier nicht in die Schuhe schieben«, gab Navarrete mit hochrotem Kopf zurück. »Wenn Sie einen Sündenbock suchen, den Sie Kemmler zum Fraß vorwerfen können, dann bin ich der Falsche.«
Ordoñez hob beide Hände in einer beschwichtigenden Geste. »Niemand will Ihnen etwas in die Schuhe schieben«, versicherte er Navarrete, aber der ließ sich nicht beruhigen, griff hinter sich zu zwei dicken Computerausdrucken und reichte sie Ordoñez. »Hier, die medizinischen Dossiers der Frauen. Sehen Sie selbst. Es ist alles haarklein dokumentiert.«
Ordoñez nahm ihm die Dokumente ab und begann, darin zu blättern, auch wenn das überflüssig war. Er kannte sie in- und auswendig von der Arbeit an den Berichten, die er regelmäßig für Kemmler verfasste. Es stand nichts darin, was die Anomalien bei den Föten erklären konnte. Sämtliche Laborwerte waren unauffällig. Von A bis Z, vom Indikator für Entzündungen Alpha 1 Antitrypsin bis zur Zink-Konzentration im Blut lagen alle Werte im oder nahe dem Normbereich. Spuren von reprotoxischen Substanzen - Dioxin, Quecksilber, Kadmium, Benzol, Phenol - waren nicht festgestellt worden. An den Resultaten der Untersuchungen, die während der Schwangerschaften vorgenommen worden waren, war ebenfalls nichts außergewöhnlich. Fruchtwasseruntersuchung und Nabelschnurpunktion zu Anfang der Schwangerschaft hatten keinerlei Chromosomendefekte erkennen lassen. Darüber hinaus hatten beide Frauen in der strikt kontrollierten Umgebung der Forschungseinrichtung gelebt, in der sie keinerlei schädlichen Einflüssen ausgesetzt waren. Wasser, Getränke, Nahrungsmittel unterlagen strengsten Kontrollen, und es wurde ein strikter Ernährungsplan eingehalten. Die Föten sollten kerngesund sein. Aber sie waren es nicht - und der Fehler konnte nicht im Verantwortungsbereich Navarretes liegen. Die Ursache für die Fehlbildungen musste irgendwo im Reproduktionsverfahren zu suchen sein, für das er selbst die Verantwortung trug. Er hütete sich jedoch, das auszusprechen - es würde nicht schaden, Navarrete zu verunsichern.
»Wir werden Kemmler informieren müssen«, hörte er Navarretes besorgte Stimme durch seine Gedanken.
»Der ist jenseits des Atlantiks, in Europa«, versetzte Ordoñez, ließ die Papiere sinken und fixierte Navarrete mit prüfendem Blick. »Wer weiß sonst noch davon?«
»Bis jetzt nur Sie und ich«, bekam er zur Antwort.
»Gut«, sagte Ordoñez. »Was wir gesehen haben, verlässt diesen Raum nicht, verstanden?«
Andalusien, Freitag, 26. Oktober, 18 Uhr
Kemmler rückte den schweren Sessel zurecht, arretierte die Rollen daran und ordnete die Decke auf dem Schoß seines Vaters. Sie hatten den heißen Tag im Schatten des Vordachs auf der Ostveranda verbracht, unter vier Augen geredet und nur kurz innegehalten, wenn Rita kam, um den Tropf zu wechseln oder um Getränke und Snacks zu bringen. Was sie zu besprechen hatten, war nicht für fremde Ohren bestimmt.
Nun, gegen Abend, waren sie der Sonne ums Haus gefolgt und saßen mit Blick nach Westen. Der alte Mann war wieder in Decken gehüllt, denn sein hinfälliger Körper fröstelte, als die Temperatur sank.
Kemmler schenkte sich ein Glas Rioja ein und hielt es so gegen die Sonne, dass ihre Strahlen die Flüssigkeit tiefrot aufleuchten ließen. »Ich weiß«, nahm er dann den Gesprächsfaden wieder auf, »dass ich dich und deine Kameraden auf eine lange Geduldsprobe gestellt habe, aber nun ist der Tag nahe, da unsere Operation endlich anlaufen kann.«
Doch er merkte, dass sein Vater nicht zuhörte.
Die Augen mit der Hand gegen die tief stehende Sonne abschirmend, beobachtete der alte Mann eine Schar Vögel in den Bäumen hinten im Park. »Die Stare kommen jedes Jahr, um hier zu überwintern«, sagte er. »Diesmal«, fügte er nach einer Pause hinzu, »werde ich nicht mehr erleben, wie sie den Rückflug nach Norden antreten.«
Auch wenn ihr Verhältnis niemals herzlich gewesen war, empfand Kemmler doch Beklemmung bei dem Gedanken, dass der Mann, der sein Leben lang die Hand über ihn gehalten hatte, nicht mehr sein sollte. Die Gefühle mussten sich auf seiner Miene abzeichnen, denn er hörte seinen Vater sagen: »Jetzt mach nicht so ein Gesicht, Siegfried. Ich habe länger gelebt, als es den meisten vergönnt ist, und ich fürchte den Tod nicht.«
»Du wirst nicht sterben, noch lange nicht«, widersprach Kemmler. »Ich nehme dich mit nach Argentinien, du bekommst die beste Betreuung, die besten Ärzte. Du wirst es noch erleben, wie die Sonne auf die Welt scheint, von der wir so lange geträumt haben.«
Sein Vater schüttelte den Kopf. »Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Ich will die Zeit, die mir noch bleibt, hier verbringen, in meinem Zuhause.« Er stoppte seinen Sohn, der widersprechen wollte, mit einer energischen Geste und sprach weiter: »Du hast die Erwartungen, die ich in dich gesetzt habe, nicht enttäuscht, mein Sohn. Meine Kameraden und ich, wir hatten schon alle Hoffnung aufgegeben, die Mission der SS eines Tages noch zu Ende zu bringen. Nun wird dank deiner dieser Tag doch noch kommen. Ich bin stolz …« Er konnte nicht weitersprechen. Kemmler sah, wie Schmerz in ihm aufwallte, sodass er nach Luft rang, das Gesicht verzerrte und die Finger sich in die Armlehnen des Sessels krallten. Es dauerte endlose Sekunden, bis der Anfall vorüber war und sich der Körper entspannte. Es war der dritte Anfall an diesem Tag, und er war heftiger als die vorangegangenen.
»Ich bin müde«, sagte sein Vater mit zitternder Stimme. »Lass uns morgen weiterreden.«
Kemmler winkte Rita herbei, die gerade für seine Leute im Gartenpavillon einen Imbiss servierte.
»Er ist erschöpft und hat Schmerzen«, sagte er, als sie bei ihnen war.
»Bringen wir ihn nach oben«, antwortete Rita und wollte seinem Vater in den Rollstuhl helfen. Doch Kemmler übernahm das selbst und erschrak dabei unwillkürlich: Der einst so große und stämmige Mann war leicht wie eine Feder.
Es gab jetzt einen Lift im Haus, und sie fuhren zu dritt nach oben. Dort blieb Kemmler noch am Bett stehen, während Rita hinausging.
»Komm mit nach Argentinien«, beschwor er seinen Vater noch einmal. »In der Klinik von ARGEN in San Isidro haben wir ungleich bessere Möglichkeiten als die Ärzte hier. Wir können morgen früh fliegen, sobald du dich ausgeruht hast.«
Der Alte winkte ab. »Die Medikamente helfen kaum noch gegen die Schmerzen, der Tod wird mir eine Erlösung sein.« Er tastete nach der Hand seines Sohnes und drückte sie fest. »Begrab mich neben deiner Mutter in Madrid«, bat er. »Versprich es mir.«
Kemmler sah ein, dass er sich nicht umstimmen lassen würde. »Wie du willst«, sagte er darum, und sein Vater ließ die Hand los.
Hagen Kemmlers Blick jedoch blieb auf seinen Sohn geheftet. »Du musst mich nicht bedauern«, sagte er ruhig. »Ich werde in der Gewissheit von dieser Welt gehen, dass du die Mission der SS zu Ende bringst. Und das«, ein raues Lachen kam aus seiner Kehle, »ausgerechnet dank tatkräftiger Vorarbeit Israels.«
Rita zog den Kopf ein, zwängte sich unter dem üppig blühenden Bougainvilleastrauch hindurch, ging zu den Bäumchen mit den Kumquats, pflückte ein paar der aromatischen Zwergorangen und legte sie in den kleinen Korb an ihrem Arm zu den Früchten, die sie an anderer Stelle des Gartens gepflückt hatte. Die dichten Sträucher hier hinten im Park entzogen sie den misstrauischen Blicken der Männer, die mit Kemmler gekommen waren. Sofort nach der Ankunft hatten sie das Haus durchsucht und im Park jeden Stein umgedreht, als durchkämmten sie ein Minenfeld. Der Älteste der drei hatte ohne ein Wort ihre Handtasche ausgekippt und ihr Handy an sich genommen. Später hatte sie bemerkt, dass auch alle Telefone im Haus weg waren. Doch da war noch das Handy im Geräteschuppen, das, zu dem nie ein Anruf kam, das, von dem aus sie regelmäßig eMails an eine unverfängliche Adresse schickte und über das sie Instruktionen erhielt. Wenn sie Verbindung aufnehmen musste, ging sie meist frühmorgens in diesen abgeschiedenen Teil des Parks und kam danach mit ein paar Blumen oder frischem Obst zurück.
Sichernd sah sie sich um und lauschte auf Schritte, bevor sie das Handy aus dem Versteck im Schuppen nahm und einschaltete. Ungeduldig wartete sie, bis der Startbildschirm erschien. Er zeigte keine neue Nachricht an. Noch einmal schaute sie sich um und horchte, dann tippte sie eine Nummer ein. Aus Sicherheitsgründen war die nicht auf dem Gerät gespeichert.
Der Teilnehmer meldete sich schon nach dem ersten Läuten: »Segarra.«
»Rita Cuñhal, es gibt Neuigkeiten.«
»Ich höre.«
»Sein Sohn ist heute früh angekommen. Mit drei Bodyguards. Er hat sich den ganzen Tag lang mit seinem Vater unterhalten.«
»Konnten Sie hören, worüber?«
Rita lauschte einen Moment in den Park und antwortete erst, als sie kein verdächtiges Geräusch hörte. »Nein, sie haben das Gespräch unterbrochen, sobald ich in ihre Nähe kam. Der Alte ist ein misstrauischer Fuchs. Er traut nicht einmal mir, selbst nach all den Jahren.«
»Er tut gut daran, nicht wahr?«, kam es spöttisch vom anderen Ende. Dann wieder ernst: »Sonst noch etwas?«
»Ja. Der Alte hat mir gestern gesagt, dass er neben seiner Frau in Madrid beerdigt werden möchte.«
Rita glaubte zu hören, wie der Gesprächspartner am anderen Ende ruckartig die Luft einsog. Seiner Stimme aber war keine Gefühlsregung anzumerken, als er fragte: »War das alles?«
»Ja, im Augenblick schon, und es kann dauern, bis ich mich wieder melde«, antwortete Rita. »Die Bodyguards seines Sohnes haben ihre Augen überall.«
»Dann melden Sie sich eben, sobald Sie können«, kam es vom anderen Ende, und es wurde aufgelegt.
Rita sah sich um, horchte, schaltete das Handy aus und legte es in das Versteck zurück. Als sie sich wieder durch die Bougainvilleas hindurchdrückte, um zurück zum Haus zu gehen, blieb ihr fast das Herz stehen. Der Jüngste der drei Begleiter Kemmlers bog in den Weg ein und kam ihr entgegen. Sein Gesicht war jugendlich, ohne eine Falte, beinahe knabenhaft, aber seine Miene war kalt und der Blick starr wie der eines Hais. Sie zwang sich zu einem Lächeln, als sie sich begegneten, und nahm eine der Kumquats aus dem Korb. »Frisch vom Baum. Möchten Sie eine probieren?«
Die Villa wirkte wie verlassen, als Kemmler die Treppe hinunter in die Eingangshalle ging. Die Nachtschwester war jetzt bei seinem Vater. Er hoffte, dass dessen Dämonen in dieser Nacht nicht wiederkehren würden.
Das späte Tageslicht fiel in Streifen durch die schmalen, hohen Fenster und zeichnete Muster auf Bodenfliesen und Wände. Als Kind hatte er oft oben an der Treppe gesessen und hinunter auf den Boden der Eingangshalle geschaut, fasziniert vom Spiel aus Licht und Schatten, wenn Wolken vor der Sonne vorbeizogen. Da war auch noch der Geruch von Bienenwachs, der den dunklen Holzmöbeln entströmte, und wenn er angestrengt lauschte, vernahm er auch die leisen, kaum hörbaren Geräusche, die dem Haus schon früher zueigen waren, hier ein Knacksen, dort ein Knistern, wenn das Holz arbeitete. Bruchstückhafte Erinnerungen an die Kindheit, die er hier verbracht hatte. Das meiste aus jener Zeit war jedoch verblasst wie alte Fotos.
Der schwarze Konzertflügel in der Mitte der Eingangshalle, dort, wo die Bodenfliesen eine Rosette bildeten, zog ihn an, und er ließ seine Hand über die spiegelnde schwarze Oberfläche gleiten. Wie oft hatte er abends als Kind in dem hohen Raum mit der phänomenalen Akustik dem Klavierspiel seines Vaters gelauscht. Bach, Schubert, Mozart! Fasziniert hatte er zugesehen, wie die Hände seines Vaters aus den Strichen und Punkten der Notenblätter magische Klänge zauberten. Das Gesicht sah manchmal regelrecht verklärt aus, wenn er am Flügel saß. Oftmals, wenn Gäste im Haus waren, vor allem in der Weihnachtszeit, hatte er sie mit Bewunderung über das Klavierspiel sprechen hören. Es waren seltene Momente gewesen, in denen er seinen Vater emotional erlebte und nicht kühl, abweisend, distanziert.
Seine Finger hatten Streifen auf dem blanken schwarzen Lack hinterlassen. Sorgfältig wischte Kemmler sie mit dem Ärmel der Jacke ab und polierte die Stelle, bis sie glänzte wie vorher, so wie sein Vater es erwartete.
Er ging hinaus in den Park und atmete die frische Abendluft ein. Wind war aufgekommen und ließ die Blätter der dicht stehenden Bäume, die dem Haus Schatten gaben, rascheln. An ihrer Höhe und den ausladenden Ästen konnte er ablesen, wie lange er fort gewesen war. Viele hatten die Dachrinnen noch nicht erreicht gehabt, als er die Villa Kemmler verlassen musste. Nun überragten sie das Haus und spannten mit ihren Ästen einen Schirm, der die unbarmherzige Sonne Andalusiens abhielt.
Am Weg hinunter zur Parkmauer setzte er sich auf eine Bank und suchte in seinem Gedächtnis nach mehr Erinnerungen an die Zeit, die er hier verbracht hatte.
Schritte kamen vom Haus auf ihn zu, und er wandte sich um. Rita.
Er sah ihr zu, während sie näherkam, in ihrem Gang jene unvergleichliche Eleganz der Bewegung, die sprichwörtlich war für die Frauen von hier. Schon die Römer, so hatte er als Kind in der Schule gelernt, hätten Frauen aus Andalusien als Tänzerinnen nach Rom geholt und es gebe kleine antike Bronzefiguren, die sie in Posen darstellten, die denen von Flamenco-Tänzerinnen ähnelten.
Er rutschte ein wenig zur Seite, und Rita setzte sich neben ihn.
»Weißt du noch?«, fragte sie und deutete auf einen großen Oleanderstrauch neben der Garage, unter dem er mit ihr seine erste - und letzte - Zigarre geraucht hatte, spätabends, während im Haus eine Gesellschaft alter Herren saß. Ihnen beiden war mächtig übel geworden - von der Zigarre und von dem aus dem Keller gemopsten Sherry, den sie dazu tranken.
Ritas Mutter war ihnen natürlich draufgekommen, hatte ihn allein verantwortlich gemacht und mit einer Flut spanischer Schimpfwörter überschüttet. Er sah das Gesicht der resoluten, stämmigen, stets schwarz gekleideten Frau noch vor sich, wie sie ihn wütend ausschimpfte und seinen spanischen Sprachschatz um so manchen Begriff erweiterte, den man in guter Gesellschaft nicht in den Mund nahm. Trotz seiner gedrückten Stimmung musste er unwillkürlich schmunzeln bei dem Gedanken an die Szene.
»Was wäre wohl aus uns geworden, wenn du damals nicht weggemusst hättest?«, drang Ritas Stimme durch seine Gedanken.
Kemmler zog die Schultern hoch. »Wer kann das wissen?«, meinte er nüchtern. »Gibt es wen?«, erkundigte er sich dann.
Rita schüttelte den Kopf. »Da waren schon ein paar«, sagte sie, »aber es ist mit keinem was geworden. So bin ich meiner Mutter hier mehr und mehr zur Hand gegangen. Ich bin sozusagen in ihre Rolle hineingewachsen. Nach ihrem Tod bin ich geblieben.«
Kemmler spürte die Bitterkeit in ihren Worten. Ihr Leben war wohl nicht so verlaufen, wie sie es sich vorgestellt hatte.
»Und du? Warum hast du nicht noch einmal geheiratet?«, fragte Rita zurück. »Wolltest du nie Kinder?« Damit rührte sie an seinen wunden Punkt.
»Es hat sich nicht ergeben«, antwortete er in einem Ton, der sehr viel schroffer ausfiel als beabsichtigt. Eine Weile herrschte ein angespanntes Schweigen zwischen ihnen. Es war Rita, die es schließlich brach. »Wie lange wirst du bleiben, Siegfried?«
»So lange mein Vater mich braucht«, antwortete er. »Ich will nicht, dass er allein ist, wenn ...« Er sprach den Satz nicht zu Ende. Rita legte ihm die Hand auf die Schulter, und sie saßen eine Zeit lang stumm nebeneinander.
»Dein Vater hat mir gesagt, dass er neben deiner Mutter in Madrid beerdigt werden möchte«, sagte sie nach einer Weile.
»Mir hat er das vorhin auch gesagt«, antwortete Kemmler tonlos. »Und ich werde ihm den Wunsch selbstverständlich erfüllen.«
Andalusien, Samstag, 27. Oktober, 3:15 Uhr
Rita erwachte von leisem Klopfen an der Tür. Sie drehte sich um und sah auf die Uhr an ihrem Bett, es war nach drei. Gähnend stand sie auf, zog einen Bademantel über und öffnete. Altagracia, die Nachtschwester, stand auf dem Flur. »Es geht ihm schlecht, ich fürchte, es geht zu Ende«, flüsterte sie, und Rita folgte ihr ins Zimmer von Hagen Kemmler.
Sie schauderte, als sie eintraten. Aus dem Mund des alten Mannes im Bett drangen leises, dumpfes Röcheln und dazwischen ein paar geflüsterte Worte. Seine Stirn war voller Schweißperlen, die Hände lagen schlaff auf der Bettdecke.
»Er fällt ins Koma«, sagte Altagracia leise, trocknete den Schweiß auf der Stirn Hagen Kemmlers mit einem Tuch und fuhr ihm sanft über die Haare. »Gott sei Dank muss er sich nicht mehr quälen wie in den letzten Nächten«, sagte sie. »Das war furchtbar. Lass uns ein Gebet für ihn sprechen.«
Hagen Kemmler hatte zwar vor Tagen einen Priester abgelehnt, aber für ihn zu beten, ließen die Frauen sich nicht nehmen. Leise sprachen sie das Vaterunser.
Das Röcheln hörte auf, Hagen Kemmlers Atem ging mit einem Mal stoßweise, keuchend. Die Krankenschwester vergewisserte sich, dass die Infusion mit dem Schmerzmittel noch tropfte, aber er würde wohl ohnehin nichts mehr spüren, dachte Rita.
Mit einem Mal trat Ruhe ein. Kemmlers Atem wurde flach, dann, noch einmal zu Bewusstsein gekommen, flüsterte er angestrengt schwer verständliche Sätze. Rita legte das Ohr an seine Lippen und hörte, dass er Deutsch sprach, zu undeutlich jedoch, als dass sie mehr als Bruchstücke verstehen konnte. Nur ein Wort konnte sie sicher heraushören, das kam immer wieder.
Altagracia legte ihr die Hand auf die Schulter. »Ich denke, du solltest seinen Sohn wecken.«
Erst auf ihr drittes Klopfen hin sah sie Licht unter Siegfrieds Tür. Als er öffnete, trug er noch die Kleider vom Tag zuvor, sein Haar war wirr, und er wirkte desorientiert, als wüsste er nicht, wo er war. »Wie spät ist es?«, fragte er.
»Viertel nach drei. Du musst kommen, schnell«, sagte sie, »deinem Vater geht es schlecht.«
Hagen Kemmler atmete nur noch schwach, als sie sein Zimmer betraten.
Respektvoll blieb Rita mit Altagracia im Hintergrund, während Kemmler sich zu seinem Vater setzte und dessen Hand hielt.
Kurz darauf war es vorbei. Altagracia bekreuzigte sich. »Gott, schenke ihm den Frieden, den er im Leben nicht gefunden hat«, sagte sie leise.
»Hat er noch etwas gesagt heute Nacht?«, fragte Kemmler.
Altagracia nickte. »Ja, aber auf Deutsch, wie in den letzten Nächten. Darum habe ich nichts verstanden, bis auf ein Wort, das er ständig wiederholt hat, ich weiß aber nicht, was es bedeutet: Aurora.«
Rita sah, wie Kemmlers Augen schmal wurden, und merkte auf.
»Ich habe es ebenfalls gehört«, bestätigte sie, »aber vom Rest konnte auch ich kaum etwas verstehen. Seine Worte waren wirr und unzusammenhängend.« Wenn sie gehofft hatte, von Kemmler eine Erklärung zu bekommen, wurde sie enttäuscht.
»Schon gut«, sagte er an die Nachtschwester gewandt. »Ich danke Ihnen vielmals für die Betreuung meines Vaters. Könntest du sie nach Hause fahren?«, wandte er sich dann an Rita, und sie willigte ein, obwohl sie hundemüde war und die schmale, kurvige Straße nach Colomera nachts nur ungern fuhr.
»Wir sollten ihn noch herrichten, nur das Nötigste«, sagte Altagracia. »Es dauert nicht lange. Den Rest kann ich morgen erledigen.«
Kemmler nickte. »Gut, tun Sie das. Rita fährt Sie dann heim.«
Als er ging, sah sie die drei stämmigen Bodyguards, die mit Kemmler angekommen waren, in der Tür stehen. Sie hatte kein gutes Gefühl bei diesen Männern. Sie war froh, wenn die wieder weg waren. Zu dem Jüngsten sagte Kemmler ein paar leise Worte, die sie nicht verstehen konnte, aber der kurze Blick, den ihr der Mann daraufhin zuwarf, machte sie schaudern.
Andalusien, Samstag, 27. Oktober, 7:15 Uhr
Dr. Alejandro García Díaz kreuzte das Feld natürlicher Tod im Totenschein an, schrieb einen kaum leserlichen Vermerk der Todesursache in die Zeile daneben, trug Ort und Zeitpunkt ein und unterzeichnete unten auf dem Formular. »Tja, manchmal geht es doch schneller als erwartet«, bemerkte er bedauernd und reichte Kemmler das Dokument. Der Arzt war überrascht gewesen, als er Hagen Kemmler beim frühmorgendlichen Besuch tot vorgefunden hatte. »Ich hatte gedacht, ihm bliebe noch etwas mehr Zeit«, meinte er. »Vielleicht wollte er aber auch einfach nicht mehr«, fügte er hinzu. »Wenn der Wille nachlässt, geht es oft schnell zu Ende. Gut, dass er Sie noch gesehen hat.«
»Er muss nicht mehr leiden«, sagte Kemmler mit unbewegter Miene. »Kommen Sie, ich begleite Sie hinaus.«
Nachdem der Wagen des Doktors durchs Tor verschwunden war, ging Kemmler in die Küche, ließ sich einen doppelten Espresso aus der Kaffeemaschine ein, verrührte eine Portion Zucker darin, blies so lange in die kleine Tasse, bis es nicht mehr dampfte, und trank vorsichtig einen Schluck.
Er nahm den Kaffee mit hinaus und setzte sich auf die sonnenbeschienene Ostveranda. Was nun? Auch wenn ein Ozean zwischen ihnen gelegen hatte, war sein Vater nur eine eMail oder einen Anruf entfernt gewesen. Rückhalt, Ratgeber, Motor, schützende Hand gegen die stets ungeduldigen Kameraden in Argentinien. Gefährliche alte Männer, denen auch die Zeit davonlief. Hagen Kemmlers Tod würde ihre Ungeduld nur noch mehr anstacheln, und nun war da niemand mehr, der sie im Zaum hielt. Er blinzelte und schirmte die Augen mit der Hand gegen die Sonne ab, die die Wolken im Osten rot färbte. Dann wandte er den Blick hoch zum Fenster des Zimmers, in dem sein toter Vater lag. So kurz vor dem Ziel sterben zu müssen - welche Niedertracht des Schicksals!
Er trank den Espresso mit zwei schnellen Schlucken aus. Es half nichts, vom Jetlag und der kurzen Nacht fühlte er sich wie zerschlagen. Gähnend raffte er sich auf und ging hinauf ins Büro seines Vaters.
Dessen Laptop stand aufgeklappt auf dem Schreibtisch. Die rote Bereitschaftsleuchte zeigte, dass er nicht ausgeschaltet, sondern nur im Ruhezustand war. Der Desktop erschien nur einen Augenblick, nachdem er die Leertaste gedrückt hatte. Im geöffneten Browser stand noch das Dokument, das sein Vater zuletzt geöffnet hatte. Ein Zeitungsartikel vom 15. Februar 2009 über einen belgischen Journalisten. Kemmler setzte sich auf die Schreibtischkante und las:
Entlarvt nach 30 Jahren
Dem belgischen Reporter Jean Paul Mulders ist es nach Jahrzehnten gelungen, einen angeblichen Enkel Adolf Hitlers als Hochstapler zu entlarven.
Ende der 70er-Jahre hatte ein Franzose namens Jean Marie Loret (er starb am 14. Februar 1985) behauptet, seine Mutter habe ihm kurz vor ihrem Tod gestanden, während des Flandern-Feldzugs im Ersten Weltkrieg ein Verhältnis mit einem deutschen Soldaten namens Adolf Hitler gehabt zu haben. Aus dieser Affäre sei er hervorgegangen. Im Auftrag der Zeitung Het Laatste Nieuws hat Mulders Lorets Geschichte nach nunmehr drei Jahrzehnten wieder aufgegriffen. Es gelang ihm, von Briefmarken, die Loret einst abgeleckt und auf Briefe an seine Familie geklebt hatte, dessen DNA zu gewinnen.