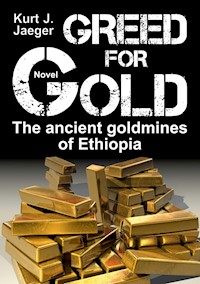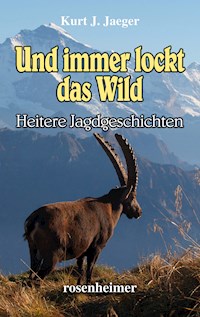5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Ära der Cockpitbesatzungen, die sich zum Teil noch mit eigenen Ideen und improvisierten Massnahmen aus schwierigen technischen Situationen befreien mussten, ist vorbei. Deren Aufgaben im Cockpit haben zum grössten Teil die Elektronik und Computer übernommen und am Boden sorgt geschultes Bodenpersonal für alle technischen Belange. Dass all dies vor nicht allzu langer Zeit anders war und Piloten öfters auch mit Notsituationen zu kämpfen hatte, wird dem Leser in diesem Buch auf spannende Art und Weise nähergebracht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Kurt J. Jaeger
DAS DAEDALUS LEGAT
ALS NOCH KOLBENMOTOREN DIE LUFTFAHRT BEHERRSCHTEN
Copyright: © 2016 Kurt JaegerUmschlaggestaltung & Satz: Erik Kinting
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
FLUG NACH LIBERIA
DURBINS LETZTER FLUG.
HART IM NEHMEN
DILMMA IN TANOUT
DIE ZIGARETTE DANACH
FERRYFLUG
NAVIGATIONPROBLEME
NOTLANDUNG IN SADE
EINE LETZTE CHANCE
SCHUTZENGEL UNTER DRUCK
WECHSELGESCHICHTE
KNAPP DANEBEN
DAS ENDE VOR AUGEN
VORWORT
Die Welt der Luftfahrt in den 60 & 70 Jahren des vorigen Jahrhunderts war voll mit Abenteuern gespickt. Es war die Zeit, als die Piloten noch nach dem Sitzleder flogen und auf ihren Flügen ohne moderne Navigationshilfen zurechtkommen mussten. Dies war speziell in Afrika und Südamerika der Fall, wo sich auch die Flugplätze alles andere als vertrauenswürdig präsentierten. Die Piloten waren noch Individualisten, die als Kommandanten die Flugzeuge noch von Hand steuerten und vielfach auf einen Autopiloten verzichten mussten. Computer und moderne Navigationshilfen, die heute die Arbeit der Piloten übernehmen, waren noch unbekannt. Das Zeitalter der Jets war noch in den Kinderschuhen. Noch beherrschten verschiedenartige Kolbenmotoren den Bereich der zivilen Fliegerei. Waren es Boxermotoren, die auf Kleinflugzeugen und leichten Geschäftsfliegern zum Einsatz kamen, so waren es bis zu 3’500 PS starke und technisch komplizierte Sternmotoren, die an den großen Transportflugzeugen Verwendung fanden. Anders als bei den heutigen Jets waren den Höhenleistungen jedoch Grenzen gesetzt. Flüge über 20‘000 Fuß mit Kolbenmotoren waren die Ausnahme. Notgedrungen musste man daher bei verschiedensten Wetterlagen durch Wolken und Gewitterzonen fliegen, dabei schwere Vereisungen oder auch Turbulenzen in Kauf nehmen. Das Bordradar steckte noch in den Kinderschuhen und war bei gewissen Transportflugzeugen gar nicht vorhanden. Alles in allem verlangte diese Art der Fliegerei von den Piloten einiges mehr, als es bei den Besatzungen der heutigen Jets der Fall ist.
Die Crews auf den Transportflugzeugen bestanden meistens aus einer zuverlässigen, verschweißten Mannschaft, bei denen sich jeder auf den anderen zu 100% verlassen konnte. Technische Notfälle wurden zudem souverän und unter Einsatz aller verfügbaren Mittel an Ort und Stelle gelöst. Praktisch jedes Besatzungsmitglied war ein ausgebildeter Techniker oder Mechaniker, der die Innereien der von ihnen geflogenen Flugzeuge bestens kannte. Dies führte unter anderem auch dazu, dass sich Piloten hin und wieder sozusagen mit den eigenen Haaren aus schwierigen technischen Knacknüssen herausziehen konnten.
Im Folgenden werden einige Beispiele erwähnt, die der Autor persönlich erlebt hat. Technische oder fliegerische Vorkommnisse, die manchmal auf primitive Art und Weise gelöst werden mussten. Den Besatzungen wurde dabei viel abverlangt, denn die Geräte und Motoren waren in ihrem Aufbau kompliziert und auch anfällig für Probleme, die sich schnell zu einer Katastrophe entwickeln konnten. Von den Piloten verlangte dies eine sehr kurze Reaktionszeit, speziell, wenn es sich um Probleme mit den Motoren handelte. Es war nicht nur das hochvolatile Flugbenzin, das sich beim geringsten Funken oder durch Hitze entzünden konnte, es waren auch die Motoren, die sich zum Teil als technisch anfällige Wunderwerke mit einem ganz eigenen Charakter erwiesen. Eine dauernde Überwachung der Instrumente war daher erforderlich, um nicht durch ein plötzliches Problem überrascht zu werden. Bei einem technischen Zwischenfall musste die Flugbesatzung blitzartig entscheiden, welche Gegenmaßnahmen die Richtigen waren.
Meistens war auch Improvisationstalent gefragt, wenn es sich um technische Probleme handelte. Auf abgelegenen Landepisten gab es sehr selten technisch versiertes Personal oder einen entsprechenden Support, um eine unterstützende Hilfe zu bieten. Speziell die Flugbesatzungen auf nichtregulären Charterflügen in abgelegene Gebiete waren gefordert. Dort war meist jede Hoffnung auf Hilfe vergebens. Die Crews waren völlig auf sich selbst angewiesen und es kam auch öfters vor, dass bei Ausfall eines Motors an einem 4-motorigen Transportflugzeug, die Aufgabe kurzerhand mit drei Motoren erledigt werden musste. Da war es auch nicht außergewöhnlich, wenn der Captain einer Transportmaschine den Flight Engineer im T-Shirt bei der Behebung eines mechanischen Problems unterstützte und mit ölverschmierten Händen an einem Motor arbeitete.
Bei Piloten auf regulären Fluglinien war so etwas ein Ding der Unmöglichkeit. Diese Crews hatten auf jedem Flugplatz, den sie planmäßig anfliegen mussten, die jeweils erforderliche technische und operationelle Unterstützung. Sie genossen dabei die neuesten Errungenschaften in Bezug auf unterstützende Geräte. Das Warten der Flight Crew auf die Erledigung eines technischen Problems fand dann in den besten Hotels der Stadt und deren Swimming-Pools statt. Zusätzlich überschritten sie eher selten ein Arbeitspensum von 70 Flugstunden im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr wurde, so musste die Überzeit finanziell entschädigt werden, ansonsten wurde protestiert oder sogar gestreikt. Dazu waren sie auch noch Mitglied von nimmersatten Gewerkschaften, die dafür sorgten, dass von den Fluggesellschaften völlig überrissene Gehälter bezahlt werden mussten.
Charterpiloten hingegen flogen selten weniger als die gesetzlich erlaubten 110 Stunden im Monat, respektive 1000 Stunden pro Kalenderjahr. Sie waren selten oder nie Mitglied einer Gewerkschaft und zogen es vor, durch Leistung in eine höhere Lohnklasse zu steigen. Eine bei den Airlines übliche, anhand von Dienstjahren erteilte Beförderung, gab es nicht. Auch waren sie immer auf sich selbst abgestellt, wenn es auf Außenlandeplätzen um Problemlösungen ging. Sie waren sozusagen eine Elite in Bezug auf die professionelle Einstellung und hatten eine enorme Erfahrung, wenn es um Ideenreichtum bei Problemlösungen ging.
Der Titel des vorliegenden Buches „Das Dädalus Legat“ soll damit auf den Einfallsreichtum gewisser Piloten hinweisen, die aus der Not heraus nach Lösungen suchten, die es ihnen erlaubten, technische Probleme aus dem Weg zu schaffen und einen Auftrag zu Ende zu fliegen. Dädalus hatte dies angeblich schon vor mehr als 2000 Jahren mit seinen Flügeln aus Federn, Bindfaden und Wachs geschafft. Auch heute noch sind manchmal unorthodoxe Methoden zur Lösung von Schwierigkeiten nötig, um sich aus einer Notlage zu befreien.
In den folgenden Kapiteln soll durch ein paar Beispiele gezeigt werden, wie gerade in Afrika in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts, die Bedingungen in der Fliegerei waren und, wie die Piloten damit umzugehen wussten. Die Namen der Protagonisten wurden absichtlich geändert.
“Mankind has a perfect record in aviation – we have never left one up there!”
(Unknown author)
CESSNA 195 (Quelle: Autor)
FLUG NACH LIBERIA
Frankfurt, den 25. Juni 1960
Es gibt immer wieder Ereignisse, die erstens überraschend eintreten und zweitens das Leben einzelner Personen maßgebend beeinflussen können. So ging es Fred Porter, als er im Juni 1960 vor dem TWA-Hangar des Flughafens Frankfurt-Main plötzlich mit einer kurzen, handgeschriebenen Notiz konfrontiert wurde. Der Mechaniker, der ihm die Meldung überbrachte, hatte offensichtlich die Mitteilung bereits gelesen, denn er erwähnte so nebenbei, dass es dem Empfänger gleich kalt über den Rücken laufen würde.
Ohne Zweifel hatte der Mechaniker damit ins Schwarze getroffen. Die Notiz von Porters Chefs war kurz und bündig: „Alles vorbereiten für einen Flug mit der Cessna 195 nach Liberia. Aha, dachte er, die Firma Aero Exploration hat tatsächlich den Zuschlag für den großen Vermessungsauftrag in diesem tropischen Land nahe dem Äquator bekommen. Ein Auftrag, über den seit Wochen in den Büros und im Hangar getuschelt wurde. Viel wusste man außerhalb der Chefetage nicht, aber einige wichtige Details waren bereits durchgesickert.
Irgendwo im Innern des unterentwickelten Landes in Westafrika hatte man angeblich Eisenerz in großen Mengen gefunden. Eine zum Zwecke der Erzförderung neu gegründete Firma mit dem Namen DELIMCO (Deutsch-Liberianische Mining Company) brauchte für die geplante Eisenbahnlinie dringend eine Vermessungsfirma, die bereit war, zu diesem Zwecke eine Gruppe von Spezialisten nach dort zu entsenden. Für die Vermessungsfirma, bei der Porter als Pilot arbeitete, war es zweifelsohne ein Glücksfall, aber die Entscheidungsträger ahnten nichts von den Schwierigkeiten, die dort eine solche Mannschaft in der Regenzeit erwartete. Konkurrenzunternehmen waren anscheinend besser informiert und nicht bereit dieses Risiko auf sich zu nehmen.
Zuverlässiges Kartenmaterial war ebenfalls nicht vorhanden. Notgedrungen würde man also dort erst einmal Luftaufnahmen machen müssen, um stereoskopisches Kartenmaterial erstellen zu können. Erst danach konnte eine Bodenmannschaft mit Theodoliten die mögliche Route einer Eisenbahnlinie durch praktisch unbekanntes Terrain vermessen. Ein entsprechendes Flugzeug, ausgerüstet mit einer WILD-Kamera gab es in Liberia aber nicht. Notgedrungen musste also erst einmal eine Maschine mit solch einer installierten Weitwinkel-Kamera Tausende von Kilometer in den dunklen Erdteil überflogen werden.
Inzwischen hatte Porter sich seit Monaten für die neu aufgebaute Cessna 195 interessiert, die hochglanzpoliert und unbenutzt im Hangar stand. Warum niemand dieses elegante, mit einem Sternmotor ausgerüstete Flugzeug fliegen wollte, konnte er nicht begreifen. Also bedrängte er seinen Boss persönlich, bis er ihm schlussendlich die Leidensgeschichte der Cessna erzählte. Es stellte sich heraus, dass diese Maschine schon zweimal schwer beschädigt worden war, und zwar durch erfahrene Piloten der Lufthansa, die man gebeten hatte, den Vogel zu zähmen. Schon bei der ersten Landung hatte ein angeblich erfahrener Flugkapitän die Kontrolle über die Maschine verloren und war nach einem „Cheval de bois“ – einem unkontrollierten Dreher beim Landen – mit beschädigtem linken Flügel und lädiertem Fahrwerk außerhalb der Piste zum Stehen gekommen. Der zweite Testflug nach langwieriger Reparatur hatte mit einem sehr ähnlichen Resultat geendet. Nach diesen zwei Versuchen aber hatte die Chefetage nicht die geringste Absicht die Maschine in die Hand eines jungen Piloten, wie Porter es war, zu geben. Lieber sollte sie weiterhin ihr Dasein im geschützten Hangar verbringen, als nochmals in einem zerstörerischen „Cheval de bois“ oder auch Ground-Loop genannt, zu enden.
Doch stetes Wasser höhlt den Stein, und so hatte Porter beschlossen, mit einem verbalen Dauerbeschuss die Entscheidung der Chefetage zu Fall zu bringen. Tagelang hatte er schon das Handbuch studiert, hatte heimlich in der Maschine gesessen und sich mit der Bedienung der Schalter und Hebel beschäftigt. Die schlechte Sicht aus dem Cockpit nach vorn über den großen Sternmotor war ihm von Anfang an suspekt gewesen. Wochen später hatte Porter den Widerstand des Firmenchefs aufgeweicht. Ein Standlauf war ihm erst einmal bewilligt worden. Die Cessna 195 wurde alsbald aus dem Hangar geschoben und Porter hatte sich mit der Bändigung des großen Sternmotors üben können. Die ersten Rollversuche hatten ihm sehr schnell gezeigt, dass die Sicht nach vorn tatsächlich äußerst prekär war. Schnell hatte er jedoch gelernt, sich durch das seitliche Fenster zu orientieren und im Zickzackverfahren zu rollen.
Dann endlich war ihm auch ein Testflug zugesprochen worden. Mit dem Blick flehend gegen den Himmel gerichtet, hatte ihm der Chef trotz seiner nicht sonderlich großen Flugerfahrung die lang erwartete Bewilligung für einen Start auf der langen Piste 27R bewilligt. Da Porter sein fliegerisches Geschick fast ganz auf Flugzeugen mit Heckrad angesammelt hatte, war er guten Mutes, dieses Monster in den Griff zu bekommen. Auf gar keinen Fall wollte er den beiden Piloten der Lufthansa nacheifern, sondern die Cessna wieder heil auf Mutter Erde zurückbringen.
Der Start war denn auch ohne Problem vonstattengegangen. Porter hatte der eleganten Maschine ihren Lauf gelassen, hatte nur sachte korrigiert und sich deren Reaktionen auf seine Steuerausschläge gemerkt. Durch die missratenen Landungen seiner Vorgänger gewarnt, hatte er nach etwa dreißig Minuten Erprobung der Flugcharakteristik dem Kontrollturm sein Anliegen erklärt und um einen langen Anflug gebeten. Anscheinend hatte der Fluglotse die ehemaligen verpatzten Landungen noch miterlebt, denn er wünschte Porter alles Gute beim Versuch, die Cessna 195 heil auf die Piste zu bekommen.
Es war bei einem Versuch geblieben. Die Fahrwerkbeine aus Federstahl hatten ihm seine ersten Kontakte mit der Piste übelgenommen. Beim Durchstarten hatte er jedoch begriffen, dass die von Kollegen empfohlene Landung mit erhöhter Geschwindigkeit und nur auf dem Hauptfahrwerk, niemals zum Erfolg führen würde. Beim nächsten Anflug hatte er daher kurz vor dem Aufsetzen die Endgeschwindigkeit reduziert, bis der Anstellwinkel eine Dreipunklandung erlaubte. Sachte, wie auf Entenfedern hatte sich die Cessna auf die Piste gesetzt und mit nur wenigen Bremskorrekturen war sie auch auf der Mittellinie geblieben. Stolz, wie ein Gockel, hatte Porter danach die Cessna vor dem Hangar und einer nicht gerade kleinen Menge an Zuschauern abgestellt. Der Chef hatte ihm als Erster strahlend die Hand gedrückt und ihm die Erlaubnis erteilt, mit weiterem Training ein Gefühl für die Maschine zu bekommen. Das Eis war damit geschmolzen und bald hatte Porter die nötige Erfahrung gesammelt, um auch längere Flüge und Landungen auf unbefestigten Pisten mit der Cessna 195 zu unternehmen.
Die Aufforderung der Geschäftsleitung, die Cessna schnellstens für den Überflug nach Liberia vorzubereiten, traf Fred Porter aber unvorbereitet. Eigentlich hatte er erwartet, dass eine der zweimotorigen Avro „Ansons“ für diesen Auftrag ausgewählt würde. Sein Hinweis, dass die einmotorige Cessna wohl besser mit den Bedingungen in Liberia fertig würde, und er kleine Wartungsarbeiten auch selbständig ausführen könnte, hatte zweifelsfrei zugunsten seines Vorschlages beigetragen. Jetzt aber galt es, in kürzester Zeit sämtliche Unterlagen und Genehmigungen für diesen Flug zusammenzustellen. Mit Grauen erinnerte er sich der Vielzahl von Telegrammen, die die Sekretärin verschicken musste, um auf der geplanten Route die Treibstoffversorgung sicherzustellen.
Karten vom Gebiet der Sahara und den diversen Kleinstaaten entlang der Flugroute mussten erst bestellt und die Notams studiert werden. Die Arbeiten an der Cessna für den Einbau eines nötigen HF-Funkgerätes kamen nicht vom Fleck und brachten Porter fast zur Verzweiflung. Doch am 22. Juni war es dann endlich soweit. Mit der Erprobung der verschiedenen Geräte konnte begonnen werden. Zu seiner Beruhigung lief alles ausgezeichnet. Die Zusammenstellung der Notausrüstung zur Überquerung der Wüstengebiete, der sogenannten „Region inhospitalière“, brachte jedoch erneut unerwartete Probleme mit sich. Die Beschaffung von Morphium Ampullen sowie einer ganzen Anzahl anderer Medikamenten war nämlich eine Sache für sich. Ein paar Tage später war es dann soweit. Die letzten Vorbereitungen zum Start konnten jetzt getroffen werden.
Es war kurz nach elf Uhr, als die Mechaniker wegen der hohen Temperaturen im Süden, das Öl des Jacobs-Sternmotors auf SAE 50 wechselten. Porter war inzwischen mit dem Verstauen der zum Teil sperrigen Ladung in der Kabine und dem Gepäckraum beschäftigt. Währenddessen tätigte sein Begleiter Herget noch ein paar Einkäufe für das leibliche Wohl. Die von den Wetterfröschen abgegebene Vorhersage für die erste Etappe war denkbar schlecht. Da die Maschine nicht für Blindflug ausgerüstet war, musste er sich an die Sichtflugregeln halten. Porter kämpfte also mit dem Ja oder Nein und entschloss sich schließlich, den Flugplan nur bis Lyon auszufüllen. Bei der bestehenden Wetterlage hielt er es für angesagt, genügend Reserve für einen Ausweisflugplatz zu haben.
Nach einem letzten Winken und dann Start von Piste 27 L flog er in einer weit gezogenen Linkskurve Richtung Süden. Die anfängliche Wolkenuntergrenze von 2500 Fuß sank bei Mannheim auf weniger als die Hälfte und bei Baden-Oos huschten sie mit der Maschine nur noch in 500 Fuß über das Rheintal. Wegen der Wetterlage entschloss er sich, dem Rhein zu folgen und nicht den direkten Weg durch die Vogesen zu riskieren. Turbulenzen fassten nach der Maschine, ließen sie tanzen, wie ein Kahn auf aufgewühlter See. Zu seiner Erleichterung meldete ihm Basel Tower per Funk – freundlich wie immer – die Aussicht auf gutes Wetter bis Genf. Entlang den Höhenzügen des Jura schien alles in bester Ordnung zu sein, bis plötzlich der Motor einen Leistungsabfall zeigte und zusätzlich einen Hustenanfall kriegte. Porters Herz rutschte in die Hose. Doch dann verriet ein Blick auf Vergasertemperatur die Ursache und ein Zug an der Vorheizung beendete das Problem. Nachdem sie Genf zu ihrer Linken passiert hatten, fassten die bekannten Turbulenzen der Rhone Schlucht nach ihnen und ein kräftiger Westwind warf zusätzlich ihre geschätzte Ankunftszeit für Lyon weit zurück. Aber es spielte keine Rolle, denn eine Übernachtung in Lyon war sowieso vorgesehen.
Am nächsten Morgen begrüßten sie Nieselregen und tiefhängende Wolken. Mit Pessimismus geladen ging's ab zum Flugplatz Bron. Doch an einen sofortigen Weiterflug war nicht zu denken, denn erstens war die Wetterlage weit von den Sichtflugbedingungen entfernt, und zweitens hatte sich die Pressluft im Heckrad-Stoßdämpfer über Nacht davongemacht. Bis Mittag war jedoch das Problem behoben. Zugleich lockerten sich auch die Wolken etwas auf. Die nächste Etappe bis Barcelona verlief daher bei schönstem Wetter. Die anschließende Verständigung mit dem dortigen Kontrollturm ließ leider zu wünschen übrig. Nachdem Porter über den Anflug und Kommunikation einer Vickers „Viking“ rätselte, bekamen auch er die erwartete Landeerlaubnis. Gerade einladend kam Porter die Piste nicht vor und es fehlte auch die QFU-Bezeichnung, aber dann quietschten auch schon die Reifen auf der geteerten Piste auf.
Langsam begann er, abzubremsen. Doch dann – oh Schreck – der Bremsdruck war weg. Die relativ günstige Eigenschaft der Cessna 195 einen Ground-Loop zu produzieren, war damit auf Höchste gegeben, zumal auch noch ein kräftiger Seitenwind herrschte. Porter tat, was möglich war, um dem Unheil entgegenzuwirken. Doch dann drehte es die Cessna auch schon mit einer 450°-Rechtsdrehung um die Hochachse. Immer noch auf der Piste stehend, schauten Hegert und er sich dumm an und dankten Gott, dass sie das Ganze ohne Schaden überstanden hatten. Mit rotem Kopf und gedämpftem Optimismus rollten sie danach dem Terminal entgegen, wo sie zum Abstellen neben eine Messerschmidt Me-109 der spanischen Luftwaffe eingewiesen wurden.
Sofort versuchte Porter, den Grund für den Bremsdruckverlust zu eruieren. Aber es war vergebens. Auf Anhieb war nichts Verdächtiges festzustellen. Es folgte ein Kopfschütteln und die Hoffnung, dass es nur ein zufälliges Problem war. Die Nacht verbrachten sie in einem Hotel in der Stadt, wo Porter für Stunden über das mögliche Problem mit den Bremsen nachdachte. Er wollte am Morgen der Sache auf den Grund gehen und so wartete der nächste Tag mit allerhand Arbeiten auf sie. Nachdem er ein paar Leute der Iberia-Fluggesellschaft mobilisieren konnte, um die Maschine aufzubocken, wurde die gesamte Bremsanlage überprüft. Bremsbeläge, die sie als Ersatzteile geladen hatte, wurden ausgewechselt und das ganze System entlüftet. Danach zog die Bremse wieder an, als ob nie etwas damit gewesen wäre.
Sofort wurde ein Flugplan bis Malaga ausgefüllt und dann rollten sie zum Start. Als Porter jedoch beim Hinausrollen die Bremse betätige, um in einer Schlangenlinie seinen Weg zu finden, fiel der Bremsdruck erneut zusammen. Seine anschließenden Kraftausdrücke waren von der untersten Schublade und wohl in keinem Duden vermerkt. Also zurück zum Abstellplatz, wo sie das ganze Prozedere mit dem Entlüften der Bremsen wiederholten. Der erneute Rollversuch brachte sie dieses Mal immerhin bis zum Holding Point der Piste.
Vor Porter startete gerade donnernd die spanische Version der Me-109, als er gleich darauf dem Jacobs-Sternmotor die Sporen gab. Die nächsten Stunden brachten sie über Valencia, Murcia und die herrliche Gebirgsgegend von Grenada. Alles sah so malerisch aus, aber Porter dachte an den vorne dumpf brummenden Motor. Wehe dem, der hier eine Notlandung vollziehen musste. Doch wenig später kam Málaga in Sicht. Der langgestreckte Sinkflug brachte sie geradezu in den "Short Final" zur Piste 14. Der Versuch, die Maschine nach der Landung abzubremsen, wurde auch hier mit einem Druckverlust beantwortet. Nur mit Hilfe von stoßweisem Gas geben und vollem Einsatz des Seitenruders sowie dem glücklichen Umstand, dass kein Seitenwind herrschte, war es zu verdanken, dass ihnen nicht wieder das Gleiche, wie in Barcelona passierte.
Dieses Mal wollte Porter unbedingt wissen, wie es dauernd zum Bremsdruckverlust kam. Nichts wollte er unversucht lassen, um hinter das Geheimnis zu kommen. Nachdem beide Räder des Fahrwerks demontiert und die dünnen Bremsscheiben entfernt waren, kam er bei der Demontage der Räder dem Geheimnis auf der Spur. Beide Scheiben zeigten wellenförmige Verwerfungen. Jetzt wurde ihm einiges klar. Die beim Abbremsen erhitzten Bremsscheiben begannen sich jeweils zu verwerfen und wischten bei jeder Umdrehung des Rades dem Bremskolben konstante Schläge aus. Dies bewirkte, dass das Bremsventil jeweils kurz öffnete und der Druck dadurch auf null absackte. Dies war eine Erfahrung, mit der er etwas anfangen konnte. Mithilfe eines gewieften, alten Schmieds mit einer noch viel älteren Werkstatt konnte er die Bremsscheiben im Feuer und über dem Amboss wieder plan richten und sie im Ölbad sintern. Der danach erfolgte Test an der Maschine bestätigte deren Wirksamkeit. Einem Weiterflug stand also nichts mehr im Weg.
Mit viel Palaver wurde am Morgen danach die Abfertigung nach Casablanca-Nouasseur gemacht. Dies war nach dem Kartenmaterial, das Porter besaß, ein riesiger Flugplatz der USAF, der temporär für Zivilmaschinen geöffnet war. Der eigentlichen Zivilflugplatz Cazes war gemäß Notam für Transitflüge gesperrt. Mit einem letzten Winken an die Helfer ging’s los. Der Flug führte vorbei an malerischen Dörfern, die wie Schwalbennester an steilen Hängen klebten. Weit im Süden konnte mal bald den von einer geschlossenen Stratusschicht umgebenen Felsen von Gibraltar erkennen. Die per Funk eingeholte Überflugs-Genehmigung kam prompt. Leichter Regen hatte jetzt eingesetzt. Sie überflogen die am Fuße des Felsens gebaute Piste in 800 Fuß und holten nach rechts aus, um die sich vor ihnen türmende Schlechtwetterzone zu umfliegen. Es half nichts. Im Tiefflug und schlechter Sicht mussten sie durch die Front, vorbei an schwer in der Dünung stampfenden Tankern. Windböen rissen an der Maschine und die Wellen unter ihnen trugen verwischte, weiße Kronen. Auch das Thermometer fiel merklich und mahnte Porter, ein Auge auf die Vergaserheizung zu haben.
Die Einöde über der Meerenge schien kein Ende zu haben. Die Minuten krochen furchtbar langsam dahin. Allein das Lästern über die spanischen Wetterfrösche, welche die Vorhersage für die Route gemacht hatte, bot etwas Abwechslung. Zu ihrer Erleichterung meldete Tangier Tower ein akzeptables Wetter und beste Sicht. Die Küste von Nordafrika kam in Sicht und sie schüttelten sich die Hände für den Übergang auf den Schwarzen Kontinent. Ein paar angeschwemmte und ausgehöhlte Schiffswracks gähnten zu ihnen herauf. Sie staunten herunter und vergaßen dar ob völlig ihre Umgebung. Erst ein Schatten, der über Porters Gesicht huschte, ließ ihn erschrocken aufschauen. Eine Mistère-Patrouille der marokkanischen Luftwaffe auf ihrer linken Seite brachte ihn etwas in Aufregung. Schon glaubte er in ihrem Flügelwackeln das Zeichen des „Follow-me“ zu sehen. Aber ein freundliches Winken hinter deren Plexiglashaube beruhigte ihn. Erfreut hob er ebenfalls die Hand zum Gruße. Nach kurzer Zeit drehten sie weg, und das Eintönige der Gegend umfing sie erneut.
Casablanca Control gab ihnen gleich darauf die Einflug-Bewilligung und leitete sie nach Nouasseur weiter. Der dort tätige Turmbeamte der US-Air-Force antwortete mit einem herrlich klaren Englisch. Ein Genuss nach all dem Kauderwelsch der letzten Tage. Allerdings wollte er wissen, wie sie überhaupt dazu kämen, Nouasseur anzufliegen. Porter erzählte ihm vom Flugplan, dem Notam und dem Transitverbot in Casablanca-Cazes.
„Stand-by!“, war seine Antwort. Zehn Minuten vergingen. Nach weiteren fünf Minuten, die sie mit dem Umkreisen des Flugplatzes verbrachten, verlor Porter die Geduld. Sein Protest war von Erfolg gekrönt, denn gleich darauf bekam er die Landerlaubnis. Kaum hatte er die Cessna auf der Piste, kam auch schon die Anweisung vom Kontrollturm, einen Taxiway auf der Südseite zu benutzen, der zu einem kleinen Hangar und ein paar Baracken führte. Argwöhnisch stellte Porter dort die Maschine ab und wartete der Dinge, die da kommen sollten.
Gerade bestaunten sie die mit B-52 Bombern und Transportflugzeugen überfüllten, riesigen Abstellplätze auf der anderen Seite der Piste, als ein Renault mit amerikanischem Kennzeichen angesaust kam. Porters Herz rutschte gegen die Magengegend. Military Police! Zu seiner Erleichterung erwies sich der Uniformierte, der ausstieg und sich ihnen näherte, als ein gutmütiger Amerikaner. Nach einer ersten kritischen Musterung hieß er sie freundlich willkommen. Gleichzeitig aber wünschte er ihnen einen guten Weiterflug nach Casablanca-Cazes. Dies wäre eine Sperrzone für Zivilflugzeuge, erklärte er mit einem schweren texanischen Akzent. Kein Zoll, kein Benzin und keine Polizei seien hier verfügbar. Als Porter ihn wegen des Notams fragte, gab er zur Antwort, das Transitverbot in Cazes sei zwar einmal gewesen, aber das liege schon über ein Jahr zurück. Ihr Staunen war echt. Mit dem Updating von Notams klappte anscheinend in Europa nicht alles.
Minuten später waren sie erneut in der Luft und in Richtung Casablanca-Cazes. Die Verständigung mit dem dortigen Tower war denkbar schlecht, aber Porter konnte heraushören, dass sie für Piste 21 eine Landegenehmigung hatten. Der erste Eindruck von Cazes war genauso schlecht. Ein furchtbares Durcheinander empfing sie am Zoll. Erst als Porter beim Chef persönlich vorstellig wurde, kam die Sache ins Rollen. Immerhin dauerte es immer noch zwei Stunden, bis sie endlich mit einem „Au revoir“ entlassen wurden.
Als Nächstes fixierte Porter den Flugplan für die nächsten drei Tage bis Dakar. Ein überaus hilfsbereiter Franzose half ihm mit der Bewilligung, die für den Flug über die „Region inhospitalière“ nötig war. Dank seiner Hilfe war in einer halben Stunde erledigt, was ansonsten 24 Stunden vor dem Flug beantragt werden musste. Bevor sie sich in die Stadt absetzten, wollte Porter aber noch die gesamte Notausrüstung überprüfen und einen Reifen am Hauptfahrwerk wechseln. Seine Liste über Zuladung und Ausrüstung, die er in weiser Voraussicht in zehnfacher Ausführung geschrieben hatte, wurde vom Zoll und der Polizei genauestens kontrolliert. Auch die Wasserkanister mussten gefüllt und das HF-Notfunkgerät vorgeführt werden.
Da sie am folgenden Tag in drei Etappen bis Villa Cisneros durchfliegen wollten, entschlossen sie sich, um fünf Uhr früh Tagwache zu blasen und im Morgengrauen zu starten. Als jedoch die letzte Motorenverschalung wieder montiert war, zeigten die Uhren bereits eine Stunde vor Mitternacht. Es wurde ihnen klar, dass die Zeit nicht mehr reichte, um in der Stadt ein Hotel zu suchen. Kurz entschlossen holte Herget die gefütterte Motorendecke aus dem Gepäckraum und machte sich daran die restlichen Nachtstunden unter dem rechten Flügel zu verbringen. Porter, seinerseits quetschte sich auf die vorderen Sitze, um den Schlaf des Gerechten zu suchen. Und so waren sie wahrscheinlich die erste Besatzung, die jemals auf dem Abstellplatz des Flugplatzes Cazes die Nacht schlafend im und unter dem Flugzeug verbracht hatten.
Niemand musste sie um fünf Uhr früh wecken, denn die Knochen taten ihnen so weh, dass sie die Zeit des Aufstehens gar nicht verpassen konnten. Ein ausgedehnter Standlauf verlieh ihnen einmal mehr das Vertrauen in den Jacobs-Sternmotor. Danach verabschiedeten sie sich vom Zoll und der Polizei. Die Art, wie sie ihnen einen guten Flug wünschten, gab der Vermutung Auftrieb, dass sie ihrem Plan, die Sahara zu bewältigen, wenige Chancen einräumten.
Um 05:45 brüllte der Motor sein Lied zu einem Start mit zum Rand gefüllten Tanks. Bei knapp 900 Fuß über Grund war dem Steigflug bereits die Grenze gesetzt. Tiefhängende Stratuswolken und leichter Nieselregen bei 12°C. schienen kein gutes Omen für die Strecke zu sein. Sie froren, als sie bei dieser Wetterlage aufs Meer hinausflogen, um einer Kollision mit den Bergen zu entgehen. Bald hatten sie den Flugplatz Safi neben sich und auch die fast senkrechte Steilküste, die etwa hundert Meter hoch teilweise in die Wolken hineinragte. Die Zeit schlich dahin und die Aschenbecher füllten sich. Derweil hatte Porter den Blick mehr als sonst auf den Instrumenten der Motorüberwachung und achtete auf die geringste Änderung des Motorengeräusches. Dann endlich kurvten sie um den hohen Felsen mit der Burg von Agadir. Sein Kollege Herget lehnte sich zu ihm herüber, um auf die Verwüstungen aufmerksam zu machen, die das große Erdbeben in der Stadt hinterlassen hatte. Tatsächlich empfing sie ein trostloses Bild. Überall am nördlichen Hang der Bucht türmten sich die Trümmer. Nur einzelne Häuser standen noch scheinbar schadlos zwischen den eingestürzten Mauern. Das Beben hatte ganze Arbeit geleistet. Was mussten die Menschen hier durchgemacht haben?
Als sie sich dem Flugplatz näherten, war im Kopfhörer ein furchtbares Tohuwabohu von Sprachen zu hören. Es schien dort allerhand los zu sein. Über dem Platz kreisten die dicken Bäuche von Avro „York“- Transportern und viermotorigen Bombern, die sich anscheinend in Landungen übten. Der Mann auf dem Kontrollturm meinte es aber gut mit ihnen. Zwischen zwei fliegenden Bäuchen ließ er sie zur Landung anschweben. Auch hier erwies sich der Zoll allmächtig. Dies wurde ihnen klar, als die Betankung verweigert wurde, bis der Zoll die Gelegenheit habe, sie auf dem Abstellplatz zu überprüfen. Also warteten sie. Nur, wo waren die Zollbeamten? Nach einer Stunde des Nägelkauens kamen endlich vier Mann in einem Jeep angefahren, um ihre Maschine und das Gepäck mit sturer Miene zu durchwühlen. Obwohl sie in Transit waren, wurde auf einer kompletten Auslegeordnung bestanden. Ob sie denn Geld hätten? Marokkanisches natürlich! Nein! Also Geldbeutel vorzeigen! Nach zwei Stunden wurden sie für harmlos erklärt und konnten den Flug fortsetzen – ohne Flugplan.
Mit 30 Knoten Rückenwind überflogen sie schließlich die eng an die Steilküste geschmiegten Orte von Sidi Ifni und Cabo Juby. Dann aber empfing sie die endlose, gelbgraue Sahara. Sand, nichts als Sand, soweit das Auge reichte. Die Sicht hatte indessen auf rund 15 Kilometer zugenommen. Kein Haus, kein Mensch über Hunderte von Kilometern. Die Stunden schienen plötzlich unendlich zu sein. Porters Aufmerksamkeit galt nun auch vermehrt dem monoton brummenden Sternmotor. Auch in dieser trostlosen Gegend wäre eine Notlandung gar nicht nach seinem Geschmack. Ein leichtes Sandtreiben schien nun eingesetzt zu haben, denn die Konturen unter ihnen wurden unscharf, wie eine verwackelte Fotografie. Am Horizont tauchten topfebene Salzseen auf und die Sonne brannte jetzt unbarmherzig ins Cockpit. Die Öltemperatur des Motors stieg unaufhörlich.
Zur Abwechslung türmten sich vor ihnen riesige Sanddünen auf. Nach Porters Berechnung mussten sie bald einmal in die Nähe von El Aaiun, dem nächsten Landplatz kommen. Also hielt er Ausschau nach dem großen Wadi, das ihm seine Position bestätigen sollte. Noch etwa zwanzig Minuten, dann müssten wir dem Wadi zur Ebene von El Aaiun folgen können, dachte er. Doch plötzlich waren sie über einem tiefen Tal. War dies nun bereits das erwartete Wadi? Nach der US-Air-Force Karte sollten sie aber noch rund 60 Kilometer davon entfernt sein. Porter zögerte. Hatten sie sich verrechnet? Zweifel nagten in ihm, aber instinktiv entschied er sich, diesem Tal nach Westen zu folgen. Die vom starken Wind erzeugte Turbulenz im breiten Wadi verlangte hohe Konzentration. Aber Porter konnte die Gedanken an eine navigatorische Fehlberechnung nicht aus dem Kopf kriegen. Wie kam es, dass die Karte für das Wadi eine andere Position angab? Immer wieder schaute er nun nach der Tankanzeige. Was war, wenn sie wegen Spritmangel notlanden mussten?
Über dem Rand des Wadis dehnte sich nun überraschend eine topfebene Hochfläche aus. Eine graue Schicht schien über der Gegend zu liegen. Schwach konnte Porter nun einen aufragenden, mit Stacheldraht eingezäunten Wachtturm erkennen, von dem der Lauf eines Maschinengewehrs herausragte. Dann, drunten im Wadi eine Gruppe von weiß getünchten Häusern. War dies das spanische Fort El Aaiun? Er war sich nicht sicher, aber als er eine mit roten Ölfässern markierte Naturpiste sah, war er sich sicher, dass sie richtig lagen. Der im Wind treibende Sand verwischte einmal mehr die Konturen. Fred entschied sich, sofort die Landung einzuleiten. Der Kompass zeigte 40 Grad, als er auf die markierte Piste zuflog. Heftige Turbulenzen erfassten sie, trieben sie seitlich von der Anfluglinie weg. Porter schätzte etwa 20 Knoten Seitenwind. Mit dem linken Flügel tief, flog er der schwach erkennbaren Piste entgegen.
Noch dachte er an die schlechten Eigenschaften, die die Cessna 195 bei Seitenwind zu zeigen pflegte. Im nächsten Augenblick jedoch schloss sie dichter, grauer Staub ein und nahm ihnen die Sicht nach vorn. Dann plötzlich sah Porter ein rotes Benzinfass neben sich vorbeihuschen. Die Piste! Gas raus! Der linke Flügel touchierte beinahe den kiesigen Boden. Er hörte noch, wie Herget aufschrie: „Achtung, Steine!“ Dann gab es einen fürchterlichen Schlag auf das linke Federbein. Fred merkte, wie es die Maschine im treibenden Sand den kaum erkennbaren Benzinfässern entgegenwischte. Den Verlauf der markierten Piste war nicht mehr erkennbar. Nur durch brüske Gasstöße und volle Ruderausschläge konnte Porter eine Bruchlandung verhüten. Es polterte und dröhnte, als ob die Cessna jeden Augenblick auseinanderfliegen würde. In Gedanken sah er sie schon in Trümmern liegen. Doch langsam ging die Höllenfahrt zu Ende. Letzte Korrekturen, um auf der Piste zu bleiben und dann stand die Cessna wiegend im heulenden Wind. Geschafft. Mit unglaublichem Staunen sah Porter nun keine zwanzig Meter vor ihm entfernt, und wie von Geisterhand hingestellt, einen Land Rover. Verhüllte Gestalten entstiegen dem Fahrzeug, kamen auf sie zu. Kaum, dass Porter die Tür auf seiner Seite einen Spalt öffnete, trieb ihm der stürmische Wind Sand ins Gesicht. Er musste die Augen schließen. Überall Sand. Es knirschte schon auf den Zähnen.
Schreiend den jaulenden Wind übertönend, begrüßten sie die spanischen Legionäre, die sie auch gleich zu einem kleinen Gebäude geleiteten, wo sie trotz Protesten der Legionäre, sofort mit der Betankung beginnen wollten. Herget stieg dort auf die im Sturm fürchterlich wankende Maschine, deckte mit seinem Rücken die Einfüllstutzen gegen den treibenden Sand und füllte die Tanks. Anschließend wurden sie in ein Gebäude geleitet. In einem kleinen, weiß getünchten Raum hieß sie ein Major willkommen. Sie schauten sich um. Zwei kleine Fenster gaben den Blick auf den draußen heulenden Wind, den treibenden Sand frei. Ringsum kahle Mauern, die aber die Hitze draußen hielten. Ein einzelner Schreibtisch dominierte den Raum. Dahinter hing eine etwas vergilbte Landkarte an der Wand. Der Platzkommandant sprach etwas Französisch, und so konnten sie sich einigermaßen unterhalten. Auf Porters Frage, wie stark der Wind da draußen toben würde, zeigte der Kommandant auf ein an der Wand montiertes Instrument. Der große Zeiger tanzte auf der Skala herum.
“Ungefähr 30 Knoten, manchmal etwas mehr.“
Herget und Porter schauten sich entgeistert an. Ohne Zweifel hatte ihnen bei der Landung eine gute Portion Glück zur Seite gestanden. Auch der Major machte eine entsprechende Bemerkung und drückte seine Bewunderung aus, dass es ihnen gelungen war, das Flugzeug heil auf den Boden zu bringen. Nachdem sie sich mit den dargebotenen Getränken gestärkt, und die Uniformen der Legionäre bewundert hatten, die in dieser Hölle ihren Dienst tun, drängten sie zum Weiterflug. Der Abschied war sehr herzlich und man konnte erkennen, dass die Leute in dieser Einöde froh waren, hin und wieder Fremde begrüßen zu können. Eine Landetaxe schien hier offenbar ein Fremdwort zu sein.
Noch immer tobte der Wind und dann kollidierten sie beim Hinausrollen um ein Haar mit Kamelen, die von einem vermummten Einheimischen quer über die Piste getrieben wurden. Unwillkürlich musste Porter daran denken, was wohl passiert wäre, wenn es dieselbe Situation bei der Landung gegeben hätte. Der Start war mehr schiebend, als geradeaus der Piste entlang. Die Maschine und Porter kämpften verbissen gegen den Seitenwind und hoben nach kurzer Rollstrecke von der kiesigen Piste ab. Der Wind aus 290 Grad steigerte jetzt ihre Geschwindigkeit über Grund auf beinahe 180 Knoten. Es ging in einer Höllenfahrt dem fernen Cabo Bojadar entgegen.
Sand, Sand und nochmals Sand. Als ihre Position rund 10 KM vor Cabo Bojador war, entdeckten sie eine schlecht markierte Piste. Konnte das schon der Flugplatz sein? Obwohl sie sich die Sache von oben genau anguckten, konnten sie nebst verfallenen Gebäuden keinen Menschen sehen. Alles sah etwas unheimlich aus und sie zogen es vor, erst einmal das Fort selbst zu überfliegen. Zwei Minuten später rauschten sie über ein paar Häuser, die den ganzen Ort darstellten. Es glich einem kleinen Ort im Wilden Westen von Amerika. Jetzt entdeckten sie auch den eigentlichen Flugplatz und fegten im Tiefflug darüber hinweg. Ein paar Leute winkten zu ihnen herauf und dann lag der kleine Ort auch schon wieder hinter ihnen.
Längs der Küste ging es nun weiter in Richtung Villa Cisneros, wobei nur gestrandete und von der Brandung zerfetzte Schiffwracks etwas Abwechslung boten. Die Sonne stach jetzt fast senkrecht auf sie herunter und das Thermometer stieg auf 38°C. Die riesigen flachen Gebiete, welche die Strecke bis Villa Cisneros charakterisierten, schienen teilweise wie eine geborstene Betondecke eingebrochen. Über Funk vernahm Porter plötzlich das Kennzeichen seiner Maschine. Es war der Turmbeamte von Villa Cisneros, der anscheinend schon auf sie wartete. Porter gab ihren ungefähren Standort bekannt sowie die geschätzte Ankunftszeit. Damit war der Beamte zunächst zufrieden.
Der Ort lag auf einer langgestreckten, nach Süden ausgerichteten Halbinsel. Als Porter daher plötzlich links drüben eine zweite Uferlinie sah, wusste er, dass das Ziel nicht mehr fern sein konnte. Ein starker Wind herrschte auch hier. Da aber die Wüste selbst der Flugplatz ist, störte ihn dies wenig. Es gab dadurch die Möglichkeit, gegen den Wind anzufliegen.
Die Cessna setzte sich weich in den Sand, und nach kurzem Rollen stellten sie die Maschine windgeschützt hinter dem Terminal und neben einer alten Tante Ju-52 ab. Der Chef des Postens bemühte sich persönlich, um ihnen einen herzlichen Empfang zu bereiten. Er war es auch, der sofort das Nötigste veranlasste, um für ihr leibliches Wohl und dasjenige der Cessna 195 zu sorgen. Anfänglich trug Porter sich mit der Idee, hier zur Erholung einen freien Tag einzuschalten. Der Ort mit dem Fort entsprach aber ganz und gar nicht seinen Vorstellungen von einem Ort der Erholung, und so entschlossen sie sich, gleich morgen früh wieder weiter zu fliegen. Nach einem Spaziergang durch das Fort, legten sie sich in die behelfsmäßigen Betten eines spartanischen eingerichteten Gästehauses.
Nachdem sie am nächsten Morgen ein reichhaltiges Frühstück zu sich genommen hatten, füllte Porter den Flugplan nach Port Etienne aus. Um 08:00 Uhr und nach einem herzlichen Abschied, rollten sie zum Start. Der starke Nordwind hob sie nach kurzer Strecke vom Boden ab und nach einer Ehrenrunde drehten sie von der Halbinsel weg in Richtung Küste. Die Gegend bot nichts Neues. Hin und wieder sah man ein gestrandetes Schiff oder einen einzelnen Reiter auf einem Kamel. Die Navigation wurde zusehends einfacher. Nach eineinhalb Stunden konnten sie in der Ferne bereits die Halbinsel von Port Etienne erkennen. Die Funkverbindung klappte auf Anhieb. Doch als der Turm eine Windgeschwindigkeit von 35 Knoten aus 260° durchgab, stellte sich bei Porter erneut ein leichtes Schaudern ein. Was wurde ihnen denn noch alles an unangenehme Überraschungen zugemutet?
Seine Bedenken bestätigten sich, denn beim Anflug war die Piste kaum mehr zu erkennen. Sie schien vom Sand völlig verweht. Er war gezwungen, sich nach den seitlichen Markierungspfosten der Piste zu orientieren. Die Landung gegen den Wind war kein Problem. Bremsen war überflüssig, denn nach ein paar Dutzenden Metern steckten sie bis zu den Achsen im Sand fest. Nur mit Vollgas konnte Porter die Maschine schließlich befreien und dann suchte er damit gleich hinter dem Flugplatzgebäude Schutz vor den Elementen. Kein uniformierter Zollbeamter und auch keine Polizei waren zu sehen. Nur ein leeres Empfangsgebäude gähnte ihnen entgegen. Außer dem Turmbeamten schien sich niemand für sie zu interessieren. Über Funk teilte er ihnen mit, dass sie mit etwa zwei Stunden zu rechnen hätten, bis der Zoll sich bequemen würde, zum Flugplatz zu kommen. Aus diesem Grunde, und weil gerade noch die Mittagspause anstand, bot er an, sie gleich in ein Restaurant auf dem nahen Hügel fahren, wo sich ein kleines Nest von niedrigen Häusern befand.
Minuten später fuhr er mit einem sonderbaren, aber nagelneuen „Deus Chevaux“ vor. Es war eine mit je einem Motor vorne und hinten angetriebene Citroën, eine „Ente“, die sich in dem sandigen Gelände wohl hervorragend eignete. Die Schaukelfahrt führte über eine behelfsmäßige, versandete Straße zum höher gelegenen Ort. Von dort schien es nur noch ein Weg zu geben, der auf der anderen Seite der Halbinsel beim Fischerhafen endete. Pierre, so nannte sich der Beamte, hielt vor einem bungalowähnlichen Gebäude an. Es war das Gästehaus und hier kamen sie in den Genuss echt französischer Küche. Pierre hatte versprochen, sie zwei Stunden später wieder abzuholen. Nach einem abschließenden starken Kaffee brachen sie auf. Was sie jedoch beim Öffnen der Tür erwartete, spottete jeder Beschreibung. Als ob sie in die Kabine einer Sandstrahlanlage geraten wären, so pfiffen ihnen der Wind und der Sand um die Ohren. Der Verdacht, dass ihre Cessna vielleicht fortgeblasen worden war, schien nicht ausgeschlossen.
Pierre kam pünktlich mit seinem „Deux Chevaux“ an und sie ließen sich in einer abenteuerlichen Fahrt über Alteisen, Felsen und Löcher zum Flugplatz fahren. Dort angekommen bestätigte sich Porters Verdacht wenigstens zum Teil. Die Maschine hatte sich trotz festgezogener Bremsen selbständig gedreht, und als er die Kabinentür öffnete, war alles mit gelblich rotem Sand eingedeckt. Er hatte unvorsichtigerweise das Seitenfenster einen Spalt offengelassen, um einen Hitzestau zu verhindern. Dadurch rieselte der Flugsand unaufhörlich durch diese Öffnung und die Belüftungsstutzen hinein. Die Sahara hatte sich buchstäblich im Innern der Cessna breitgemacht.
Nachdem sie mit viel Mühe das völlig mit Sand verwehte Fahrwerk freigeschaufelt hatten, sprachen sie beim inzwischen eingetroffenen, durch die hastig aufgesetzte Mütze erkennbaren Zöllner vor. Ein kurzes Gespräch war alles, was dieser gewillt war, sich einzulassen. Statt die Pässe oder die Ladung in der Maschine zu kontrollieren, war er lediglich an den letzten Neuigkeiten in Europa interessiert. Immerhin bequemte er sich, das Logbuch abzustempeln.
Gemäß dem Turmbeamten Pierre hatte sich der Wind inzwischen auf 42 Knoten gesteigert. Porter entschloss sich, trotzdem einen Start zu versuchen. Mit dem roten Feuerwehrwagen vor ihnen den Weg weisend, rollten sie langsam auf die kaum erkennbare Piste zu. Dort stellte Fred die Maschine in Startrichtung auf und setzte den Kreisel. Da bei dem treibenden Sand die Rollbahn sich in Nichts auflöste, wollte er keinesfalls die Pistenrichtung verfehlen und mit einem der seitlichen Begrenzungspfähle kollidieren. Dann schob er den Gashebel bis zum Anschlag vor. Der Motor brüllte auf. Nach ein paar Metern hob die Maschine auch schon vom Boden ab und stieg beinahe vertikal weg. Sie kamen sich vor, wie in einem Helikopter. Das Staunen wandelte sich jedoch plötzlich in Schrecken, als die Maschine von heftigen Böen erfasst wurde und sie in einem Wechselspiel von positiver und negativer Beschleunigung heftig herumgeworfen wurden. Karten und Ausrüstung flogen durch die Kabine und Porter hatte alle Mühe, die Maschine einigermaßen in der Luft zu halten. Auf knapp hundert Meter Höhe waren sie aus dem Schlamassel heraus und bogen bei herrlich klarem Himmel in Richtung St. Louis ab.
Große Buchten und riesige, dreckig braune mit weißen Streifen durchsetzte Salzseen von teilweise mehr als 60 Km Länge lösten einander während längerer Zeit ab. Nouakchott, ein ehemaliger Umschlagplatz für den Sklavenhandel, überflogen sie in großer Höhe, um den abnehmenden Nordwind noch lange ausnützen zu können. Und dann kamen die ersten Zeichen sich anbahnender Vegetation in Sicht. Sträucher und Büsche säumten ausgetrocknete Wasserläufe, und je mehr sie nach Süden vorankamen, um so zahlreicher wurden die anfänglich einzelnen Hütten und Krals.
Kurz vor Einbruch der Dämmerung erreichten sie schließlich Saint-Louis, die alte Hauptstadt Senegals am gleichnamigen Fluss, umgeben von Sumpf und Wasser. Da der Radiokompass bereits seit zwei Stunden ausgefallen war, bereitete ihnen das Auffinden des von der Stadt abgelegenen Flugplatzes in der Dämmerung einige Schwierigkeiten. Die Stadt selbst erinnerte Porter an Colmar im Elsass: Kanäle, Brücken und enge Gassen. Ein kleines Venedig in Afrika, das von einstigem Reichtum der dort angesiedelten Franzosen zeugte. In einem altehrwürdigen Hotel, dessen Treppenaufgänge, Balustraden und Fenster kunstvoll mit Eisengittern verziert waren, gab es dann ein reichhaltiges Essen und komfortable Betten.
Anderntags hatten sie alle Hände voll zu tun, um die Cessna nach dem Saharatrip wieder sauber zu kriegen. Überall klebte der rote Flugsand und bildete mit dem Öl Dunst vom Sternmotor eine furchtbar klebrige Angelegenheit. Aber am frühen Nachmittag war auch die 25-Stundenkontrolle beendet. Nach der Betankung starteten sie nun in Richtung Dakar. Nach einer Stunde schon holte Porter die Landegenehmigung für die dortige, große Landepiste ein. Angenehm überrascht vom Flughafen und seinen neuen Einrichtungen, kam dann aber schnell die Ernüchterung, als sie die Zoll- und Polizeikontrolle über sich ergehen lassen mussten. Nachdem sie auch noch feststellen mussten, dass in keinem der Hotels in der Stadt ein Zimmer frei war, verhalf ihnen ein sehr freundlich gesinnter Flughafenangestellter zu einem für die Flugbesatzung der Air France reservierten Doppelzimmer im Hotel N‘Gor.
An ein Frühstück am anderen Morgen war nicht mehr zu denken. Sie hatten sich tüchtig verschlafen. Trotz aller Probleme war es dann so weit, dass sie um 11:00 Uhr zum Start rollen konnten. Kurz, nachdem sie Dakar hinter sich gelassen hatten, zeigte sich die Natur unter ihnen immer üppiger. Palmenwälder und dichtes Buschwerk, durchsetzt von kleinen Wasserläufen, zierten die Landschaft. Hübsch an Wasserläufen gelegene Dörfer der Eingeborenen wechselten mit einzelnen Strohhütten, die auf Pfählen gebaut und vor Hochwasser geschützt, auf Lichtungen angesiedelt waren.
Ihr nächster Checkpoint war die Stadt Zinguichor. Der dazugehörige, kleine Flugplatz machte von oben einen denkbar schlechten Eindruck. Im Tiefflug konnten sie erkennen, dass überall auf der Piste der Bitumen aufgebrochen war. In einer großen Schleife flogen sie nun auf die Grenze zu Portugiesisch-Guinea zu. Das Klima wurde zusehends feuchter. Schweißtropfen begannen, sich auf der Stirn zu bilden. Porter wurde völlig überrascht, als plötzlich, wie aus heiterem Himmel der erste Regenschauer auf sie niederprasselte. Es waren nur kurze tropische Schauer, und zwischendurch brannte die Sonne wie durch eine Lupe. Ein fast geschlossener, grüner Teppich begleitete sie nun, bis in den Bereich von Guinea-Bissalanca, dem Flugplatz der neuen Hauptstadt von Portugiesisch-Guinea kamen.
In einer weiten Rechtskurve bog Porter kurz darauf auf die Hartbelagpiste ein, wo er die Cessna nach der Landung auf dem großen Abstellplatz abstellte. Sie wurden äußerst freundlich von Offizieren der Kolonialarmee begrüßt und unter großem Hallo in die Empfangshalle geleitet. Da der Papierkrieg auf Flugplätzen, und sei es auch in Afrika, anscheinend unbedingt das Gewicht des Flugzeuges haben muss, verweilten sie entsprechend lange unter den großen Deckenventilatoren, bis alles seine Richtigkeit hatte.
Zwei Offiziere anerboten sich, sie dann im Privatauto nach der etwa zehn Kilometern entfernten Hauptstadt zu fahren, wo sie im „Grand Hotel“ wegen Mangel an Gästen problemlos ein Logis zugewiesen bekamen. Die Stadt mit den alten Befestigungen war eine Besichtigung am Abend wert. Nach einem ausgiebigen Dinner und einer Flasche Wein suchten sie dann den verdienten Schlaf.
Donner und starker Regen weckte sie frühzeitig. Ein üppiges Frühstück half nicht über die deprimierte Stimmung hinweg. Und so ließen sie sich mit gemischten Gefühlen von einem ausgelatschten Taxi zum Flugplatz fahren. Aber ein Tiefschlag kommt selten allein, denn, als sie dort die ziemlich leeren Tanks der Cessna auffüllen wollten, lautete die stoische Antwort: „Kein Benzin für Privatflieger!“ Was nun? Trotz Bitten und Betteln wurde keine Ausnahme gewährt. Der restliche Sprit in den Flügeltanks aber reichte bei Weitem nicht bis zum nächsten Etappenziel. Schließlich aber fand Porter die Lösung beim lokalen Aeroklub, der ihnen den begehrten Saft zwar zu einem Höchstpreis verkaufte, aber immerhin, sie bekamen die Tanks voll. Danach ging Porter zum militärischen Wetterdienst. Die Vorhersage bis Freetown lautete 1000 Fuß Untergrenze, Sicht etwas unter 5 Km und zeitweise Regen.