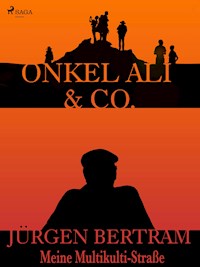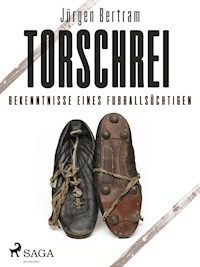7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Am 7. April 1945 marschieren vier schwer bewaffnete Hitlerjungen, die gegen die herannahenden Amerikaner kämpfen sollen, in Brettheim ein. Einige couragierte Bürger entwaffnen die Kindersoldaten, damit ihr Dorf nicht im sinnlosen Kampf zerstört wird. Doch ihr entschlossenes Eingreifen hat verhängnisvolle Folgen: Die SS verurteilt drei Dorfbewohner zum Tode. Wenige Tage später verhindern die deutschen Befehlshaber die kampflose Übergabe des Dorfes an die Amerikaner. Statt den ersehnten Frieden zu bekommen, verwandelt sich Brettheim durch die Bombardierung amerikanischer Truppen in ein Inferno. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 183
Ähnliche
Jürgen Bertram
Das Drama von Brettheim
Eine Dorfgeschichte am Ende des Zweiten Weltkriegs
FISCHER Digital
Inhalt
Die erste Heimsuchung
1 »Noch lebt in uns die teutonische Wut« Frühling in Hohenlohe
Ein Frühling, wie man ihn aus romantischen Liedern kennt, segnet das Land zwischen den Flüssen Tauber und Jagst. In der Scholle, aufgewühlt vom Pflug und strotzend vor Kraft, keimt die erste Saat. Ein Wärmeschub, der die Temperatur nach dem langen, viel zu langen Winter auf zwanzig Grad katapultierte, lässt an den Obstbäumen die Knospen platzen.
In den Gärten der Bauernhäuser setzen Nester aus Osterglocken, Krokussen und den letzten Schneeglöckchen heitere Tupfer. Hinter der Fachwerkfassade duftet es nach frischem Kuchen. Ein paar Tage noch – und die Pforten der Kirchen werden sich den Konfirmanden öffnen.
Ach, wie unbeschwert könnten die Bürger an diesen Frühlingstagen in die Zukunft blicken … Doch es herrscht Krieg. Und dieser Weltkrieg, dem bereits mehr als 50 Millionen Menschen zum Opfer fielen, hat nun auch die kleine Welt von Hohenlohe, dieses süddeutsche Idyll, erreicht.
Auf der Kaiserstraße, die so heißt, weil hier mal ein Kaisermanöver stattfand, rücken von Westen amerikanische Panzer vor. Immer häufiger übertönt das Rasseln ihrer Ketten den Singsang der aus ihren Winterquartieren heimgekehrten Vögel. Machte man den Schrecken bislang an so fernen Schauplätzen wie Stalingrad fest, so berührt die Kampflinie im April 1945 auch Orte wie Crailsheim, Bad Mergentheim oder das mittelalterliche Rothenburg ob der Tauber – eine Region, die schon unter den Römern der Schutzwall des Limes durchzog.
Wie hoffnungslos die Lage ist, offenbaren seit Monaten die Durchhalte-Parolen der nationalsozialistischen Machthaber. Als wichtiges Forum dient ihnen auch in diesem entlegenen Winkel zwischen Bayern und Württemberg neben dem Radio die Heimatzeitung, das Blatt »Der Franke« zum Beispiel, das in dem Städtchen Gerabronn erscheint und das sich, da zu viele deutsche Soldaten bereits gefallen, gefangen oder des Krieges einfach müde sind, an die Zivilbevölkerung wendet.
Ein NS-Propagandist namens Georg Beßler wählt die Form des Gedichtes, um seine Mitbürger auf das letzte Gefecht einzuschwören. Es ist eine apokalyptische Begeisterung, die aus seinen Worten spricht:
Der Volkssturm ruft! Der Notruf gellt:
Der Feind steht vor den Toren!
Frisch auf, Kameraden, die Waffen gefällt,
Wir geben das Reich nicht verloren.
Noch lebt in uns die teutonische Wut,
Was schert uns der Feinde Masse?
Wir stillen den Haß in unserem Blut
Und bahnen der Freiheit die Gasse.
Der Volkssturm ruft! Lärm an! …
Auf Greise, Männer, Knaben!
Wir stehen zusammen Mann für Mann
Und lassen uns lieber begraben.
Und krallen uns in der Erde ein,
Eh’ wir einen Schritt weichen,
Zur Festung wird jedes Haus, jeder Stein!
Wir stehen wie Deutschlands Eichen![1]
Knallharte, fast täglich publizierte Anweisungen zum Gebrauch der unterschiedlichsten Waffen bestätigen, welche bittere Realität sich hinter der schwülstigen Lyrik verbirgt. Sie richten sich vor allem an jene Halbwüchsigen, die der Dichter beschönigend »Knaben« nennt und die im offiziellen Sprachgebrauch »Hitlerjungen« heißen. Diesen 14, 15, 16 Jahre alten Söhnen der Bauern, Handwerker oder Knechte weist das in die Enge getriebene Regime eine zentrale Rolle zu.
Die Wunderwaffe, mit der sie den hochgerüsteten Feind bezwingen sollen, ist die Panzerfaust. »Du musst unbedingt darauf achten«, warnt eine dieser Gebrauchsanweisungen, »dass sich beim Schießen … in zehn Meter Entfernung hinter dir kein Kamerad befindet. Der nach hinten gehende Feuerstrahl der Treibladung kann bis auf drei Meter tödlich wirken.« Ein anderer Lehrsatz degradiert diese blutjungen Menschen vollends zu Kanonenfutter: »Du sollst den Feldpanzer nicht fürchten, sondern alles aufbieten, ihn umzulegen.«
Auch eine zweispaltig ins Heimatblatt gerückte Verlautbarung des Reichsjugendführers Artur Axmann dekretiert selbstmörderische Opferbereitschaft:
Leidenschaftlich bekennt die Jugend: Wir kapitulieren nie. Dieser Vernichtungskrieg läßt keine bürgerlichen Maßstäbe mehr zu. Es gibt kein Zurück mehr, sondern nur ein Vorwärts. Es gibt nur ein Handeln bis zur letzten Konsequenz. Es gibt nur Sieg oder Untergang. Seid grenzenlos in der Liebe zu eurem Volk und ebenso grenzenlos im Hass gegen den Feind. Eure Pflicht ist es zu wachen, wenn andere müde werden, zu stehen, wenn andere weichen. Eure größte Ehre sei aber eure unerschütterliche Treue zu Adolf Hitler![2]
Schon am 2. April 1945 hat Reichsleiter Martin Bormann, Chef der Parteizentrale, eine an Primitivität kaum zu überbietende »Anordnung« erlassen:
Ein Hundsfott, wer seinen vom Feind angegriffenen Gau ohne ausdrücklichen Befehl des Führers verläßt, wer nicht bis zum letzten Atemzug kämpft; er wird als Fahnenflüchtiger geächtet und behandelt.
Es lebe Deutschland! Es lebe Adolf Hitler![3]
Der Chef des Wehrmachtsführungsstabes, Generaloberst Ernst Jodl, beschwört bei seinen Durchhalte-Appellen sogar eine historische Zwangsläufigkeit. Vor Gauleitern erklärt er, »daß wir siegen, weil wir siegen müssen, denn sonst hätte die Weltgeschichte ihren Sinn verloren«. Er glaubt, »daß wir selbst die Trümmer unserer Häuser bis zur letzten Patrone verteidigen würden, weil es in ihnen tausendmal besser zu leben ist als in Knechtschaft«.
Für diejenigen, die ihre Tapferkeit noch in den Ruinen unter Beweis stellen sollen, setzt das Regime eine untere Altersgrenze fest: 14 Jahre.
Ausgiebige Reportagen aus anderen umkämpften Gebieten sollen den Hohenloher Kinder-Soldaten suggerieren, dass es sich lohnt, für das Vaterland sein Leben zu riskieren. Im »Endkampf« präsentiert die Propaganda sogar ein Wesen als Vorbild, in dessen Hand nach einem Nazi-Klischee die Puppe gehört und nicht die Waffe. Unter der Überschrift »Das Mädel mit der Panzerfaust« berichtet ein Kriegskorrespondent:
Im Kampfe um eine mittelpommersche Stadt waren in einem Gebäudekomplex zwei deutsche Soldaten, Feldwebel Rode und Gefreiter Meier zurückgeblieben. Zu ihnen gesellte sich ein junges Pommermädel, das irgendwoher aus der brennenden Stadt kam. Plötzlich fuhren drei Sowjetpanzer auf, die … das Gebäude unter Feuer nehmen wollten. Die Männer waren sofort entschlossen, dieses Vorhaben mit der Panzerfaust zunichte zu machen. In Schutz und Deckung einer Mauer pirschten sie sich auf etwa 35 Meter heran: ein großer Teil der Strecke mußte robbend zurückgelegt werden. Der alterfahrene Panzerkämpfer Feldwebel Rode nahm den ersten Panzer aufs Korn und erledigte ihn, der zweite wurde durch den Gefreiten Meier vernichtet.
Den dritten aber zerstörte das tapfere Mädchen. Es war den Männern mutig gefolgt, hatte sich mit einer Panzerfaust bewaffnet und wandte die Waffe so sicher an, daß ihrem Schuß der dritte Panzer zum Opfer fiel. Hatte sie hierbei schon einen außergewöhnlichen Mut bewiesen, so zeigte sie darauf bei der Bergung des Feldwebels Rode – der durch mehrere Schüsse schwer verwundet war –, daß ihre tapfere Tat nicht nur ein plötzlicher Einfall war, sondern einem wahrhaft tapferen Wesen entsprach. Trotz dauernden Beschusses brachte sie gemeinsam mit dem Gefreiten Meier den Feldwebel zurück.
Dieses junge Pommermädel, das namenlos auftauchte, mit ruhiger Selbstverständlichkeit ihr junges Leben einsetzte, und namenlos ging, bürgt dafür, daß Deutschland am Leben bleibt. Ein junges Pommermädel, ein großes, starkes Herz, besiegte Stahl und Eisen.[4]
In einer schwarz umrandeten Anzeige ist von einem anderen Mädel die Rede: von »Lore« aus Wallhausen-Kornwestheim, Württemberg, die »Gott unser Vater nach seinem Willen durch einen feindlichen Fliegerangriff … im Alter von 16 Jahren zu sich genommen hat«. Und eine Familie aus Dünsbach bedankt sich »für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme anläßlich des Heldentodes meines lieben, unvergeßlichen Mannes und lieben Sohnes und Bruders«, des »Obgefr. Karl Häberlein«.
Doch die Zeitung konfrontiert ihre Leser in der Endphase des Dritten Reiches nicht nur mit Pathos und Untergang. Immer wieder schiebt sich jene Normalität in die Spalten, die vor dem Hintergrund des Infernos auch etwas Absurdes hat, in der aber auch schon die zarte Hoffnung auf einen Neuanfang keimt.
Der Bäckermeister Karl Haußer aus Gerabronn bietet einem »kräftigen Jungen« eine Lehrstelle an. Das Tierzuchtamt Schwäbisch Hall ersucht »alle Gemeinden und Bullenhalter, die im Laufe des April einen gekörten Bullen benötigen, ihren Bedarf umgehend … zu melden«. Jeder »Versorgungsberechtigte«, der die »Einzelabschnitte 3–8 der Reichseierkarte« besitzt, darf sich »bis 8. April 1945 … insgesamt 6 Eier« abholen.
Dass es offenbar der Erwerbstrieb ist, der in der Katastrophe zuletzt stirbt, dokumentiert der Anzeigenteil. Das Chaos des Krieges wird sogar gezielt als Marktlücke genutzt. »Wenn Sie aber jetzt eine kriegswichtige Reise durchzuführen haben«, heißt es in einer Annonce, »dann nehmen Sie zur Vermeidung von Übelkeit in überfüllten Zügen eine Viertel Stunde vor Fahrtbeginn zwei Tabletten Peremesin«. Die Überschrift über dieser Werbung lautet: »Erst siegen – dann reisen«.
Ein anderer Text wendet sich an die »junge Mutter im Arbeitseinsatz«. Sie sei »besonders dankbar, wenn sie in ihrer knappen Zeit recht schnell und einfach ihrem Kleinen ein Fläschchen oder ein Zwiebackbreichen bereiten kann. HIPP’s Kinderzwiebackmehl und HIPP’s Kindernahrung mit Kalk und Malz … bieten ihr diese Vorteile … Selbstversorger erhalten von ihrem Ernährungsamt Berechtigungsscheine.«
Oder: »Dem Frontsoldaten machen Photos seiner Kinder stets besondere Freude. Auch der gute Mimosa-Panchroma-Film ist heute knapp; deshalb heißt die Parole: weniger, aber besser photographieren!« Oder: »Die deutsche Frau ist sich wohl bewußt, daß ihre Arbeitskraft von der Gesundheit abhängt. Mehr noch als in früheren Zeiten ist es notwendig, ›kritische‹ Tage tapfer zu überwinden – Es wird deshalb von allen Frauen dankbar empfunden, daß die neuzeitliche ›Camelia‹-Hygiene nach wie vor in ausreichender Menge hergestellt wird.«
Im Bekanntmachungsteil des Blattes wird im ersten Quartal 1945 mehrfach das Dorf Brettheim erwähnt. Mal ruft die NSDAP zu einer Versammlung mit dem Thema »Unser Wille wird den Sieg erringen«, mal lädt sie zur Vorführung des Jugendfilms »Kopf hoch, Johannes«. Niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass Brettheim in diesen wunderschönen Frühlingstagen zum Schauplatz eines Dramas wird, das die Historiker noch Jahrzehnte später beschäftigt und in dem die von der Heimatzeitung zu Kriegshelden stilisierten Hitlerjungen einen grausamen Part spielen.
2 »Die Rotzbuben wollen noch verteidigen!« Bauer Hanselmann und die Hitlerjungen
»Das Mädel soll’s gut haben.« – Es ist eine liebevolle Bemerkung, mit der sich der Brettheimer Bauer Friedrich Hanselmann am Morgen des 7. April 1945, dem Samstag nach Ostern, von seiner Frau Lina verabschiedet. Mit dem Mädel meint er die 14 Jahre alte Schülerin Maria, die man vor einem halben Jahr aus der von Bomben bedrohten Großstadt Stuttgart in die tiefe Provinz evakuierte und die, welch ein Glücksfall für sie, den Hanselmanns zugeteilt wurde, einer der angesehensten Familien in dieser Gemeinde von knapp tausend Einwohnern.
Morgen wird Maria konfirmiert. Und da sich der Landwirt, der sie wie seine eigene Tochter behandelt, ein solches Fest nicht ohne Braten vorstellen kann, schwingt er sich auf sein Fahrrad, um sich ins zwei Kilometer entfernte Hilgartshausen zu begeben. Dort wohnt ein Hausschlachter, der sein Handwerk selbst in diesen chaotischen Zeiten ausübt.
Auch für Friedrich Hanselmann ist die Konfirmation, mit der das Mädchen Abschied von der Kindheit nimmt, eine willkommene Abwechslung. Endlich steht im Dorf mal wieder eine höchst private Feier im Mittelpunkt und nicht die ewige Partei-Propaganda, an deren Verheißung von der großen Wende er ohnehin nicht mehr glaubt.
Viele der versprengten deutschen Soldaten, die, amerikanische Truppen im Nacken, sporadisch durch Brettheim irren und denen auch Bauer Hanselmann gelegentlich ein paar Eier oder einen Schinken zusteckt, tragen zerlumpte Filzschuhe statt Kampfstiefeln, ähneln Vagabunden mehr als Kombattanten. »Macht bloß keinen Quatsch hier«, hat ein desillusionierter Feldwebel die Brettheimer gewarnt, »der Ami schießt alles zusammen, wenn er Widerstand findet. Wenn ihr nichts tut, passiert auch nichts.« Ein Brettheimer Bürger fasst die Stimmung im Dorf später in dem Satz zusammen: »Wir warteten auf die Befreiung durch die Amerikaner.«
Die Schrecken des Krieges hat der Bauer Hanselmann selbst in schmerzhaften Etappen durchlitten. Das Giftgas-Inferno des Ersten Weltkrieges erlebte er als Frontsoldat. Und er war auch dabei, als Adolf Hitler 1939 den polnischen Nachbarn überfiel und damit jenen Weltenbrand entfachte, dessen letzte Glut nun vor den Toren des Hohenloher Dorfes aufglimmt.
Hanselmanns Sohn Otto fiel, kurz vor seinem 21. Geburtstag, im Februar 1943 »bei den schweren Kämpfen im Osten«, wie es die Hinterbliebenen in der Todesanzeige formulierten. »Bei Dolschenki«, so der Nachruf, »ruht er in fremder Erde.« Den jüngeren Sohn Fritz zog man, als er gerade 16 war, im Januar 1945 zur Flak ein. Vater Hanselmann hat ihn vor ein paar Wochen in seiner Stellung im fränkischen Fürth besucht. Mehr als 50 Kilometer ist er, das Gepäck voller Fressalien, mitten durch die feindlichen Linien geradelt.
»Abends«, erinnert sich der mittlerweile 75-jährige Fritz Hanselmann, »hat mein Vater dann unsere Geschützführer und Zugführer zu einem Essen eingeladen. Er hatte auch ein Stück Fleisch mitgebracht, und das haben die in einer Gaststätte herrichten lassen. Kurze Zeit bin ich dabeigesessen. Über das Kriegsgeschehen und das nahe Ende haben die sich auch unterhalten mit meinem Vater.«
Die Hoffnung, dass das Elend bald ein Ende haben möge, teilt Friedrich Hanselmann mit der Mehrheit der Bürger. Zwar sind sie keine Helden, die sich den Anordnungen der Partei offen verweigern, doch die schwejksche Variante des Widerstands beherrschen diese Menschen durchaus. Als der NS-Ortsgruppenleiter von Brettheim kürzlich die Errichtung einer Panzersperre befahl, gehorchten die Bauern zunächst, räumten sie nachts aber wieder klammheimlich beiseite. Ein anderer Trupp demontierte, um den Feind nicht unnötig zu reizen, das vier mal vier Meter große Hakenkreuz, das, als es noch opportun war, in leuchtendem Weiß von der Höhe des Hirschbergs grüßte.
Friedrich Hanselmann hat sich als Führer der Feuerwehr sogar mal mit dem Parteichef von Brettheim angelegt. Der hatte, ohne ihn zu fragen, eine durch den Ort ziehende deutsche Militärkolonne großzügig mit Wasser aus dem Tank der Motorspritze versorgt. Diebstahl sei das, schimpfte Hanselmann. Schließlich wisse man nie, welche Brände man in diesen Schicksalstagen noch löschen müsse.
Einen Menschen mit so viel Charakter und Ansehen informiert man, wenn im Dorf etwas Beunruhigendes geschieht. Und so konfrontieren ihn, als er sich an diesem Samstagmorgen gerade auf den Weg nach Hilgartshausen macht, zwei Mitbürger mit einer Nachricht, die ihn elektrisiert: Vier Hitlerjungen seien, bewaffnet mit Panzerfäusten, Handgranaten und einem Gewehr, in aller Herrgottsfrühe in Brettheim einmarschiert. Einer von ihnen hat einen Bauern, der die Gruppe nach ihrem Ziel fragte, angeblafft: »Wenn Sie nicht die Klappe halten, knallen wir Sie ab.«
Der Krieg, den er für ein Wochenende vergessen wollte, hat den Bauern Friedrich Hanselmann schon kurz hinter seiner Haustür wieder eingeholt. Er weiß, dass der Trupp, sollte er die anrückenden Amerikaner aufhalten wollen, den Ort in höchste Gefahr bringen würde. Also bietet er sich an, den Halbwüchsigen hinterherzufahren und sie zu stellen. In dem Moment, in dem er in die Pedale tritt, nimmt auch das Unheil seinen Lauf.
Hanselmann, dem die Informanten zu Fuß folgen, entdeckt die Hitlerjungen gegenüber der Molkerei. Sie haben sich am Wegesrand zur Rast niedergelassen und tragen Armbinden mit der alarmierenden Aufschrift: »Deutscher Volkssturm, Wehrmacht«. Ohne zu zögern, geht der erregte Bauer auf sie zu. »Buben!«, möchte er wissen, »was wollt ihr da?!«
Der Anführer des Trupps, höchstens 16 ist er, weist den fast 50 Jahre alten Familienvater zurecht: »Halten Sie den Mund und fahren Sie weiter!«
Hanselmann lässt nicht locker: »Was ihr da wollt, frag ich!«
»Gar nichts haben Sie uns zu fragen. Wir haben unsere Befehle.«
Die haben die Jungen tatsächlich. Aus einem nahe gelegenen Wehrertüchtigungslager sind sie mit der Order abkommandiert worden: »Panzeraufklärung betreiben, Panzerannäherungen melden und bekämpfen!« Der Bauer Hanselmann will das unter allen Umständen verhindern. Und die Mitbürger, die ihm mittlerweile zu Hilfe geeilt sind, sehen das auch so. »Die Rotzbuben wollen noch verteidigen!«, erregt sich einer von ihnen.
Am Ende einer heftigen Auseinandersetzung werden die zum Letzten entschlossenen Jugendlichen entwaffnet und die Kriegsgeräte, damit sie nie wieder Unheil anrichten können, im nahen Dorfteich versenkt. Der Molkereilehrling Hans Schwarzenberger, so alt wie die Pimpfe, ist dabei behilflich.
Kein Zweifel: Die Hauptverantwortung für die Aktion trägt der Bauer Hanselmann, der einen besonders frechen Hitlerjungen sogar ohrfeigt. Die Frage, die er ihm und seinen Kameraden entgegenschleudert, belegt, dass er auch sie vor Unheil bewahren will: »Ja, wollt ihr euch denn noch totschießen lassen, ihr Idioten?«
Hanselmann macht sich endlich auf den Weg nach Hilgartshausen. Die gedemütigten Hitlerjungen melden den Zwischenfall ihrem Vorgesetzten; der informiert die nächsthöhere Instanz – und bei den Dorfoberen bricht kurz darauf Panik aus. Die Order an sie lautet: Die Waffen sind sofort wieder herbeizuschaffen.
Bürgermeister Leonhard Gackstatter, seit 34 Jahren im Amt, und der NS-Ortsgruppenleiter Leonhard Wolfmeyer, gleichzeitig der Hauptlehrer in Brettheim, überlegen sogar, den völlig verschlammten Teich abzulassen, um die Panzerfäuste, Handgranaten und das Gewehr bergen zu können. Aber was würde das schon nützen? Die Waffen sind, bevor man sie versenkte, unbrauchbar gemacht worden. Der Gemeindediener Friedrich Uhl, der von den Panzerfäusten die Sprengkapseln entfernte, hat das seinem Bürgermeister am Morgen treuherzig berichtet.
Das Dorf, so viel steht fest, hat sein Schicksal nicht mehr selbst in der Hand.
3 »Dann sorge ich eben selbst für Ordnung!« Der Herrscher von Fränkisch Sibirien
Über den sanft ansteigenden Äckern und Wiesen von Hohenlohe, diesem lieblichen Land, thront, aus allen Himmelsrichtungen unübersehbar, ein gewaltiges Bauwerk: das Schloss Schillingsfürst. Der 545 Meter hohe Berg, auf den es das hier herrschende Fürstengeschlecht im 18. Jahrhundert hat setzen lassen, ist die höchste Erhebung der Gegend. »Fränkisch Sibirien« nennt der Volksmund diese Enklave ihres rauen Klimas wegen.
Kälte strahlt auch der Koloss aus, der Franz Kafka, dem Dichter der Vergeblichkeit, als Vorbild für seinen Roman »Das Schloss« hätte dienen können. In das im Grunde ja heitere Gelb seiner Mauern, denen kein Sims oder Balkon das Bedrohliche nimmt, mischt sich, an regnerischen Tagen vor allem, ein deprimierendes Grau. Gusseiserne Laternen und steinerne Adler arrangieren sich im Innenhof zu einem düsteren Spalier. An der Frontseite prangen, als bedürfe die Herrschaft der doppelten Absicherung, zwei mächtige Kronen.
Hinter der Pforte zu den labyrinthischen Fluren reckt sich, die Zähne gebleckt und die Augen weit aufgerissen, ein ausgestopfter Braunbär. Die Fürstin Marie zu Hohenlohe-Schillingsfürst hat ihn 1897 auf ihren russischen Besitzungen erlegt. Von ihrer Jagdleidenschaft zeugen auch Dutzende von Geweihen und die Schädel von Büffeln, Böcken, Keilern.
Auf Filigranes stößt man erst in den Salons und Sälen dieses im spanischen Barockstil errichteten Schlosses: auf flandrische Gobelinstickerei, Nymphenburger Porzellan oder ein Schachspiel aus Elfenbein. Der Intarsienboden im Empfangssalon ist mit seinen Tier- und Pflanzenmotiven ein Meisterstück fränkischen Handwerks.
Auch politisch und intellektuell hat dieses Adelsgeschlecht einiges zu bieten. Clodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst war von 1894 bis 1900 deutscher Reichskanzler und zuvor, unter dem Märchenkönig Ludwig II., bayerischer Ministerpräsident.
Die Fürstin Maria von Thurn und Taxis-Hohenlohe, die von 1855 bis 1934 lebte, machte das bei Triest gelegene Schloss Duino zu einem kulturellen Mittelpunkt des Habsburger Reiches. Einer ihrer ständigen Gäste war der berühmte Dichter Rainer Maria Rilke. Seine »Duineser Elegien« (»Denn nah am Tod sieht man den Tod nicht mehr«) gingen in die Literaturgeschichte ein.
Gustav Adolf Prinz zu Hohenlohe-Schillingsfürst, im 19. Jahrhundert als Kurienkardinal entschiedener Gegner des päpstlichen Unfehlbarkeits-Dogmas, gehörte zu den Mäzenen und Freunden des Komponisten Franz Liszt. An diese Verbindung erinnert im Hofgarten ein Denkmal, das sich vor der übermächtigen Kulisse des Schlosses allerdings etwas verloren ausnimmt.
In diesem gleichsam von Götterdämmerung und Feingeist geprägten Ambiente residieren seit dem Frühjahr 1945 die neuen Herren von Schillingsfürst: der SS-General Max Simon und sein Stab. Ihre Mission: die letzten Kräfte gegen den heranrückenden Feind zu mobilisieren und gnadenlos abzustrafen, wer sich den Anordnungen widersetzt. SS ist die Abkürzung von Schutzstaffel – ein verharmlosender Begriff für eine Gruppierung, auf deren Radikalität und bedingungslose Treue Adolf Hitler im Endkampf baut.
Max Simon, am 6. Januar 1899 in der schlesischen Hauptstadt Breslau geboren, stammt aus kleinen Verhältnissen. Sein Vater übte bei der Bahn den Beruf eines »Güterbodenarbeiters« aus, war Beamter auf der untersten sozialen Sprosse, ein Kleinbürger.
In seinen Noten im Abschlusszeugnis der städtischen Volksschule erreicht der Sohn gerade mal Durchschnitt: Rechnen und Raumlehre »gut«, Geschichte und Staatsbürgerkunde »genügend«, Turnen »genügend«, Religion »fast gut«, Deutsch »fast gut«. Alles in allem: ein Ausweis der Halbbildung.
Auch das Zertifikat, das ihm die jüdische Kleiderfabrikantin Sally Bodlaender nach seiner dreijährigen Kaufmannslehre ausstellt, enthält die Botschaft, dass es sich bei diesem Lehrling nicht um eine Leuchte handelte. Er habe sich, heißt es lapidar, »gut geführt«.
Karriere macht der mit zivilen Talenten nicht sonderlich gesegnete junge Mann erst beim Militär, wo Kriterien wie Disziplin, Ordnung und Gehorsam ein schlichtes Verhaltensmuster vorgeben. Simon wird 1917 zur Wehrmacht eingezogen. Nach dem Ersten Weltkrieg bleibt er in der Reichswehr, die er 1929 als Wachtmeister verlässt.
Nachdem er schon 1932 in die NSDAP eingetreten ist, meldet sich Max Simon 1933 zur Allgemeinen SS und wird ein Jahr später von der berüchtigten Waffen-SS übernommen. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges ist er bereits Regimentskommandeur.
Ende 1944 befördert man ihn zum Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS. Auf Schillingsfürst ist er, wie ihm nach dem Krieg eine amtliche Beurteilung bescheinigt, ein »harter, rücksichtsloser Kommandeur«.