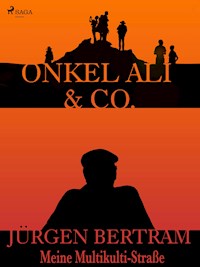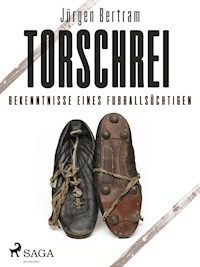7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Jüdisches Leben kehrt zurück nach Deutschland. Jüdische Maler und Musiker, Autoren und Regisseure beleben die Kunstszene der Republik. Es gibt in Deutschland wieder koschere Läden, jüdische Restaurants, jüdische Theater und Salons. Bei seinen monatelangen Reisen kreuz und quer durch Deutschland hat Jürgen Bertram gemeinsam mit seiner Frau, der Autorin Helga Bertram, mit alteingesessenen wie zugewanderten Juden gesprochen. Die Offenheit, auf die der Autor bei seiner Recherche stieß, ermöglicht dem Leser einen Blick in eine über Jahrzehnte eher im Verborgenen liegende Welt. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Ähnliche
Jürgen Bertram
Wer baut, der bleibt
Neues jüdisches Leben in Deutschland
FISCHER Digital
Mit Fotografien und Protokollen von Helga Bertram
Inhalt
Vorwort
Es war wohl die Sehnsucht, der geistigen Enge meiner Heimatstadt Goslar am Harz wenigstens für eine gute Stunde zu entfliehen, die mich im Konfirmandenalter regelmäßig zu den Film- und Vortragsabenden in der Aula des Ratsgymnasiums trieb. Projektoren zauberten Bilder von fernen Kontinenten und aus fremden Kulturen auf die Leinwand: exotische Tiere und Pflanzen, gewaltige Bergmassive, antike Stätten, schier endlose Strände. Einer der Referenten, ein Weltenbummler namens Heinz Helfgen, postierte, wie ich mich noch genau erinnere, das Fahrrad, mit dem er den halben Globus umrundet hatte, neben seinem Rednerpult.
Ich weiß nicht mehr, wie der Titel der Dokumentation hieß, die zu einem Riss in meinem Leben führte. Auf jeden Fall muss er so nichtssagend oder irreführend gewesen sein, dass der Inhalt mich, der ich im behaglichen Dunkel auf neue Abenteuer wartete, völlig unvorbereitet traf. In Gräben stapelten sich Leichen zu Bergen. Entsetzte Soldaten wühlten in Kleiderresten. Statt von Vulkanen oder Pyramiden war von Konzentrationslagern die Rede.
Dem Schreck folgte der Schock. Aus dem Schock wuchs – auch – eine bis heute nicht verbrauchte Neugier: Wie konnte es zu dieser Katastrophe kommen? Wie gehen Opfer und Täter damit um? Ließen mich meine Erzieher, die angesichts des Grauens entweder selbst verstummten oder aber, als Lehrer unbelehrbar, von ihren Feldzügen durch Europa schwadronierten, mit meinen Fragen noch allein, so nutzte ich später als Journalist jede Gelegenheit, aus den zahllosen Publikationen zu diesem Phänomen wenigstens einige wichtige ökonomische, politische und psychologische Gründe für das gigantische Verbrechen herauszufiltern.
Nur: Überlebende des Holocaust oder ihre Nachkommen, Juden also, mit denen man einen persönlichen Dialog hätte führen können, traf ich nie – und dies, obwohl ich in Hamburg in Nachbarschaft zur Synagoge wohnte. Seltsam leblos wirkte das Gotteshaus auf mich und trotz der räumlichen Nähe in mystische Ferne entrückt.
Doch als ich nach 13 Korrespondenten-Jahren in Asien 1995 zurückkehrte in mein heimatliches Quartier, hatte sich das Bild grundlegend verändert. Ganze Gruppen versammelten sich vor allem an den jüdischen Feiertagen vor dem Gebäude, und es drangen bei meinen Spaziergängen Fetzen von Sprachen an mein Ohr, die in Hamburg-Eimsbüttel ziemlich fremd klangen: Russisch, Polnisch, Jiddisch, Hebräisch. Wieder mündete ein überraschendes Erlebnis in Neugier. Aber dieses Mal war sie nicht ausschließlich auf die Vergangenheit gerichtet, sondern auch auf die Zukunft. Befinden sich diese Gemeinden, so fragte ich mich, nach einer Phase der Agonie im Aufwind? Bahnt sich gar eine Renaissance jüdischen Lebens in Deutschland an?
Das Vorhaben, dieses Buch zu schreiben, versetzte mich in die Lage, mich weit mehr als ein Jahr lang auf diese Thematik zu konzentrieren. Immer wieder reiste ich kreuz und quer durch die Bundesrepublik, besuchte jüdische Gemeinden, Schulen, Theater, koschere Läden und Restaurants. Ich abonnierte jüdische Zeitungen, arbeitete mich durch Stapel von Fachliteratur. Vor allem aber: Ich traf mich, endlich, mit Juden. Ich redete also nicht mehr nur über sie, sondern mit ihnen.
Es waren Gespräche, die zu den faszinierendsten Erfahrungen meiner mehr als vierzigjährigen journalistischen Laufbahn gehören. Ihre Substanz erleichterte mir die Antwort auf die entscheidende Frage, mit der sich jeder Autor, vor dem sich eine Überfülle an Stoff ausbreitet, vor dem Schreiben herumquälen muss: Wo setze ich die inhaltlichen und dramaturgischen Prioritäten?
Ich verabschiedete mich schnell von dem Ehrgeiz, eine Studie zu erarbeiten, die den ebenso anmaßenden wie unsinnigen Anspruch erhebt, allumfassend und mit wissenschaftlicher Verbindlichkeit über eine keineswegs abgeschlossene Entwicklung zu informieren. Auch verzichtete ich darauf, mich mit jeder Facette des Richtungsstreits zu beschäftigen, der die noch immer nach Orientierung suchende jüdische Gemeinschaft in Deutschland belastet. Eine solche Verzettelung würde, wie ich glaube, der Dimension des Themas nicht gerecht.
Stattdessen stelle ich jene Menschen in den Mittelpunkt, von denen als Folge politischer Weichenstellungen nun wieder mehr als 200000 in der Heimat des Holocaust leben. Ihre Schicksale, Probleme und Hoffnungen werden besonders sinnfällig in den individuellen Protokollen, die Helga Bertram, meine Frau, zu dem Text beisteuert. Aufklärung durch Annäherung ist das zentrale Anliegen dieses Buches, das, indem es Perspektiven aufzeigt, keineswegs die Vergangenheit entsorgt und die Gefahr eines neuen Antisemitismus übersieht.
Hamburg, Anfang 2008
Jürgen Bertram
PS Im Text erwähnte Fachbegriffe aus der jüdischen Lebenswelt werden am Ende des Buches in einem Glossar erläutert.
TEIL 1 ANNÄHERUNG
Kapitel 1 »Menschen mit zwei Armen, zwei Beinen, einem Kopf« Erste Erkundungen in Königs Wusterhausen
Königs Wusterhausen? Ach ja, das war einer der Namen auf der Skala des Blaupunkt-Radios, das in den fünfziger Jahren bei uns zu Hause auf dem Sims neben dem klobigen Sofa stand. Man streifte ihn, wenn man, in fiebriger Erwartung der Hitparade, nach dem britischen Soldatensender BBC suchte. And number one: Bill Haily – Rock around the clock.
Ein halbes Jahrhundert später irrt mein Zeigefinger auf der Autokarte durch die Mark Brandenburg, bis er irgendwo zwischen Berlin und Fürstenwalde endlich auf Königs Wusterhausen stößt. In Berlin kamen während des Zweiten Weltkriegs meine Großeltern, mütterlicherseits, bei einem Bombenangriff ums Leben. In Fürstenwalde wurde ich, als mein Vater am Frankreichfeldzug teilnahm, 1940 geboren. 1933, mit 25, war er in die NSDAP eingetreten.
Seine Kriegskameraden blieben auch nach dem Krieg die engsten Freunde meines Vaters. Einer von ihnen, der »schöne Erich«, hatte es sogar bis in die Waffen-SS gebracht. Wenn die Männer in unserem Wohnzimmer bei Bier, Korn und Mettbrötchen zusammensaßen, erzählten sie, wieder und wieder, von Lumpi, dem Regimentshund, den sie bei Perpignan aufgegriffen hatten, klagten sie, Mal um Mal, über die Zustände im amerikanischen Gefangenenlager von Remagen am Rhein und die Zumutung ihrer Entnazifizierung, sangen sie, nun schon betrunken, das Marschlied ihrer Landserjahre: »Oh, Du schö-hö-hö-ner We-he-hester-wald, über Deine Höhen pfeift der Wind so kalt; und schon der kleinste Sonnenschein dringt tief ins Herz hinein.«
Meine Mutter sprach selten über die Nazi-Zeit. Als sie es einmal tat, fiel auch der Begriff »Juden«. Das Arztehepaar, bei dem sie als Haushaltshilfe gearbeitet habe, sagte sie, sei »ganz plötzlich« verschwunden. Wohin? Achselzucken. Seitdem wurde das Wort »Juden« bei uns nie wieder erwähnt.
Königs Wusterhausen also. Bevor ich meinen Termin in der Jüdischen Gemeinde wahrnehme, schlendere ich, mich dem Zufall der Eindrücke überlassend, durch das Städtchen. Träge fließt, von Trauerweiden gesäumt und Schwänen bewohnt, die Dahme durch seine Mitte. Auf der Weihnachtspyramide im Schaufenster des Geschenkeshops blähen die lackierten Engel aus dem Erzgebirge zwei Monate vor dem Fest die Bäckchen zum Fanfarenstoß.
Der »Wernersgrüner Keller« lockt mit »Karaoke jeden Donnerstag ab 20.00 Uhr«. Für die Gäste heißt das: »Singen, bis die Luft knapp wird«. Bröckelnde Buchstaben weisen ein Gebäude am Schlosspark noch immer als »VEB Kreismühlenbetrieb« aus. Der Frisiersalon schräg gegenüber heißt »hair meets fashion«, das Sonnenstudio nebenan »beauty sun«, das Bürgerhaus im Zentrum »Hanns Eisler«.
Die wichtigsten Straßen sind nach Pionieren des Sozialismus benannt: Karl-Marx-Straße, Karl-Liebknecht-Straße oder Friedrich-Engels-Straße, die mich in ein gutbürgerliches Viertel führt. Die Häuser, nur wenige höher als zwei Stockwerke, halten gebührenden Abstand zueinander. An ihren Fassaden rankt sich herbstlich buntes Weinlaub empor. Vogelbeeren leuchten in der Mittagssonne. In den Blumenkästen blühen die robusten Begonien.
Vor dem Grundstück 10 a/b hat man zwei Platten in den Bürgersteig eingelassen, so genannte Stolpersteine. »Hier wohnte Saly Jacob, Jahrgang 1882, deportiert 1941, Riga«. Und: »Rosa Jacob, Jahrgang 1887, deportiert 1941, Riga«. Unter diese Angaben sind drei Fragezeichen graviert. Sie bedeuten: Man weiß nicht, was aus den Schwestern wurde.
Von dem Opfer, dem die Gedenktafel vor der nur wenige Meter entfernten katholischen Kirche gewidmet ist, weiß man’s. »28.2.1937. Grundsteinlegung durch Bernhard Lichtenberg, Dompropst an St. Hedwig in Berlin, gestorben am 05.11.1943 auf dem Transport ins KZ Dachau«.
Die Losung für den Monat Oktober, ausgehängt neben der Kirchenpforte, lautet:
Dankbar mich verneigen
Voll Staunen voll tiefer Liebe
Zur Schöpfung
Dankbar mich verneigen
Voll Erinnerungen an all das Gute
Das Du bewirkst
Hinter dem Bahnhof, von wo die Züge nach Berlin und Fürstenwalde fahren und vor dessen Kiosk einige glatzköpfige Jugendliche Halt an ihren Bierflaschen und Zigaretten suchen, gerate ich in ein Labyrinth aus Schrebergärten, Kleinbetrieben, Lagerhallen. Am Fliederweg entdecke ich wieder eine Tafel. So schlicht wirkt sie, dass sie verkünden könnte: »Betreten der Baustelle verboten!« Oder: »Besucher, bitte beim Pförtner melden!« Doch ich lese:
»1944–1945, Außenlager des Konzentrationslagers Sachsenhausen. Auf diesem Gelände zwischen ehemaliger Senziger Landstraße und Priestergraben befand sich das KZ-Außenlager Königs Wusterhausen. In diesem Lager mussten jüdische KZ-Häftlinge polnischer und ungarischer Nationalität Zwangsarbeit leisten.«
Einige Wochen zuvor habe ich die Holocaust-Gedenkstätte in Berlin besucht. Diese unscheinbare Tafel in der Vorstadtöde von Königs Wusterhausen, die von der Einbettung des Verbrechens in den Alltag berichtet, berührt mich mehr als die Stelen im Herzen Berlins, deren Monumentalität, so wirkt es zumindest auf mich, auch Distanz erzeugt zu den Todesfabriken, an die sie erinnern sollen. KZ Dachau, wohin die Nazis den Propst von Sankt Hedwig verfrachten wollten … KZ Sachsenhausen, das in Königs Wusterhausen jüdische Zwangsarbeiter ausbeutete … KZ Buchenwald, Bergen-Belsen, Theresienstadt, Neuengamme, Stutthof, Esterwegen, Flossenbürg, Mauthausen, Ravensbrück, Mittelbau Dora, Auschwitz … Nach Auschwitz, hat der Philosoph Theodor W. Adorno, ein Jude, gesagt, könne man keine Gedichte mehr schreiben.
Der Lyriker Paul Celan, ein Jude, schreibt nicht lange nach Auschwitz ein Gedicht. Er nennt es »Todesfuge«. Seine Botschaft: »Der Tod ist ein Meister aus Deutschland!« Seine Freundin Rose Ausländer, eine Jüdin, die Celan in einem osteuropäischen Ghetto kennenlernte, presst ihre Fassungslosigkeit in zwei Verse:
Mein
aus der Verzweiflung
geborenes Wort
Aus der verzweifelten Hoffnung
dass Dichten
noch möglich sei
Die Juden, die das Glück haben, der Vernichtungsmaschinerie zu entrinnen, stehen nach ihrer Befreiung ohne Heimat da. »Für uns Juden aus Deutschland«, resigniert der hochangesehene Rabbiner Leo Baeck 1945 wenige Monate nach seiner Befreiung aus dem KZ Theresienstadt, »ist eine Geschichtsepoche zu Ende gegangen. Eine solche geht zu Ende, wann immer eine Hoffnung, ein Glaube, eine Zuversicht endgültig zu Grabe getragen werden muss. Unser Glaube war es, dass deutscher Geist und jüdischer Geist auf deutschem Boden sich treffen und durch ihre Vermählung zum Segen werden können. Dies war eine Illusion – die Epoche der Juden in Deutschland ist ein für alle Mal vorbei.«
Der Literaturwissenschaftler Hans Mayer urteilt: »Die abendländische Aufklärung ist gescheitert.«
1946, ein Jahr nach der Befreiung der Konzentrationslager, befindet der jüdische Publizist Robert Weltsch: »Hier riecht es nach Leichen, nach Gaskammern und nach Folterzellen. Deutschland ist kein Boden für Juden.« In seiner Ausgabe vom 15. September 1947 bezeichnet das Jüdische Mitteilungsblatt Deutschland als »Friedhof des jüdischen Volkes«. Zwei Jahre später verkündet der Jüdische Weltkongress, dass »kein Jude mehr deutschen Boden betreten« werde. Als sich 1950 der »Zentralrat der Juden in Deutschland« gründet, gehört es zu seinen Zielen, den 15000 bis 20000 Juden, die trotz allem im Land der Mörder blieben, bei der Auswanderung behilflich zu sein.
Im brandenburgischen Königs Wusterhausen gibt es seit dem Frühjahr 2000 wieder eine jüdische Gemeinde, eine der kleinsten in der Bundesrepublik. 51 Mitglieder hat sie. Das sind elf mehr als vor der Nazi-Diktatur. Auf dem Weg ins Obergeschoss eines kommunalen Zentrums, wo sie unter einem Dach mit der Drogenberatung und der Selbsthilfegruppe »Angst und Depression« residiert, überkommt mich selbst Angst – Schwellenangst. Ihre Symptome sind ein Kreisen in der Magengrube, ein Kribbeln ums Herz, ein Chaos im Kopf.
Mein Gott, als die Juden deportiert und umgebracht wurden und dein Vater als Soldat seine schreckliche Pflicht tat, warst du ein Kleinkind … Musst du also Schuldgefühle haben? Nein. Fürchtest du, deine jüdischen Gesprächspartner könnten trotzdem Vorbehalte gegen dich, den älteren Deutschen, haben? Ja. Tragen die Zeugnisse des Verbrechens, mit denen du gerade in Königs Wusterhausen konfrontiert wurdest, zu deinen Skrupeln bei? Wahrscheinlich. Liegt deine Verunsicherung auch daran, dass du, obwohl du dich mit seinen Ursachen beschäftigst hast, die Dimension dieses Verbrechens bis heute nicht begreifst und wohl auch nie begreifen wirst? Ganz sicher.
Fürchtest du, dass du deine Unsicherheit durch Philosemitismus kompensierst und aus Gründen der political correctness alles von deinen Protagonisten fernhältst, was ihre Integrität beschädigen könnte, dass du sie also idealisierst? Auch das. Nur eine »normale« Annäherung, flüstere ich mir ein, führt zu brauchbaren Erkenntnissen. Aber wie stellt man nach dem, was mit den Juden geschehen ist, »Normalität« her? Erzwingen kann man sie nicht.
Leonid Gajdichoytsch, der Vorsitzende der Gemeinde, stellt sie her – atmosphärisch zumindest. Es gelingt ihm, indem er unser Gespräch über sein Leben als Jude in Deutschland genau dann mit Humor und pragmatischen Weisheiten würzt, wenn sich in meine Fragen ein wohlwollend beflissener Unterton mischt. Was, so möchte ich von ihm wissen, nach seiner Übersiedlung aus der Ukraine im Jahre 1999 seine ersten Erlebnisse und Empfindungen gewesen seien. Statt, wie von mir erwartet (und wohl auch erhofft), über Verluste, Ängste und Brüche zu reden, erzählt er die Geschichte von »Juta«, seinem russischen Cockerspaniel. Der habe, als man in Königs Wusterhausen in die neue Wohnung gezogen sei, ziemlich häufig und laut gebellt. »Naja, irgendwann wurde ich auf das Amt zitiert und mit ›Juta‹ zum Benimmkurs geschickt. Der Hund musste solange üben, bis er nicht mehr bei jeder Gelegenheit bellte.«
Ich denke: Schikane! Und: typisch deutsch! Leonid Gajdichoytsch findet das Ganze nur »komisch«. Nicht als Beschwerde trägt er den Fall vor, sondern als Anekdote. Sein nach innen gekehrtes, kaum wahrnehmbares Lächeln verwandelt sich beim Erzählen immer wieder in ein herzhaftes Lachen. »Mit dem Hund zum Benimmkurs – nein, so was.«
Leonid Gajdischoytsch gehört, wie alle Mitglieder seiner Gemeinde, zu den »Kontingent-Flüchtlingen«. So heißen auf Amtsdeutsch jene osteuropäischen Juden, die seit dem Zusammenbruch des Sowjetreiches dem Angebot folgen, sich in Deutschland anzusiedeln. Die Regelung geht auf eine Initiative der letzten DDR-Regierung unter dem Ministerpräsidenten Lothar de Maizière zurück.
So viele Familien machen von dieser Möglichkeit Gebrauch, dass sich die Zahl der Mitglieder in den jüdischen Gemeinden der Bundesrepublik innerhalb von 15 Jahren fast vervierfacht – von knapp 30000 auf 108000. Rechnet man die Angehörigen mit, die nach den strengen Vorschriften der Religion nicht als Juden gelten, weil sie keine jüdische Mutter haben, kommt man auf mehr als 200000 Zuwanderer.
In den Kommentaren zu dem Phänomen, dass ausgerechnet Deutschland zum wichtigsten Aufnahmeland für Juden in Europa avanciert, stößt man auch bei den kühlsten Köpfen immer wieder auf einen Begriff, der fassungsloses Staunen ausdrückt: »Wunder.« Fest steht, dass dieser Exodus ein Schlaglicht auf die offenbar völlig desolaten Zustände in den Nachfolge-Nationen der UdSSR wirft und dass er gleichzeitig zu den großen Herausforderungen in der Geschichte der Bundesrepublik gehört. »Denn die Frage«, so formuliert es der damalige Bundesaußenminister Joschka Fischer, »ob sich Juden in Deutschland sicher, vollständig akzeptiert und vielleicht sogar ›zu Hause‹ fühlen können, ist für den Erfolg unserer Demokratie, für die Glaubwürdigkeit unseres Landes von zentraler Bedeutung.«
Der Vorsitzende der Gemeinde Königs Wusterhausen stammt aus Kiew, der ukrainischen Hauptstadt. Bis er sich im Alter von 54 Jahren entschließt, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in den unbekannten Westen überzusiedeln, arbeitet er als diplomierter Elektroniker in einem Luftfahrtunternehmen – ein nicht sonderlich gut bezahlter, aber sicherer und angesehener Job. Warum gibt man das auf?
Ein tiefer Seufzer beendet ein längeres Schweigen. »Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wenn bei uns im Betrieb leitende Posten besetzt werden sollten, habe ich mich regelmäßig beworben. Schließlich hatte ich ein abgeschlossenes Studium und hervorragende Noten. Aber am Ende hieß es immer: ›Sie nicht, Herr Gajdichoytsch!‹.«
»Und warum kamen Sie nicht weiter?«
»Weil in meinem Pass unter ›Nationalität‹ stand: ›Jude‹.«
Arkadi Schwarz, der zweite Vorsitzende, mischt sich ein. Auch er lebt seit 1999 in Königs Wusterhausen. Er verließ auf Nimmerwiedersehen einen Ort in der Nähe der ukrainischen Hafenstadt Odessa, wo er als »ökonomischer Bauingenieur« arbeitete. »Nach der Hochschule habe ich mich bei einer Militärwerft beworben, weil man da gutes Geld verdienen konnte. Die Prüfungskommission hat gesagt: ›Wir nehmen Sie!‹ Sogar schriftlich hat man mir das gegeben. Als ich später ein Formular ausfüllen musste, konnte ich nicht mehr verbergen, dass ich Jude bin. Da hat mich die Personalleiterin zur Seite genommen. ›Ich würde Sie ja einstellen‹, meinte sie, ›aber spätestens bei der Überprüfung durch den Geheimdienst werden Sie scheitern. Suchen Sie sich was anderes!‹«
»Aber die Verhältnisse haben sich doch geändert in Osteuropa«, werfe ich ein. »Die meisten Staaten sind demokratischer geworden.«
»Demokratischer?« Im Tonfall der Frage schwingt Verwunderung über meine Naivität mit. »Was die Politiker sagen, ist eine Sache, aber was die Politiker machen …« Der unvollendete Satz mündet in eine wegwerfende Handbewegung, die mehr sagt als Worte. »Demokratie«, fügt Arkadi Schwarz nach einer längeren Denkpause hinzu, »habe ich erst in Deutschland kennengelernt.«
Es hält sich in diesem Deutschland hartnäckig ein Vorurteil, auf das ich selbst in aufgeklärten Kreisen immer wieder gestoßen bin und von dem auch ich nicht ganz frei war: Juden sind wohlhabend, und es wird ihnen in der Bundesrepublik, sozusagen als Vergangenheitsbonus, der rote Teppich ausgerollt. Auch in diesem Falle hat das Klischee nichts mit der Realität zu tun.
Das zweite Leben des Arkadi Schwarz beginnt in einem Übergangslager im Spreewald. Nicht sein ausdrücklicher Wunsch, sondern die Absurdität, die amtlichen Verteilerschlüsseln innewohnt, hat ihn und seine Familie dort landen lassen. Nach einer Woche, in der er sich »so fremd« vorkommt »wie im Weltall«, wird ihm eine »Sozialarbeit« zugewiesen: in öffentlichen Anlagen Äste schneiden, Rasen mähen. Es ist ein Ein-Euro-Job. Die Wohnung, die ihm später die Stadt Königs Wusterhausen anbietet, renoviert er in Nachtschichten. Das Mobiliar besorgt er sich aus zweiter Hand. Einem Sprachkurs folgt die Betreuung eines im Rollstuhl sitzenden Mädchens. Er fährt es zur Schule, bringt es wieder nach Hause.
Dann, endlich: Arbeit bei einem Bootsbauer. Nach einem Jahr steht er wieder auf der Straße. Das Unternehmen sieht sich gezwungen, drastisch Personal abzubauen. Arkadi Schwarz lässt sich zum Konstrukteur ausbilden, schreibt anschließend, wie er sagt, »mehr als hundert Bewerbungen«. Auf eine Zusage wartet er bis heute. »Zu alt«, meint der 54-Jährige lakonisch.
Der jüdische Auswanderer Arkadi Schwarz, der vom Ingenieur abstieg in die Arbeitslosigkeit, teilt, schlicht und einfach, das Schicksal vieler seiner alteingesessenen Mitbürger. Seinen sozialen Status markiert heute jene bürokratische Abkürzung, die er mit der resignativen Routine derer ausspricht, die auf bessere Zeiten nicht mehr hoffen: »ALG 2« – Arbeitslosengeld 2. Dass dies unter den Juden von Königs Wusterhausen keine Ausnahme ist, macht schon der Mitgliedsbeitrag an die Gemeinde deutlich: zwei Euro im Monat. »Assoziierte« Familienmitglieder zahlen einen Euro. Jeder Taubenzüchterverein nimmt mehr.
Aber: Von Arkadi Schwarz hört man kein Wort der Klage. Im Gegenteil: Selbst den sozialen Tiefpunkten seiner Existenz gewinnt er etwas Positives ab. »Beim Ästeschneiden im Park«, erinnert er sich, »habe ich mir gesagt: ›Arkadi, du bist hier mit so vielen Deutschen zusammen. Eine bessere Chance, deren Sprache zu lernen, bekommst du nicht. Na ja, und der Chef der Werft, bei der ich später gearbeitet habe, hat seinen deutschen Arbeitern gesagt: ›In den ersten Monaten sprecht ihr so langsam mit Arkadi, dass er euch auch versteht‹.«
Pragmatismus also statt Pessimismus. Aber genügt das, so frage ich mich, um auf Dauer mit einer Zäsur fertig zu werden, die doch auch erhebliche Verluste mit sich bringt? Es muss, sage ich mir, hinter dieser Zuversicht irgendein Geheimnis stecken, das sich mir noch nicht erschlossen hat. »Gab es Momente«, taste ich mich weiter vor, »in denen Sie Ihren Schritt bereut haben?« Natürlich erwarte ich kein eindeutiges Ja, das eine wohl überlegte und schicksalhafte Entscheidung als Lebenslüge entlarven könnte. Aber mit einer abwägenden Erklärung, vielleicht auch einem Herumdrucksen, rechne ich schon. Stattdessen lautet die Antwort kurz und bündig: »Nein. Nie.«
»Und warum nicht?«
»Weil unsere Kinder es hier auf jeden Fall besser haben als in der Ukraine. Dort werden jüdische Studenten an den Universitäten noch immer benachteiligt. In Deutschland ist das unvorstellbar. Nehmen Sie meine Tochter. Die war 16, als wir nach Brandenburg kamen. Natürlich fiel es ihr schwer, sich in Königs Wusterhausen einzuleben. Schließlich hatte sie sämtliche Freunde zurückgelassen. Heute studiert sie in Bremen Freizeitwissenschaften. Sie spricht deutsch, russisch, englisch, französisch, ukrainisch … Damit steht ihr doch die Welt offen!«
»Oder nehmen Sie meine beiden Söhne«, fügt der Vorsitzende Leonid Gajdichoytsch hinzu. »Der eine macht gerade in Berlin eine Ausbildung als Physiotherapeut und der andere hat sein Diplom als Arzt in der Tasche. Ich glaube nicht, dass die beiden das in der Ukraine so schnell geschafft hätten – selbst mit den besten Noten nicht.«
Der Antisemitismus, der Juden in ihrem Fortkommen behindert, ist in der Ukraine so stark ausgeprägt wie in kaum einem anderen osteuropäischen Land. Jeder dritte Bürger, so eine Untersuchung der Universität Kiew, würde den Juden am liebsten die Staatsbürgerschaft aberkennen. Besonders unter jungen Ukrainern sei die antisemitische Stimmung, die in dieser Region eine lange Tradition hat, weit verbreitet.
Auch aus Russland, dem Kerngebiet der ehemaligen Sowjetunion, kommen solche alarmierenden Meldungen. »Viele der bis zu einer Million Juden«, berichtet Anfang 2005 die Süddeutsche Zeitung, »haben es täglich mit Ausgrenzung, Misstrauen und manchmal auch mit Anfeindung zu tun. Dass es dabei nicht immer nur bei Worten bleibt, hat der Rabbiner Alexander Lakschin erst am vergangenen Freitag in Moskau erlebt. Eine Gruppe junger Männer verfolgte ihn auf dem Heimweg und traktierte ihn mit Fußtritten, ehe er fliehen konnte. ›Ich bat die Verkäuferinnen in einem Laden, die Polizei zu rufen. Sie lehnten das ab. Stattdessen sagten sie, dass mein Kopf blute und ich ihnen nicht das Geschäft verschmutzen solle.‹« Genau ein Jahr später zitiert der Evangelische Pressedienst (epd) den russischen Oberrabbiner Berl Laser nach einem Attentat auf einen Besucher einer Moskauer Synagoge mit den Worten: »Es ist zu spät davon zu reden, dass uns Faschismus droht, wir haben schon echten Faschismus.« So alltäglich, bestätigt der Bericht, seien »Überfälle auf Rabbiner und Hakenkreuzschmierereien an jüdischen Einrichtungen, dass sie den russischen Medien schon lange keine Schlagzeilen mehr wert sind«. Und von den 20 Duma-Abgeordneten, die ein Jahr zuvor öffentlich gefordert hätten, »alle jüdischen Organisationen zu verbieten«, sei nicht ein einziger strafrechtlich verfolgt oder wenigstens aus seiner Fraktion ausgeschlossen worden. Sogar im Buchladen des Parlaments liege antisemitische Literatur aus.
»Ist schon mal jemand aus der Gemeinde«, frage ich Leonid Gajdichoytsch, den Vorsitzenden aus Königs Wusterhausen, »zurückgekehrt in sein Heimatland?«
»Ja, ein junger Mann. Der dachte, hier liegt das Gold auf der Straße. Der hat sich nicht klar gemacht, dass es hier für uns täglich heißt: kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und der hat nicht kapiert, dass man hier trotzdem freier lebt.«
In die Freiheit, ungehindert ihrem Glauben nachgehen zu können, müssen sich die Juden von Königs Wusterhausen erst einüben. Schließlich gehörte in den gut 70 Jahren, in denen das Sowjetsystem seine Bürger der Diktatur des Proletariats unterwarf, der Atheismus zur Staatsdoktrin. »Was Judentum wirklich bedeutet, das begreifen wir erst hier in Deutschland«, sagt Leonid Gajdichoytsch. »Mehrere 1000 Jahre Tradition!«, schwärmt sein Stellvertreter. »Mir war überhaupt nicht klar, was das für ein Schatz ist.«
Das Bewusstsein für diese Werte zu fördern gehört zu den wichtigsten Zielen des Vorstands. So hilft man den Mitgliedern der Gemeinde nicht nur beim Ausfüllen kryptischer Wohngeldformulare oder bei der häufig frustrierenden Suche nach Arbeit, sondern man bietet ihnen auch eine ganze Palette religiöser Aktivitäten an.
Zweimal im Monat reist aus Berlin ein aus Israel stammender Religionslehrer an, der die Exilanten aus der Ukraine, Russland oder Moldawien in jüdischer Tradition unterweist. Seine Gebete spricht er auf Hebräisch. Eine israelische Studentin liest der Kindergruppe der Gemeinde einmal in der Woche jüdische Geschichten vor. Der mobile Rabbiner, der in regelmäßigen Abständen nach Königs Wusterhausen kommt, achtet zum Beispiel darauf, dass bei Feiern auch wirklich koschere Gerichte gereicht werden. Der Gebetsschal, den er beim Gottesdienst trägt, wird, in sakraler Abgeschlossenheit, in einer Vitrine in der kleinen Haussynagoge aufbewahrt.
Ich schwenke mit meinen Augen das Büro ab, in dem ich seit zwei Stunden meine ersten Lektionen über das neue jüdische Leben in Deutschland erhalte. Auf dem von Kinderhand gemalten Bild an der Tür neben mir prangt in blauen Buchstaben der jüdische Friedensgruß: SCHALOM. Unter dem »C« lacht eine Sonne. Über dem »L« leuchtet ein Herz. Der Davidstern füllt das Oval des »O« aus. An der Wand hängen die blauweiße israelische Flagge und das Foto einer Stadt, die eingebettet ist in eine sanfte Hügellandschaft und in deren Mitte eine goldene Kuppel glänzt: Jerusalem.
Das Telefon klingelt. Leonid Gajdichoytsch wechselt, nachdem er den Hörer aufgelegt hat, mit seinem Stellvertreter ein paar Sätze auf Russisch. Dann wendet er sich mit einem Lächeln, das Genugtuung verrät, an mich. »Es klappt mit dem Gymnasium in Wildau«, verkündet er. »Wir unterzeichnen den Kooperationsvertrag.«
»Was bedeutet das?«
»Mitglieder unserer Gemeinde gehen in die Klassen und diskutieren mit den Schülern über das Judentum. Wir haben auch schon ein erstes Thema: Wie fühlen sich die Juden in Deutschland?«
»Was werden Sie den Schülern sagen?«
»Dass uns niemand gezwungen hat, hierher zu kommen und dass wir deswegen bereit sind, uns in die Gesellschaft einzubringen. Und es wäre schön, wenn die Schüler am Ende sagen: ›Die Juden sind ja ganz normale Menschen – mit zwei Armen, zwei Beinen, einem Kopf‹.«
Die Zusammenarbeit mit dem privaten Gymnasium markiert einen Wendepunkt im Selbstverständnis der jüdischen Gemeinde. Agierte sie am Anfang noch im Verborgenen, so geht sie nun auf die Gesellschaft zu, wirkt auch in sie hinein. So werden zu den zahlreichen jüdischen Festen die örtlichen Vereine und politischen Repräsentanten eingeladen. Zusammen mit nichtjüdischen Bürgern arbeitet man an einem Projekt, das sich mit der Vorkriegsgeschichte der Juden in Königs Wusterhausen beschäftigt. Diese Aufklärungsarbeit soll auch dazu beitragen, den wachsenden Antisemitismus in den neuen Bundesländern einzudämmen.
Ein vom Zentralrat der Juden in Deutschland vermittelter Auftritt der weltbekannten Pianistin Anastasia Seifetdinova im Schloßsaal ist einer der Höhepunkte im kulturellen Leben des Städtchens. »Gestern Wien, heute Königs Wusterhausen«, begeistert sich Leonid Gajdichoytsch. Dieses Konzert, will er damit sagen, hat nicht nur seine Gemeinde aufgewertet, sondern den ganzen Ort.
Die Patriarchen der Gemeinde gehen auf die Bürger zu – und die Bürger auf die Gemeinde. Einmal in der Woche erteilt zum Beispiel die Pensionärin Christel Schöpel in einem der Räume im Dachgeschoss Deutschunterricht – ehrenamtlich. Die Idee hatten ihre Genossen vom Ortsverband der PDS. »Als die mich fragten, ob ich das machen wolle, habe ich keine Sekunde gezögert.«
Pädagogische Vorkenntnisse hat die Siebzigjährige nicht. Ihre Uni ist das Leben, das ihr nach der Wende die schwerste Prüfung auferlegte: den Verlust des Arbeitsplatzes als Ökonomin. Es ist ein Schicksal, das sie mit den meisten ihrer Schüler teilt. Fünf sind heute gekommen, vier Frauen und ein Mann, fast alle älter als 50. Ihre Körpersprache – die Hände artig auf dem Schreibheft gefaltet, der Blick voller Wissbegier – lässt auf eine hohe Motivation schließen.
Für den Fall, dass sie mit ihrem berlinerisch einfärbten Idiom an Grenzen stößt, steht der Lehrerin eine ebenfalls 70 Jahre alte Assistentin zur Seite, die Russisch beherrscht, die Sprache der Zuwanderer. Ihr Lehrprogramm (»Die gebräuchlichsten Ausdrücke und ihre verschiedenen Ausdrucksformen«) hat Christel Schöpel handschriftlich in einer Kladde festgehalten. Bevor die resolute Frau loslegt, dreht sie sich zu mir um und stellt klar: »Ich bin Praktikerin. Ich orientiere mich am Alltag.« Irgendwie klingt das wie eine Warnung.
Und tatsächlich reagiere ich zunächst irritiert auf die Begriffe, die nun wie verbale Geschosse durch das mit sakralem Dekor bestückte Klassenzimmer schwirren. Auch der Gemeindevorsitzende Leonid Gajdichoytsch, ein Schöngeist, der sich gerade die deutsche Literatur erschließt, zuckt merklich zusammen, wenn es heißt, zu einer bestimmten Variante der Körpertätowierung sage man auch »Arschgeweih«, zu einer missliebigen Frau »Olle« oder »Mistbiene«, zu einem unsympathischen Mann »Flitzpiepe« oder »Kotzbrocken« und zu Polizisten »Bullen«.
Darauf bedacht, ihre Schüler aktiv am Unterricht zu beteiligen, fragt die Pensionärin in die Runde: »Und wie nennt man in Ihrer Heimat die Polizei?« Aus einem Tuscheln kristallisiert sich ein russisches Wort heraus, das die Assistentin ins Deutsche übersetzt und das über das Verhältnis zwischen Bürgern und Staat im Osten Europas eigentlich alles sagt: »Müll«.
Die Juden von Königs Wusterhausen lernen, dass jemand, der das Opfer einer unglücklichen Entscheidung wurde, »die Arschkarte gezogen« hat, dass es statt »schlafen« auch »an der Matratze horchen« heißen kann, »labern« statt »reden« oder »piffeln« statt »rauchen«. Als der älteste Schüler, ein grauhaariger Herr um die 70, melancholisch aus dem Fenster schaut, statt sich auf die vulgären Wortkaskaden zu konzentrieren, ruft ihn die Lehrerin in die Realität zurück: »Hast du das verstanden, Igor?« Dem »Du« haftet nichts Herablassendes an. Es klingt nach Solidarität.
Der leere Blick sagt: Igor hat nichts verstanden. Er versteht die ganze Welt nicht mehr. »Vor einigen Wochen«, flüstert mir Leonid Gajdichoytsch zu, »ist seine Frau gestorben; Krebs. Und auch ihm geht es gesundheitlich nicht gut. Für ihn es wichtig, dass er dabei ist.« Und dann bittet mich der Vorsitzende um mein Urteil: »Finden Sie den Unterricht gut?«
Eine jüngere Frau, die sich während der Lektion am eifrigsten Notizen gemacht hat, kommt mir zuvor. »Wenn ich deutsche Bücher lese«, sagt sie, »verstehe ich alles. Wenn ich mit Deutschen rede, verstehe ich nichts. Deswegen ist es richtig, dass wir auch solche Begriffe lernen.« Wieder klärt mich Leonid Gajdichoytsch auf: »Diese Frau kommt aus Odessa. Obwohl sie zwei Kinder zu versorgen hat, will sie unbedingt arbeiten. Die gäbe alles für einen Job.«
Als mir Christel Schöpel, die Pensionärin von der PDS, das praktische Programm erläutert, das den Sprachunterricht flankiert, schwinden auch bei mir die letzten Zweifel am Wert ihrer Mission. Zusammen mit ihrer Assistentin begleitet sie ihre Schüler in Supermärkte, Arztpraxen oder Amtsstuben und konfrontiert sie dort mit dem offenbar ziemlich rauen Alltag in dem 33000-Einwohner-Städtchen zwischen dem Spreewald und Berlin. »Die Sprache zu lernen«, diktiert mir Leonnid Gajdichoytsch in den Block, »ist das Wichtigste überhaupt. Fast alle Fälle von sozialer Isolation sind auf mangelnde Sprachkenntnisse zurückzuführen.«
Ein Besuch, der mit Schwellenängsten begann, endet mit einer Geste des Vertrauens: Der Vorsitzende reicht mir das Fotoalbum der Gemeinde. Es ist das Dokument einer doppelten Suche – nach der jüdischen Identität, die im Osten Europas fast verloren gegangen wäre, und nach einer neuen Heimat, in die man allmählich hineinwächst.
Die Frauengruppe beim Literaturabend … Kinder beim Anzünden der Schabbat-Kerzen … die Ausflüge zum jüdischen Museum in Berlin und zur Gartenschau … das Lesen der Thora … die Feier mit den nichtjüdischen Freunden aus Königs Wusterhausen … die Kranzniederlegung am Ehrenmal für die Opfer des Nazi-Terrors … die Busreise nach Sachsenhausen … Was haben Sie als Jude empfunden, als Sie in Sachsenhausen mit dem KZ konfrontiert wurden? Bevor ich die im Kopf bereits formulierte Frage aussprechen kann, tippt Leonid Gajdichoytsch auf das nächste Fotomotiv: Altmühltal.
München, 9. November 2006. Zweieinhalb Wochen nach meinen Recherchen in Königs Wusterhausen wird am 68. Jahrestag der »Reichskristallnacht« in der bayerischen Metropole die neue Synagoge eingeweiht. Das größte jüdische Gotteshaus Europas steht am St.-Jakobs-Platz, im Herzen der Stadt. Das Fernsehen berichtet live.
Bundespräsident Horst Köhler erklärt in seiner Festrede: »Jüdische Religion, jüdisches Leben, jüdische Kultur schlagen im Alltag unseres Landes immer tiefere Wurzeln.« Und: »An diesem 9. November habe ich einen ganz konkreten Wunsch. Den nämlich, dass die Synagoge ganz selbstverständlich zu München gehört – so, wie jede Synagoge in Deutschland ein Teil unserer gemeinsamen Zukunft ist.«
Charlotte Knobloch, die Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, ging als Sechsjährige an der Hand ihres Vaters durch München, als am 9. November 1938 jüdische Einrichtungen demoliert wurden. Den Holocaust überlebte sie, weil eine ehemalige Hausangestellte ihrer Familie sie als uneheliches Kind ausgab. Bei der Einweihung des neuen jüdischen Zentrums sagt sie: »Von heute an werde ich jeden Tag aufwachen und feststellen, dass mein Traum Wirklichkeit geworden ist.« Ihre Botschaft an die deutsche Gesellschaft lautet: »Wer baut, der bleibt.«
Kapitel 2 »Sind Sie … äh … Jude?« Ein Rabbiner für Oldenburg
Ein Sud aus Häme und Hass trieft aus den Versen, wenn der geistige Pöbel zu dichten beginnt. Ihre Blütezeit erlebt die Lyrik des Stammtisches vor und während der Nazi-Diktatur. Als bevorzugte Zielscheibe dienen ihr folgerichtig jene Bürger, aus deren Kreis sich in der Weimarer Republik der Kern der intellektuellen Avantgarde rekrutierte: die Juden.
Die in Reime gefassten, sogar auf Postkarten verbreiteten Tiraden gegen sie gehören zu den Vorboten der deutschen Katastrophe, und sie sparen, wie ein Blick in die Archive zeigt, keinen Lebensbereich und keine noch so abgelegene Gegend aus. Auf der Nordseeinsel Borkum zum Beispiel, dem tiefbraunen ostfriesischen Festland vorgelagert, grölt man schon Jahre vor der Machtübernahme durch Adolf Hitler ein antisemitisches »Heimatlied«:
… doch wer sich naht mit platten Füßen,
die Nase krumm, die Haare kraus,
der soll nicht unseren Strand genießen
der muß hinaus, hinaus, hinaus!
Bewahrt die alte deutsche Sitte,
Prägt es Euren Kindern ein:
Laßt’ keinen Jud in Eure Mitte.
Borkum soll frei von Juden sein!
Judenfrei! – Zunächst sind es die Hotels, die Pensionen, die Kneipen, die sich mit dem rassistischen Prädikat schmücken. Als die Nationalsozialisten mit der systematischen Ausrottung dieser Minderheit beginnen, meldet unweit der ostfriesischen Inseln eine ganze Stadt Vollzug: Oldenburg, eines der Verwaltungszentren der Region. Es ist die erste deutsche Kommune, die sich damit brüstet, sämtliche Juden aus ihren Mauern vertrieben zu haben.
Im fünften Jahrzehnt nach dem Beginn der Deportationen feiert das jüdische Leben in Oldenburg seine Wiedergeburt. 1992:16 Bürger, einige von ihnen Überlebende des Holocaust, unterzeichnen das Gründungsprotokoll für eine neue Gemeinde. 1993 erhält sie eine Thorarolle, die Schrift mit den fünf Büchern Moses. Im selben Jahr treffen die ersten Familien aus dem Osten Europas ein. 1995: die neue Synagoge in der Wilhelmstraße wird eingeweiht.
Auf 300 Mitglieder, was fast dem Stand vor der faschistischen Herrschaft entspricht, ist die Gemeinde gewachsen, als im Herbst 2006 der Rabbiner Daniel Alter in sein Amt eingeführt wird. Weltweit, eine mongolische Zeitung inbegriffen, berichten in dieser Phase die Medien über den 1959 in Nürnberg geborenen Geistlichen. Es ist sein ganz besonderer beruflicher Werdegang, der soviel Aufmerksamkeit erregt.
Nach einem Jurastudium, einem Besuch der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg und einer Tätigkeit als Religionslehrer an der Jüdischen Oberschule in Berlin schreibt sich Daniel Alter am Potsdamer Abraham Geiger Kolleg ein. Als er an dem Institut, das in der Tradition des liberalen, aufgeklärten Judentums steht, im September 2006 sein Examen ablegt, gehört er zu den ersten drei Rabbinern, die seit der Herrschaft der Nazis auf deutschem Boden ausgebildet wurden. Er ist der einzige Absolvent, der in Deutschland aufwuchs.
Von einem »Tag des Sieges« schwärmt der sächsische Landesrabbiner Salomon Almekias-Siegl während der Ordinationsfeier, für die man, um dem historischen Ereignis einen würdigen Rahmen zu geben, die neue Synagoge von Dresden auswählte. Der Publizist Josef Joffe, Mitherausgeber der Wochenzeitung DIE ZEIT und Mitglied im Kuratorium des Abraham Geiger Kollegs, spricht von einem »Triumph für das deutsche Judentum wie auch für diese Republik, das beste Deutschland, das es je gab. Diese Ordination symbolisiert eine Kontinuität, die kein Mensch 1945 für möglich gehalten hätte.«
Kundigen Beobachtern fällt bei der Zeremonie, wie es die Berliner Zeitung formuliert, »eine weitere kleine Sensation« auf. Der Zentralrat der Juden in Deutschland, der zum liberalen Judentum bislang eine eher distanzierte Haltung einnahm, gehört zu den Mitveranstaltern der Feier und schickt einen ranghohen Repräsentanten nach Dresden. Dies unterstreicht den Willen, Traditionalisten und Reformkräfte unter einem Dach zu vereinen und sich, statt um die Verteilung öffentlicher Mittel zu streiten, mit vereinten Kräften einem der zentralen Probleme des jüdischen Lebens in Deutschland zu stellen: der Integration der Zuwanderer aus dem Osten Europas. »Die neue Vitalität«, kommentiert Josef Joffe, »geht Hand in Hand mit innerjüdischer Versöhnung, was nicht so einfach war. Denn wie der alte Witz besagt: Zwei Juden, drei Meinungen, fünf Parteien.«
Ein Interview mit dem neuen Rabbiner von Oldenburg, das die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung am Tag seiner Amtseinführung veröffentlicht, macht deutlich, wie kompliziert der Weg in die Normalität auch für die in Deutschland geborenen Juden trotz aller positiven Signale noch immer ist. Einem Geplänkel um die Frage, ob es ihm als jüdischem Geistlichen gestattet sei, sich am arbeits- und vergnügungsfreien Schabbat im Fernsehen ein Spiel seines Lieblingsvereins Eintracht Frankfurt anzusehen, stehen bemerkenswerte Schilderungen aus dem bundesrepublikanischen Alltag gegenüber. Einige Beispiele:
»Als ich in Heidelberg studiert habe, habe ich oft Anhalter mitgenommen, wenn ich auf dem Heimweg nach Frankfurt war. Da kommt man ins Gespräch: ›Was studierst du so?‹ – ›Judaistik‹. Und dann erstmal Schweigen auf dem Beifahrersitz. Und dann: ›Sind Sie … äh, bist du …‹ – die Stimme senkt sich, dann, fast zitternd … ›Jude‹? Dann denkt man: Moment mal, ist das ein Schimpfwort?«
»Als ich mal an einer jüdischen Oberschule unterrichtet habe, habe ich häufig nichtjüdische Besuchergruppen betreut. Da kam dann regelmäßig die Frage: ›Haben Sie auch normale Schüler?‹«
»Wenn ich hochrechnen würde, wie oft ich das schon gehört habe, dass mir Deutsche erzählt haben, ihre Familie habe in der Nazizeit Juden versteckt, dann müssten hunderttausend Juden in Deutschland in Kellern und auf Dachböden überlebt haben. Da merkt man, dass jemand mit irgendetwas nicht zurechtkommt. Und da fährt der Karren so richtig in den Sand: Man merkt, das Gegenüber ist verkrampft, man fühlt sich schuldig, man verkrampft sich ebenfalls. Dann hat man den schönsten emotionalen Verkehrsstau.«[1]
Zum ersten Teil dieser Aussage fällt mir ein Witz ein, der unter den Juden in Deutschland kursiert: »Ein in Amerika lebender Jude besucht die Heimat seiner Vorfahren. Als er vor dem Bahnhof in Berlin von einer Zelle aus telefonieren will, fragt er einen Passanten, ob er mal kurz auf seinen Koffer aufpassen könne. Der Passant identifiziert den Bittsteller als Juden – und legt erst mal los: ›Mein Großvater war in der Nazi-Zeit Kapitän auf einem Schiff, das Tausende von Juden gerettet hat‹… Der Besucher aus Amerika entscheidet sich: diesem Mann vertraue ich meinen Koffer nicht an. Er fragt eine vorbeikommende ältere Frau. Auch sie erzählt erst mal eine Geschichte: ›Meine Mutter hat ihre jüdische Nachbarin in der Speisekammer versteckt …‹ Der Jude schickt auch sie weg. Schließlich wendet er sich an einen älteren Herrn. ›Mein Vater‹, erzählt der Mann, ›war überzeugter Nazi‹. Ihm vertraut der Jude den Koffer an.«
»Verkrampfungen und Verklemmungen haben viel zu tun mit dem ›Second Generation Syndrom‹, dem psychischen Syndrom der Holocaust-Überlebenden. Das kenne ich von mir selbst. Da merke ich, dass ich extrem dünnhäutig werden kann, etwa in der Mahnmal-Diskussion. Daran muss man arbeiten, man muss einfach wissen, dass man empfindlich ist. Von deutschem Boden ist nun mal die Schoa ausgegangen – und ein großer Teil meiner Familie ist in der Schoa ermordet worden.«
»… es kann schon hilfreich sein, eigene vererbte Ängste zu reflektieren, wenn man merkt, dass man verkrampft ist. Das ist nicht leicht, wenn man gerade Anfeindungen erlebt hat. Aber es gibt auch die alte rabbinische Regel, in jedem Menschen erst mal das Gute zu sehen.«[2]
Als ich mit den Reflexionen Daniel Alters konfrontiert werde, denke ich sofort an die eigene Verunsicherung, die ich, wie kürzlich in Königs Wusterhausen, bei meinen Recherchen immer mal wieder verspüre. In einer der zahlreichen Schriften des Frankfurter Architekten und Publizisten Salomon Korn entdecke ich eine Erkenntnis, die mir entscheidend bei der Analyse dieses Phänomens hilft: »… denn nach allem, was geschah, ist es durchaus normal, dass noch nicht alles normal ist. Daher wird die ›Normalität der Anormalität‹ oder die ›Anormalität der Normalität‹ zwischen Juden und Nichtjuden in Deutschland andauern – vielleicht zwei, vielleicht drei Generationen. Angesichts solcher Entwicklungszeiträume verlieren gelegentliche … oder vermeintliche Rückschläge im vielschichtigen deutsch-jüdischen Verhältnis manches von ihrer Dramatik und lassen sich in dieser Sicht gelassener beurteilen.«[3]
Auch die Schriftstellerin Esther Dischereit spricht, als sie in einem Interview nach ihrer Existenz in der Bundesrepublik gefragt wird, von einer »Abwesenheit der Normalität«.
Der Familienvater Daniel Alter war der Wunschkandidat der Oldenburger Gemeindevorsitzenden Sara-Ruth Schumann. Sie gehört zu der in die Nazizeit hineingeborenen Generation. Und so lassen sich auch an ihrer Person exemplarisch Entwicklungen, Probleme und Perspektiven des jüdischen Lebens in Deutschland aufzeigen. Als ich die ehemalige Leiterin des Oldenburger Kulturamtes und Galeristin interviewe, muss ich sie erst einmal davon überzeugen, dass wir, um der sensiblen Thematik gerecht zu werden, ihre Vergangenheit nicht ausklammern können. Es treibt sie die Sorge um, auf den Holocaust-Aspekt reduziert zu werden. Sie will, wie sie sagt, nicht als »Berufsjüdin« erscheinen, sondern »lieber nach vorn blicken«.
Der Blick zurück in ihre Kindheit führt in eine entscheidende Phase des deutschen Faschismus. 1938, in ihrem Geburtsjahr, nimmt der Judenhass die Dimension von Pogromen an, signalisiert Adolf Hitler mit dem Einmarsch in Österreich und der Eingliederung des Sudetenlandes, dass seine Machtgier auch geografisch keine Grenzen mehr kennt und die Welt sich auf einen neuen Krieg einstellen muss.
Sara-Ruths Mutter ist Christin. Das rettet ihren Vater, einen jüdischen Kunstschmied, vor dem Abtransport in ein Konzentrationslager. Als die Verfolgung auch vor Mischehen nicht mehr halt macht, sorgt der nichtjüdische Arbeitgeber des Vaters dafür, dass sich die Familie Abraham mit ihren drei Kindern und zwei Kindern von jüdischen Verwandten in ein niedersächsisches Dorf absetzen kann, wo man Unterschlupf auf einem Bauernhof findet. Obwohl die Herkunft der fremden Familie in der kleinen Gemeinde allgemein bekannt ist und man bei jedem Klopfen an der Tür »tausend Ängste aussteht«, wie sich Sara-Ruth Schumann erinnert, übt niemand Verrat. Von den acht Geschwistern ihres Vaters, denen die Rettung durch Flucht versagt bleibt, überleben nur drei den Holocaust.
Als im deutschen Fernsehen in den siebziger Jahren eine amerikanische Serie läuft, die das Leiden der Juden am Beispiel einer einzelnen Familie aufzeigt, wagt Sara-Ruth Schumann zum ersten Mal die visuelle Konfrontation mit der Vergangenheit. Sie schaltet ein – und schnell wieder aus. Ihre Nerven halten nicht durch. Erst im Jahre 2005, als in Oldenburg längst die Jüdische Gemeinde gegründet ist, sieht sie sich in der Lage, das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald zu besuchen. »Ich habe immer wieder versucht«, sagt sie, »rational mit meinen Ängsten umzugehen. Aber auch in Buchenwald waren meine Gefühle übermächtig. Ich hatte die ganze Zeit eine Gänsehaut. Es war fast so, als ob ich nicht atmen konnte.«