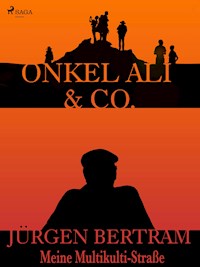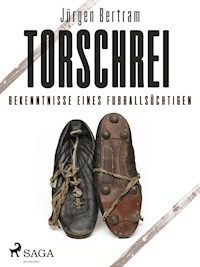9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Es gibt so gut wie kein Produkt, das in China nicht kopiert wird. Als typisch gilt das Beispiel eines Hannoverschen Mittelständlers, der sich in Peking auf ein joint venture zur Produktion von Spezialverschlüssen für Ölleitungen einließ. Am Ende einer Kette von Irritationen und Betrügereien stahlen ihm seine chinesischen Partner den Panzerschrank mit den Blaupausen seiner viel versprechenden Patente und setzten die genialen Ideen in ihrer eigenen Fabrik um. Ist das kriminell? Nach der konfuzianischen Lehre, dem kulturellen Fundament Chinas, ist es keineswegs verwerflich, sich des geistigen Eigentums von Fremden zu bemächtigen. Schließlich dient ein solcher Diebstahl der Gesellschaft – der chinesischen. Insgesamt gehen der innovativen deutschen Wirtschaft durch diese Piraterie jedes Jahr etwa 30 Milliarden Euro verloren. Lebensgefährlich wird es, wenn die Chinesen den Weltmarkt mit minderwertigen oder schadstoffhaltigen Kopien von Arzneimitteln, Kinderspielzeug oder Bremsbelegen überschwemmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Ähnliche
Jürgen Bertram
Die China-Falle
Abgezockt im Reich der Mitte
Sachbuch
Fischer e-books
Vorwort
»Wir haben Wettbewerber wie China, die sich an keine Regel halten.«
Angela Merkel [1]
Marktwirtschaft ist, wie man weiß, kein Halmaspiel. Wer sich ihren Mechanismen unterwirft, kann es mit einem einzigen Mausklick zu Reichtum bringen, durch eine unbedachte Aktion aber auch an den Rand des Ruins geraten. Auf jeden Fall setzt er sich einem Konkurrenzkampf aus, der sich im Zeichen der Globalisierung und der noch längst nicht überstandenen internationalen Finanzkrise ständig verschärft.
Vor dem Hintergrund wachsender Zwänge ganz auf Werte wie kaufmännische Fairness oder gar Ethik zu setzen, dürfte blauäugig sein. Bleibt also, eine Nummer kleiner, die Hoffnung, dass wenigstens die international verbindlichen Regeln eingehalten werden, die das Wirtschaftsleben vor dem Absturz in die Anarchie bewahren. Doch es gibt auf dem Weltmarkt einen potenten Kandidaten, der mit stoischem Egoismus selbst gegen dieses Minimum an Konsens verstößt: die Volksrepublik China.
Das klingt, zugegeben, arg pauschal. Aber es existieren für diese Behauptung so viele Belege, dass sich selbst die zu vorsichtigem Taktieren neigende deutsche Industrie mittlerweile lautstark über die neueste Variante der Piraterie beklagt. In die Milliarden gehen die Verluste, die ihr durch den Diebstahl von Blaupausen, Patenten und sogar kompletten Konzepten entstehen.
Mein Buch präsentiert eine Fülle eklatanter Beispiele, versteht sich aber nicht als verbale Begleitmusik eines unternehmerischen Klageliedes – schließlich wurde kein Investor zu seinem Engagement in Fernost gezwungen. Was mich über den besorgniserregenden Befund hinaus interessierte, waren die Fragen nach seinen Ursachen und seinen möglichen Folgen. Wo liegen die kulturellen Wurzeln für das uns unverständliche Geschäftsgebaren der Chinesen? Welcher Mentalität entspringt es? Wer profitiert in erster Linie von dem Ideenklau? Und: In welcher Weise verändert sich unsere eigene Gesellschaft, wenn wir uns, was so mancher Politiker allen Ernstes fordert, stärker an den »asiatischen Werten« orientieren?
Als äußerst hilfreich erwiesen sich für mich die Kontakte, die ich bereits in meiner Pekinger Korrespondentenzeit zwischen 1985 und 1992 zu deutschen Kollegen, Kaufleuten oder Studenten, aber auch zu einheimischen Intellektuellen knüpfte. Da sie auf gemeinsam durchstandenen politischen Turbulenzen basieren, haben sie, wie ich bei meinen Recherchen mit Genugtuung feststellte, bis heute Bestand.
Diese alten Freunde können bezeugen, dass mich nicht ein antichinesisches Sentiment zu meinem ungeschminkten Report trieb, sondern die Befürchtung, ein mafioses System könnte sowohl die Ausbeutung und Unterdrückung im Innern zementieren als auch die gesellschaftliche Stabilität in der westlichen Welt untergraben. Einen Kotau vor der glitzernden Fassade und die Ignoranz der Realität würden mir meine der Aufklärung verpflichteten Informanten jedenfalls nicht verzeihen – zumal ich als Journalist zwar dem Gebot einer sauberen Beweisführung und plausiblen Argumentation unterliege, aber gottlob nicht den Zwängen der Diplomatie.
Hamburg, im Herbst 2009
Jürgen Bertram
I.TRAUM UND TRAUMA
1.»Der hat alles ausgeplündert, was auszuplündern war«
Ein Ingenieur und seine falschen Freunde
Es gibt dieses ganz bestimmte Leuchten in den Augen. Bei den Zeugen Jehovas sieht man es, die bei Wind und Wetter vor dem Bahnhof oder dem Kaufhaus für ihre christliche Botschaft werben, bei dem Fußballfan, der trotz einer Niederlagenserie seines Clubs siegesgewiss zum Stadion strebt, oder bei dem Angler, an dessen Rute nach stundenlangem Warten endlich ein dicker Fisch zappelt.
Als ich während meiner acht Jahre als Fernsehkorrespondent in Peking immer mal wieder mit dem Flugzeug zwischen Deutschland und China pendele, entdecke ich es auch bei einer Spezies, die, ständig kalkulierend, eigentlich zu einem klaren Blick neigt: bei Unternehmern und ihren Repräsentanten. Ginge von ihrem Strahlen, so phantasiere ich, auch eine physikalische Kraft aus, dann könnte die Crew getrost darauf verzichten, das Deckenlicht einzuschalten.
Ein verbales Mantra befeuert die Hochstimmung. Es lautet: Markt, Markt, Markt. Wenn nur jeder tausendste Chinese unseren Kühlschrank kauft, schwärmt mein Nachbar, der Salesmanager, dann … Wenn das Joint Venture mit dem Stahlwerk in Shanghai klappt, begeistert sich der Ingenieur hinter uns, dann … Schwungvoll hebt man nach jedem Gedankenspiel die Gläser und prostet sich auf Chinesisch zu: Ganbei! Und bei einem ersten Crashkurs in dieser so fremden Sprache hat man auch schon gelernt, was der Trinkspruch auf Deutsch bedeutet: trockenes Glas. Anders ausgedrückt: Ex!
Wer in solche aufgekratzten Runden eine Prise Skepsis streut, gilt schnell als Bedenkenträger, dem jeglicher Sinn für die Vision abgeht und der mit seiner notorischen Nörgelei das Investitionsklima verdirbt. Mein eigener Berufsstand steht ohnehin unter diesem Generalverdacht – nach der Formel: Journalismus gleich Defätismus.
Gut eine Dekade nach meinem Abschied aus Asien finde ich mich abermals im Kreis von Managern wieder – diesmal bei Diskussionsveranstaltungen der deutschen Wirtschaft. Schon die Themenstellung signalisiert einen Sinneswandel. »China – Wirtschaftswunder oder Fälscherparadies?«, fragt, im Mai 2008, die Industrie- und Handelskammer Magdeburg. »Bröckelt die China-Euphorie?«, will die IHK Hannover von den Experten auf dem Podium wissen.
Zornesröte steigt bei dem Forum in der niedersächsischen Metropole einem mittelständischen Spezialisten für das Verschweißen von Pipelines ins Gesicht, als er von seinen Erfahrungen in dem riesigen Land berichtet, das sich als Reich der Mitte und der Sitte versteht. Wir tauschen Visitenkarten aus und halten Kontakt. Im Sommer 2008 sitze ich dem Fabrikanten in seinem Büro am Stadtrand von Hannover gegenüber. Stundenlang lausche ich einer Geschichte, die ein volkswirtschaftliches und betriebliches Dilemma offenbart, aber auch ein persönliches Drama. Dessen tragische Momente verbieten eine klammheimliche Freude darüber, dass man als Journalist damals wohl doch nicht so falsch lag mit seiner Skepsis.
Eginhard Vietz wird 1941, in einer der schwärzesten Phasen der deutschen Geschichte, in dem Dorf Pommerzig an der Oder geboren und wächst, wie er mit einer für einen Aufsteiger ungewöhnlichen Offenheit bekennt, »in ärmlichsten Verhältnissen« auf. Seit Generationen verdingt sich die Familie bei einem Gutsbesitzer, der die Tagelöhner, so der Unternehmer, »wie Sklaven behandelt«. Der Vater fällt an der Front. Die Mutter wird von Polen erschossen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges packt die Oma einen Handwagen voll mit Lebensmitteln und Kleidung, setzt den Enkel obendrauf und zuckelt mit ihm, der besseren Perspektive wegen, in die Umgebung von Berlin.
In Babelsberg, einem Stadtteil von Potsdam, absolviert Eginhard Vietz eine Lehre als Schweißer. Am 10.August 1961, drei Tage vor der Errichtung der Mauer, flieht er aus der DDR, die auf Plan und Kollektiv setzt, in den Westen, der auf Markt und Eigeninitiative baut. Er steigt zum Ausbilder bei der Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt Hannover auf, bringt es auf dem zweiten Bildungsweg zum Ingenieur, tüftelt bahnbrechende Verfahren aus und macht sich am Anfang der achtziger Jahre selbständig. Der Zwei-Mann-Betrieb wächst in kurzer Zeit zu einer Firma mit 200 Mitarbeitern heran. Die Devise ihres Besitzers prangt im Konferenzraum an der Wand: »Erst wenn meine Kunden zufrieden sind, bin ich zufrieden.«
Als der Techniker den Sprung in die Unabhängigkeit wagt, beginnen in der Volksrepublik China die Reformen zu greifen, die den brachialen, menschenfressenden Experimenten des Revolutionärs Mao Tse-tung ein Ende bereiten und die in jeder Hinsicht verrottete Nation fitmachen sollen für die Herausforderung der Globalisierung. Das Rezept: kapitalistischer statt marxistischer Materialismus, ökonomische Öffnung statt ideologische Isolation.
Der Lebenssaft, nach dem es die rapide wachsende Wirtschaft dürstet, ist Öl. Um es aus den abgelegenen Provinzen in die boomenden Regionen an der Küste transportieren zu können, benötigt man Pipelines von einigen tausend Kilometern Länge. Der hannoversche Fabrikant Eginhard Vietz weiß, wie man die Versatzstücke schnell und sicher miteinander verzahnt. Seine Technik gilt sogar als führend in der Welt. Und so sagt er sich: »China – das ist mein Durchbruch.«
Sein erstes Ziel im neuen Gelobten Land der deutschen Industrie ist Urumqi, die Hauptstadt der an Bodenschätzen reichen Provinz Xinjiang. In der Heimat des muslimischen Turkvolkes der Uiguren herrschen mit harter Hand die von ihrer kulturellen Überlegenheit überzeugten Han-Chinesen. Auch unter den etwa 3000 Zuhörern, vor denen Eginhard Vietz in der Halle des Volkes über seine hochmoderne Technologie referiert, dominieren sie.
In Urumqi, wo er sich zunächst auf seine Vortragstätigkeit beschränkt, erlebt der Unternehmer allerdings auch seinen ersten Schock auf chinesischem Boden. »Als ich mein Hotel bezog«, erinnert er sich, »traute ich meinen Augen nicht. Der Altbau war völlig heruntergekommen, und die Zimmer hatten nicht einmal Türen. Dann lüftete ich die Bettdecke – und mir krabbelten Käfer entgegen. Ich brauche keinen Luxus, aber dieses Loch verletzte meinen Stolz. Ich dachte: Bloß wieder weg hier!«
Das ist leichter gesagt als getan. Denn die klapprige Iljuschin, die Peking mit Urumqi verbindet, verkehrt damals nur einmal in der Woche – wenn sie denn fliegt.
Mit einem Abstand von 25 Jahren schließt der Pipeline-Experte nicht mehr aus, dass seine Gastgeber ihn mit Kalkül in diese Bruchbude steckten. »Die wollten mir wohl zeigen, dass sie die Bedingungen bestimmen, und dass ich als Ausländer froh sein konnte, überhaupt von ihnen empfangen zu werden. Aber vielleicht war es auch nur Gleichgültigkeit.«
Auf jeden Fall tut Eginhard Vietz nach der ersten Horrornacht das, was er unter gleichen Umständen auch in München, Mailand, Rio oder Melbourne getan hätte: Er beschwert sich. Doch was in der übrigen Welt als selbstverständlich gilt, begreifen die Chinesen als Affront. »Eine Viertelstunde hat mein Dolmetscher gebraucht, um den Parteikadern meinen Unmut nahezubringen.«
»Aber vielleicht gab es keine bessere Unterkunft«, werfe ich ein, mich daran erinnernd, dass ich in den achtziger Jahren in Urumqi mit meinem Team selbst mal in einem Hotel mit unzumutbaren Bedingungen genächtigt habe. Immerhin liegen damals im Restaurant Fragebögen aus, auf denen man die Speisen und den Service benoten kann. Wir machen unsere kritischen Anmerkungen und übergeben die Bögen dem Personal, das sie unter lautem Gekicher als Papierschwalben zu uns zurückfliegen lässt.
»Doch, es existierte in der Nähe der Stadt ein staatliches Gästehaus«, setzt Vietz seine Schilderung fort. »Als meine Gastgeber erkannten, dass ich nicht nur theoretisch etwas zu bieten hatte, sondern auch praktisch, ich also genau der richtige Mann für die Verwirklichung ihrer ehrgeizigen Pläne war, brachte man mich dort auch unter. Die Wachen salutierten, als sich meine Limousine näherte. So etwas Exklusives hatte ich noch nie gesehen. Das Gebäude war in eine phantastische Bergwelt eingebettet. Ich dachte: Das ist ja wie am Wolfgangsee.«
Der Ingenieur, der einen der Schlüssel für die Modernisierung des Landes besitzt, wird nun jahrelang in der Volksrepublik hofiert. In Peking geht er bei der Nomenklatura der KP ein und aus. Wenn er landauf und landab seine Referate hält und die Ausbeutung der Bodenschätze evaluiert, umgarnen ihn Gouverneure und Bürgermeister. Je häufiger er durch China reist, desto stärker werden ihm aber auch dessen kulturelle Eigenarten und gesellschaftlichen Defizite bewusst. Manche irritieren ihn nur, andere findet er »erschreckend«.
Mit der Übermacht des hierarchischen Denkens wird Eginhard Vietz bei einem Bankett in der Nähe von Peking konfrontiert. Nachdem er zusammen mit Spitzenfunktionären »die edelsten Meeresfrüchte meines Lebens« genossen hat, beschließt er, dem Koch für sein »Kunstwerk« ein persönliches Lob auszusprechen. Doch als er den Dolmetscher bittet, ihm den Mann vorzustellen, reagiert die Runde konsterniert. Minuten vergehen – und nichts geschieht. Der Gast aus Deutschland insistiert. Und wieder rinnt die Zeit dahin.
Dann, endlich, erscheint der Koch am Tisch – aber nicht in seinem Küchen-Outfit, sondern im dunklen Anzug und mit Schlips und Kragen. »Als ich ihm die Hand geben wollte«, so Vietz, »schlug er die Hacken zusammen und bedankte sich wie ein Soldat. Mir war sofort klar: Diesem Bediensteten war Lob fremd.«
An der Tafel der Auserwählten, so der chinesische Komment, haben die niederen Ränge nichts verloren. Und wenn der ausländische Gast das nicht begreift und sich unbedingt gemein machen will mit einem Koch, dann muss zumindest dessen Kleidung dem Status der Honoratioren angemessen sein.
Als mir der Fabrikant das aus unserer Sicht feudale Gehabe schildert, fällt mir sofort eine Episode aus meiner eigenen China-Zeit ein. Ihr Protagonist ist der damalige deutsche Postminister Christian Schwarz-Schilling. Ich begleite ihn mit meinem Team zu einer Raketenstation in den Bergen der Provinz Sichuan, und mein chinesischer Nachbar im Bus übersetzt für den konservativen Politiker. Mit der Dauer der Tour steigert sich seine Begeisterung. »Stellen Sie sich vor«, staunt er, »der Minister hat sich nach meiner Familie und nach meiner Ausbildung erkundigt. Und er hat mich sogar gefragt, ob er etwas für mich tun kann.« Als der Dolmetscher in meinem Blick ein gelassenes ›Na und‹ entdeckt, fügt er hinzu: »Das würde bei uns ein so hoher Kader nie tun.«
In Urumqi, wo sein China-Engagement begann, präsentiert man dem Ingenieur aus Hannover irgendwann auch die industrielle Infrastruktur – womöglich mit dem Hintergedanken, dem potentiellen Partner vor Augen zu führen, dass er sich in China um sozialen Schnickschnack wie Sicherheit oder feste Arbeitszeiten keine großen Gedanken machen muss. Doch nach dem Besuch einer Kohlemine reagiert der Unternehmer nicht anders als ein Gewerkschafter. »Das war menschenunwürdig«, erregt er sich noch heute. »Auf den Knien haben die Kumpels die Loren geschoben. Ich habe Mitleid mit ihnen gehabt – und nur noch gerufen: ›Raus, raus, raus hier!‹ Mein Gott: das sind doch Menschen und keine Roboter.«
Bei der Besichtigung einer Fabrik in Urumqi interessiert sich Eginhard Vietz besonders für die Schweißarbeiten, sein Spezialgebiet. »Da saßen Frauen im Kessel, die konnten vor giftigen Dämpfen keinen Meter weit blicken. Schutzmasken trugen sie nicht. Ich habe sofort meinen Dolmetscher auf den Missstand aufmerksam gemacht, aber der hat nur gesagt: ›Das macht doch nichts. Die schaffen das schon.‹« Bei einer Visite der Ölfelder von Daqing im Nordosten Chinas entsetzen den Gast vor allem die Umweltschäden. »Aus den Schornsteinen kamen Farben, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Und genauso sahen die Flüsse aus.«
Wer sich in China engagiert, mehrt auch in der Heimat sein Ansehen. Eginhard Vietz begleitet nationale und regionale Regierungschefs auf ihren Asien-Reisen. Bei seinen Sommerfesten in Hannover schaut der niedersächsische Ministerpräsident vorbei. Für seine innovatorischen Leistungen heimst er Preis um Preis ein. Er avanciert zur Vorzeigefigur des Mittelstandes, jener unternehmerischen Kraft, die mit ihrer Kreativität und Flexibilität erheblich zur Position Deutschlands als Exportweltmeister beiträgt.
Ausgestattet mit der weltbesten Technologie, einem hart erkämpften Selbstbewusstsein und ersten Erfahrungen mit dem chinesischen Alltag, wagt sich der Ingenieur an sein erstes großes Projekt in der Volksrepublik: den Bau einer 4200 Kilometer langen Pipeline von Urumqi nach Shanghai. Er liefert siebzig Prozent der Maschinen, und als das gigantische Unternehmen dank ihrer Präzisionsarbeit zu einem aufsehenerregenden Erfolg wird, macht der chinesische Auftraggeber einen verlockenden Vorschlag: Lasst uns ein Joint Venture gründen und die Maschinen gemeinsam vor Ort produzieren.
Eginhard Vietz kalkuliert: Der Konzern gehört mit 1,3 Millionen Beschäftigten zu den größten Arbeitgebern des Landes. Und der Partner wäre gleichzeitig der beste Kunde. Also sagt er ja zu der gemeinsamen Firma. 2004 erwirbt er in Peking ein Grundstück. Ein Jahr später beginnt die Produktion. 150 Mitarbeiter stammen aus China, vier aus Hannover. Der Unternehmer verbringt anderthalb Wochen im Monat vor Ort. Er ist morgens der Erste im Büro und verlässt das Gelände als Letzter; er entspricht also ganz dem konfuzianischen Ideal des vorbildlichen Meisters.
Doch von nun an geht’s bergab. Im März 2005, nur ein Vierteljahr nach dem Start, merkt der deutsche Teilhaber, »dass mit der Firma irgendwas nicht stimmt«. Das chinesische Führungspersonal wechselt ständig, in der Buchhaltung häufen sich die Unstimmigkeiten. Eines Tages gibt Vietz den einheimischen Mitarbeitern vor, für ein paar Tage nach Deutschland zu jetten, bezieht aber zusammen mit einem chinesischen Bekannten Position auf einem Grundstück, von dem er das Geschehen auf dem Gelände des Joint Ventures im Blick hat. Er legt sich also auf die Lauer. Was er beobachtet, kommt ihm noch heute vor »wie im Film«.
Vor der Fertigungshalle fährt an diesem denkwürdigen Tag ein VW-Bus vor, dem einige dubiose Figuren entsteigen. Nachdem sie sich mit Angestellten des Gemeinschaftsunternehmens ausgetauscht haben, verlässt das Auto das Areal. Der Fabrikant und sein Kompagnon folgen ihm. Nach acht Kilometern stoppt der VW-Bus vor einem Gebäude, das vom Zaun bis zum Dach genauso aussieht wie die Produktionsstätte, mit der Eginhard Vietz sein China-Engagement begann. Als er die Halle inspiziert, entdeckt er Kopien seiner eigenen Zeichnungen und Maschinen, die anhand dieser Unterlagen nachgebaut wurden.
Vietz trennt sich von den betrügerischen Mitarbeitern und stellt mit Hilfe des Arbeitsamtes neue Ingenieure ein. Den Tüchtigsten macht er zum technischen Leiter – und damit, um es salopp auszudrücken, den Bock zum Gärtner. Der Mann arbeitet nämlich parallel exakt für die Firma, die Vietz in Nacht- und Nebelaktionen das Know-how klaute. »Der hat«, so der Unternehmer, »alles ausgeplündert, was auszuplündern war.«
In Anwesenheit von zwei Angehörigen der deutschen Botschaft gesteht der leitende Angestellte den Diebstahl. Vietz will das von ihm schwarz auf weiß haben und verfasst ein entsprechendes Papier. Als er mit dem Schreiben das Büro des Mannes betritt, ist der gerade dabei, die Daten des Hauptrechners auf seinen Laptop zu laden. Die von Vietz alarmierten Polizisten wiegeln den Fall zunächst als »interne Angelegenheit« ab. Erst als sie an der Wand ein Foto entdecken, das den deutschen Boss zusammen mit dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder und dessen chinesischem Amtskollegen Wen Jiabao zeigt, rufen sie vier höherrangige Beamte herbei. Sie versprechen, den Dieb festzunehmen und den Laptop einzubehalten. Am nächsten Mittag werde das Gerät dann im Beisein von Experten geöffnet.
Nichts geschieht am nächsten Mittag. Stattdessen wird Vietz immer wieder durch Anrufe hingehalten. Und dann steht plötzlich der Ingenieur mitsamt dem Laptop in der Tür und triumphiert mit Worten, die sein Arbeitgeber wohl nie vergessen wird: »Was wollt ihr? Ich bin frei.«
Noch gibt Vietz, der sich in China einen unternehmerischen Traum erfüllen wollte, nicht auf. Er verstärkt das deutsche Kontingent in der Belegschaft und drosselt die Produktion. Aber schon bald trifft ihn der K.-o.-Schlag. Der Mitarbeiter, der die sensiblen Daten auf seinen Laptop lud und auf wundersame Weise davonkam, fährt nachts mit einem Lastwagen vor dem Firmengelände vor, öffnet mit einem Nachschlüssel die Halle und transportiert einen etwa 25 Kilo schweren Tresor ab. Sein Inhalt: wichtige Papiere und der Hauptrechner.
Diesmal spricht der Bestohlene gleich beim Polizeipräsidenten vor, der sich aber für »nicht zuständig« erklärt. Begründung: Der LKW stamme aus einer Provinz außerhalb Pekings. Hatte er seine Nerven bis dahin halbwegs im Griff, so missachtet der Unternehmer in diesem Moment das Gebot, in China nie die Contenance zu verlieren. »Ihr Schweine, ihr Verbrecher«, erregt er sich, »was macht ihr mit mir?« Auch eine Intervention von Bundeskanzler Gerhard Schröder bei der chinesischen Politspitze verläuft im Sande. »Das war alles von höchster Stelle abgedeckt«, ist sich Vietz sicher. »China will unbedingt Hightech haben. Und um da ranzukommen, sind alle Mittel recht. Als ich hörte, dass auch Airbus in China montieren lässt, dachte ich sofort: O Gott, o Gott! Für mich ist es so sicher wie das Amen in der Kirche, dass China nach spätestens zwei Jahren einen eigenen Airbus baut, vielleicht noch eine Nummer größer.«
Hofiert, solange er nützlich war, fallengelassen, nachdem man sein Wissen ausgeweidet hatte – ich frage den Unternehmer, wie ihm zumute war, als ihm diese zynische Mechanik klarwurde.
»Für mich brach eine Welt zusammen. Ich habe hemmungslos geweint.«
»Waren Sie suizidgefährdet?«
»Ja, es gab einen Moment, in dem ich mir das Leben nehmen wollte. Aber meine Frau, die mich immer vor dem Engagement in China gewarnt hat, baute mich durch ihre Stärke wieder auf.«
Eginhard Vietz reicht mir zwei Fotos. Auf dem einen flankieren ihn vier in traditionelle Tracht gewandete Schönheiten, die üppig dekorierte Schatullen mit Geschenken in den Händen halten. Blaue und gelbe Luftballons zieren die Wände, Blumenbuketts den Festtisch. »Einweihungsfeier Juni 2004« lautet die Unterschrift. Auf dem anderen Bild posiert eine Gruppe angeheiterter Chinesen mit ihrem Gastgeber vor dessen Hausbar in Hannover. Einer der Besucher legt vertrauensvoll den Arm um die Schulter seines deutschen Geschäftsfreundes. »Drei Joint-Venture-Partner in bester Laune für die Zukunft«, heißt es dazu. »Wahrscheinlich«, sagt der Unternehmer, »haben die mich schon damals betrogen. Da muss man doch verzweifeln. Oder?«
»Sind Sie diesen Leuten später noch mal begegnet?«
»Ja, bei einer Messe in China. Der größte Übeltäter hat mich lachend begrüßt und gesagt: ›Wir bauen Ihre Geräte jetzt selbst.‹ Das hat mich aufs Neue gekränkt.«
»Chinesen lachen oft aus Verlegenheit … «
»Verlegenheit? Nein: Das war Triumph.«
Das Gefühl der Ohnmacht, das ihn am Messestand paralysiert und sprachlos macht, beschleicht Vietz nur wenig später an einem Ort, an dem er sich vor chinesischen Produktpiraten sicher wähnte: im Sudan, dem an Bodenschätzen reichen, politisch aber bankrotten Staat im Norden Afrikas. Er hat dort ein Ausbildungszentrum errichtet, das einheimische Techniker in die Lage versetzen soll, die Ausbeutung der Ölvorkommen voranzutreiben. Natürlich will er eines Tages selbst davon profitieren, aber er verbindet das Projekt mit einer entwicklungspolitischen Philosophie: Hilfe zur Selbsthilfe. Als er in der Hauptstadt Khartoum eintrifft, um das Gebäude feierlich zu eröffnen, empfängt ihn am Flughafen ein sichtlich geschockter deutscher Spitzendiplomat. Seine Botschaft: die sudanesische Führung hat das Projekt ihren neuen chinesischen Freunden vermacht, die dort ihre eigenen Leute ausbilden.
Der Initiator der Institution kehrt unverrichteter Dinge nach Hannover zurück und zieht, vom Gläubigen zum Realisten konvertiert, seine Schlüsse aus dem Desaster in Afrika: »Ich möchte nicht wissen, wie viel Geld seitens der Chinesen geflossen ist. In Sachen Korruption kennen sie sich schließlich aus. In China läuft kein Geschäft ohne Bestechung. Glauben Sie’s mir.«
Nach einer Lehrzeit von gut einem Vierteljahrhundert reduziert der niedersächsische Mittelständler seine China-Aktivitäten auf ein Minimum. Er unterhält in Peking nur noch eine Dependance mit drei Mitarbeitern. Vor allem lässt er in der Volksrepublik keine kompletten Maschinen mehr bauen, sondern nur noch Komponenten, die in Deutschland zusammengesetzt werden. In einem Papier, mit dem er Unternehmer-Kollegen über die Risiken in Fernost aufklärt, warnt er: »Es sollte nicht in China investieren, wer Schlüsseltechnologien herstellt, die für die Chinesen interessant sind, und wer nicht eine Million Euro zur Verfügung hat, auf die er verzichten kann.«
Die Überschrift über einem Erfahrungsbericht, den er für eine Fachschrift verfasste, lautet: »Vom chinesischen Traum zum Trauma«.
2.»Das Lebenswerk meiner Eltern wurde zerstört«
Alice Maria im Wunderland
Alzenau in Unterfranken gehört zu den deutschen Provinzstädten, in denen eine »Zuchtkaninchen-Schau« noch als Ereignis gilt. Schlappohrig posieren die Belgischen Riesen, Weißen Wiener und Englischen Schecken auf überdimensionalen Plakaten in den Schaufenstern des Einzelhandels, und mit ihrer mümmelnden Behaglichkeit nehmen sie auch den Besucher für sich ein, den es wegen einer ganz anderen Thematik in den nördlichen Winkel des Freistaates Bayern verschlug. Der satte Klang der Abendglocken von Sankt Justinus, die von den letzten Sonnenstrahlen gülden gefärbten Kaskaden eines Flüsschens namens Kahl und die auf einer Anhöhe des Spessarts thronende mittelalterliche Burg, in deren Hof man gerade »Das Käthchen von Heilbronn« spielt, vollenden das Idyll. An die Vorstellung, dass in diesem Ort von 19 000 Einwohnern deutsche Spitzentechnologie gefertigt wird, muss man sich erst gewöhnen.
Die Firma micotrol residiert in der Daimlerstraße, die sich mit ihren zweckorientierten Fassaden aus Glas und Beton und ihren unwirtlichen Supermärkten scharf abgrenzt gegen den heimeligen Kern der Gemeinde. Auf die elektronische Steuerung von Fahrstühlen hat sich das Unternehmen spezialisiert. Seine Geschäftsführerin Alice Maria Salber lässt zeitlupenhaft die Fingerkuppen aneinanderstoßen, um die Vorzüge ihrer Geräte zu demonstrieren. »Keinen Zentimeter«, sagt sie, »dürfen die Kanten beim Öffnen des Lifts voneinander abweichen. Und der Start muss so sanft sein, dass man ihn gar nicht merkt. Wenn ich irgendwo auf der Welt einen Aufzug benutze und ein Ruckeln verspüre, dann weiß ich sofort: die Steuerung stammt nicht von uns.«
Wesentlich knapper antwortet die 41-Jährige auf eine Frage, die ich vorsichtshalber als »ziemlich gemein« avisiere: »Welcher Begriff fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie an China denken?«
»Ohnmacht.«
»Sonst nichts?«
»Doch: Wut.«
Es sind ihre Eltern, die Ende der neunziger Jahre auf die Idee kommen, es mit ihrem »Nischenprodukt« auf dem Markt im Fernen Osten zu versuchen. Das Kalkül: Die neuen ökonomischen Freiheiten lassen vor allem in den boomenden Küstenstädten eine neue, zahlungskräftige Schicht entstehen. Deren Streben nach Komfort und Prestige schlägt sich in der Bauweise ihrer Siedlungen nieder. Also wächst auch der Bedarf an eleganten und perfekt funktionierenden Aufzügen.
In einem Kaufmann aus Kanton findet das Familienunternehmen einen, wie es auf den ersten Blick scheint, idealen Partner. Als ehemaliger Fahrstuhlmonteur versteht er etwas von der Technik. In seinem neuen Job als Unternehmer weiß er um die Lücken und Tücken des chinesischen Marktes. »Ein wenig zu forsch« fällt allerdings, wie sich die Tochter erinnert, der Antrittsbesuch in Alzenau aus. »Sein erster Satz lautete: ›Ich will schnell Millionär werden!‹.«
»Hatte er wenigstens den Charme eines Hochstaplers?«
»Nein. Aus ihm sprach die reine Geldgier. Das galt noch mehr für seine Frau, die er in die Verhandlungen schickte, wenn es um die letzten Details ging. Mit einer so knallharten Person hatte ich es noch nie zu tun.«
Die Stutzeffekte häufen sich mit der Dauer der Zusammenarbeit. Mal lässt sich der chinesische Repräsentant die hochwertige Ware in die Sonderzone Hongkong schicken, um sie wohl auf geheimen Wasserwegen mit Dschunken zollfrei in Richtung Festland zu schleusen. Mal wählt er den direkten Weg, aber dann verschwinden die Geräte oft monatelang bei den volksrepublikanischen Kontrollbehörden. »So lange eben«, mutmaßt Alice Maria Salber heute nicht ohne Grund, »bis man sie kopieren konnte.«
Und mit der Zahl der Aufträge nehmen auch die Forderungen zu, mit denen der geschäftstüchtige Kantonese seine unterfränkischen Partner nervt. Als seine Frau mit einem zweiten Kind schwanger ist, bedrängt er die Familie, sie bis zur Geburt bei sich aufzunehmen. Der Trick, auf den sich das Alzenauer Unternehmen allerdings nicht einlässt: Auf diese Weise erwirbt das Baby das Recht auf die deutsche Staatsbürgerschaft – und die chinesischen Eltern umgehen die Strafe, die ihnen in der Heimat wegen der strikten Ein-Kind-Politik droht.
Schon bald greift auch ein Mechanismus, mit dem sich fast jeder deutsche China-Investor konfrontiert sieht: Es rückt, auf Firmenkosten, eine Gruppe von Kadern an, die das Geschäft in der Volksrepublik dank ihrer politischen und bürokratischen Macht forcieren oder behindern können. Das Trio, das man in Alzenau begrüßt, hält sich in dem kulturell interessanten, aber von einem Nachtleben weitgehend freien Städtchen gar nicht erst lange auf, sondern steuert spornstreichs die etwa dreißig Kilometer entfernte Metropole Frankfurt an. »Die hatten«, so Alice Maria Salber, »nur ein Ziel im Kopf: Das Rotlichtviertel in der Nähe des Hauptbahnhofs. Ja, und irgendwann kam dann ein Anruf von der Polizei. Ein Beamter bat uns händeringend, die drei Chinesen auszulösen. Sie waren mit den Diensten der Damen wohl nicht zufrieden und weigerten sich, die Rechnung zu begleichen.«
Auch ein Bankett, zu dem die deutsche Unternehmer-Familie ihre Gäste einlädt, mündet in einen Eklat. »Weil ihnen offenbar irgendetwas nicht passte, haben sie das Personal angepöbelt und wurden sogar handgreiflich. Die Dolmetscherin war am Ende dermaßen mit den Nerven fertig, dass sie den Job hingeschmissen hat.«
Die Folge: Einen Italien-Trip, der vor allem dem Kauf von Schmuck dient, muss die Gruppe ohne Begleitung antreten. Prompt verpassen die Touristen aus Fernost in Mailand den Rückflug nach Frankfurt. Sie nehmen den Zug – und wieder gibt es Ärger mit der Polizei. In ihren Pässen fehlt das Visum für die Schweiz. »Als sie dann endlich in Alzenau eintrafen, hatte ich Mühe, ihnen klarzumachen, dass man sich auch als Chinese in Europa an bestimmte Regeln halten muss. Unglaublich, wie die sich hier aufgeführt haben. Unverfroren und unverschämt war das.«
Meine Interviewpartnerin breitet, nachdem sie ihre Suada beendet hat, die Arme aus, hebt die Schultern und zieht die Augenbrauen hoch. Es fällt mir nicht schwer, ihre Körpersprache zu deuten, weil ich exakt das Gleiche empfinde: Es tut mir ja leid, dass ich ein so drastisches Urteil fällen muss. Aber das ist nun mal die Realität. Sie aus Gründen der political correctness zu verdrängen, wäre verlogen und bringt uns nicht weiter.
Als wolle sie dokumentieren, dass sie trotz ihrer negativen Erfahrungen auch zur Solidarität mit chinesischen Bürgern fähig ist, schickt Alice Maria Salber einige Eindrücke von einer Reise in die chinesische Provinz hinterher: »Da stand an einer Kreuzung ein ausgemergelter Mann mit seinem Fahrrad, dessen Anhänger haushoch mit Holz beladen war. Als die Ampel auf Grün sprang und er in die Pedale trat, dachte ich: gleich bricht er vor unseren Augen zusammen. Und dann die Arbeitsbedingungen in den Betrieben, die man uns zeigte: Morgens um fünf wird da angefangen, abends gegen acht aufgehört. Zwischendurch legt man sich in der Massenunterkunft mal auf die Pritsche. Und es herrscht dort ein unglaublich autoritärer Ton. Also für mich war China ein einziger Kulturschock.«
Auch für mich. Und das gilt nicht nur für meine acht Korrespondentenjahre, sondern genauso für meine regelmäßigen Besuche danach. Was ich zum Beispiel während einer Drehreise im Jahre 1999 in der Provinz westlich von Peking erlebe, bestätigt die Eindrücke meiner Alzenauer Gastgeberin. Mein Thema ist der zehnte Jahrestag der Niederschlagung des Volksaufstandes am 4.Juni 1989. Als wir in einem Steinbruch filmen, in dem das Material für das Pflaster auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking gewonnen wird, entdecke ich eine Gruppe junger Frauen, die mit Hämmern riesige Brocken zerkleinern und gegen den feinen Staub, der nach jedem Schlag auf ihre Kleidung und ihre Gesichter rieselt, in keiner Weise geschützt sind. Ich frage den chinesischen Besitzer, wie lange seine Arbeiterinnen täglich im Akkord schuften. Seine Antwort: »So lange, bis sie nicht mehr können.«
Auch für das Auftreten der Kader während ihres Europa-Besuchs fällt mir bei meinem Gespräch in der Firma micotrol eine Parallele ein. Erst wenige Monate zuvor hat mir ein deutscher Kaufmann, den ich aus meiner Zeit in Peking kenne und der jetzt in Australien lebt, von seinen Schwierigkeiten berichtet, die chinesischen Kunden seines bei Ulm ansässigen Arbeitgebers in Hotels unterzubringen. »In der ganzen Stadt und ihrer Umgebung war damals kein Wirt bereit, diese Besucher aufzunehmen. So schlechte Erfahrungen hatte man mit ihnen gemacht. Ausländerfeindlichkeit war es jedenfalls nicht, die zu dieser Weigerung führte.«
China hat den Sprung in die ökonomische Moderne, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, innerhalb weniger Dekaden vollzogen. Das feudalistische und bäuerliche Fundament, auf dem die Gesellschaft seit einigen Jahrtausenden basiert und das auch der kommunistischen Revolution standhielt, blieb von dieser Zäsur weitgehend unberührt. Am auffälligsten schlägt sich dies im Verhalten der Neureichen und der von dieser Schicht profitierenden Kader nieder.
Der verunglückte Besuch im Bordell, die Raufhändel im Restaurant, die Komplikationen während der Zugfahrt – es sind Vorkommnisse, die sich irgendwie ausbügeln lassen. Für die wirtschaftlichen Nackenschläge, die folgen, gilt das nicht. Im Jahre 2003 bestätigt sich bei einer Inspektionsreise der Verdacht, dass der in China residierende Repräsentant die in Alzenau gefertigten Geräte in eigener Regie nachbaut. Ein deutscher Mitarbeiter hilft ihm offenbar dabei. Die Firma, die das unterfränkische Unternehmen hintergeht, nennt sich »micocontrol«. Das klingt fast genauso wie der Originalname »micotrol«. Ihn benutzt der Produktpirat weiter auf seiner Website.
Die Konsequenzen sind katastrophal: Die asiatischen Kunden glauben, es mit dem renommierten Unternehmen in Alzenau zu tun zu haben, bekommen aber Geräte geliefert, die zwar erheblich preiswerter sind, aber auch von weitaus schlechterer Qualität. Und so häufen sich in Alzenau die Beschwerden über Steuerungssysteme, die man gar nicht produziert hat. Als in einer Mängelrüge von »Schrott« die Rede ist, betätigen sich Experten aus dem Mutterhaus als Detektive und prüfen die Seriennummern der beanstandeten Ware. Und siehe da: während in Alzenau jedes gefertigte Stück eine neue Nummer erhält, beschränken sich die Nachahmer auf eine einzige Zahl. Doch als man die Fälschung belegen kann, ist der Ruf in Asien bereits ruiniert. »Meine Eltern haben auch sehr viel privates Geld in das China-Projekt gesteckt«, erklärt Alice Maria Salber. »Am Ende war ihr Lebenswerk zerstört.«
»Haben Sie versucht, Ihr Recht einzuklagen?«
»Das haben wir aufgegeben, als der chinesische Anwalt sofort 30 000US-Dollar Anzahlung verlangte. Aber wir haben uns das Copyright auf unseren Firmennamen gesichert.«
Vater und Mutter ziehen sich resigniert zurück. Die Tochter, die ihr Studium der Politologie und Soziologie mit einer Arbeit über den Genossenschaftsgründer Georg Heim abschloss, wagt als Geschäftsführerin eines Nachfolgeunternehmens einen neuen Anfang. 30 Mitarbeiter hatte der Betrieb zu seiner Blütezeit in Alzenau. Heute sind es fünf. »Das sind alles hochqualifizierte Leute«, sagt die Chefin, »die dafür sorgen, dass wir im Service ungeschlagen bleiben. Dieses Qualitätsbewusstsein ist ein Wert, den wir unserer chinesischen Billig-Konkurrenz voraushaben.«
Auf einer Fachmesse in Shanghai passiert Alice Maria Salber das Gleiche wie dem niedersächsischen Pipeline-Spezialisten Eginhard Vietz: Sie trifft auf den Dieb ihres Know-hows. Als sie ihn zur Rede stellt, reagiert der Mann, der sonst vor Selbstbewusstsein strotzt, sichtlich nervös. Ausländische Kunden umlagern seinen Stand. Deswegen ist ihm die Konfrontation mit seiner ehemaligen Partnerin unangenehm. »Aber dann«, berichtet die Unternehmerin, »bekam er doch noch die Kurve. Er hat mich einfach als hysterische Ziege hingestellt.«
3.»Wir müssen aufhören, mit Wattebällchen zu werfen«
Die Palette der Produktpiraten
Pförtnerlogen sind nicht gerade Orte der Inspiration. Man wartet darauf, dass sich die elektronisch gesteuerte Tür öffnet, stellt sich knapp dem Mann hinter der zentimeterdicken Trennscheibe vor, füllt den Besucherschein aus und fällt, bevor man in die Chefetage vorgelassen wird, jener geistigen Müdigkeit anheim, zu der jede öde Prozedur verleitet. Wie gut, dass der Wächter am Eingang zum Werk 6 der Waiblinger Firma STIHL AG & Co. KG dem sattsam bekannten Ritual eine Frage hinterherschickt, deren Brisanz die journalistische Neugier gerade noch rechtzeitig wieder belebt. »Besitzen Sie«, will er wissen, »ein Handy, mit dem Sie fotografieren oder filmen können?«
Angst vor Spionen – wo sie derartig ausgeprägt ist wie bei diesem baden-württembergischen Familienunternehmen, sage ich mir, müssen Werte auf dem Spiel stehen, die weit über das gängige Maß hinausreichen. Ein Blick in das Informationsmaterial, das mir der Jurist Martin Welker, Leiter der Abteilung »Recht und Patentwesen«, als Basis für unser Gespräch überreicht, bestätigt meine Vermutung. Die Güter, die es zu schützen gilt, wurzeln in einer gut achtzigjährigen Tradition und erschöpfen sich nicht im Materiellen.
Der Name Stihl, so lerne ich, gilt weltweit als Synonym für Motorsägen und deutsche Wertarbeit. 35