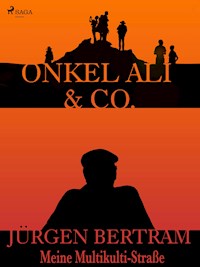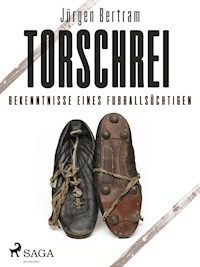3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Nur der Tod bringt Quote Flash-TV ist ausschließlich an einem interessiert: an Erfolg. Und den garantieren lebendige Bilder vom Tod. Der junge Reporter Lutz Hösch liefert sie – aus den Krisengebieten der Welt. Hösch macht schnell Karriere, doch bald verlangt sein Chefredakteur immer ausgefallenere News. Da kommt Hösch eine perfide Idee ... Ein schockierender Enthüllungsroman aus der Welt der TV-News vom langjährigen Auslandskorrespondenten der ARD, Jürgen Bertram. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 325
Ähnliche
Jürgen Bertram
Der Story-Jäger
Roman
FISCHER Digital
Inhalt
1
Amerika!
Endlich hatte Hösch auf dem Weg in die Stadt eine Herausforderung entdeckt. Wenn es mir gelingt, sagte er sich, die beiden Eisschollen auf dem Teich zu verschmelzen, dann entsteht, ungefähr jedenfalls, ein Gebilde mit den Konturen des amerikanischen Kontinents.
Jetzt kam es darauf an, die Aktion dramaturgisch so dicht zu gestalten, dass kein Freiraum blieb für abschweifende Gedanken. Denn die, das wusste Hösch aus Erfahrung, würden an solch diffusen, vor sich hin dämmernden Dezembertagen doch nur um die unerfreulichen, oft genug demütigenden Momente in seinem Leben kreisen.
Das plötzliche Versagen der Stimme bei seinem Vortrag über die Mexikoreise … der verschossene Elfmeter beim Endspiel um die Schulmeisterschaft … Nun ja, mit solchen Erinnerungsfetzen wurde Hösch mittlerweile ganz gut fertig, weil er sie erfolgreich mit Eindrücken bekämpfte, die er seit fünf Jahren als Polizeireporter beim Abend-Kurier sammelte. Was bedeutete schon ein durch seine Schuld verlorenes Fußballfinale gegen das Elend der Hemsburger Drogenszene? Aber der Film, der an trüben Wintertagen mit fast immer gleichen Bildern vor ihm ablief, enthielt auch zwei Szenen, die sich bis heute seinen Verdrängungsversuchen widersetzten.
In der Aula des Anne-Frank-Gymnasiums in Schutterfeld haben sich die Schüler, ihre Eltern, die Lehrer und die Honoratioren der kleinen Stadt zur Abiturfeier versammelt. Studiendirektor Schadebrodt verteilt die Reifezeugnisse. Als er Lutz Hösch auf die Bühne bittet, löst jemand geräuschvoll die Jalousie an der hinteren Fensterfront. Es ist Höschs Vater, der Hausmeister des Gymnasiums. Er trägt sein speckiges Cordhütchen, den blauen Kittel, die klobigen braunen Halbschuhe. Die festlich gekleidete Versammlung dreht sich irritiert nach ihm um und starrt ihn an. Ludwig Hösch, den alle nur den «alten Hösch» nennen, errötet. In seiner Not sucht er nach irgendeiner Ablenkung und wälzt mit der Zunge einen Bonbon von der einen Seite des Mundes auf die andere; von links nach rechts, von rechts nach links. Sein Blick wirkt auf eine entrückte Weise debil. Die unteren Lamellen der Jalousie, die sich ineinander verhakt hatten, lösen sich scheppernd. Als sei ihm eine Clownerie gelungen, macht der Hausmeister eine linkische Verbeugung. Ein paar Gäste klatschen. Es ist ein höhnischer Beifall.
Am Tag vor ihrem fünfzigsten Geburtstag kehrt Höschs Mutter vom Frisör zurück. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat sie es gewagt, sich im vornehmen Salon Kiki frisieren zu lassen. Gisela Hösch tritt vor den Garderobenspiegel, weicht zurück, versucht, die blonden Strähnen, die man ihr ins graue Haar gefärbt hat, unter einem Wust frischer Locken zu verstecken. Sie lächelt verlegen. Das Lächeln erstirbt. Mit einem Ausdruck zwischen Hoffen und Flehen blickt sie ihren Mann an. Ihr Blick fragt: Wie findest du meine Frisur? Ludwig Hösch umkreist seine Frau. Er zupft prüfend an einigen Haarsträhnen. Dann weicht er plötzlich zurück, stemmt die Hände in die Hüften und sagt: «Wie ’n Schaf.»
Was, fragte sich Hösch immer wieder, ist es eigentlich, das mich an diesen beiden Szenen so quält? Ist es die Hilflosigkeit? Die soziale Erniedrigung? Er wagte nicht, sich eine klare Antwort zu geben, aber er spürte, dass die Angst, die in seinem Elternhaus gezüchteten Hemmungen könnten ihm den gesellschaftlichen Aufstieg verbauen, stärker war als sein Mitleid.
Hösch schätzte die Entfernung zu den beiden Eisschollen ab und entwarf einen dreistufigen Plan. Stufe eins: aufsammeln von Steinen am Wegesrand. Stufe zwei: mit den Steinen so genau auf die Fläche neben den Eisteppichen zielen, dass der Wellenschlag sie zum amerikanischen Kontinent zusammenfügt. Stufe drei: die Aktion, wenn sie gelingt, auf dem verbleibenden Weg in die Stadt immer wieder – wie bei der Zeitlupenwiederholung einer Fußballszene – in Erinnerung rufen. Um die Spannung zu steigern, beschränkte Hösch die Zahl der Steine auf zehn. Wenn dieses Arsenal nicht ausreicht, sagte er sich, dann soll zur Strafe dieser verdammte Film vor mir ablaufen.
Der erste Stein prallte auf das gegenüberliegende Ufer und schreckte eine Gruppe von Enten aus ihrem winterlichen Dämmer. Ihr aufgeregtes Geschnatter steckte eine Schar von Krähen an, die über dem Teich zeternd ein paar Runden flogen und nach der Rückkehr in ihre Kastanienbäume so aggressiv um ihre angestammten Plätze stritten, dass sich der feine Schnee von den Ästen löste. Ein Schneeschauer traf Hösch, gerade als er zum zweiten Wurf ausholte. Weil er den Arm instinktiv zum Schutz gegen den Schnee erhob, rutschte ihm der Stein aus der Hand, kullerte die Böschung hinunter und blieb im Schlick stecken.
Die nächsten drei Steine schlugen zwar auf dem Wasser auf, doch die Wellen, die sie auslösten, zerrannen weit vor dem Ziel. Die Jalousie … die Verbeugung … der Beifall … die neue Frisur … Schon drängten sich Hösch wieder die verhassten Bilder ins Bewusstsein; schemenhaft noch wie die Fragmente eines Traumes, an den man sich am Morgen nicht mehr genau erinnern kann, aber doch fordernd und bedrohlich.
Der sechste Stein, ein vor Dreck strotzender Brocken, erlöste ihn. Der südliche Block trieb nach diesem Wurf exakt auf den nördlichen zu, und an der Schnittstelle, etwa an der Grenze zwischen Panama und Costa Rica, schob sich der eine Rand ein paar Zentimeter über den anderen. War das nicht derselbe Effekt, der an der pazifischen Küste, zum Beispiel in San Francisco, immer wieder schwere Erdbeben verursachte?
Euphorisiert durch diese Entdeckung, spielte Hösch nun Regisseur. In seiner Fantasie ließ er Hochhäuser in sich zusammensacken, Ambulanzen durch die Straßen rasen, Suchhunde nach Überlebenden scharren, Kinder durch Ruinen irren. Er mixte Szenen des Horrors mit Studien seiner Steinwürfe und spulte die Bilder mal in Slow Motion, mal im Schnellgang ab. Die Musik, die er zu seinen Montagen erfand, pfiff er leise vor sich hin.
Die Kraft dieser Bilder ließ nach, als der graue Nachmittag fast übergangslos im Schwarz des Abends versank und ihm die dumpfen Schläge einer Kirchturmuhr wieder die Symbole seiner Schmach einhämmerten: die Jalousie … die Verbeugung … Sein Erdbebenfilm, der ihn für einige Minuten von der schmerzlichen Erinnerung befreit hatte, riss ab. Stattdessen – und das war neu für Hösch – traten Figuren auf, die in seinem jetzigen Leben eine wichtige Rolle spielten und ihn nun, je stärker er seine Schritte beschleunigte, mit Monologen traktierten.
Monika, seine Freundin: «Story, Story … Immerzu redest du von deinen Storys! Und ich? Hast du mich jemals gefragt, wie ich in meinem Kindergarten klarkomme? Wenn du mal wieder eine deiner Storys ausgegraben hast, muss ich dir stundenlang zuhören. Aber wenn ich dir etwas erzählen will, hörst du einfach weg – außer du kannst eine Story daraus machen. Story! Ich kann das Wort nicht mehr hören! Wann waren wir eigentlich zum letzten Mal zusammen im Kino? ‹Es geht nicht!› – ‹Ich kann heute nicht!› – ‹Vielleicht morgen!› Morgen, mein Lieber, bin ich vielleicht gar nicht mehr da! Lutz, bitte, denk doch auch mal an mich und nicht nur an deine Storys!»
Studiendirektor Schadebrodt, sein Klassenlehrer: «Sie sind blitzgescheit, Hösch, wirklich! Aber bedenken Sie, wie schnell ein Blitz vorüber ist. Ihren Aufsätzen fehlt der Donner, der dem Blitz folgt, der Nachhall, die Reflexion. Sie haben doch eine schnelle Auffassungsgabe und verstehen sicher, was ich meine.»
Josef Meinert, sein Kollege aus dem Feuilleton: «Also, mein lieber Hösch, der Begriff ‹Mondschein-Mörder›, den sie in Ihrer Reportage verwenden, ist doch sehr problematisch. Für mich jedenfalls ist ein Mondschein-Mörder jemand, der den Mondschein ermordet hat. Das ist zwar eine faszinierende Vorstellung, aber Ihr Held, werter Kollege, hat doch wohl nicht auf ewig den guten Mond ausgelöscht, sondern jemanden im Mondschein oder, während der Mond schien, umgebracht. Für mich jedenfalls sind solche Verknappungen ein Verbrechen an der Sprache.»
Helmut Otte, sein Chefredakteur: «Ihre Reportagen, Hösch, sind wirklich flüssig geschrieben. Doch woran es Ihren Texten mangelt, ist die Tiefe. Dass es Ihnen neulich als einzigem Reporter in Hemsburg gelungen ist, den Boss des Drogenkartells zu interviewen – großartig, wirklich großartig! Wie Sie seine Wohnung beschreiben – gut, sehr gut sogar! Aber was für eine Psyche hat der Mann? Welche Motive treiben ihn? Hat er Skrupel? Und wenn nicht: Wann, durch welchen Knacks in seinem Leben sind ihm die Skrupel abhanden gekommen? Das fehlt leider. Hemsburg ist eine Universitätsstadt, Hösch! Unsere Leser erwarten auch etwas Hintergrund. Sie sind begabt, Hösch, wirklich. Aber Sie sind ein Mann des Boulevards.»
«Aber, aber, aber!» Hösch erschrak über die Lautstärke, mit der er dieses Wort mehrmals in die Dunkelheit schrie. Sie sind blitzgescheit, aber … Sie sind begabt, aber … Seine Eltern hatten sich ihr Reihenhaus vom Mund abgespart, aber gesellschaftlich anerkannt waren sie in Schutterfeld trotzdem nicht. Fast drei Jahre kannte er Monika jetzt, aber dass Journalismus eine Leidenschaft, eine Variante der Sucht war und dass ein Reporter eigentlich immer an seine Storys denken muss, das hatte sie bis heute nicht begriffen. Alles in seinem Leben war eingeschränkt durch dieses «Aber», nichts war eindeutig oder gar perfekt. Auch seine Perspektiven erschienen ihm so verschwommen wie die Konturen des Parks, durch den er gerade hetzte. Ein Bruch muss her, sagte er sich. Besser noch, ein Durchbruch.
Hösch suchte nach einem Satz, der den Zustand, aus dem er sich befreien wollte, griffig beschrieb. «Meine Heimat ist das Niemandsland.» Würde Helmut Otte, der Chefredakteur, diesen Satz akzeptieren? Er hörte ihn sagen: Für dieses bombastische Sprachbild, mein lieber Hösch, sind Sie nicht bedeutend genug! Geht es nicht eine Nummer kleiner?
Hinter einem Wall aus Bäumen, der den Stadtpark von der City abgrenzte, leuchtete Reklame auf, tänzelten die Scheinwerfer der Autos. Hösch beschleunigte seine Schritte und fädelte sich in den Strom der Passanten ein, die einer breiten Schneise des Konsums zustrebten, der Fußgängerzone von Hemsburg.
Die Reize, die er im Park so sehr vermisst hatte, boten sich Hösch nun im Überfluss. Die Fassaden der Kaufhäuser waren herausgeputzt mit riesigen Engeln aus Pappmaché, mit Luftballons, Lametta, Tannenbäumen. Posaunenchöre bliesen. Ein kindisch über das Pflaster hüpfender Weihnachtsmann neckte auch Hösch mit seiner Rute und drückte ihm einen Prospekt in die Hand, der für billige Ferienziele warb. Über seine fiebrigen Fantasien im Park und das abrupte Getöse der City hätte er fast vergessen, weshalb er überhaupt hier war. Ach ja, Geschenke wollte er kaufen, für Monika und seine Eltern.
Hösch steuerte das erstbeste Kaufhaus an, und an einem Stand gleich hinter dem Eingang entdeckte er das ideale Präsent für Monika: einen Kalender mit Motiven aus Andalusien. Dort hatten sie ihren letzten Urlaub verbracht. Für seine Mutter suchte er, wie schon seit vielen Jahren, die größte Schachtel Pralinen aus. Die leerte sie meist schon am Heiligen Abend, und Hösch fragte sich jedes Mal, ob dieser zum Fest animalisch hervorbrechenden Sucht nach Süßigkeiten eine unbefriedigte Sehnsucht nach Geborgenheit zugrunde lag.
Obwohl er diesen Star mit dem kantigen Gesicht und dem gestanzten Lächeln nicht mochte, kam Hösch nicht daran vorbei, für seinen Vater die Biografie des Rennfahrers Michael Schumacher zu kaufen. Sein Vater liebte «Schumi». Im Fernsehen verpasste er keines seiner Rennen. Über seine Karriere wusste er besser Bescheid als über die journalistische Laufbahn seines Sohnes, für die er sich kaum interessierte. Lutz Hösch hatte schon beobachtet, wie sein Vater selbstvergessen am Fenster stand, offenbar Siege seines Helden Revue passieren ließ und dazu in regelmäßigen Abständen murmelte: «Der Schumi, ja der Schumi …»
2
Froh darüber, sich der lästigen Pflicht der Weihnachtseinkäufe so schnell entledigt zu haben, wollte Hösch das Kaufhaus schon wieder verlassen, als ihm beim beiläufigen Blick durch die Drehtür eine Wand voller zuckender und flackernder Bilder auffiel. Er kehrte um, bahnte sich eine Gasse durch die nachdrängende Kundschaft und stand nach ein paar Rempeleien und gegenseitigen Beschimpfungen vor einem Arrangement von ungefähr zwanzig Monitoren, die ihn so sehr in ihren Bann zogen wie Roulettetische einen notorischen Spieler.
Systematisch wanderte Höschs Blick über die Mattscheiben, auf denen sich das gesamte Spektrum des Weltenlaufs darbot – oder zumindest das, was das Fernsehen in diesem Moment, also am Freitag kurz nach sieben Uhr abends, davon zeigte. Ein Pandabär kaute an einem Bambuszweig. Der Präsident von Amerika schüttelte dem Präsidenten von Russland die Hand. Eine Trachtengruppe zog in einen Festsaal ein. Soldaten trugen andere Soldaten auf Bahren über ein Schlachtfeld. Ein Vulkan spie Lava. Ein Taucher verfolgte eine Gruppe bunter Fische. Am Rande einer Autobahn deckte ein Polizist eine Leiche zu. Eine Operndiva sang.
An einem Monitor, auf dem ein junger Reporter vor einer Kolonne heranrollender Panzer in ein Mikrofon sprach, blieb Höschs Blick haften. Da der Ton sehr leise eingestellt war, beugte er sich ganz dicht vor das Gerät und versuchte, zumindest ein paar Fetzen des Statements mitzubekommen. «Palästina» hörte er heraus und «israelische Offensive». Deutlich verstand er die Schlussworte: «Georg Hartmann, Flash TV, Hebron.»
Wie alt mochte dieser Reporter sein, fragte sich Hösch. Fünfundzwanzig, sechsundzwanzig? Höchstens achtundzwanzig – wie er selbst. Wie viele Menschen schauten ihm wohl zu? Drei Millionen? Vier? Der Abend-Kurier hatte eine Auflage von 110000 Exemplaren. Das heißt, seine Artikel, für die er manchmal wochenlang recherchierte, wurden höchstens von 200000 Menschen gelesen. Wenn er aber, wie der Kollege Georg Hartmann, auf einem Hügel bei Hebron vor einer Kamera stünde, wäre er in ganz Deutschland zu sehen – in Kiel, Hannover, Heilbronn, in Erlangen, Bad Kreuznach und Aachen, in der Eifel, am Neckar, auf der schwäbischen Alb und im Sauerland. Und wenn seine Eltern, die nie eine seiner Reportagen gelesen hatten, in diesem Augenblick die News von Flash TV einschalten würden, dann stünde er plötzlich in ihrem Reihenhaus am Lerchenweg Nummer vier mitten in der Wohnstube.
Fernsehen … News … Diese Begriffe elektrisierten Hösch. Es war genau wie vorhin mit den beiden Eisschollen im Stadtpark, wo er das magische Wort «Amerika» ausgerufen hatte, als sich die beiden Blöcke in seiner Fantasie zu einem Kontinent zusammenfügten. Fernsehen … wäre das die Zäsur, die er so dringend brauchte, um seiner Existenz eine neue Richtung zu geben? Seine Augen fixierten die Wand mit den Monitoren. Wo eben noch der Pandabär seine Bambusblätter kaute, jagte nun ein Löwe einer Gazelle nach. Auf der Mattscheibe, auf der Soldaten ihre verwundeten Kameraden abtransportiert hatten, tobten nun fettbäuchige Catcher durch einen Ring. Auch Georg Hartmann, der Berichterstatter aus Hebron, war vom Fernseher verschwunden. Auf diesem Kanal warb jetzt Michael Schumacher, der «Schumi» seines Vaters, für einen Joghurt.
Vor einem Monitor, auf dem die Kunden sich selbst betrachten konnten, blieb Hösch kurz stehen. Er ordnete sein Haar und straffte seine Kleidung. Er zwang sich zu einem entschlossenen Gesichtsausdruck und hielt die Faust vor seinen Mund, als sei sie ein Mikrofon. Seine Fantasie projizierte eine Schrift auf den Bildschirm: Lutz Hösch, Flash TV, Hebron.
Als er das Kaufhaus verließ und die frische Winterluft einatmete, war er noch so berauscht von der Vielfalt der Bilder und der Kühnheit seiner Gedankenspiele, dass ihm die lärmende Stadt wie eine Filmkulisse vorkam, durch die Tausende von Komparsen wie aufgedreht mit ihren Taschen und Tüten hetzten. Du darfst jetzt nicht abheben, ermahnte er sich selbst, als er im Taxi nach Hause saß. Nur wenn du gelassen bleibst, wirst du die richtigen Entscheidungen treffen. Um sich in dieser wichtigen Phase vor unbedachten Handlungen zu schützen, belegte er sich für den Abend mit einem Alkoholverbot.
Den Frühstückstisch deckte Hösch am nächsten Morgen, obwohl er allein war, mit einer Liebe zum Detail, die er auch als Symbolik für die Mühe verstand, mit der er im Laufe des Tages seine Gedanken ordnen wollte. Wie das Besteck zu den Tellern passte, die Tasse zur Kaffeekanne und der Set zur Farbe der Kerze, sollte sich eine Idee so harmonisch zur anderen fügen, dass am Ende ein vernünftiger und gleichzeitig verheißungsvoller Entschluss herauskam. Hösch, normalerweise ein unordentlicher Mensch, verbreitete eine Aura penibler Feierlichkeit um sich, in der sich ein schludriger Umgang mit Plänen und Perspektiven verbot. Und es stand für ihn fest, dass er sich heute, einen Tag vor Heiligabend, entscheiden würde.
Hatte er, wie der Reporter Georg Hartmann, den Mut, mitten aus einem Kriegsgebiet zu berichten? Konnte er, wenn er als Fernsehjournalist scheiterte, zumindest als freier Mitarbeiter zum Abend-Kurier zurückkehren? War er in der Lage, eine finanzielle Durststrecke durchzustehen? Hösch verfasste einen Katalog mit acht zentralen Fragen und setzte für jeden Aspekt eine Punktzahl zwischen null und zehn fest. Würde er mindestens vierzig Punkte erreichen, so hieß sein Ziel: Fernsehen. Dass ein solcher Entschluss trotz aller Abwägungen mit einem Risiko behaftet blieb, war ihm klar. Aber in diesem Risiko lag ja auch ein Reiz.
Das Telefon klingelte. Hösch vermutete, dass es Monika war. Sie würde ihn fragen, ob er mit ihr heute Abend essen gehen wolle. Sein Blick streifte das Bild, das auf seinem Schreibtisch stand und Monika in der Gondel eines Riesenrades zeigte. Was für ein herzhaftes Lachen sie hatte! Er griff zum Hörer, nahm ihn aber nicht ab.
68 Punkte! Das Ergebnis elektrisierte ihn. Du musst ruhig bleiben, sagte er sich, weiter ganz systematisch vorgehen. Als er sich wieder mit einem Mikrofon auf einem Schlachtfeld sah und «Lutz Hösch, Flash TV, Hebron» sagen hörte, drehte er mit dem Daumen und dem Zeigefinger symbolisch an seiner Stirn, als wolle er einen Fernseher ausschalten. Er beschloss, alle Verabredungen zum Weihnachtsfest, auch den Besuch bei seinen Eltern, abzusagen. Die praktischen Schritte, die nun notwendig waren, verlangten volle Konzentration, und den Triumph darüber, seinem Leben endlich eine Wende gegeben zu haben, wollte er ganz allein auskosten. Als Erstes rief er zu Hause in Schutterfeld an.
«Ja, hier Ludwig Hösch.»
«Hallo, hier ist Lutz.»
«Na, das wird aber auch Zeit, dass du mal wieder anrufst! Deine Mutter und ich, wir haben mal nachgerechnet: Seit siebenundzwanzig Tagen hast du dich nicht gemeldet.»
«Ich hatte viel zu tun.»
«Viel zu tun, viel zu tun … So viel hat doch keiner zu tun, dass er nicht mal seine Eltern anrufen kann!»
«Weihnachten kann ich leider auch nicht kommen. Ich komme dann gleich im neuen Jahr vorbei. Dann bring ich auch die Geschenke mit.»
«Was? Du kannst Weihnachten nicht kommen? Wir haben Weihnachten doch immer gemeinsam gefeiert! Deine Mutter hat schon den Fasan eingekauft!»
«Ich kann es nicht ändern. Ausgerechnet über Weihnachten hat die Polizei eine Drogenrazzia angesetzt.»
«Was hast du denn mit Drogen zu tun?»
«Ich berichte über die Razzia – für den Abend-Kurier. Ich bin Reporter.»
«Ja, ja, die Reporter … Bei uns stand in der Heimatzeitung, wir hätten nach dem Orkan das Dach des Gymnasiums zu spät wieder gedeckt. Da ist kein Wort wahr dran!»
«Also dann, frohe Weihnachten.»
«Es ist das erste Mal, dass du zu Weihnachten nicht kommst!»
An dem Dialog mit seinem Vater interessierte Hösch im Grunde nur das Ergebnis: Es war ihm gelungen, sich vor den unseligen Ritualen zum Weihnachtsfest zu drücken, und die Ausrede, die ihm diesen Vorteil verschafft hatte, schien ihm auch geeignet, sich von dem Abendessen mit Monika zu befreien. Wie sollte das schon ablaufen? Er würde sich seine berufliche Zukunft ausmalen und Monika würde ihn genervt fragen: Woran denkst du bloß schon wieder? Nein, er hatte keine Lust, diesen bedeutenden Tag in einer aggressiven Stimmung ausklingen zu lassen.
Um ein Telefongespräch mit Monika zu vermeiden, ersann Hösch einen Plan, den er selbst als perfide empfand, aber auch als günstige Gelegenheit begriff, sich schon mal in den Skrupellosigkeiten einzuüben, die ihm, sollte sich sein Traum erfüllen, sicher auch bei der Jagd nach News abverlangt würden. Hösch wusste, dass Monika, die mit dem Frühzug zu ihrer Schwester reisen wollte, am Nachmittag in ihrem Kindergarten eine Weihnachtsfeier hatte. Ihre Abwesenheit, so sein Kalkül, war ein perfekter Vorwand, das Abendessen durch ein Fax abzusagen.
Er schrieb: «Liebe Monika! Leider konnte ich dich heute Nachmittag telefonisch nicht erreichen. Ich muss dir daher auf diese doch sehr unpersönliche Weise mitteilen, dass wir uns heute Abend nicht treffen können. Die Polizei hat für 17.00 Uhr eine Razzia in der Drogenszene angesetzt, die sich bis in den Morgen hinziehen wird. Als Polizeireporter bin ich natürlich gezwungen, über diese Razzia zu berichten. Wenn du von deiner Weihnachtsfeier zurückkommst, renne ich also hinter irgendwelchen bewaffneten Polizisten her, und wenn du morgen früh im Zug sitzt, sitze ich vermutlich im Polizeirevier bei einer Pressekonferenz. Sorry, Monika, sorry! Aber ich kann es nicht ändern. Ich rufe dich Weihnachten bei deiner Schwester an. Viele Grüße und tausend Küsse! Dein Lutz.»
Die wahrscheinlichste Reaktion, so kalkulierte Hösch, würde tiefe Enttäuschung sein. Dies würde Monika sicher so stark paralysieren, dass sie zu einem Kontrollanruf auf seinem Handy nicht mehr fähig war. Er sah Monikas Bild vor sich auf dem Schreibtisch. Ihre langen blonden Haare wehten im Wind. Mit einer Hand winkte sie ihm, dem Fotografen, zu. Mit der anderen umklammerte sie die Eisenstange der Gondel. Dieses Lachen … Er zögerte kurz, das Fax abzuschicken. Aber dann drückte er doch auf «Start».
Auch bei Flash TV wollte er sich per Fax bewerben. Ein Brief konnte bei einer Fernsehstation, die zu jeder vollen Stunde die neuesten Nachrichten präsentierte, altmodisch wirken. Und ein Anruf war zu aufdringlich. Auf jeden Fall musste der Text so originell sein, dass er unter den vielen Bewerbungen, die sicher täglich bei diesem Unternehmen eingingen, sofort auffiel.
Flash TV hatte in Hemsburg seine Zentrale. Über die Eröffnung des Senders im vergangenen Jahr hatte der Abend-Kurier ausführlich berichtet. Chefredakteur Hans Mangold war in der Medienszene der Stadt eine Größe. Das war sein Adressat.
Hösch formulierte: «Flash!!!! – Ja: Es hat bei mir wie der Blitz eingeschlagen, als ich neulich in Ihrem Sender eine Reportage aus Hebron sah. Kann ich das auch? Ich weiß es nicht. Aber ich würde es gerne ausprobieren. Ich arbeite zur Zeit als Polizeireporter beim Abend-Kurier, und es drängt mich nach einer neuen Herausforderung. Geben Sie mir eine Chance? Wenn ja: Ich wäre umgehend zur Stelle, blitzartig sozusagen – oder besser: wie ein Flash!!!!»
Wieder drückte Hösch bei seinem Faxgerät auf «Start».
«Erfolg», meldete der Computer.
Das Telefon klingelte. Monika? Und wenn es Hans Mangold war, der Chefredakteur von Flash TV? Es könnte doch sein, dass er gleich nach dem Empfang der Bewerbung zurückrief. Hösch sah sich gezwungen, den Hörer abzunehmen. Mehr als ein Ja brachte er nicht heraus. Der Teilnehmer am anderen Ende der Leitung blieb stumm, legte aber auch nicht auf. Die Stille zerrte an seinen Nerven.
«Monika …?»
Aus dem Klang der Frage war die Hoffnung herauszuhören, dass sich diese Vermutung nicht bestätigen möge. Für ein paar Sekunden herrschte diese bedrückende Stille. Dann hörte Hösch ein Schluchzen, und der Anrufer legte den Hörer auf die Gabel; nicht aggressiv, eher zögernd, vermutlich verzweifelt. Keine Frage: Es war Monika.
Hösch rief ihre Nummer an. Sie nahm den Hörer nicht ab. Er versuchte es noch einmal, vergebens. Mit einem Signal, das die Beklemmung in Erwartung umschlagen ließ, kündigte der Computer ein Fax an. Hösch las: «Haben Sie Dank für Ihr Fax. Erwarte Sie am 2. Januar, 9.30 Uhr, in meinem Büro. See you. Dr. Mangold, Chefredakteur, Flash TV.»
3
Sie brauchen sich gar nicht erst zu setzen», sagte Hans Mangold, als er Hösch vor seinem Schreibtisch mit einem Handschlag begrüßte, dessen Wirkung er genau kontrollierte. Als er spürte, dass der junge Mann den kräftigen Druck als Geste der Herzlichkeit verstand und nicht, wie beabsichtigt, als Zeichen von Autorität und Entschlussfreude, zog er seine Hand abrupt zurück. Diesen Bruch, der ihn von der Berührung befreite und damit auch körperlich den Abstand zwischen dem Hierarchen und dem Bewerber wiederherstellte, unterstrich er durch ein ruckartiges Abwenden des Kopfes, das Hösch an die eckigen, seelenlosen Bewegungen der Tangotänzer erinnerte, die er vor einigen Jahren als Volontär bei einem Turnier in der Schutterfelder Stadthalle beobachtet hatte.
Hösch begriff die abweisende Körpersprache schnell. Er hielt gebührenden Abstand, als ihn der Chefredakteur zum Frontfenster seines Büros führte, wo er die Jalousie wie einen Theatervorhang öffnete.
«Das da unten», sagte Mangold kühl, «ist die Prinzenallee. Sie ist ungefähr vier Kilometer lang und eine echte Hauptstraße. Es ist jetzt kurz nach halb zehn. Um elf Uhr sehen wir uns – falls es sich dann für Sie noch lohnt – in meinem Büro wieder. Sie haben also fast anderthalb Stunden Zeit, auf der Prinzenallee nach Themen zu suchen. Ich erwarte fünf Vorschläge von Ihnen. Wichtig ist, dass Sie Storys ausgraben, verstehen Sie: Storys!»
Hösch war für einen Moment wie gelähmt.
«An Ihrer Stelle», ermahnte ihn Hans Mangold, «würde ich hier keine Wurzeln schlagen. Jede Minute zählt.»
In diesem Augenblick wurde Hösch klar: Heute Vormittag geht es um alles oder nichts.
Fußgänger, Häuser, Reklame, Marktstände, Presslufthämmer, Autos, Fahrräder, Gehupe, Geklingel, Geschwätz: Hösch taumelte auf die Straße und die Elemente der pulsierenden, nach den vielen Feiertagen wie befreit aufbrausenden Stadt vermengten sich für ihn zu einem verwirrenden optischen und akustischen Brei. Natürlich, zwanzig, dreißig, vierzig Storys hielt diese Meile parat, aber wo sollte er anfangen mit seinen Recherchen? In einem der Bürotürme, wo vielleicht gerade ein spielsüchtiger Buchhalter einen Firmenscheck zu seinen eigenen Gunsten fälschte? In einem der Hotels, wo ein Popstar womöglich seine Frau mit einer Geliebten betrog? Da drüben in der Zentrale des Mineralöl-Konzerns, wo der Vorstand vermutlich die nächste Erhöhung des Benzinpreises beschloss?
Nein, diese wie Burgen abgeschotteten Glaspaläste nach Themen zu durchforsten wäre, gemessen an der Zeit, die ihm zur Verfügung stand, viel zu aufwendig und riskant. Pförtner und Sicherheitsbeamte würden sich ihm schon am Anfang seiner Erkundungen in den Weg stellen, nach Ausweisen und Terminabsprachen fragen, ihn in Diskussionen oder Dispute verwickeln, ihre Vorgesetzten informieren, am Ende gar die Polizei rufen.
Es verstrichen drei, vier wertvolle Minuten, bis die Konfusion jener Kälte wich, mit der Hösch vor Weihnachten schon seine Freundin Monika und seinen Vater abgewimmelt hatte. Er analysierte die Lage. Du musst dich, sagte er sich, auf einen überschaubaren Sektor der Prinzenallee konzentrieren und dort alles auf Storys abklopfen, was aus dem Rahmen fällt und dich und damit auch deine Zuschauer neugierig macht. Hatte er an «Zuschauer» gedacht? Nicht mehr an Leser?
Der Straßenmusikant, der gegenüber in der Kaufhauspassage melancholische Lieder zur Ziehharmonika sang – woher mochte der kommen? Mit einem Schwung, der den bärtigen Mann auf ihn aufmerksam machte, ließ Hösch einen Zehn-Euro-Schein in die Öffnung des Hutes segeln, neben dem ein ausgemergelter Hund döste. Als der Musiker seinen Vortrag für ein «Dankeschön» unterbrach, nutzte Hösch seine Chance.
«Sind Sie Russe?», fragte er.
«Ja, ich komme aus Moskau.»
«Moskau ist eine schöne Stadt.»
«Ja, eine schöne Stadt. Aber es gibt auch viele arme Leute in Moskau. Ich war an einem Operettenhaus engagiert. Vor einem Jahr hat es Pleite gemacht.»
«Und nun treten Sie in Deutschland auf …»
«Ja, auf dem Bürgersteig.»
Hösch formulierte im Kopf: Vom Operettenkönig zum Bettelmann – eine russische Tragödie. Story Nummer eins. Er blickte auf seine Uhr. 9.40 Uhr. Eine Stunde und zwanzig Minuten vor der Deadline.
An einer Baustelle beobachtete Hösch, wie sich die Arbeiter lautstark mit einem Trupp von Handwerkern stritten, die Kabeltrommeln von einem Lastwagen luden. Er bat einen dieser Männer um Feuer und fragte ihn beiläufig nach dem Grund des Konfliktes.
«Das sind doch Idioten», schimpfte der Handwerker: «Wir liefern heute die Kabel und die haben schon gestern die Gräben wieder zugeschüttet. Jetzt muss die ganze Straße noch mal aufgerissen werden.»
Hösch notierte die Story Nummer zwei: Kabelkrieg auf der Prinzenallee – Hemsburgs jüngster Schildbürgerstreich. 9.51 Uhr.
Er hatte sich kaum mehr als hundert Meter von der Baustelle entfernt, als er vor der Katharinen-Kirche auf eine Gruppe von Menschen stieß, die stoisch einen vor dem Portal aufgebauten Informationsstand umrundeten und dabei die Fotos eines afrikanischen Ehepaares und seiner beiden Kinder vor sich her trugen. «Hände weg von Familie Nogombo!» stand unter einem der Bilder, «Gott kennt keine Grenzen» neben einem anderen.
Hösch gab sich sofort als Journalist zu erkennen und ließ sich von einem der Demonstranten den Hintergrund der Aktion erläutern: Der Familienvater habe einen Imbiss besessen, den ihm rechtsradikale Jugendliche niedergebrannt hätten. Damit sei Jonathan Nogombo seiner Existenzgrundlage beraubt worden, und ausgerechnet das habe die Ausländerbehörde zum Vorwand genommen, ihn in seine Heimat Eritrea abzuschieben, wo ihm, da er dort zur politischen Opposition gehöre, die Todesstrafe drohe. Der Pfarrer der Gemeinde habe der Familie, übrigens gegen den Willen des Kirchenvorstandes, für einige Tage Asyl gewährt. Sollte die Polizei anrücken und versuchen, in das Gotteshaus einzudringen, würde man Widerstand leisten. Hösch warf einen flüchtigen Blick in das Innere der Kirche, wo sich die Familie neben dem Altar auf einer Decke ausgebreitet hatte und in stummer Verzweiflung auf eine Entscheidung wartete. Würde das spärliche Kerzenlicht ausreichen, um das Elend mit der Kamera einzufangen? Brauchte man eine Genehmigung der Kirchenleitung, wenn man hier drehen wollte? Wie viel Honorar müsste man der Familie zahlen? War eine Quittung nötig?
10.02 Uhr. Hösch notierte die Schlagzeile für die dritte Story: Nur Jesus hält zu Jonathan – Wann stürmt die Polizei Sankt Katharinen?
Seine vierte Story entdeckte Hösch am Schaufenster einer Zoohandlung. Ein Aushang verwies auf eine Gesetzesänderung, nach der ältere Menschen Zuschüsse von ihrer Krankenkasse bekamen, wenn sie sich gegen ihre Vereinsamung einen Hund, eine Katze oder einen Vogel zulegten. Mühelos filterte er aus dem umständlichen Text eine griffige Schlagzeile heraus: Wenn Waldi wunde Seelen heilt – Haustiere als Therapeuten. Seine Uhr zeigte 10.12.
War er vor einer knappen halben Stunde noch der Verzweiflung nahe gewesen, weil er keine Ordnung in die Flut der Eindrücke bringen konnte, so begann Hösch nun den Triumph auszukosten, den er der Rückbesinnung auf seine journalistischen Tugenden verdankte: seiner Besessenheit, seinem Instinkt für das Wesentliche und nicht zuletzt seiner ausgeprägten Neugier, die ihn schon als Volontär beim Schutterfelder Kreisanzeiger durch die Straßen seines Heimatstädtchens getrieben hatte, wo er, stets auf der Suche nach dem Extrem, menschliche Abgründe und menschliches Glück aufspürte, auf jeden Fall aber Stoff für irgendeine Story. Vier Geschichten, allesamt geeignet für ein Massenpublikum, hatte er hier auf der Prinzenallee in Rekordzeit zusammengetragen. Aber was ihm zur Krönung seiner Recherchen noch fehlte, war ein Knüller, ein Scoop, der Hans Mangold vollends von seinen Qualitäten überzeugen würde.
Etwa eine Dreiviertelstunde blieb ihm noch bis zum schicksalhaften Rapport beim Chefredakteur. Bevor er sich auf die letzte Etappe begab, genoss Hösch für ein paar Sekunden das Machtgefühl, das ihn beim Blick auf die vor Leben strotzende, von der Wintersonne in warmes Licht getauchte Allee überkam. Alles, was sich auf dieser Meile abspielte, ordnete er seiner selektiven Fantasie unter: Er, Lutz Hösch, entschied, was und wer es wert war, zum Gegenstand oder zum Helden einer Story zu werden.
Wo ein paar heruntergekommene Wohnblocks das im Ganzen elegante Bild der Prinzenallee beeinträchtigten, fiel Hösch eine Reihe von Fenstern auf, in denen, zu Herzen oder Amorpfeilen geformt, am helllichten Tage bunte Glühlämpchen blinkten. Die Namen neben den Klingelknöpfen im Torbogen ließen darauf schließen, dass die Bewohnerinnen aus slawischen Ländern stammten: Dorota, Natascha, Maria, Anja, Raissa … War das nicht das Grundstück, das die Polizei im vergangenen Jahr monatelang observiert hatte? Und war die geplante Razzia nicht in letzter Minute mit der Begründung abgesagt worden, der Verdacht, die Russenmafia betreibe hier ein illegales Bordell, habe sich nicht erhärtet?
Hösch, der einen ausgeprägten, vielleicht sogar, wie er manchmal befürchtete, selbstzerstörerischen Hang zu den Niederungen der Gesellschaft hatte, witterte, als er auf das Klingelbrett starrte, die große Story, die er noch brauchte. Auch die Vorstellung, dass ein Schritt über die Schwelle der Eingangstür genügte, um ihn aus der gesitteten Sphäre der Prinzenallee in das vulgäre Ambiente eines Bordells zu katapultieren, übte auf ihn einen unwiderstehlichen Reiz aus. Dass er durch diese zeitraubende und womöglich erfolglose Aktion sein gesamtes Projekt gefährden könnte, dieser Gedanke kam ihm nicht in den Sinn. Und wie ein Drogenabhängiger, Trinker oder Spieler im Zustand höchster Erregung zu gezieltem Handeln fähig ist, wenn es nur der Befriedigung seiner Sucht dient, prüfte auch Hösch, bevor er einen der Vornamen auswählte, seine Geldreserven. Dann entschied er sich für «Maria», weil er, würde eine Story dabei herausspringen, die Unschuld dieses Namens dramaturgisch gegen die Brutalität des Milieus ausspielen konnte. Seine Uhr stand auf 10.18 Uhr, als er den Klingelknopf drückte.
Maria Lubanski empfing ihren Freier – er war der vierte an diesem Vormittag – in einem Morgenrock aus durchsichtiger, zartblauer Seide. Sie kam aus dem polnischen Städtchen Jelenia Góra, war vierundzwanzig Jahre alt und schlank. Aufdringlich war eigentlich nur ihr Outfit. Ihr Haar hatte sie rot gefärbt, ihre Fingernägel in den schrillsten Farben lackiert. Sie trug gewaltige Ohrringe und hochhackige Stiefel, bewegte sich mit trippelnden Schritten und war, indem sie ihre Lippen unnatürlich schürzte, um einen lasziven Gesichtsausdruck bemüht. Aber so sehr sie zumindest äußerlich dem Klischee einer aufgedonnerten Hure entsprach: Es haftete ihrer Erscheinung etwas Zerbrechliches und Hilfloses an, ein Geheimnis, das Hösch weitaus mehr reizte als die schwüle Erotik des mit Peitschen und Dessous drapierten Zimmers.
Wie ein Sprechautomat leierte Maria Lubanski ihr sexuelles Angebot herunter: «Massage vierzig Euro, Französisch fünfzig. Ficken zwei Preise: du unten, ich oben, sechzig Euro; du oben, ich unten, fünfundsiebzig Euro.»
Hösch war amüsiert, dass Maria das ordinäre Wort «ficken» radebrechend wie «fieken» aussprach, und er war froh darüber, dass sich seine Verkrampfung durch diesen liebenswerten Lapsus ein wenig löste.
«Warum», fragte er, «gibt es für die beiden Stellungen unterschiedliche Preise?»
«Wenn Frau unten und Mann oben», antwortete Maria, «Körper dichter beieinander, als wenn Frau oben und Mann unten.»
Nähe, dachte Hösch, kostet also extra. Da ihn ohnehin nur seine Story interessierte, zählte er vierzig Euro ab und sagte: «Na gut, Massage.»
Während Maria ihn wortlos massierte, schwenkte er mit den Augen systematisch die Wände nach Motiven ab. Zwischen einem mit Rüschen und Pailletten verzierten Slip und dem grauen Kleiderspind entdeckte er ein Kruzifix. In diesem spärlich beleuchteten und mit Sexsymbolen überfrachteten Zimmer fiel es kaum auf, aber Höschs optische Fantasie wurde sofort beflügelt, weil sich das Kreuz aus seinem Blickwinkel in einer Achse mit Marias Kopf befand. Wenn sie sich etwas heftiger bewegte, wurde das Kruzifix immer wieder von ihrer Frisur abgedeckt und wieder freigegeben. Mein Gott, dachte er, wenn ich jetzt eine Kamera bei mir hätte! Man könnte den Sturz aus der Unschuld ins Verderben mit einer einzigen Einstellung symbolisieren.
Um 10.39 Uhr hatte Hösch sich wieder angekleidet. 21 Minuten blieben ihm also noch bis zu seinem Termin mit dem Chefredakteur. Etwa zehn Minuten würde er für den Weg zur Fernsehstation brauchen. Für die Recherche, den Zweck seines Besuches, hatte er nur noch elf Minuten Zeit. Er musste aufs Ganze gehen, sofort. Hösch zog hundert Euro aus seinem Portemonnaie und reichte sie Maria, die auf dieses Geschenk überrascht reagierte, weil sie wusste, dass ihr Service nicht mehr gewesen war als Routine.
«Du warst gut», heuchelte Hösch. Mit einer Stimme, die einfühlsam klingen sollte, fügte er hinzu: «Ich bin Reporter. Ich beschäftige mich mit dem Thema Menschenhandel. Und ich glaube, dass ich bei dir an der richtigen Adresse bin. Mich interessiert dieses Thema nicht nur als Journalist, sondern auch als Mensch. Ich finde, dass ich auch die moralische Pflicht habe, etwas gegen diese Ausbeutung zu tun …»
Maria Lubanski begann zu zittern.
Hösch strich ihr über den Arm. Es war das erste Mal, dass er sie während seines Besuches berührte. «Ich werde dich nichts fragen, sondern nur ein paar Behauptungen aufstellen. Wenn ich etwas Falsches sage, schüttelst du einfach den Kopf, das reicht. Okay?»
Maria zündete sich eine Zigarette an. Um ein paar Sekunden zu gewinnen, zog sie die Farbe auf ihren Lippen nach. Ihre Hände zitterten noch immer und sie verirrte sich mit dem Stift mehrere Male auf ihr Kinn, wo das Rot kleine Zickzackkurven hinterließ. Spuren der Verzweiflung, formulierte Hösch, und er hörte Josef Meinert, den Kollegen aus dem Feuilleton, urteilen: Kitsch, Hösch, Kitsch! Er griff nach Marias Händen, blickte ihr fest in die Augen und sprach sie – was ihm selbst bei vertrauten Menschen schwer fiel – mit ihrem Vornamen an: «Maria, hör mir zu: Was immer du jetzt tust – du gehst dabei kein Risiko ein. Sollte ich eines Tages über dein Schicksal berichten, dann bleibst du anonym. Und ein paar tausend Euro sind auch für dich drin. Dann hast du endlich mal Geld, das du nicht deinem Zuhälter geben musst. Ist das okay?»
«Ist okay», antwortete Maria.
Hösch, dem die Zeit davonrann, spulte mit äußerster Konzentration seinen Katalog an Mutmaßungen ab: «Du stammst aus dem Osten Europas, wahrscheinlich aus Polen. Du bist auf eine Anzeige hereingefallen, die in Deutschland guten Verdienst als Kellnerin versprach. Die Männer, die dich nach Hemsburg gebracht haben, haben dir den Pass abgenommen und dich in dieses Bordell gesteckt. Für den Fall, dass du abhauen willst, haben sie dir angedroht, dir die Knochen zu brechen.»
Bei keinem der Punkte schüttelte Maria den Kopf. Hösch schloss daraus, dass er mit seinen Vermutungen zu hundert Prozent richtig lag.
«Du musst keine Angst vor mir haben», versicherte er Maria Lubanski, als er ihr Zimmer um 10.49 Uhr verließ. Er rannte, das Rot der Ampeln ignorierend, die Prinzenallee hinunter und entwarf in bewegenden Bildern das Porträt einer gefallenen Frau: Maria bei der Kommunion, Maria mit der Schultüte, Maria in den Fängen der Russenmafia. Vom Christuskreuz in der Kirche, dachte er, könnte man überblenden auf das Kreuz in ihrem Bordellzimmer, vom verträumten Antlitz des Mädchens umschneiden auf das durch Schminke entstellte Gesicht der Hure.
Als er in den Fahrstuhl der Flash-TV-Zentrale stieg, spürte er gleichzeitig das wohlige Gefühl des Erfolgs und die Angst vor dem Scheitern. Noch ist nichts entschieden, sagte er sich. Nichts!
4
Hans Mangold war ein Seiteneinsteiger. So nannte man in seinem Gewerbe die Kollegen, die nicht von Anfang an eine journalistische Karriere angestrebt, sondern zunächst in anderen Berufen gearbeitet hatten: als Juristen, Buchhändler, Gastwirte, Lehrer oder auch als Lastwagenfahrer. Mangold hatte Literatur mit dem Schwerpunkt deutsche Lyrik studiert und sich danach ein paar Jahre als Assistent eines Professors nützlich gemacht, bei dem er über den expressionistischen Dichter Georg Trakl promovierte. Dessen Selbstmord, begangen aus Erschütterung über seine Erlebnisse in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs, diente Mangold noch heute, wenn seine akademischen Freunde ihn am Stammtisch wegen seiner «unterirdischen» Sendungen kritisierten, als Rechtfertigung für den Gleichmut, mit dem er die brutalsten Katastrophen-Szenarien ertrug und ins Programm hob. «Soll ich denn enden wie Trakl?», rief er dann pathetisch in die Runde, und das Echo («Hans, du bringst die Dimensionen durcheinander!») folgte so zuverlässig, dass es irgendwann zum Ritual verkümmerte, dem sich keine Diskussion mehr anschloss, sondern ein von lautem Männerlachen begleiteter Trinkspruch: «Auf dem Teiche schwimmt eine Leiche, ihr Arsch ist bemoost – Prost!»
Mit dem Medium Fernsehen war Hans Mangold zum ersten Mal in Berührung gekommen, als er bei einem öffentlich-rechtlichen Sender eine Diskussion über die Verfilmung von Romanen der Schriftstellerin Hedwig Courths-Mahler geleitet hatte. Die Leidenschaft, mit der er das Projekt gegen die hämische Kritik des Feuilletons verteidigte, hatte den Programmdirektor der Anstalt begeistert, der ihm daraufhin die Leitung der Kulturredaktion andiente, mit dem Auftrag, die einzig verbliebene Literatursendung auf Unterhaltung zu trimmen. Dies gelang Hans Mangold so überzeugend, dass das Management des neuen Privatsenders Flash TV auf ihn aufmerksam wurde. Innerhalb weniger Monate avancierte er in der Zentrale an der Prinzenallee vom Moderator des Boulevard-Magazins «Wundertüte» zum Chefredakteur der Redaktion «Aktuelles», deren Paradestück die tägliche News-Show «Flash» war. Die Geschäftsführung hatte ihm aufgetragen, den Markt durch infotainment zu erobern, einem Mix aus Nachrichten und bunter Unterhaltung.