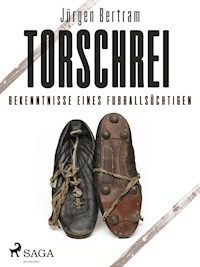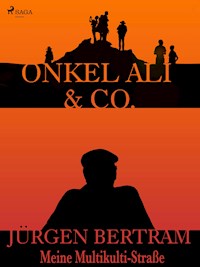
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Migranten: Es wird Zeit, die Menschen zu betrachten, nicht die Diskussion Multikulti: schon längst Realität unseres Alltags Fluch oder Segen – zwischen diesen Polen pendelt die Integrationsdiskussion. Jürgen Bertram, der als Fernsehkorrespondent selbst viele Jahre im Ausland verbrachte, sprach in seiner Hamburger Nachbarschaft mit den Bürgern, die sonst nur Gegenstand von Polemiken, Statistiken oder Seminaren sind. Das Ergebnis seines Spaziergangs durch die Kulturen sind spannende Lebensgeschichten und überraschende Erkenntnisse. »Deutschland schafft sich ab« – die Erregung, die Thilo Sarrazins These auslöste, begriff Jürgen Bertram als Anregung. Er streifte durch seine Straße im ganz normalen Hamburger Stadtteil Eimsbüttel und führte Gespräche mit den Menschen, um die es in der unvermindert heißen Integrationsdebatte geht. Ob er nun einen vietnamesischen Fischhändler kennenlernte, einen von islamischen Mitgliedern geprägten Boxklub oder eine kabylische Tänzerin – überall traf er auf fesselnde Lebensberichte und die Bereitschaft, dem Gastland etwas zurückzugeben. Aufklärung, aber keine Verklärung lautet das Credo seines Buches, das nicht für den Stammtisch bestimmt ist, sondern der Differenzierung dienen soll.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürgen Bertram
Onkel Ali & Co.
Meine Multikulti-Straße
Mit »Protokollen« vonHelga Bertram
Saga
Vorwort
Braucht mein Auto neues Öl, bedient mich der algerische Tankwart. Die Rosen zum Geburtstag kaufe ich beim pakistanischen Blumenhändler, das Obst und das Gemüse beim Türken gleich nebenan, den Rollmops und den Heringssalat beim Fischhöker aus Vietnam.
Meinen Schoppen am Abend lasse ich mir in der griechischen Schenke kredenzen. Will ich meinen Gästen einen besonderen Tropfen bieten, berät mich der Weingrossist aus Chile. Und zu den Polizisten, die in meinem Viertel Streife gehen, gehören ein bosnischer und ein kurdischer Beamter.
Man sieht: das Prinzip Multikulti, das so mancher Politiker bereits für gescheitert hält, gehört zur alltäglichen Praxis in meiner ganz normalen Straße. Sie liegt im Hamburger Durchschnittsbezirk Eimsbüttel, ist etwa einen Kilometer lang und nach dem hanseatischen Heimatdichter Gustav Falke benannt.
So selbstverständlich leben in der Gustav-Falke-Straße Menschen mit dem unterschiedlichsten kulturellen Hintergrund zusammen, dass vor allem die Bürger mit nichtdeutschen Wurzeln eines der am meisten verkauften Bücher der vergangenen Jahrzehnte, nämlich Thilo Sarrazins Traktat »Deutschland schafft sich ab«, als Beleidigung empfinden.
Niemand von ihnen bestreitet, dass es in der Bundesrepublik islamische Eltern gibt, die ihre Töchter zur Heirat zwingen, oder libanesische Gangs in den Problemvierteln Berlins ganze Häuserblocks kontrollieren, dass der frühere Finanzsenator und Bundesbanker also punktuell richtig liegen mag mit seinen Befunden. Was sie aber in Rage bringt, ist die bereits in dem provokanten Titel anklingende und vom Stammtisch gierig aufgegriffene Behauptung, es handele sich um eine allgemeine, mithin existenzielle Gefahr.
Für mich, den nach 13 Korrespondenten-Jahren in Asien ins Herz von Hamburg zurückgekehrten Journalisten, war die Aufregung um dieses Buch eine Anregung – mich nämlich mit der Frage zu beschäftigen, welchen Einfluss Bürger mit einem »Migrationshintergrund« auf das gesellschaftliche Leben in meinem Quartier ausüben und was sie auf sich nahmen, als sie ihre Heimat aus ökonomischen oder politischen Gründen verließen. Menschen, mit denen mich bisher ein Hallo-wie-geht’s-Verhältnis verband, lernte ich bei meinen Recherchen also endlich kennen.
Da die Straße, in der ich wohne, auch in den unauffälligeren Bezirken von Berlin, Frankfurt, Köln oder Hannover liegen könnte, sind meine Erfahrungen, wie ich glaube, repräsentativer als Thilo Sarrazins Thesen. Aufklärung, aber keine Verklärung – so lautet das Ziel meines Spaziergangs durch die Kulturen, zu dem ich den Leser einlade.
Dass ich mich nicht auf die von Thilo Sarrazin fokussierten Familien mit islamischem Hintergrund beschränke, hat einen einfachen Grund: Auch die Chilenen oder Griechen in meiner Umgebung empfinden sein Buch als Rundumschlag gegen »die Ausländer«. In einigen Fällen erzählen die Protagonisten ihre Geschichte in der Ich-Form. »Protokolle« nennt man diese literarische Variante, die aus den Extrakten langer Interviews besteht. Meine Frau Helga Bertram hat sie aus Tonbandaufzeichnungen zusammengestellt.
Hamburg, im Herbst 2011
Jürgen Bertram
I Eine anatolische Saga
1 »Hier bin ich, Mölln!«
Hüseyins Traum
Wovon träumt ein Hirte, der auf den Höhen Ostanatoliens für einen Hungerlohn Schafe hütet? Von einem Trecker träumt er, von einem dieser bulligen Gefährte, die, den Pflug im Schlepp und in eine Wolke aus Staub gehüllt, unten im Tale des Euphrat über die Äcker tuckern. Wie Musik, Zukunftsmusik, klingt das monotone Geräusch der Maschine in seinen Ohren. Denn einen Trecker zu besitzen, bedeutet: sein eigener Herr sein.
Aber wer sich Ende der sechziger Jahre selbständig machen will in dem Provinznest Erzincan, der muss seiner türkischen Heimat erst einmal den Rücken kehren und sich in das ferne Land begeben, in dem die Schlote rauchen, die jungen Frauen Minirock tragen und die Studenten einen Revolutionär namens Ho Chi Minh hochleben lassen.
Von Erzincan juckelt der Sohn, Ehemann, Bruder, Vater und Onkel mit dem Bus ins knapp zweitausend Kilometer entfernte Istanbul. Dort steigt er in den Zug nach München und anschließend in den nach Hamburg. Mit dem Lastwagen geht es noch einmal in Richtung Norden.
Vier Tage und vier Nächte dauert die Reise in die kleine Stadt in Schleswig-Holstein, in die eine Agentur in Istanbul den anatolischen Gastarbeiter vermittelte und für deren Finanzierung er sich bei seiner Verwandtschaft hoch verschuldete. Hier bin ich, Mölln! Ich, der Hirte Hüseyin Yldirim aus Erzincan – Ende zwanzig, acht Geschwister, drei Kinder, fünf Jahre Grundschule, kein Wort Deutsch, nichts gelernt, aber strotzend vor Kraft, Arbeitskraft.
Am liebsten würde sich Hüseyin Yldirim gleich nach seiner Ankunft, einem Freitag im Frühling, seinen Platz in der Gießerei ansehen, die ihn für zunächst zwei Jahre unter Vertrag nimmt. Aber der Betrieb ruht. Wie? Freitags arbeiten die Deutschen nicht? Hieß es in der Türkei nicht, sie seien so fleißig? Am Montag darauf regt sich immer noch nichts in der Firma. Und auch die Bäckereien, die er, mit seinen zwanzig Mark Begrüßungsgeld in der Tasche, in der Fußgängerzone des Kurortes abklappert, bleiben geschlossen. Was der Moslem nicht weiß: In der Bundesrepublik begeht man gerade eines der wichtigsten christlichen Feste. Von Karfreitag bis Ostermontag dauert es.
So häufig hat der Hirte, der auszog, um sich in Deutschland den Traum vom eigenen Trecker zu erfüllen, seiner Tochter Fetiye über seine ersten Tage in Mölln berichtet, dass es ihr nicht schwer fällt, uns die Geschichte bei türkischem Gebäck und Tee in allen Einzelheiten weiter zu erzählen. Fetiye gehört zu unseren Nachbarn in der Gustav-Falke-Straße in Hamburg-Eimsbüttel, einem Bezirk, der weder zu den sozialen Brennpunkten noch zu den Flaniermeilen der Schickeria gehört. In der gesellschaftlichen Mitte ankert er.
Mit ihrer Liebe zum Detail erweist sich unsere Nachbarin vom Haus Nummer 10 als Glücksfall für die Erkundungen in unserer Straße und ihrer unmittelbaren Umgebung. Denn vor allem im Alltag, in den Irritationen und Frustrationen, Erfolgen und Misserfolgen, Brüchen und Durchbrüchen, spiegelt sich eine Migranten-Existenz und nicht in Statistiken, Verordnungen oder gar biologistischen Thesen.
Am Dienstag nach Ostern wird also wieder gearbeitet in der Möllner Gießerei. Und als seine deutschen Kollegen ihm »Mahlzeit« zurufen, bedeutet das für den Arbeiter aus dem Osten Anatoliens: Endlich gibt’s wieder etwas Handfestes zu essen. Aber was ist das für Fleisch, das in der kleinen Kantine serviert wird? Lamm? Huhn? Kalb? Es könnte, da sich eine undefinierbare Masse auf dem Teller häuft, auch Schweinefleisch dabei sein. Und Allah, der Gott und Richter am Jüngsten Tag, verbietet dessen Genuss. Also: Finger davon lassen! »In seiner ersten Woche in Mölln«, berichtet Fetiye, die Tochter, »hat mein Vater aus Angst, er könnte gegen den Koran verstoßen, fast nur Brot gegessen – Brot und manchmal ein Ei dazu.«
Mit seiner Unterkunft, einem Raum mit sechs Betten, kommt der ostanatolische Gastarbeiter besser klar. Weil er mit leichtem Gepäck anreiste, benötigt er nicht viel Platz. »Sein Koffer«, erzählt seine Tochter, »war so klein, dass er gerade für ein wenig Proviant und die Unterwäsche ausreichte. Die Hose, die mein Vater an hatte, war die einzige, die er besaß. Und seine beiden einzigen Hemden trug er übereinander am Körper. Es herrschte eben extreme Armut bei uns auf dem Land.«
Zwischen fünfzig und sechzig Mark in der Woche zahlt die Gießerei ihrem türkischen Mitarbeiter. Das ist eine Menge Geld für einen Hirten, der vor seinem Aufbruch nach Deutschland heiratete und einen Sohn und zwei Töchter zu versorgen hat. Eines der Mädchen ist Fetiye, unsere heutige Nachbarin. Für sich selbst gibt Hüseyin Yldirim so gut wie nichts aus in Mölln. Umso mehr schmerzt es ihn, dass für jede Nutzung des gemeinschaftlichen Waschraums eine Mark fällig wird. Seine Überweisungen in die Türkei beschränkt er auf wenige Male im Jahr. Auf diese Weise reduziert er die Gebühren auf ein Minimum.
Die Nachrichten, die Hüseyin Yldirim aus der Heimat erreichen, werden immer dramatischer. Zunächst stirbt sein kleiner Sohn an einer Lungenentzündung. Ihm folgt die jüngere der beiden Töchter – plötzlicher Herztod. Und dann lässt sich seine Mutter, die weder lesen noch schreiben kann, einen Brief aufsetzen, in dem sie verkündet, dass auch Fetiye, die mittlere Tochter, immer kränker werde und kaum Überlebenschancen habe. In der Nachbarschaft raune man schon: eine Mutter, die so schwache Kinder zur Welt bringt, taugt wohl nichts. Der Brief schließt mit einem Hilferuf: Komm nach Erzincan! Komm sofort.
Als der Vater in seiner Heimat eintrifft, ist die kranke Tochter anderthalb Jahre alt – und, wie man ihr später berichtet, »schon halbtot«. Was ihrem Körper so zusetzt, weiß man nicht. In der medizinisch unterversorgten ostanatolischen Provinz hat der sozialdarwinistische Lehrsatz damals eine erschreckende Gültigkeit: Weil du arm bist, musst du früher sterben. Doch der frühere Hirte ersinnt einen Ausweg: eine Behandlung in Deutschland. Also verfügt der Patriarch vor seiner Rückreise: Fetiye kommt mit!
Den Traum vom eigenen Trecker gibt Hüseyin Yldirim keineswegs auf. Aber nun rückt erst einmal das schwerkranke Mädchen in den Mittelpunkt seiner Gedanken und Aktivitäten. Von einem türkischen Freund weiß er, dass die Bundesbahn in Hamburg dringend Personal für die Reinigung von Gleisen und Waggons sucht, und da es im Stadtteil Eppendorf ein bestens ausgestattetes Universitätskrankenhaus gibt, wechselt er den Arbeitgeber und den Wohnsitz. Im Zentrum der Hansestadt mietet er eine Einzimmer-Behausung. Im UKE, einem der renommiertesten Hospitäler der Bundesrepublik, stellen die Ärzte bei seiner Tochter endlich eine Diagnose: verschleppte Kinderlähmung. Acht, höchstens neun Monate war sie alt, als der erste Schub sie heimsuchte.
Jeden Tag besucht der Vater das Mädchen im UKE. Im Sommer 1971 kommt auch die Mutter nach Hamburg. Sie verdingt sich zunächst als Hilfskraft in einer Fischfabrik und später in einer Bäckerei. Im Leben der Tochter Fetiye, der in der ostanatolischen Heimat das Schicksal ihrer beiden Geschwister drohte, ist dieser Sommer ein Wendepunkt.
2 »Das Mädchen gehört aufs Gymnasium«
Fetiyes Aufstieg
Wie gut, dass es Fatma gibt. Fatma, benannt nach der jüngsten Tochter des Propheten Mohammed, ist zwanzig Jahre alt und gehört zu den Nachbarn der Familie Yldirim. Da auch sie unter einer Körperbehinderung leidet, die sie ans Haus bindet, hat sie genügend Zeit, sich gegen einen kleinen Lohn um die physisch und psychisch noch immer angeschlagene Fetiye zu kümmern. Deren Eltern, die ja beide arbeiten, nimmt sie damit eine große Last ab.
Die Existenz der jungen Frau bekommt durch die neue Aufgabe einen Sinn, und Fetiye geht es unter ihren Fittichen von Tag zu Tag besser. In einem Quartier direkt über dem Hamburger Obdachlosenasyl »Pik As« findet sich eine anrührende Schicksalsgemeinschaft, der auch jener kämpferische Pragmatismus innewohnt, den man sich in Überlebensgesellschaften aneignet und ohne den Behinderte ihren Alltag kaum meistern könnten.
Als Fetiye einen Bruder bekommt, ihre Familie also auf vier Personen anwächst, wird es zu eng in der Einzimmerwohnung. Diesmal ist es zunächst der Hamburger Kinderarzt, der die Initiative ergreift. Er schaltet eine städtische Sozialberaterin ein, die prompt eine größere Wohnung besorgt. »Zweieinhalb Zimmer«, schwärmt Fetiye noch heute, »das war für uns Luxus pur. Traurig war nur, dass wir unsere Fatma zurücklassen mussten.«
Auf jeden Fall werden sich Fetiyes Eltern so ganz allmählich eines der größten gesellschaftlichen Unterschiede zwischen ihrer alten und ihrer zweiten Heimat bewusst. Im Tale des Euphrat war es ausschließlich der Familienclan, der, wenn auch mehr schlecht als recht, für eine Absicherung sorgte. Im Sozialstaat Deutschland aber kann man sich, ohne sich als Bettler fühlen zu müssen, auch an eine Amtsperson wenden, wenn man Unterstützung benötigt. »Vor allem mein Vater«, erinnert sich unsere Nachbarin, »hat lange gebraucht, um dieses Prinzip zu begreifen. Und dass man seine Söhne und Töchter sogar für wenig Geld in einem Kindergarten unterbringen kann, hat er überhaupt nicht gewusst. Ich glaube, er war lange Zeit auch zu stolz, um staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.«
Auch Fetiye weiß, dass es nicht nur deutsche, sondern auch aus dem Ausland stammende Familien gibt, die den Sozialstaat durch ihre Raff-und-Schlaff-Mentalität in Gefahr bringen und sich damit unsolidarisch gegenüber den wirklich Bedürftigen verhalten. Aber das Beispiel ihrer eigenen Familie repräsentiert, wie mir mit dieser Materie vertraute Beobachter versichern, eine Mehrheit und nicht, wie man an manchen Stammtischen glaubt, die Ausnahme.
Statt sie der Obhut von Erzieherinnen anzuvertrauen, also für einige Stunden außer Haus zu geben, sinnt Fetiyes Vater darüber nach, wie seine Tochter und ihr kleiner Bruder am sichersten in der neuen, im vierten Stock gelegenen Wohnung aufgehoben sind, während die Eltern ihrer Arbeit nachgehen. Die Eisenstäbe, die er im Sperrmüll findet, bringt er in so dichten Reihen vor den Fenstern an, dass seine Kinder nicht hindurchschlüpfen können. Die Wohnungstüren verriegelt er. »Als die Sozialarbeiterin das entdeckte«, berichtet Fetiye, »bekam sie einen Schock. Sie sagte: ›Das ist ja wie im Gefängnis.‹ Sie sorgte dann dafür, dass wir endlich in den Kindergarten kamen. Wir wunderten uns, dass es da sogar was zu essen gab.«
»Und wie war das mit der Schule? Irgendwann mussten Sie und Ihr Bruder ja auch eingeschult werden ...«
»Ja, ja – das war meinen Eltern durchaus klar. Aber sie wussten nicht, wie man das anstellt. Da haben sie uns einfach Schultüten verpasst und uns zum nächsten Schulgebäude geschickt. Wir sind tatsächlich losmarschiert und haben uns zu den anderen Kindern gestellt. Alle wurden aufgerufen – nur wir nicht. Der Rektor hat gefragt: ›Was wollt ihr denn hier?‹ – ›Lernen‹, habe ich geantwortet. ›Aber ihr seid nicht angemeldet‹, hat der Rektor gesagt und uns weitergeschickt.«
Wo immer Fetiye und ihr Bruder auch um Einlass bitten – man kann nichts anfangen mit ihnen. Als sie am Ende ihrer kafkaesken Suche keinen Ton mehr herausbringen, weist man ihnen Plätze in einer Sonderschule zu. Allmählich überwinden die beiden ihre Scheu – und es stellt sich heraus, dass sie viel zu intelligent sind für das Untergeschoss des deutschen Bildungswesens. Durch die ständigen Besuche in der Arztpraxis und bei Behörden hat zum Beispiel Fetiye bereits so gut Deutsch gelernt, dass die Sozialberaterin den Eltern rät, das Kind nach den ersten Grundschuljahren auf eine höhere Schule zu schicken.
Gut, sagt der Vater: Dann geht sie eben auf die Realschule. Die liegt in unmittelbarer Nähe zu unserer Wohnung in der Neustadt. Also hat Fetiye es mit ihrer Gehbehinderung nicht so schwer. Und auch für uns Eltern ist das die günstigste Lösung. Nein, sagt die Sozialberaterin: Das Mädchen gehört aufs Gymnasium. Und ich fahre Fetiye jeden Tag mit meinem Auto dorthin und hole sie nach dem Unterricht wieder ab.
Als eine deutsche Mitschülerin sie zu sich nach Hause einlädt, empfindet Fetiye das als einen »ganz großen Moment«. Und auch die Überraschung, die sie während des Besuchs erlebt, wird sie nie vergessen. »Da ratterte in der Küche so ein merkwürdiges Ding. Ich fragte: ›Was ist denn das?‹ – ›Eine Waschmaschine‹, antwortete meine Freundin. Zu Hause habe ich das sofort meiner Mutter erzählt. Sie wusch ja die Wäsche der gesamten Familie noch mit der Hand – auch die schietigen Arbeitsklamotten meines Vaters. Irgendwann hatte sie keine Fingernägel mehr. Wir haben uns dann in einem Laden informiert, was eine Waschmaschine alles kann und was sie kostet. Aber mein Vater hat sich zunächst gegen einen Kauf gesträubt, weil er ja ständig an seinen Trecker dachte. Aber am Ende hat er sich doch überreden lassen.«
»Und das war’s dann endgültig mit dem Trecker?«
»Keineswegs. Es wurde weiter eisern gespart, kein Pfennig zu viel ausgegeben. Auch ein Telefon kam bei uns nicht ins Haus. Das war viel zu teuer. Wenn man aber mal mit der Tante in der Türkei sprechen wollte, dann lief das so ab: Man ging zum großen Postamt am Hauptbahnhof und meldete ein Gespräch nach Erzincan an, wo es in jeder Straße aber nur ein öffentliches Telefon gab. Meldete sich jemand am anderen Ende der Leitung, dann bat man, die Tante zu informieren, sie möge am nächsten Tag zu einer bestimmten Zeit für einen Anruf parat stehen. Dieses Gespräch verlief dann im Stakkato, in abgehackten Sätzen. Für irgendwelche Plaudereien blieb keine Zeit. Fünf Mark für ein Gespräch waren das absolute Limit. Mehr Geld nahm man gar nicht erst mit.«
Das Kommunikationszentrum der in Hamburg lebenden Türken ist damals wie heute die Wandelhalle des Hauptbahnhofs. »Wer geheiratet hat, wer gestorben ist ... Was in der Heimat passierte, das erfuhr man in dieser Halle. Es war auch ganz normal, dass man einem Wildfremden tausend Mark in die Hand drückte und ihn bat, das Geld irgendwo in der Türkei abzugeben. Ich habe nie gehört, dass etwas weggekommen ist.«
Als Fetiyes Familie um eine weitere Tochter wächst, teilen sich die Mädchen einen Schlafraum, und der Bruder zieht aufs Sofa um. Da die Mutter auch am Wochenende in ihrer Bäckerei arbeitet und der Vater bei der Bahn keine Sonderschicht auslässt, brauchen die Yldirims dringend jemanden, der ihren Alltag managt. Der Kinderarzt, wegen seiner medizinischen Fähigkeiten und seiner außerdienstlichen Fürsorge eine Respektsperson bei den Yldirims, ernennt Fetiye zum Boss. Sie füllt die Anträge aus, kümmert sich um ihre Geschwister, disponiert die Essensvorräte.
»Hat sich Ihr Vater, der ja aus der tiefen anatolischen Provinz stammt, gegen diesen Rollentausch gewehrt?«
»Nein, überhaupt nicht. Unsere Familie gehört der islamischen Reformgemeinde der Alewiten an. Und zu deren Zielen gehört die Förderung der Frauen. Auch die Bildung spielt bei den Alewiten eine zentrale Rolle.«
»Aber Ihre Mutter konnte doch, als sie die Türkei verließ, weder lesen noch schreiben ...«
»Man darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass die Familien im bitterarmen Osten Anatoliens viel größer sind als in Deutschland. Wenn man zehn Kinder hat, kann man meist nur ein Kind gezielt fördern. Meine Tante zum Beispiel hatte das Glück, mit Büchern aufzuwachsen. Aber natürlich sagten viele Männer im Dorf zu meinem Opa: ›Du wirst schon sehen, was du davon hast, das Mädchen etwas lernen zu lassen‹«.
Zwei neue Operationen werfen Fetiye, die erst mit sechs gehen lernte und noch immer Schwierigkeiten beim Treppensteigen hat, körperlich und seelisch und damit auch schulisch zurück. Wenn ihre Mutter sie im Krankenhaus besuchen will, verläuft sie sich ständig. »Sie kannte ja nur den kurzen Weg von unserer Wohnung bis zu ihrer Bäckerei. Aber dann hat sie ein Fahrer des Krankenhauses einmal in der Woche abgeholt. Sie blieb dann drei, vier Stunden und wurde anschließend wieder zurückgebracht. Es war ein christliches Krankenhaus. Auf diese positive Erfahrung ist wohl mein Faible für die Kirche zurückzuführen.«
Ende der siebziger Jahre, eine Dekade nach seiner Ankunft in Mölln, erfüllt sich für Fetiyes Vater endlich der Lebenstraum. Er hat nun soviel Geld beisammen, dass er sich bei einem Fachhändler vor den Toren Hamburgs einen Trecker kaufen kann. Um die Frachtkosten so gering wie möglich zu halten, schließt er sich mit einigen Landsleuten zusammen, die ebenfalls einen Traktor erworben haben. Per Sammelfracht werden die Gefährte auf eine weite Reise in die türkische Provinz geschickt. Hüseyin Yldirims Trecker erhält einen Ehrenplatz auf dem Grundstück, das sich die Familie mit den Ersparnissen ihrer in Deutschland arbeitenden Söhne und Töchter anschaffte.
Nur ein paar Jahre später erwirbt der ehemalige Hirte ein Fahrzeug, das seinen Stolz festigt. Knallrot, also nicht zu übersehen, ist der nagelneue VW-Golf, den er in bar bezahlt. »Wir gingen zur Bank«, erinnert sich seine Tochter, »und holten die 18000 Mark ab. Zu Hause zählten wir nach – und siehe da: Es waren 20000. Wir zählte und zählten. Es blieb bei 20000. ›Zieh dich wieder an‹, sagte mein Vater, ›wir bringen die 2000 Mark, die man uns zuviel ausgezahlt hat, zurück.‹ Ja, und da stand ich, das kleine Türkenmädchen, am Schalter und sagte zu dem Kassierer: ›Sie haben einen Fehler gemacht ...‹ Als ich dann die zwanzig Hundertmarkscheine hinblätterte, wusste der Mann immer noch nicht, wie ihm geschah.«
1992, ein Jahr nach ihrer Einbürgerung in Deutschland, macht Fetiye an der Hamburger Klosterschule ihr Abitur. »Ohne die Unterstützung durch ganz tolle Pädagogen, die auf meine Behinderung Rücksicht nahmen, hätte ich das nicht geschafft. Meine Lehrer für Latein und Mathematik haben manchmal Sonderschichten für mich eingelegt. Und in der Nähe des Hauptbahnhofs existierte ein Zentrum, in dem Studenten Kindern mit nichtdeutschen Wurzeln kostenlos Nachhilfeunterricht gaben.«
Im selben Jahr reist Fetiye in ihre ostanatolische Heimat und trifft dort Önder wieder, einen Spielkameraden aus ihren Kindertagen. Es ist eine schicksalhafte Begegnung.
3 »Ich liebe meinen Beruf«
Fetiye und Önder
Verliebt, verlobt ... aber auch: verheiratet? Als Fetiye und Önder verkünden, jene Gemeinschaft anzustreben, die man den Bund fürs Leben nennt, kommt plötzlich Skepsis auf im ostanatolischen Clan: Passen die 18 Jahre alte Abiturientin aus Hamburg und ihr zwei Jahre älterer Jugendfreund, der seine Heimat nie verließ, so die heiß diskutierte Frage, denn überhaupt zusammen?
Ginge es nach dem in Deutschland gängigen und auch nicht gänzlich unbegründeten Klischee, müsste Fetiyes Vater sagen: Dein Bräutigam hat eine gute schulische Ausbildung und als Besitzer einer kleinen Lederfabrik eine vielversprechende berufliche Zukunft. Also: nimm ihn! In Wahrheit aber sagt er: Als türkischer Mann wird er dich unterdrücken, an den Herd binden und die Unabhängigkeit, die du dir mühsam erkämpft hast, als Bedrohung empfinden. Also: lass es.
Es siegt – welch eine seltene Fügung – ein Bündnis aus Liebe, Pragmatismus und Einsicht. Fetiye und Önder lassen sich von der Ehe nicht abbringen, heiraten aber, aus Verbundenheit mit ihrer Heimat und im Einklang mit den traditionellen Bedürfnissen ihrer Verwandtschaft, in dem Städtchen Erzincan. Nachdem die auch von einem üppigen Mahl gespeiste Euphorie verklungen ist, analysiert der Bräutigam die Perspektive. »Fetiye«, erinnert er sich, »konnte ja kaum noch Türkisch. Und ich bekam mit, dass sie sich nicht zu Hause fühlte in dem Ort, in dem sie geboren wurde. Ich wusste, dass ich es in Deutschland schwer haben würde, aber für Fetiye wäre es unmöglich gewesen, sich in Erzincan zurechtzufinden.«
Das liegt auch an den archaischen Vorurteilen, die Fetiye bei ihrem Besuch nicht verborgen bleiben und die auch ihre Mutter bereits zu spüren bekam. »Ich merkte, dass die Menschen mich wegen meiner Behinderung als nicht vollwertig einstuften. Und ich hatte das Gefühl, dass sie von meinem physischen Zustand auf meine geistigen Fähigkeiten schlossen. Außerdem gab es genügend abschreckende Beispiele von türkischen Frauen, die in Deutschland aufgewachsen waren, nach ihrer Rückkehr in die Türkei heirateten und dort unglücklich waren. Nein: Ich wollte mich nicht sehenden Auges in einen Käfig begeben.«
Fetiye und Önder, noch ein ungleiches Paar, richten sich in Hamburg ein. Die Tochter des Hirten beginnt an der Universität der Hansestadt ein Studium der Erziehungswissenschaften. Nebenbei jobbt sie in der Verwaltung der Imbiss-Kette »Burger King«. Önder hilft, bevor auch er in dieser Firma anfängt, einem Cousin auf dem Großmarkt aus. Dabei vertieft er nicht nur seine Deutschkenntnisse, sondern lernt auch, wie man professionell mit Obst und Gemüse umgeht. Träumte sein Schwiegervater vom eigenen Trecker, so teilen Fetiye und Önder nun den Traum vom eigenen Laden.
Sich selbständig machen, gemeinsam etwas aufbauen, keinem Vorgesetzten verantwortlich sein – so stark beseelt sind auch die Eheleute aus dem Osten Anatoliens von diesem urmenschlichen, über allen Kulturen stehenden Impuls, dass die beiden die Karriere-Offerte ihres Arbeitgebers ablehnen. Stattdessen greifen sie 1994 sofort zu, als ihnen ein Verwandter anbietet, sein Geschäft im bürgerlichen Hamburger Stadtteil Alsterdorf zu übernehmen. In der multikulturell ausgerichteten Himmelstraße befindet sich der Laden.
Auf die Hilfsbereitschaft, die sie in Hamburg schon während ihrer von gesundheitlichen Rückschlägen geprägten Jugend erfuhr, kann sich Fetiye auch verlassen, als es darum geht, Studium und Beruf einigermaßen in Einklang zu bringen. So lösen sich nach der Geburt ihres Sohnes Beritan die Nachbarn in der Aufsicht des Kindes ab. »Die haben«, berichtet Fetiye, »einen regelrechten Dienstplan ausgearbeitet. Als Gegenleistung habe ich mir geduldig die Sorgen meiner Kunden angehört. Einer hat mal gesagt: ›Das geht hier zu wie in der psychotherapeutischen Praxis. Demnächst stelle ich dir eine Couch in den Laden‹.«
Die Uni, das Geschäft, das Kind – irgendwann wird die Dreifachbelastung für Fetiye trotz der nachbarschaftlichen Hilfe zu viel. Sie macht Abstriche beim Studium und verlagert ihre Forschungen auf den komplexen Alltag in ihrer Umgebung. Dabei stößt sie auch auf ein Phänomen, das zu den Schattenseiten der Absetzbewegung in Richtung Bundesrepublik gehört. »In einem der Eingänge neben unserem Geschäft flackerten auch tagsüber rote Lämpchen. Junge Frauen aus Osteuropa empfingen dort ihre männlichen Kunden. Ich habe mich oft mit diesen bildhübschen Frauen unterhalten und war erstaunt, dass sie alle einen akademischen Abschluss besaßen. Sie berichteten mir, dass sich ihre Eltern, um das Studium der Töchter finanzieren zu können, hoch verschuldet hatten und dass sie in Hamburg als Edelprostituierte in vier Monaten mehr verdienten als in Polen oder in der Ukraine in einigen Jahren. Ihren Familien haben sie erzählt, in deutschen Krankenhäusern ein Praktikum zu absolvieren.«
Nach zehn Jahren in der Himmelstraße ziehen Fetiye und Önder in den Bezirk Eimsbüttel um. Am Anfang der Gustav-Falke-Straße, unmittelbar vor dem Eingang einer belebten U-Bahn-Station, mieten sie eine frei gewordene Fläche, die sich ideal für den Verkauf von Obst, Gemüse und Getränken eignet. Auch der Kiosk mit Süßigkeiten, der Zeitungsladen und der Schnellimbiss in ihrer Nachbarschaft befinden sich in türkischer Hand. Eine deutsche Bäckerei und ein pakistanisches Blumengeschäft runden den multikulturellen Charakter der Zeile ab.
Als Fetiye 2005 ihr zweites Kind, die Tochter Belen, bekommt, nimmt die gesamte Nachbarschaft Anteil an diesem Ereignis. Die Stammkundin Ranghild Flechsig, Gustav-Falke-Straße 4, gratuliert mit einem Strampelhöschen und einer Biografie des türkischen Reformers Atatürk, für dessen Lebenswerk sich der Vater Önder besonders interessiert.
Die Oberschulrätin, die seit viereinhalb Jahrzehnten in diesem Quartier wohnt, versteht ihre Präsente auch als Dank dafür, dass Migranten wie das anatolische Ehepaar eine Lücke füllen, die ein schleichender, aber folgenschwerer gesellschaftlicher Wandel hinterließ. »Als ich hier in den sechziger Jahren zusammen mit meiner Mutter einzog«, erinnert sich die Kundin, »gab es in unserer unmittelbaren Umgebung eine ganze Reihe deutscher Einzelhändler und Handwerksbetriebe: Läden für Gemüse, Obst, Lebensmittel und Fisch, einen Uhrmacher, eine Laufmaschenreparatur, eine Heißmangel, eine Apotheke, eine Gaststätte mit deutscher Hausmannskost. Davon ist heute keiner mehr da, keiner. Als die Besitzer aus Altersgründen aufgeben mussten, fand sich unter den Einheimischen niemand, der diese aufreibenden Jobs übernehmen wollte. Hätten wir die Migranten nicht, würde unsere Gegend vollends veröden.«
Dabei gehört die mittlerweile pensionierte Beamtin keineswegs zu den Romantikern, die das aus der Immigration resultierende Problempotential verdrängen. Aus ihrer Erfahrung im Schuldienst weiß sie, dass zum Beispiel »Jungen mit islamischem Hintergrund häufiger negativ auffallen als Mädchen gleichen Glaubens«. Aber im Gegensatz zum per se von Ängsten und Ablehnung gesteuerten Reaktionär wägt sie ab, differenziert sie: »Natürlich fällt die Bilanz trotz mancher Probleme insgesamt positiv aus.«
Als Vorsitzende der Hamburger Goethe-Gesellschaft untermauert die Pensionärin ihr Plädoyer für mehr Offenheit sogar mit dem Wirken des genialen Dichters. Dem Schöpfer des Werkes »Der west-östliche Divan« sei das in deutschen Landen »weit verbreitete kleine Karo zutiefst zuwider« gewesen. Und der Weltbürger aus Weimar habe immer den Kontakt zu internationalen Geistesgrößen gesucht und zum Beispiel die persische Lyrik bewundert.
Ein Dienstagnachmittag im Februar. Der eisige Sturm, der in der Nacht zuvor die Wahlplakate der Hamburger Parteien über das Pflaster schurren ließ und vor unserer Haustür in der Gustav-Falke-Straße sogar eines dieser blechernen Toilettenhäuschen umwarf, wirbelt nun vor dem Laden von Fetiye und Önder den Staub eines von keinerlei Niederschlag gemilderten Wintertages auf. Atemfahnen wehen den Menschen voran, die sich auf den Rolltreppen zum U-Bahn-Schacht drängen. Allein der Rauch, der aus den von Önder mit Tee gefüllten Gläsern steigt, vermittelt das Gefühl, dass es noch Wärme gibt zu dieser frostigen Stunde.
Ich nehme auf dem Hocker neben der Kasse Platz und komme mir vor, als säße ich auf einem Regiestuhl. Aber die Alltagshelden, die unmittelbar vor meinen Augen agieren, bedürfen keiner ordnenden Hand. Ihre Dialoge und Monologe fügen sich von selbst zu einem spannenden, bisweilen absurden, auf jeden Fall aber von multikultureller Vielfalt geprägten Stück.
Als habe ihn ein Anfall von Hospitalismus gepackt, rennt ein Mann mittleren Alters vor dem Laden hin und her. Es sind arabische Laute, die er, wie wild mit der freien Hand fuchtelnd, in sein Handy schreit. Ständig wiederholt er einen Satz, der offenbar mit einem Fragezeichen endet und nach einer Antwort verlangt. Ein Blick auf das Telefon, ein Kopfschütteln, ein Fluch, eine wegwerfende Bewegung.
Der Anrufer stürzt auf Önder zu und stammelt: »Kairo, Kairo ... Batterie leer.« Ob er sie in dem Geschäft aufladen könne. Natürlich kann er das. Er lebe in Hamburg, klärt uns der Ägypter auf, und mache sich große Sorgen um das Schicksal seiner Verwandten. Seit dem Beginn der Demonstrationen gegen das Mubarak-Regime habe er nichts mehr von ihnen gehört.
Stecker raus, neuer Versuch. Dem Satz mit dem Fragezeichen folgt eine Antwort, der Antwort ein Lächeln, dem Lächeln ein in die Höhe gereckter Daumen. Alles okay in Kairo.
»Sind die Weintrauben süß?«, erkundigt sich die ältere Dame.
»Ja ... Weintrauben sind immer süß«, antwortet Önder leicht verlegen.
»Ich möchte wissen, ob sie sehr süß sind.«
»Sie sind süß, aber nicht sehr süß.«
»Wichtig ist, dass sie nicht zu süß sind.«
»Warum ist das wichtig?«
»Sie sind für meine 96-jährige Mutter – und die ist Diabetikerin.«
»Probieren Sie doch einfach mal eine Weintraube!«
»Ja, sie sind süß, aber nicht zu süß. Ein halbes Pfund, bitte.«
Der aus Polen stammende Physiotherapeut, der im Gebäude um die Ecke seine Praxis betreibt, bestellt, wie jeden Nachmittag zu dieser Zeit, einen »Kaffee to go«. Aber er geht nicht. Er bleibt. So lange bleibt er, bis er Önder und mir die Geschichte von seinem Besuch beim König von Malaysia erzählt hat.
Zusammen mit der deutschen Hockey-Nationalmannschaft, die er auf einer Tour nach Südostasien begleitete, wurde er dort eingeladen. »Dieser Palast ... ein Prunk war das – unfassbar.« Wir erfahren, dass der Blick von den Twintowers in Kuala Lumpur zu den grandiosesten Eindrücken seines Lebens gehörte und dass die pingeligen Kontrollen an der Grenze zu Singapur ihn an »die schlimmsten Zeiten der DDR« erinnert hätten.
Ein letzter Schluck, eine letzte Geschichte. Von Boris Becker handelt sie, der sich, als er vor Schmerzen nicht mehr weiterwusste, in seine Obhut begab. Unter einem Dehn-Defekt habe der Tennisstar gelitten.
Fröhlich vor sich hin pfeifend, fegt ein Bediensteter der Stadtreinigung zwischen dem U-Bahn-Schacht und dem