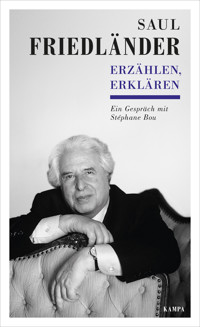29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2007 an Saul Friedländer
Saul Friedländers Buch über die Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden ist einhellig als eines der bedeutendsten historischen und literarischen Werke unserer Zeit gerühmt worden. Nirgendwo sonst wird die Geschichte des Holocaust so eindringlich, kenntnisreich und reflektiert erzählt. Wer wissen will, was in Deutschland und dann in ganz Europa zwischen 1933 und 1945 geschehen ist, und wie es geschehen konnte, der kommt an dieser vielfach preisgekrönten Darstellung nicht vorbei.
"Eine makellos sachliche und gründliche Arbeit: Die Fassungslosigkeit wird hier erklärt, doch glücklicherweise und mit gutem Grund nicht eliminiert (...) Ein erstaunliches und ergreifendes, ein unvergessliches Buch."
Marcel Reich-Ranicki
"Wer dieses Buch gelesen hat, der wird es nicht vergessen; es ist emotional aufwühlend, intellektuell herausfordernd, es ist wahrhaftig (...) das beste Buch, das es zu diesem Thema gibt."
Ulrich Herbert, Süddeutsche Zeitung
"Die wichtigste Darstellung des Holocaust aus der Feder eines Überlebenden und großen Gelehrten - ein Meisterwerk."
Volker Ulrich, Die Zeit
"Saul Friedländer hat eine exzellente Gesamtdarstellung des Holocaust geschrieben und zugleich den Opfern ein Denkmal gesetzt (...) Wer wissen will, wie es eigentlich gewesen ist, der muss dieses Buch lesen."
Dieter Pohl, Der Spiegel
"Saul Friedländer schildert die Jahre der Vernichtung mit einer ungeheuren Wucht und Dramatik. Seine Erzählform erinnert an einen Filmregisseur. Und er verbindet elegant Einzelschicksale mit dem Weltgeschehen."
Dan Diner, Die Welt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
SAUL FRIEDLÄNDER
Das Dritte Reichund die Juden
Die Jahre der Verfolgung1933–1939
Die Jahre der Vernichtung1939–1945
Aus dem Englischen übersetztvon Martin Pfeiffer
VERLAG C.H.BECK MÜNCHEN
Inhalt
Die Jahre der Verfolgung1933–1939
Danksagung
Einleitung
Erster TeilEin Anfang und ein Ende
1. Der Weg ins Dritte Reich
2. Einverstandene Eliten, bedrohte Eliten
3. Der Erlösungsantisemitismus
4. Das neue Ghetto
5. Der Geist der Gesetze
Zweiter TeilDie Einkreisung
6. Kreuzzug und Kartei
7. Paris, Warschau, Berlin – und Wien
8. Ein Modell Österreich?
9. Der Angriff
10. Ein gebrochener Rest
Die Jahre der Vernichtung1939–1945
Danksagung
Einleitung
Erster TeilTerror (Herbst 1939 – Sommer 1941)
1. September 1939 – Mai 1940
2. Mai 1940 – Dezember 1940
3. Dezember 1940 – Juni 1941
Zweiter TeilMassenmord (Sommer 1941 – Sommer 1942)
4. Juni 1941 – September 1941
5. September 1941 – Dezember 1941
6. Dezember 1941 – Juli 1942
Dritter TeilShoah (Sommer 1942 – Frühjahr 1945)
7. Juli 1942 – März 1943
8. März 1943 – Oktober 1943
9. Oktober 1943 – März 1944
10. März 1944 – Mai 1945
Anhang
Anmerkungen
Bibliographie
Register
Die Jahre der Verfolgung1933–1939
Für Omer, Elam und Tom
Ich möchte kein Jude in Deutschland sein.
Hermann Göring, 12. November 1938
Danksagung
Bei meiner Arbeit an diesem Buch ist mir vielfältige Hilfe zuteil geworden. Die Familie Maxwell Cummings, Montreal, und der 1939 Club, Los Angeles, haben an der Universität Tel Aviv und an der University of California, Los Angeles, Lehrstühle gestiftet, welche die Durchführung dieses Projekts erleichterten. Kurze Aufenthalte am Humanities Research Institute der University of California, Irvine (1992), und am Getty Center for the History of Art and the Humanities, Los Angeles (1996), verschafften mir das unschätzbarste Privileg, das es gibt: freie Zeit. Während all dieser Jahre habe ich aus den umfangreichen Beständen und der großzügigen Unterstützung, welche mir die Wiener Library an der Universität Tel Aviv, die University Research Library an der University of California, Los Angeles, die Archive des Leo Baeck Institute in New York sowie die Bibliothek und die Archive des Instituts für Zeitgeschichte in München boten, vielfältigen Nutzen gezogen.
Freunde und Kollegen waren so liebenswürdig, das Manuskript in Teilen oder als Ganzes zu lesen, und einige von ihnen haben es durch seine verschiedenen Entwicklungsstadien hindurch verfolgt. Sie alle gaben mir viele gute Ratschläge. An der University of California, Los Angeles, möchte ich Joyce Appleby, Carlo Ginzburg und Hans Rogger danken; an der Universität Tel Aviv meinen Freunden, Kollegen und Mitherausgebern von History and Memory, insbesondere Gulie Ne’eman Arad für ihr bemerkenswertes Urteil und für die ständige Unterstützung bei diesem Projekt, und ebenso Dan Diner und Philippa Shimrat. Desgleichen möchte ich Omer Bartov (Rutgers), Philippe Burrin (Genf), Sidra und Yaron Ezrahi (Jerusalem) und Norbert Frei (München) Dank sagen. Darüber hinaus bin ich meinen Forschungsassistenten Orna Kenan, Christopher Kenway und Gavriel Rosenfeld sehr zu Dank verpflichtet. Natürlich gilt die übliche Formel: Alle Fehler in diesem Buch sind die meinen.
Der verstorbene Amos Funkenstein konnte leider nicht das gesamte Manuskript lesen, aber ich habe meine vielen Gedanken und Zweifel bis fast zum Ende mit ihm geteilt. Er hat mir viel Ermutigung gegeben, und ihm, meinem engsten Freund, gegenüber habe ich unendlich viel mehr als eine gewöhnliche Dankesschuld; ich vermisse ihn mehr, als ich sagen kann.
Aaron Asher und Susan H. Llewellyn trugen beide zur Bearbeitung dieses Buches bei, welches das erste ist, das ich ganz auf englisch geschrieben habe. Die deutsche Ausgabe dieses Buches verdankt viel der engagierten Übersetzung von Dr. Martin Pfeiffer, dem ich bei dieser Gelegenheit danken möchte. Ebenso danken möchte ich Dr. Volker Dahm für seine aufmerksame Lektüre des Textes und vor allem Ernst-Peter Wieckenberg, meinem Lektor bei Beck. Auf Grund meiner über dreißigjährigen Erfahrung mit Buchveröffentlichungen weiß ich die unentbehrliche Hilfe des Lektors zu schätzen. Ernst-Peter Wieckenberg gehört mit Sicherheit zu den besten, mit denen ich je zusammengearbeitet habe, und ich bin ihm für seine ständige Beratung und Umsicht außerordentlich dankbar.
Seit nunmehr 37 Jahren gibt mir Hagith die Warmherzigkeit und die Unterstützung, die für alles, was ich tue, lebenswichtig sind. Diese Unterstützung war niemals entscheidender als in der langen Zeit, die ich mit der Abfassung dieses Buches verbracht habe. Vor Jahren habe ich unseren Kindern Eli, David und Michal ein Buch gewidmet; dieses Buch hier ist unseren Enkeln gewidmet.
Einleitung
Die meisten Historiker meiner Generation, die kurz vor Beginn der NS-Zeit geboren sind, erkennen explizit oder implizit: Wer sich in die Ereignisse jener Jahre hineingräbt, der entdeckt nicht nur eine kollektive Vergangenheit wie jede andere, sondern auch entscheidende Elemente seines eigenen Lebens. Aus dieser Einsicht ergibt sich keineswegs Einigkeit darüber, wie wir das NS-System definieren, wie wir seine innere Dynamik bestimmen, wie wir seinen zutiefst verbrecherischen Charakter wie auch seine äußerste Banalität angemessen wiedergeben oder wo und wie wir es schließlich in einem breiteren historischen Rahmen ansiedeln sollen.[1] Doch trotz unserer Kontroversen teilen viele von uns, glaube ich, bei der Schilderung dieser Vergangenheit ein Gefühl persönlicher Betroffenheit, das unseren Forschungen eine besondere Dringlichkeit verleiht.
Für die nächste Historikergeneration – und mittlerweile auch für die, die nach ihr kommt – stellen, wie für den größten Teil der Menschheit, Hitlers Reich, der Zweite Weltkrieg und das Schicksal der Juden Europas keine Erinnerung dar, an der sie teilhaben. Und doch scheint paradoxerweise die zentrale Stellung dieser Ereignisse im heutigen historischen Bewußtsein viel ausgeprägter zu sein als vor einigen Jahrzehnten. Tendenziell entwickeln sich die laufenden Debatten mit nicht nachlassender Heftigkeit, wenn Fakten in Frage gestellt und Beweise in Zweifel gezogen werden, wenn Interpretationen und Bemühungen um Gedenken in Widerspruch zueinander treten und wenn Aussagen über historische Verantwortung in regelmäßigen Abständen in die Öffentlichkeit getragen werden. Es könnte sein, daß in unserem Jahrhundert des Völkermords und der Massenkriminalität die Vernichtung der Juden Europas, abgesehen von ihrem spezifischen historischen Kontext, von vielen als der höchste Maßstab des Bösen wahrgenommen wird, an dem sich alle Grade des Bösen messen lassen. In diesen Debatten spielen die Historiker eine zentrale Rolle. Für meine Generation mag der Umstand, daß sie zu gleicher Zeit an der Erinnerung an diese Vergangenheit und an ihrer gegenwärtigen Wahrnehmung teilhat, eine beunruhigende Spannung hervorrufen; er kann jedoch auch Einsichten befördern, die auf anderem Wege nicht zugänglich wären.
Eine historische Darstellung des Holocaust zu schaffen, in der sich die Praktiken der Täter, die Einstellungen der umgebenden Gesellschaft und die Welt der Opfer in einem einzigen Rahmen behandeln lassen, bleibt eine gewaltige Herausforderung. Einige der bekanntesten historischen Interpretationen dieser Ereignisse haben sich vor allem auf die Verfolgungs- und Todesmaschinerie der Nazis konzentriert und dabei der Gesellschaft im weiteren Sinne, dem allgemeineren europäischen und weltweiten Umfeld oder dem sich wandelnden Schicksal der Opfer selbst nur geringe Aufmerksamkeit geschenkt; andere haben sich, und das geschah weniger häufig, deutlicher auf die Geschichte der Opfer konzentriert und nur eine eingeschränkte Analyse der NS-Politik und ihres Umfeldes geliefert.[2] Die vorliegende Arbeit versucht einen Bericht zu geben, in dem zwar die politischen Maßnahmen der Nationalsozialisten das zentrale Element bilden, in dem aber zugleich die umgebende Welt sowie die Einstellungen, die Reaktionen und das Schicksal der Opfer einen untrennbaren Bestandteil dieser sich entfaltenden Geschichte bilden.
In vielen Arbeiten sind die Opfer dadurch, daß man implizit von ihrer generellen Hoffnungslosigkeit und Passivität ausging oder von ihrer Unfähigkeit, den Lauf der zu ihrer Vernichtung führenden Ereignisse zu ändern, in ein statisches und abstraktes Element des historischen Hintergrundes verwandelt worden. Zu häufig vergißt man, daß sich die Einstellungen und die Politik der Nazis ohne Kenntnis vom Leben und nicht zuletzt von den Gefühlen der jüdischen Männer, Frauen und Kinder selbst nicht vollständig beurteilen lassen. Daher wird hier in jedem Stadium der Beschreibung der sich entfaltenden politischen Maßnahmen der Nationalsozialisten und der Einstellungen der Gesellschaften Deutschlands und Europas, wie sie sich auf die Entwicklung dieser Politik auswirkten, dem Schicksal, den Verhaltensweisen und bisweilen den Initiativen der Opfer große Bedeutung beigemessen. Schließlich sind ihre Stimmen unverzichtbar, wenn wir zu einem Verständnis für diese Vergangenheit gelangen wollen.[3] Denn ihre Stimmen sind es, die das offenbaren, was man wußte und was man wissen konnte; ihre Stimmen waren die einzigen, die sowohl die Klarheit der Einsicht als auch die totale Blindheit von Menschen vermittelten, die mit einer völlig neuen und zutiefst entsetzlichen Realität konfrontiert waren. Die ständige Gegenwart der Opfer in diesem Buch ist nicht nur an und für sich historisch wesentlich, sie soll auch dazu dienen, das Handeln der Nationalsozialisten in eine richtige, umfassende Perspektive zu rücken.
Es ist ziemlich leicht zu erkennen, welche Faktoren den historischen Gesamtrahmen prägten, in dem der von den Nationalsozialisten verübte Massenmord stattfand. Sie bestimmten die Methoden und das Ausmaß der «Endlösung»; sie trugen auch zum allgemeinen Klima der Zeit bei, das den Weg zu den Vernichtungen begünstigte. Es mag genügen, wenn ich hier die ideologische Radikalisierung erwähne – mit glühendem Nationalismus und rabiatem Anti-Marxismus (später Anti-Bolschewismus) als ihren wichtigsten Triebfedern –, welche in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts hervortrat und nach dem Ersten Weltkrieg (und der russischen Revolution) ihren Höhepunkt erreichte; die neue Dimension massenweisen industriellen Mordens, die dieser Krieg eingeführt hatte; die zunehmende technische und bürokratische Kontrolle, wie sie von modernen Gesellschaften ausgeübt wird; und die anderen wichtigen Faktoren der Moderne selbst, die ein beherrschender Aspekt des Nationalsozialismus waren.[4] Doch wie entscheidend diese Bedingungen auch dafür waren, den Boden für den Holocaust zu bereiten – und als solche sind sie ein untrennbarer Teil dieser Geschichte –, sie bilden dennoch nicht für sich allein die notwendige Kombination von Elementen, die den Gang der Ereignisse von der Verfolgung zur Vernichtung bestimmten.
Im Hinblick auf diesen Prozeß habe ich die persönliche Rolle Hitlers und die Funktion seiner Ideologie bei der Genese und der Durchführung der antijüdischen Maßnahmen des NS-Regimes hervorgehoben. Dies sollte jedoch keineswegs als eine Rückkehr zu früheren simplistischen Interpretationen verstanden werden, mit ihrer ausschließlichen Betonung der Rolle (und der Verantwortung) des obersten Führers. Doch im Laufe der Zeit sind die gegenteiligen Interpretationen, so scheint mir, zu weit gegangen. Der Nationalsozialismus wurde nicht hauptsächlich von dem chaotischen Zusammenprall konkurrierender Feudalherrschaften in Bürokratie und Partei angetrieben, und die Planung seiner antijüdischen Politik wurde auch nicht vorwiegend den Kosten-Nutzen-Rechnungen von Technokraten überlassen.[5] Bei all seinen wichtigen Entscheidungen war das Regime von Hitler abhängig. Insbesondere in seinem Verhältnis zu den Juden wurde Hitler von ideologischen Obsessionen getrieben, die alles andere als die kalkulierten Manöver eines Demagogen waren; das heißt, er führte einen ganz spezifischen Typ von völkischem Antisemitismus an seine extremsten und radikalsten Grenzen. Ich bezeichne diesen charakteristischen Aspekt seiner Weltanschauung als «Erlösungsantisemitismus»; dieser ist verschieden, wiewohl abgeleitet von anderen Varianten antijüdischen Hasses, die im gesamten christlichen Europa verbreitet waren, und er ist gleichfalls verschieden von den gewöhnlichen Arten des deutschen und europäischen rassischen Antisemitismus. Diese erlösende Dimension, diese Synthese aus einer mörderischen Wut und einem «idealistischen» Ziel, die der Führer der Nationalsozialisten und der harte Kern der Partei miteinander teilten, führte zu Hitlers schließlicher Entscheidung, die Juden zu vernichten.[6]
Aber Hitlers politisches Handeln war nicht allein von Ideologie geprägt, und die hier gebotene Interpretation geht der Interaktion zwischen dem Führer und dem System nach, in dem er agierte. Der NS-Führer fällte seine Entscheidungen nicht unabhängig von den Organisationen der Partei und des Staates. Seine Initiativen waren vor allem in der Frühphase des Regimes nicht nur von seiner Weltanschauung geprägt, sondern auch von den Auswirkungen interner Zwänge, vom Gewicht bürokratischer Beschränkungen, bisweilen vom Einfluß der öffentlichen Meinung in Deutschland und sogar von den Reaktionen ausländischer Regierungen und der öffentlichen Meinung im Ausland.[7]
In welchem Umfang hatten die Partei und die Massen an Hitlers ideologischer Obsession teil? Unter der Parteielite war der «Erlösungs»antisemitismus eine verbreitete Erscheinung. Neuere Untersuchungen haben auch gezeigt, daß ein derart extremer Antisemitismus in den Behörden, die für die Durchführung der antijüdischen Politik eine zentrale Stellung einnehmen sollten – wie etwa Reinhard Heydrichs Sicherheitsdienst der SS (der SD) –, nicht ungewöhnlich war.[8] Was die sogenannten Parteiradikalen angeht, so waren sie häufig von dem sozialen und ökonomischen Ressentiment motiviert, das seinen Ausdruck in extremen antijüdischen Initiativen fand. Mit anderen Worten, innerhalb der Partei und manchmal, wie wir sehen werden, auch außerhalb gab es Zentren eines kompromißlosen Antisemitismus, die über genügend Macht verfügten, um den Druck von Hitlers eigener Vehemenz weiterzugeben und zu verbreiten. Doch unter den traditionellen Eliten und in weiteren Kreisen der Bevölkerung lagen antijüdische Einstellungen mehr im Bereich eines stillschweigenden Einverständnisses oder einer mehr oder weniger ausgeprägten Willfährigkeit.
Obwohl sich der größte Teil der deutschen Bevölkerung schon einige Zeit vor dem Kriege über die immer härteren Maßnahmen, die gegen die Juden ergriffen wurden, völlig im klaren war, gab es nur kleine Bereiche, in denen abweichende Meinungen vertreten wurden (und dies nahezu ausschließlich aus wirtschaftlichen und spezifischen religiösideologischen Gründen). Anscheinend hielt sich jedoch die Mehrheit der Deutschen, auch wenn sie zweifellos von verschiedenen Formen des traditionellen Antisemitismus beeinflußt war und die Absonderung der Juden ohne weiteres akzeptierte, von der weitverbreiteten Gewalttätigkeit gegen sie zurück und drang weder auf ihre Vertreibung aus dem Reich noch auf ihre physische Vernichtung. Nach dem Angriff auf die Sowjetunion, als die totale Vernichtung beschlossen worden war, handelten (im Unterschied etwa zu den hochmotivierten SS-Einheiten) die Hunderttausende von «gewöhnlichen Deutschen», die sich aktiv an den Morden beteiligten, nicht anders als die ebenso zahlreichen und «gewöhnlichen» Österreicher, Rumänen, Ukrainer, Balten und sonstigen Europäer, welche zu bereitwilligsten Handlangern der Mordmaschinerie wurden, die in ihrer Mitte im Gange war. Doch waren die deutschen und österreichischen Mörder, ob sie sich dessen bewußt waren oder nicht, auch von der erbarmungslosen antijüdischen Propaganda des Regimes indoktriniert, die in jeden Winkel der Gesellschaft drang und deren Parolen sie, hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Krieg im Osten, zumindest teilweise verinnerlicht hatten.[9]
Wenn ich betone, daß Hitler und seine Ideologie eine entscheidende Wirkung auf den Kurs des Regimes hatten, dann will ich damit keineswegs sagen, daß Auschwitz ein vorherbestimmtes Resultat von Hitlers Machtergreifung war. Die antijüdischen politischen Maßnahmen der dreißiger Jahre müssen in ihrem Rahmen verstanden werden, und selbst Hitlers mörderische Wut und die Tatsache, daß er den politischen Horizont nach den extremsten Optionen absuchte, lassen nicht darauf schließen, daß es in den Jahren vor dem deutschen Einmarsch in die Sowjetunion Planungen für eine totale Vernichtung gab. Doch zugleich kann kein Historiker das Ende des Weges vergessen. So wird hier auch das Schwergewicht auf diejenigen Elemente gelegt, von denen wir aus der Rückschau wissen, daß sie bei der Entwicklung zu dem verhängnisvollen Ergebnis eine Rolle gespielt haben. Die Geschichte NS-Deutschlands sollte nicht nur aus der Perspektive der Kriegsjahre und ihrer Greuel geschrieben werden, aber der dunkle Schatten, den die Dinge werfen, die in dieser Zeit geschahen, verfinstert die Vorkriegsjahre so sehr, daß ein Historiker nicht so tun kann, als beeinflußten die späteren Ereignisse nicht die Gewichtung des Materials und die Einschätzung des Gesamtablaufs dieser Geschichte.[10] Die vom NS-Regime begangenen Verbrechen waren weder ein bloßes Ergebnis eines zusammenhanglosen, unwillkürlichen und chaotischen Ansturms beziehungsloser Ereignisse noch eine vorherbestimmte Inszenierung eines dämonischen Drehbuchs; sie waren das Resultat konvergierender Faktoren, Ergebnis des Wechselspiels von Intentionen und unvorhergesehenen Ereignissen, von wahrnehmbaren Ursachen und Zufall. Allgemeine ideologische Zielsetzungen und taktische politische Entscheidungen verstärkten sich gegenseitig und blieben, wenn sich die Umstände änderten, immer für radikalere Schritte offen.
Grundsätzlich folgt in dieser zweibändigen Darstellung die Erzählung dem chronologischen Ablauf der Ereignisse: ihrer Vorkriegsentwicklung in diesem, ihrer monströsen Zuspitzung während des Krieges im folgenden Band. Dieser zeitliche Gesamtrahmen hebt Kontinuitäten hervor und läßt den Kontext wesentlicher Veränderungen erkennen; er ermöglicht es auch, innerhalb einer festliegenden chronologischen Spanne die Erzählung zu verschieben. Derartige Verschiebungen ergeben sich aus den Veränderungen der Perspektive, die mein Ansatz verlangt, aber sie rühren auch von einer anderen Entscheidung her: völlig verschiedene Ebenen der Realität nebeneinanderzustellen – beispielsweise Diskussionen und Entscheidungen über antijüdische Politik auf höchster Ebene und daneben Szenen routinemäßiger Verfolgung –, und zwar mit dem Ziel, ein Gefühl der Entfremdung zu erzeugen, welches der Neigung entgegenwirkt, mittels nahtloser Erklärungen und standardisierter Wiedergaben diese bestimmte Vergangenheit zu «domestizieren» und ihre Wirkung abzuschwächen. Dieses Gefühl der Entfremdung scheint mir die Art und Weise zu reflektieren, in der die unglücklichen Opfer des Regimes zumindest während der dreißiger Jahre eine absurde und zugleich bedrohliche Realität wahrnahmen, eine durch und durch groteske und bedrückende Welt hinter der Fassade einer noch bedrückenderen Normalität.
Von dem Augenblick an, in dem die Opfer von dem Prozeß verschlungen wurden, der zur «Endlösung» führte, begann – nach einer kurzen Spanne verstärkten Zusammenhalts – ihr kollektives Leben zu zerfallen. Bald darauf verschmolz diese kollektive Geschichte mit der Geschichte der Verwaltungs- und Mordmaßnahmen, die zu ihrer Vernichtung führten, und mit deren abstrakter statistischer Darstellung. Die einzige konkrete Geschichte, die sich bewahren läßt, bleibt diejenige, die auf persönlichen Erzählungen beruht. Vom Stadium des kollektiven Zerfalls bis zu dem des Abtransports und des Todes muß diese Geschichte, damit sie überhaupt geschrieben werden kann, als die zusammenhängende Erzählung individueller Schicksale dargestellt werden.
Zwar spreche ich von meiner Historikergeneration und von den Einsichten, die uns wegen unserer besonderen Stellung in der Zeit potentiell zu Gebote stehen, aber ich kann das Argument nicht übergehen, daß eine persönliche emotionale Beteiligung an diesen Ereignissen einen rationalen Zugang zum Schreiben von Geschichte ausschließt. Man hat die «mythische Erinnerung» der Opfer dem «rationalen» Verstehen anderer gegenübergestellt. Gewiß möchte ich keine alten Debatten wieder aufleben lassen, sondern nur den Standpunkt vertreten, daß deutsche und jüdische Historiker ebenso wie diejenigen mit jedem beliebigen anderen Hintergrund ein gewisses Maß an «Übertragung» angesichts dieser Vergangenheit nicht vermeiden können.[11] Eine derartige Beteiligung beeinflußt zwangsläufig das Schreiben von Geschichte. Doch das Maß an Objektivität, das der Historiker braucht, wird dadurch nicht ausgeschlossen, sofern ein hinreichendes Bewußtsein für die eigene Situation vorhanden ist. Möglicherweise ist es sogar schwieriger, das Gleichgewicht in der anderen Richtung zu bewahren; zwar könnte ein ständig selbstkritischer Blick die Auswirkungen der Subjektivität verringern, aber er könnte auch zu anderen, nicht geringeren Risiken führen, nämlich zu übermäßiger Zurückhaltung und lähmender Vorsicht.
Die Verfolgungs- und Vernichtungstaten der Nazis wurden von gewöhnlichen Menschen begangen, die in einer modernen Gesellschaft lebten und handelten, welche der unseren nicht unähnlich ist, in einer Gesellschaft, die sie ebenso hervorgebracht hatte wie die Methoden und Werkzeuge zur Durchführung ihrer Handlungen; die Ziele dieser Handlungen dagegen wurden von einem Regime, einer Ideologie und einer politischen Kultur formuliert, die alles andere als gewöhnlich waren. Diese Beziehung zwischen dem Ungewöhnlichen und dem Gewöhnlichen, die Verschmelzung der auf weite Strecken gemeinsamen mörderischen Potentialitäten der Welt, die auch die unsere ist, mit der eigentümlichen Besessenheit des apokalyptischen Feldzugs der Nationalsozialisten gegen den Todfeind, den Juden, verleiht der «Endlösung der Judenfrage» sowohl universelle Bedeutung als auch historische Besonderheit.
ERSTER TEILEIN ANFANG UND EIN ENDE
1.Der Weg ins Dritte Reich
I
Der Exodus jüdischer und linker Künstler und Intellektueller aus Deutschland begann in den ersten Monaten des Jahres 1933, fast unmittelbar nach der Machtübernahme durch Adolf Hitler am 30. Januar. Der Philosoph und Literaturkritiker Walter Benjamin verließ am 18. März Berlin, um sich nach Paris zu begeben. Zwei Tage später schrieb er an seinen Kollegen und Freund Gershom Scholem, der in Palästina lebte: «Zumindest kann ich gewiß sein …, keinem Impuls der Panik gefolgt zu sein. … Es gibt unter den mir näher stehenden niemand, der das anders beurteilt.»[1] Der Romancier Lion Feuchtwanger, der die Sicherheit der Schweiz erreicht hatte, vertraute seinem Schriftstellerkollegen Arnold Zweig an: «Es war zu spät für mich, in Deutschland noch irgend etwas zu retten. So muß ich wohl alles … verlorengeben.»[2]
Die Dirigenten Otto Klemperer und Bruno Walter wurden zur Flucht gezwungen. Walter wurde der Zugang zu seinem Leipziger Orchester verwehrt, und als er im Begriff stand, ein Sonderkonzert der Berliner Philharmoniker zu dirigieren, wurde ihm mitgeteilt, nach vom Propagandaministerium ausgestreuten Gerüchten würde der Saal der Philharmonie niedergebrannt werden, wenn er sich nicht zurückzöge. Walter verließ das Land.[3] Hans Hinkel, der neue Leiter des Amtlichen Preußischen Theaterausschusses, der auch für die «Entjudung» des kulturellen Lebens in Preußen verantwortlich war, erklärte in der Frankfurter Zeitung vom 6. April, Klemperer und Walter seien von der musikalischen Bühne verschwunden, weil es nicht möglich sei, sie vor der «Stimmung» eines deutschen Publikums zu schützen, das seit langem von «jüdischen Kunstbankrotteuren» provoziert worden sei.[4]
Bruno Walters Konzert wurde nicht abgesagt: Richard Strauss dirigierte es.[5] Dies veranlaßte wiederum Arturo Toscanini dazu, Anfang Juni zu erklären, aus Protest werde er nicht bei den Bayreuther Festspielen dirigieren. Propagandaminister Joseph Goebbels vermerkte lakonisch in seinem Tagebuch: «Toscanini hat Bayreuth abgesagt.»[6]
Dieselbe öffentliche «Stimmung» muß die Dresdener Oper dazu veranlaßt haben, ihren musikalischen Direktor Fritz Busch zu verjagen, der selbst kein Jude war, dem aber vorgeworfen wurde, er pflege zu viele Kontakte mit Juden und habe zu viele jüdische Künstler zu Auftritten eingeladen.[7] Andere Methoden wurden ebenfalls angewendet: Als die Hamburger Philharmonische Gesellschaft ihr Programm zur Feier des 100. Geburtstags von Johannes Brahms veröffentlichte, wurde ihr mitgeteilt, Reichskanzler Hitler sei bereit, die Schirmherrschaft über die Feierlichkeiten zu übernehmen, sofern sämtliche jüdischen Künstler (darunter der Pianist Rudolf Serkin) vom Programm verschwänden. Das Angebot wurde bereitwillig angenommen.[8]
Der Drang zur «Entjudung» der Künste produzierte sein eigenes Maß an Verwirrung. So berichtete am 1. April eine Lübecker Zeitung, in der Kleinstadt Eutin habe es beim letzten Konzert der Wintersaison insofern eine Überraschung gegeben, «als anstelle des ausgezeichneten Cellisten der Kieler städtischen Kapelle, John de J., Professor Hofmeier Klaviersoli vortrug. Wie wir hören, war festgestellt worden, daß John de J. Jude sein sollte.» Bald darauf kam jedoch ein Telegramm von de J. an Hofmeier: «Behauptung unwahr. Einwandfreie Urkunden.» Am 5. Mai verkündete Kreisleiter S., der deutsche Bürger niederländischer Abstammung de J. sei ebenso wie mehrere Generationen seiner Vorfahren evangelischer Christ.[9]
Die Erleichterung darüber, daß jemand kein Jude war, muß enorm gewesen sein. In seiner nur geringfügig literarisierten Darstellung der Karriere des Schauspielers und späteren Intendanten des Staatlichen Schauspielhauses in Berlin Gustaf Gründgens, der ein Schützling Görings war, beschrieb Klaus Mann diese ganz eigentümliche Euphorie: «Angenommen aber sogar, die Nazis blieben an der Regierung: was hatte er, Höfgen [Gründgens], schließlich von ihnen zu fürchten? Er gehörte keiner Partei an, er war kein Jude. Vor allem dieser Umstand – daß er kein Jude war – erschien Hendrik mit einem Mal ungeheuer tröstlich und bedeutungsvoll. Was für ein unverhoffter und bedeutender Vorteil, man hatte es früher gar nicht so recht bedacht! Er war kein Jude, also konnte ihm alles verziehen werden.»[10]
Wenige Tage nach den Reichstagswahlen vom 5. März erhielten alle Mitglieder der Sektion für Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste einen vertraulichen Brief von dem Dichter Gottfried Benn, der die Frage enthielt, ob sie in Anbetracht der «veränderten geschichtlichen Lage» bereit seien, Mitglieder der übergeordneten Akademie der Künste und Wissenschaften zu bleiben; in diesem Falle hätten sie sich jeder Kritik an dem neuen deutschen Regime zu enthalten. Überdies hatten die Mitglieder durch Unterzeichnung einer Loyalitätserklärung die richtige «nationalkulturelle» Einstellung zu bekunden. Neun der 27 Mitglieder der Sektion für Dichtkunst antworteten ablehnend, darunter Alfred Döblin, Thomas Mann, Jakob Wassermann und Ricarda Huch. Thomas Manns Bruder Heinrich war wegen seiner linken politischen Ansichten bereits ausgestoßen worden.[11]
Max von Schillings, der neue Präsident der Preußischen Akademie, übte Druck auf die «arische» Dichterin Ricarda Huch aus, sie möge nicht zurücktreten. Es kam zu einem Briefwechsel, und in ihrer letzten Entgegnung schrieb Huch im Hinblick auf den Ausschluß von Heinrich Mann und den Rücktritt Alfred Döblins, der Jude war: «Sie erwähnen die Herren Heinrich Mann und Dr. Döblin. Es ist wahr, daß ich mit Herrn Heinrich Mann nicht übereinstimme, mit Herrn Döblin tat ich es nicht immer, aber doch in manchen Dingen. Jedenfalls möchte ich wünschen, daß alle nichtjüdischen Deutschen so gewissenhaft suchten, das Richtige zu erkennen und zu tun, so offen, ehrlich und anständig wären, wie ich ihn immer gefunden habe. Meiner Ansicht nach konnte er angesichts der Judenhetze nicht anders handeln, als er getan hat. Daß mein Verlassen der Akademie keine Sympathiekundgebung für die genannten Herren ist, trotz der besonderen Achtung und Sympathie, die ich für Herrn Dr. Döblin empfinde, wird jeder wissen, der mich persönlich oder aus meinen Büchern kennt. Hiermit erkläre ich meinen Austritt aus der Akademie.»[12]
Der in Wien lebende Schriftsteller Franz Werfel, der Jude war, sah die Dinge anders. Er war durchaus bereit, die Erklärung zu unterzeichnen, und am 19. März telegraphierte er wegen der erforderlichen Formulare nach Berlin. Am 8. Mai teilte Schillings Werfel mit, er könne kein Mitglied der Akademie bleiben; zwei Tage später waren einige von Werfels Büchern unter denen, die öffentlich verbrannt wurden. Im Sommer 1933, als der Reichsverband deutscher Schriftsteller gegründet war (der dann im November in die Reichskulturkammer [RKK] eingegliedert wurde), versuchte es Werfel noch einmal: «Ich bitte Sie, zur Kenntnis zu nehmen, daß ich czechoslowakischer Staatsbürger bin», schrieb er, «und meinen Wohnsitz in Wien habe. Zugleich möchte ich erklären, daß ich jeglicher politischen Organisation und Tätigkeit immer fern stand und fern stehe. Als Angehöriger der deutschen Minorität in der Czechoslowakei, der seinen Wohnsitz in Österreich hat, unterstehe ich den Gesetzen und Vorschriften dieser Staaten.» Selbstverständlich bekam Werfel nie eine Antwort.[13] Möglicherweise wollte der Schriftsteller den Verkauf seines neuen Romans Die vierzig Tage des Musa Dagh sicherstellen; in ihm wird die Geschichte der Vernichtung der Armenier durch die Türken während des Ersten Weltkriegs erzählt. Ende 1933 erschien das Buch tatsächlich im Reich, wurde aber schließlich im Februar 1934 verboten.[14]
Albert Einstein hielt sich am 30. Januar 1933 zu einem Besuch in den Vereinigten Staaten auf. Er brauchte nicht lange, um zu reagieren. In Ostende, wo er die Geschehnisse in Deutschland als eine «seelische Krankheit der Massen» bezeichnete, beendete er seine Rückreise und setzte nie wieder einen Fuß auf deutschen Boden. Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft enthob ihn seiner Stellung; die Preußische Akademie der Wissenschaften schloß ihn aus. Seine Staatsbürgerschaft wurde ihm aberkannt. Einstein war kein Deutscher mehr. Prominente Stellung und Ruhm schützten niemanden. Max Reinhardt wurde aus der Leitung des Deutschen Theaters, das «dem deutschen Volke übergeben» wurde, vertrieben und floh aus dem Reich. Max Liebermann, mit 86 Jahren möglicherweise der bekannteste deutsche Maler der damaligen Zeit, war zu alt, um auszuwandern, als Hitler an die Macht kam. Als ehemaliger Präsident und nunmehr, 1933, Ehrenpräsident der Preußischen Akademie der Künste trug er die höchste deutsche Auszeichnung, den Orden Pour le Mérite. Am 7. Mai erklärte Liebermann seinen Austritt aus der Akademie. Wie der Maler Oskar Kokoschka in einem Leserbrief an die Frankfurter Zeitung, der veröffentlicht wurde, aus Paris schrieb, hielt es keiner von Liebermanns Kollegen für nötig, ein Wort der Anerkennung oder des Mitgefühls zu äußern.[15] Isoliert und verfemt starb Liebermann 1935; nur drei «arische» Künstler nahmen an der Beerdigung teil. Seine Ehefrau überlebte ihn. Als im März 1943 die Polizei mit einer Bahre eintraf, um die bettlägerige 85jährige zum Abtransport in den Osten abzuholen, beging sie Selbstmord, indem sie eine Überdosis Veronal schluckte.[16]
So peripher es in der Rückschau aussehen mag, der kulturelle Bereich war der erste, aus dem Juden (und «Linke») in großem Umfang vertrieben wurden. Schillings’ Brief wurde unmittelbar nach den Reichstagswahlen vom März 1933 abgeschickt, und die Veröffentlichung des Interviews mit Hinkel fand vor der Verabschiedung des Berufsbeamtengesetzes vom 7. April statt, von dem noch die Rede sein wird. So hatten sich die neuen Herrscher Deutschlands, noch bevor sie ihre ersten systematischen antijüdischen Ausschließungsmaßnahmen in Gang setzten, gegen die exponiertesten Vertreter des «jüdischen Geistes» gewandt, der von nun an ausgelöscht werden sollte. Im allgemeinen waren die wichtigeren antijüdischen Maßnahmen, welche die Nazis von da an in den verschiedenen Bereichen ergriffen, nicht nur Terrorakte, sondern auch symbolische Aussagen. Diese Doppelfunktion brachte die Allgegenwart der Ideologie im System zum Ausdruck: Ihre Dogmen mußten in ritueller Weise immer wieder geltend gemacht werden, wobei die Verfolgung ausgewählter Opfer einen Teil des ablaufenden Rituals darstellte. Mehr noch: die Doppelbedeutung der Initiativen des Regimes erzeugte bei einem großen Teil der Bevölkerung eine Art gespaltenes Bewußtsein. So konnte es sein, daß manche mit der Brutalität der Entlassungen jüdischer Intellektueller aus ihren Stellungen nicht einverstanden waren, aber begrüßten, daß das deutsche Kulturleben vom «übermäßigen Einfluß» der Juden gereinigt wurde. Selbst einige der gefeiertsten deutschen Exilschriftsteller wie Thomas Mann waren zumindest eine Zeitlang gegen diese Art doppelter Wahrnehmung der Ereignisse nicht immun.
Mann, selber kein Jude, aber mit einer Jüdin verheiratet, befand sich nicht in Deutschland, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, und er kehrte nicht zurück. In einem Brief an Einstein vom 15. Mai sprach er davon, wie schmerzlich ihm schon allein der Gedanke an das Exil sei: «Damit ich in diese Rolle gedrängt würde, mußte wohl wirklich ungewöhnlich Falsches und Böses geschehen, und falsch und böse ist denn auch meiner tiefsten Überzeugung nach diese ganze ‹Deutsche Revolution›.»[17] Einige Monate später äußerte sich der Autor des Zauberbergs in einem Brief an seinen einstigen Freund, den ultranationalistischen Literaturgeschichtler Ernst Bertram, der zu einem überzeugten Anhänger des neuen Regimes geworden war, nicht weniger deutlich: «‹Wir werden sehen›, schrieb ich Ihnen vor Jahr und Tag, und Sie antworteten trotzig: ‹Gewiß, das werden wir.› Haben Sie angefangen zu sehen? nein, denn mit blutigen Händen hält man Ihnen die Augen zu, und nur zu gern lassen Sie sich den ‹Schutz› gefallen. Die deutschen Intellektuellen – verzeihen Sie das rein sachlich gemeinte Wort – werden sogar die allerletzten sein, die zu sehen anfangen, denn zu tief, zu schändlich haben sie sich eingelassen und bloßgestellt.»[18] Doch tatsächlich gab es in Manns Einstellungen immer noch viel Zwiespältiges: Um sicherzustellen, daß seine Bücher in Deutschland weiterhin veröffentlicht und verkauft wurden, vermied er es mehrere Jahre lang sorgfältig, sich deutlich gegen die Nazis auszusprechen. Und anfangs behandelten ihn einige NS-Organisationen wie der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund ebenfalls vorsichtig: Thomas Manns Bücher wurden bei dem berüchtigten Autodafé vom 10. Mai 1933 nicht verbrannt.[19]
Die (im besten Falle) ambivalente Einstellung Manns, insbesondere zu den Juden, tritt in dieser ersten Phase in seinen Tagebucheintragungen zutage: «Aber geht dennoch Bedeutendes und Groß-Revolutionäres vor in Deutschland?» schrieb er am 4. April 1933. «Die Juden … Daß die übermütige und vergiftende Nietzsche-Vermauschelung Kerr’s ausgeschlossen ist, ist am Ende kein Unglück; auch die Entjudung der Justiz am Ende nicht.»[20] Immer wieder leistete er sich derartige Bemerkungen, aber seine stärksten Ressentiments brachte Mann vielleicht in der Tagebucheintragung vom 15. Juli 1934 zum Ausdruck: «Dachte an den Widersinn, daß ja die Juden, die man in Deutschland entrechtet und austreibt, an den geistigen Dingen, die sich in dem politischen System [des Nationalsozialismus] gewissermaßen, sehr fratzenhaft natürlich, ausdrücken, starken Anteil haben und zum guten Teil als Wegbereiter der antiliberalen Wendung zu betrachten.»[21] Als Beispiele erwähnte Mann den Dichter Karl Wolfskehl, ein Mitglied des esoterischen literarischen und intellektuellen Kreises um den Dichter Stefan George, und insbesondere den Münchener Exzentriker Oskar Goldberg. Es besteht eine gewisse Diskrepanz zwischen Ausdrücken wie «starken Anteil», «zum guten Teil» und «Wegbereiter der antiliberalen Wendung» und diesen beiden marginalen Beispielen.[22] Er ging noch weiter. «Überhaupt glaube ich, daß viele Juden [in Deutschland] mit ihrer neuen Rolle als geduldete Gäste, die an nichts teilhaben, bis auf die Steuern freilich, in tiefster Seele einverstanden sind.»[23] Klar, unzweideutig und öffentlich sollte Manns Anti-Nazi-Position erst zu Anfang des Jahres 1936 werden.[24]
Manns Haltung veranschaulicht die Allgegenwart des gespaltenen Bewußtseins und erklärt so die Leichtigkeit, mit der Juden aus dem kulturellen Leben vertrieben wurden. Mit Ausnahme einiger mutiger Persönlichkeiten wie Ricarda Huch gab es in diesem Bereich – und auch anderswo – keine Macht, die sich dem entgegenstellte.
Hitler hatte im Hinblick auf alles Jüdische mit Sicherheit kein gespaltenes Bewußtsein. Doch zumindest 1933 beugte er sich Winifred Wagner (der aus England stammenden Witwe von Richard Wagners Sohn Siegfried, die in Bayreuth die bestimmende Kraft war): «Erstaunlicherweise», so schreibt Frederic Spott zu Recht, «ließ es Hitler in diesem Jahr sogar zu, daß die Juden Alexander Kipnis und Emanuel List in seiner Gegenwart sangen.»[25]
II
Drei Tage vor den Reichstagswahlen im März brachte die Hamburger Ausgabe der jüdischen Zeitung Israelitisches Familienblatt unter der Schlagzeile «Wie wählen wir am 5. März?» einen bezeichnenden Artikel. «[Es gibt] viele Juden», hieß es da, «die das wirtschaftliche Programm der heutigen Rechten billigen, die aber nicht die Möglichkeit haben, sich ihr anzuschließen, da diese Parteien in völlig unlogischer Weise ihre wirtschaftlichen und politischen Ziele mit einem Kampf gegen das Judentum … verkoppelt haben.»[26]
Am 30. Januar 1933 fand im Berliner Café Leon eine Sitzung statt, bei der es um Fragen der Förderung des jüdischen Handwerks ging. Die Nachricht von Hitlers Ernennung zum Reichskanzler wurde kurz vor Beginn der Veranstaltung bekannt. Unter den anwesenden Vertretern jüdischer Organisationen und politischer Bewegungen nahm nur der zionistische Rabbi Hans Tramer auf die Nachricht Bezug und bezeichnete das Ereignis als große Veränderung; alle anderen Redner hielten sich an ihr angekündigtes Thema. Tramer «machte mit seiner Rede gar keinen Eindruck. Das ganze Publikum hielt das für Schwarzmalerei. Es gab keinerlei Echo.»[27] Der Vorstand des Central-Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens schloß am selben Tage eine öffentliche Erklärung in eben diesem Sinne: «Im übrigen gilt heute ganz besonders die Parole: Ruhig abwarten.»[28] Ein Leitartikel in der Zeitung des Vereins vom 30. Januar aus der Feder Ludwig Holländers, des Vorsitzenden der Organisation, war im Ton ein wenig beunruhigter, zeigte aber im Prinzip dieselbe Haltung: «Auch in dieser Zeit werden die deutschen Juden ihre Ruhe nicht verlieren, die ihnen das Bewußtsein untrennbarer Verbundenheit mit allem wirklich Deutschen gibt. Weniger denn je werden sie ihre innere Haltung zu Deutschland von äußeren Angriffen, die sie als unberechtigt empfinden, beeinflussen lassen.»[29]
Im großen ganzen gab es unter der überwältigenden Mehrheit der annähernd 525.000 Juden, die im Januar 1933 in Deutschland lebten, kein erkennbares Gefühl von Panik oder auch nur von Dringlichkeit.[30] Im Laufe der Wochen hofften Max Naumanns Verband Nationaldeutscher Juden und der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten auf nichts Geringeres als die Integration in die neue Ordnung. Am 4. April richtete Leo Löwenstein, der Vorsitzende des Frontsoldatenbundes, eine Eingabe an Hitler und legte eine Aufstellung nationalistisch orientierter Vorschläge in bezug auf die Juden Deutschlands bei sowie ein Exemplar des Gedächtnisbuches, das die Namen der 12.000 deutschen Soldaten jüdischer Abstammung enthielt, die im Weltkrieg für Deutschland gefallen waren. Ministerialrat Wienstein antwortete am 14. April, der Reichskanzler habe ihn beauftragt, den Empfang des Briefes und des Buches «ergebenst zu bestätigen». Hans Heinrich Lammers, der Chef der Reichskanzlei, empfing am 28. eine Abordnung der Frontkämpfer,[31] aber damit hörten die Kontakte auf. Bald bestätigte Hitlers Büro Eingaben der jüdischen Organisation nicht mehr. Wie der Central-Verein glaubten die Zionisten weiterhin, daß sich die anfänglichen Umwälzungen durch eine Neubehauptung jüdischer Identität oder einfach durch Geduld überwinden ließen; die Juden waren der Ansicht, daß die Verantwortung der Macht, der Einfluß der konservativen Regierungsmitglieder und eine wachsame Außenwelt auf alle Tendenzen der Nazis zu Exzessen einen mäßigenden Einfluß ausüben würden.
Selbst nachdem am 1. April die Nationalsozialisten jüdische Geschäfte boykottiert hatten, erklärten einige bekannte deutsch-jüdische Persönlichkeiten wie der Rabbiner Joachim Prinz, es sei unvernünftig, eine gegen die NSDAP gerichtete Position einzunehmen. Prinz war der Auffassung, «daß eine Auseinandersetzung mit der ‹Neuordnung› in Deutschland, die das Ziel hat, ‹den Menschen Brot und Arbeit zu geben, … weder beabsichtigt noch möglich ist›».[32] Diese Erklärung mag lediglich taktischer Natur gewesen sein, und man darf nicht vergessen, daß viele Juden unschlüssig waren, wie sie reagieren sollten. Manche Exzentriker gingen erheblich weiter. So erklärte noch im Sommer 1933 Felix Jacoby, Historiker an der Kieler Universität, in der Einführung zu seiner Vorlesung über den römischen Dichter Horaz: «Als Jude befinde ich mich in einer schwierigen Lage. Aber als Historiker habe ich gelernt, geschichtliche Ereignisse nicht unter privater Perspektive zu betrachten. Ich habe seit 1927 Adolf Hitler gewählt und preise mich glücklich, im Jahr der nationalen Erhebung über den Dichter des Augustus lesen zu dürfen. Denn Augustus ist die einzige Gestalt der Weltgeschichte, die man mit Adolf Hitler vergleichen kann.»[33] Dies war jedoch eher ein Ausnahmefall.
Für einige Juden war es eine Quelle der Zuversicht, daß der alte, geachtete Reichspräsident Paul von Hindenburg immer noch als Staatsoberhaupt amtierte; gelegentlich schrieben sie ihm über ihre Notlage. «Ich war 1914 verlobt», schrieb Frieda Friedmann, eine Berlinerin, am 23. Februar an Hindenburg. «Mein Verlobter fiel 1914. Zwei meiner Brüder, Max und Julius Cohn, fielen im Jahre 1916 und 1918. Mein letzter Bruder Willy kam erblindet … aus dem Felde zurück. … Alle haben das Eiserne Kreuz für Verdienst am Vaterland. Jetzt jedoch ist es in unserem Vaterlande so gekommen, daß auf der Straße öffentlich Broschüren gehandelt werden ‹Juden raus!›, öffentliche Aufforderungen zu Pogromen und Gewalttaten gegen die Juden. Ist die Judenhetze Tapferkeit oder Feigheit, wenn es im deutschen Staat bei 60 Millionen Menschen 1 % Juden gibt?» Hindenburgs Büro bestätigte umgehend den Empfang des Briefes, und der Präsident ließ Frieda Friedmann wissen, daß er entschieden gegen Exzesse eingestellt sei, die an Juden verübt wurden. Der Brief wurde an Hitler weitergeleitet, und der schrieb an den Rand: «Die Behauptungen dieser Dame sind ein Schwindel! Es ist selbstverständlich nicht eine Aufforderung zum Progrom [sic] erfolgt!»[34]
Schließlich waren sich die Juden ebenso wie ein beträchtlicher Teil der deutschen Gesellschaft überhaupt insbesondere vor den Reichstagswahlen vom 5. März 1933 nicht sicher, ob sich die Nationalsozialisten an der Macht halten würden oder ob ein konservativer Militärputsch gegen sie noch möglich war. Manche jüdischen Intellektuellen warteten mit einigermaßen ungewöhnlichen Vorhersagen auf. «Die Prognose», schrieb Martin Buber am 14. Februar an den Philosophen und Pädagogen Ernst Simon, «hängt vom Ausgang der bevorstehenden Kämpfe zwischen den Regierungsgruppen ab. Es ist anzunehmen, daß eine Verschiebung des Machtverhältnisses zugunsten der Nationalsozialisten auch bei proportionaler Stärkung ihrer parlamentarischen Basis gegenüber den Deutschnationalen nicht zugestanden werden wird. In diesem Fall werden entweder die Hitlerleute trotzdem in der Regierung bleiben; dann werden sie in den Kampf gegen das Proletariat vorgeschickt und dadurch ihre Partei gespalten und vorerst ungefährlich gemacht.
Oder sie treten aus. … Solange die gegenwärtige Koalition noch andauert, ist an eigentliche Judenhetzen oder Judengesetzgebungsakte nicht zu denken, nur an administrative Unterdrückung; eine antijüdische Legislative käme nur bei einer Machtverschiebung zugunsten der Nationalsozialisten in Betracht, die aber wie gesagt kaum zu erwarten ist; Judenhetzen kommen in Betracht für die Zeit zwischen einem Austritt der Nat. Soz. aus der Regierung und einer Erklärung des Ausnahmezustands.»[35]
III
Die politischen Hauptopfer des neuen Regimes und seines Terrorsystems waren zumindest in den ersten Monaten nach der Machtübernahme nicht Juden, sondern Kommunisten. Nach dem Reichstagsbrand vom 27. Februar führte die antikommunistische Jagd zur Verhaftung von fast 10.000 Parteimitgliedern und Sympathisanten und zu ihrer Inhaftierung in neugeschaffenen Konzentrationslagern. Dachau war am 20. März eingerichtet worden und wurde am 1. April von SS-Chef Heinrich Himmler offiziell eingeweiht.[36] Im Juni wurde SS-Gruppenführer Eicke Kommandant des Lagers, und ein Jahr später wurde er zum «Inspekteur der Konzentrationslager» ernannt: Unter der Ägide Himmlers war er zum Architekten der Lebens- und Todes-Routine der Lagerinsassen in Hitlers neuem Deutschland geworden.
Nach den Massenverhaftungen, die auf den Reichstagsbrand folgten, war es klar, daß die «kommunistische Bedrohung» nicht mehr existierte. Doch die Versessenheit des neuen Regimes auf Repression – und Innovation – ließ nicht nach; ganz im Gegenteil. Eine Verordnung des Reichspräsidenten vom 28. Februar hatte Hitler bereits Ausnahmebefugnisse verliehen. Zwar gelang es den Nationalsozialisten nicht, bei den Wahlen vom 5. März die absolute Mehrheit zu gewinnen, aber ihre Koalition mit der ultrakonservativen Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) errang sie. Einige Tage später, am 23. März, begab sich der Reichstag seiner Funktionen, indem er das Ermächtigungsgesetz verabschiedete, das dem Reichskanzler uneingeschränkte legislative und exekutive Vollmachten gab. Das Tempo der Veränderungen, die nun folgten, war atemberaubend. Die Länder wurden gleichgeschaltet; im Mai wurden die Gewerkschaften aufgelöst und durch die Deutsche Arbeitsfront ersetzt; Mitte Juli gab es im Reich dann keine andere politische Partei mehr als die NSDAP. Die Unterstützung der Bevölkerung für diese Sturzflut von Aktivitäten und diese ständige Machtdemonstration wuchs lawinenartig an. In den Augen einer rasch zunehmenden Zahl von Deutschen war eine «nationale Wiedergeburt» im Gange.[37]
Man hat oft gefragt, ob die Nationalsozialisten über konkrete Ziele und präzise Pläne verfügten. Ungeachtet interner Spannungen und sich wandelnder Umstände wurden in den meisten Bereichen kurzfristige Ziele systematisch verfolgt und rasch erreicht. Doch die Endziele des Regimes, die Leitlinien der langfristigen Politik, wurden nur in Umrissen bestimmt, und konkrete Schritte zu ihrer Umsetzung wurden nicht formuliert. Doch diese vage formulierten langfristigen Ziele waren nicht nur als eine Art Richtlinien entscheidend, sondern auch als Indikatoren für grenzenlose Ambitionen und Erwartungen: Für Hitler und seine Clique waren sie Gegenstand echten Glaubens; sie mobilisierten die Energien der Partei und verschiedener Sektoren der Bevölkerung; und sie waren Ausdruck des Glaubens an die Richtigkeit des Weges.
Antijüdische Gewalttaten nahmen nach den Märzwahlen zu. Am 9. nahmen SA-Leute im Berliner Scheunenviertel Dutzende von osteuropäischen Juden fest. Diese Ostjuden, traditionell die erste Zielscheibe deutschen Judenhasses, waren auch die ersten, die als Juden in Konzentrationslager abtransportiert wurden. Am 13. März erzwang die örtliche SA in Mannheim die Schließung jüdischer Geschäfte; in Breslau wurden jüdische Anwälte und Richter im Gerichtsgebäude tätlich angegriffen; und in Gedern in Hessen brach die SA in jüdische Häuser ein und schlug «unter dem Beifall einer rasch anwachsenden Menschenmenge» die Bewohner zusammen. Die Liste vergleichbarer Vorfälle ist lang.[38] Es gab auch Morde. Im Bericht des Regierungspräsidenten von Niederbayern von Ende März heißt es: «Am 15. ds. Mts., früh gegen 6 Uhr, erschienen in einem Kraftwagen mehrere Männer in dunkler Uniform vor der Wohnung des israelitischen Güterhändlers Otto Selz in Straubing. Selz wurde von ihnen in Nachtkleidern aus der Wohnung geholt und in einem Kraftwagen entführt. Etwa um 9.30 wurde Selz in einem Wald bei Weng, Bezirksamt Landshut, erschossen aufgefunden. Der Kraftwagen soll aus der Richtung München-Landshut gekommen und auf der gleichen Strecke wieder zurückgefahren sein. Er war mit sechs Uniformierten besetzt und trug das Zeichen: II A. … Mehrere Landleute wollen bei einigen Insassen des Wagens die rote Armbinde mit dem Hakenkreuz bemerkt haben.»[39] Am 31. März schickte Innenminister Wilhelm Frick an alle örtlichen Polizeireviere eine telegraphische Warnung, kommunistische Agitatoren, die in SA-Uniformen verkleidet seien und SA-Autokennzeichen benutzten, würden die Schaufensterscheiben jüdischer Geschäfte einschlagen und die Gelegenheit nutzen, um Unruhe zu stiften.[40] Bei derartigen Anschuldigungen gegen die Kommunisten handelte es sich um die übliche Desinformation der Nazis. Am 1. April berichtete das Polizeirevier Göttingen, das den am 28. März an jüdischen Geschäften und der örtlichen Synagoge angerichteten Schaden untersuchte, man habe zwei Mitglieder der kommunistischen Partei und einen Sozialdemokraten gefaßt, die im Besitz von Nazi-Uniformteilen gewesen seien; die Zentrale in Hildesheim wurde informiert, die Verhafteten seien diejenigen, welche antijüdische Aktionen begangen hätten.[41]
Ein großer Teil der ausländischen Presse behandelte die Gewalttaten der Nationalsozialisten ausführlich. Der Christian Science Monitor dagegen äußerte Zweifel an der Richtigkeit der Berichte über Nazigreuel und rechtfertigte später die Vergeltung gegen «Leute, die Lügen gegen Deutschland verbreiteten». Und Walter Lippmann, damals der prominenteste politische Kommentator in Amerika und selbst Jude, fand Worte des Lobes für Hitler und konnte sich einen Seitenhieb gegen die Juden nicht verkneifen. Abgesehen von diesen bemerkenswerten Ausnahmen nahmen die meisten amerikanischen Zeitungen hinsichtlich der antijüdischen Verfolgungsmaßnahmen kein Blatt vor den Mund.[42] Jüdische und nichtjüdische Proteste mehrten sich. Eben diese Proteste nahmen die Nationalsozialisten zum Vorwand für den berüchtigten Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933. Zwar wurde die Anti-Nazi-Kampagne in den Vereinigten Staaten bei einer Kabinettssitzung am 24. März in einiger Ausführlichkeit diskutiert,[43] aber die endgültige Entscheidung zugunsten des Boykotts wurde wahrscheinlich bei einer Zusammenkunft von Hitler und Goebbels am 26. März in Berchtesgaden getroffen. Doch schon Mitte März hatte Hitler es einem Komitee unter dem Vorsitz von Julius Streicher, dem Gauleiter von Franken und Herausgeber des Stürmers, der bösartigsten antijüdischen Zeitung der Partei, gestattet, die Vorbereitungen dafür in Angriff zu nehmen.
Tatsächlich war der Boykott schon von dem Augenblick an vorhersehbar gewesen, in dem die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Von der Möglichkeit war in den beiden vorangegangenen Jahren,[44] als kleine jüdische Läden zunehmend schikaniert und jüdische Angestellte auf dem Arbeitsmarkt immer mehr diskriminiert worden waren, oft die Rede gewesen.[45] Unter den Nationalsozialisten wurde ein großer Teil der Agitation für antijüdische ökonomische Maßnahmen von einer bunt zusammengewürfelten Koalition von «Radikalen» initiiert, die teils der Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation (NSBO) unter der Leitung von Reinhold Muchow angehörten, teils dem Kampfbund für den gewerblichen Mittelstand Adrian von Rentelns oder verschiedenen Abteilungen der SA, die von Otto Wagener, einem Ökonomen und früheren geschäftsführenden Stabschef der SA, zu diesem Zweck mobilisiert wurden. Ihr gemeinsamer Nenner war das, was Gregor Strasser, die frühere Nummer Zwei in der Partei, einmal als «die antikapitalistische Sehnsucht»[46] bezeichnet hatte; der einfachste Weg, auf dem sie diese zum Ausdruck bringen konnten, war bösartiger Antisemitismus.
Derartigen Parteiradikalen werden wir in jedem wichtigen Stadium antijüdischer Politik bis hin zum Kristallnacht-Pogrom vom November 1938 begegnen. Im April 1933 lassen sie sich als Mitglieder der verschiedenen wirtschaftlichen Interessengruppen der Partei identifizieren, aber es gab unter ihnen auch Juristen wie Hans Frank (den künftigen Generalgouverneur des besetzten Polen) und Roland Freisler (den künftigen Präsidenten des Volksgerichtshofes) und Rassenfanatiker wie Gerhard Wagner und Walter Groß – von Streicher, Goebbels, der SA-Führung und, vor allen anderen, Hitler ganz zu schweigen. Doch in ihrer besonderen Rolle als Pressure-group bestanden die Radikalen hauptsächlich aus «alten Kämpfern» – aus SA-Mitgliedern und einfachen Parteiaktivisten, die mit dem Tempo der nationalsozialistischen Revolution, mit der Dürftigkeit der ihnen zugefallenen Beute und mit dem häufig privilegierten Status von Parteigenossen, die in der Staatsbürokratie Schlüsselstellungen innehatten, unzufrieden waren. Die Radikalen waren eine veränderliche, aber beträchtliche Kraft aus mißvergnügten Parteimitgliedern, die nach verstärkten Aktionen und nach dem Primat der Partei über den Staat lechzten.[47]
Der Einfluß der Radikalen sollte jedoch nicht überschätzt werden. Sie zwangen Hitler nie dazu, Maßnahmen zu ergreifen, die er nicht ergreifen wollte. Wenn ihre Forderungen als zu weitgehend betrachtet wurden, verwarf man ihre Initiativen. Die antijüdischen Beschlüsse vom Frühjahr 1933 erleichterten es dem Regime, die Gewalttätigkeit der SA in vom Staat kontrollierte Bahnen zu lenken;[48] für die Nationalsozialisten waren diese Maßnahmen natürlich auch um ihrer selbst willen willkommen.
Am 29. März unterrichtete Hitler das Kabinett über den geplanten Boykott von Geschäften in jüdischem Besitz und erklärte den Ministern, er selbst habe ihn gefordert. Er beschrieb die Alternative als spontane Gewalttaten der Bevölkerung. Ein zugelassener Boykott, so fügte er hinzu, würde gefährliche Unruhe vermeiden.[49] Die deutschnationalen Minister machten Einwendungen, und Präsident Hindenburg versuchte einzugreifen. Hitler verwarf jede mögliche Zurücknahme, aber zwei Tage später (am Tage vor dem geplanten Boykott) erwähnte er die Möglichkeit einer Verschiebung bis zum 4. April – falls die britische und die amerikanische Regierung auf der Stelle ihren Widerstand gegen die antideutsche Agitation in ihren Ländern erklärten; anderenfalls würde die Aktion am 1. April stattfinden, gefolgt von einer Wartephase bis zum 4. April.[50]
Am Abend des 31. erklärte sich die britische wie auch die amerikanische Regierung bereit, die erforderliche Erklärung abzugeben. Außenminister Konstantin Freiherr von Neurath gab jedoch bekannt, es sei zu spät für einen Kurswechsel; er sprach dann von Hitlers Entscheidung für eine eintägige Aktion, gefolgt von einer Wartephase.[51] In Wirklichkeit wurde die Möglichkeit, den Boykott am 4. April wieder aufzunehmen, nicht mehr in Erwägung gezogen.
Mittlerweile war vor allem in den Vereinigten Staaten und in Palästina die jüdische Führung in einem Zwiespalt: Sollte sie massenhafte Proteste und einen Gegenboykott gegen deutsche Waren unterstützen oder sollte aus Furcht vor weiteren «Vergeltungsmaßnahmen» gegen die Juden in Deutschland eine Konfrontation vermieden werden? Göring hatte eine Reihe von namhaften Vertretern der deutschen Juden zu sich bestellt und sie nach London geschickt, wo sie gegen die geplanten antideutschen Demonstrationen und Initiativen intervenieren sollten. Zugleich telegraphierten am 26. März Kurt Blumenfeld, der Präsident der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, und Julius Brodnitz, der Präsident des Central-Vereins, an das American Jewish Committee in New York: «Wir protestieren kategorisch gegen Abhaltung Montagmeeting Radio und sonstiger Demonstrationen Stop Verlangen unbedingt energische Bemuehungen zur Einwirkung auf Unterlassung deutschfeindlicher Kundgebungen.»[52] Durch Beschwichtigung der Nazis hoffte die besorgte deutsch-jüdische Führung dem Boykott zu entgehen.
Die Leitung der jüdischen Gemeinschaft in Palästina entschied sich ungeachtet des Drucks der öffentlichen Meinung ebenfalls für Vorsicht. Sie schickte ein Telegramm an die Reichskanzlei, in dem sie versicherte, «daß keine autorisierte Körperschaft in Palästina einen Handelsboykott gegen Deutschland erklärt habe oder zu erklären beabsichtige».[53] Die führenden Persönlichkeiten der amerikanischen Juden waren sich nicht einig; die meisten jüdischen Organisationen in den Vereinigten Staaten waren gegen Massendemonstrationen und wirtschaftliche Aktionen, hauptsächlich aus Furcht davor, den Präsidenten und den Außenminister in Verlegenheit zu bringen.[54] Zögernd und unter dem Druck von Gruppen wie den Jewish War Veterans entschied sich der American Jewish Congress schließlich anders. Am 27. März fanden in mehreren amerikanischen Städten Protestversammlungen statt, an denen sich auch Führer der Kirchen und der Arbeiterbewegung beteiligten. Was den Boykott deutscher Waren anging, so breitete er sich als emotionale Basisbewegung aus, die im Laufe der Monate zunehmend institutionelle Unterstützung fand, zumindest außerhalb Palästinas.[55]
Goebbels’ Erregung war nicht zu bezähmen. In seiner Tagebucheintragung für den 27. März schrieb er: «Ich diktiere einen scharfen Aufsatz gegen die Greuelhetze der Juden. Schon seine Ankündigung läßt die ganze Mischpoke [sic; jiddisch für «Familie»] zusammenknicken. Man muß solche Methoden anwenden. Großmut imponiert den Juden nicht.» 28. März: «Ich telephoniere mit dem Führer. Der Boykottaufruf wird heute veröffentlicht. Panik unter den Juden!» 29. März: «Ich versammle meine Referenten um mich und entwickle ihnen die Organisation des Boykotts.» 30. März: «Der Boykott ist in der Organisation fertig. Wir brauchen jetzt nur auf einen Knopf zu drücken, dann läuft er an.»[56] 31. März: «Viele lassen die Köpfe hängen und sehen Gespenster. Sie meinen, der Boykott würde zum Krieg führen. Wenn wir uns wehren, können wir nur Achtung gewinnen. Wir halten in kleinem Kreise eine letzte Besprechung ab und beschließen, daß der Boykott morgen in aller Schärfe beginnen soll. Er wird einen Tag durchgeführt und dann von einer Pause bis Mittwoch abgelöst. Geht die Hetze im Ausland zu Ende, dann wird er abgestoppt, im anderen Falle beginnt dann der Kampf bis aufs Messer.»[57] 1. April: «Der Boykott gegen die Weltgreuelhetze ist in Berlin und im ganzen Reich in voller Schärfe entbrannt. Das Publikum», fügte Goebbels hinzu, «hat sich überall solidarisch erklärt.»[58]
Im Prinzip hätte der Boykott der jüdischen Bevölkerung ernsthafte wirtschaftliche Schäden zufügen können, denn 1933 waren, wie Avraham Barkai schreibt, «über 60 Prozent aller jüdischen Erwerbstätigen …, ähnlich wie 1925 und auch schon 1907, im Sektor Handel und Verkehr konzentriert, die überwältigende Mehrheit davon im Wareneinzelhandel. Auch die im Sektor Industrie und Handwerk aufgeführten Juden waren zum größten Teil Inhaber mittelständischer Betriebe und Handwerker.»[59] In Wirklichkeit stieß die Aktion der Nazis jedoch sogleich auf Probleme.[60]
Die breite Bevölkerung stand dem Boykott oft gleichgültig gegenüber und hatte manchmal sogar ein Interesse daran, in «jüdischen» Läden zu kaufen. Dem Völkischen Beobachter vom 3. April zufolge versuchten in Hannover einige Käufer, sich mit Gewalt Zugang zu einem in jüdischem Besitz befindlichen Laden zu verschaffen.[61] In München führten wiederholte Ankündigungen über den bevorstehenden Boykott bei in jüdischem Besitz befindlichen Läden in den letzten Märztagen (die Öffentlichkeit wußte noch nicht, wie lange der Boykott dauern würde) zu so regen Geschäften, daß der Völkische Beobachter die «Unvernunft eines Teiles des Publikums» beklagte, «das sein sauer verdientes Geld den Volksfeinden und hinterlistigen Verleumdern geradezu aufdrängte».[62] Am Tage des Boykotts blieben viele jüdische Geschäfte geschlossen oder schlossen früh. Große Scharen von Zuschauern blockierten in den Geschäftsvierteln des Stadtzentrums die Straßen, um sich den Ablauf der Ereignisse anzusehen: Sie waren passiv, aber sie zeigten keineswegs die Feindseligkeit gegenüber den «Volksfeinden», welche die Parteiagitatoren erwartet hatten.[63] Martha Appel, die Frau eines Dortmunder Rabbiners, bestätigt in ihren Memoiren eine ähnlich passive und gewiß nicht feindselige Einstellung bei den Menschenmengen auf den Straßen im Geschäftsviertel dieser Stadt. Sie berichtet sogar, sie habe viele Äußerungen der Unzufriedenheit mit dieser Initiative der Nationalsozialisten gehört.[64] Diese Atmosphäre scheint in den meisten Teilen des Reiches verbreitet gewesen zu sein. Der zweimonatliche Polizeibericht in der bayerischen Stadt Bad Tölz ist knapp und eindeutig: «Das einzige jüdische Geschäft ‹Cohn› am Fritzplatz hier wurde nicht boykottiert.»[65]
Zum Mangel an Begeisterung in der Bevölkerung kam erschwerend hinzu, daß sich eine Vielzahl unvorhergesehener Fragen einstellte: Wie sollte ein «jüdisches» Unternehmen definiert werden? Durch seinen Namen, durch das Judentum seiner Geschäftsleitung oder durch jüdische Kontrolle über sein Kapital oder Teile davon? Wenn das Unternehmen geschädigt würde, was würde dann, in einer Zeit der wirtschaftlichen Krise, mit seinen arischen Angestellten geschehen? Was würden, etwa bei einer Vergeltung durch das Ausland, die allgemeinen Konsequenzen dieser Aktion für die deutsche Wirtschaft sein?
Auch wenn der Aprilboykott einige Zeit lang gedroht hatte, war er doch ganz eindeutig eine improvisierte Aktion. Er mag das Ziel verfolgt haben, die antijüdischen Initiativen der SA und anderer Radikaler zu kanalisieren; deutlich zu machen, daß langfristig die Basis jüdischer Existenz in Deutschland zerstört werden würde; oder, naheliegender, nach Art der Nationalsozialisten auf ausländische Proteste gegen die Behandlung der deutschen Juden zu reagieren. Welches auch die verschiedenen Motivationen gewesen sein mögen, Hitler praktizierte eine Form der Führung, die für seine antijüdischen Aktionen der nächsten Jahre charakteristisch werden sollte: Er bestimmte gewöhnlich einen scheinbaren Kompromißkurs zwischen den Forderungen der Parteiradikalen und den pragmatischen Vorbehalten der Konservativen, wodurch er in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckte, er selbst stehe über den Details der Operation.[66] Eine derartige Zurückhaltung war offensichtlich taktischer Natur; im Falle des Boykotts war sie vom Zustand der Wirtschaft und von der Furcht vor internationalen Reaktionen diktiert.[67]
Für einige in Deutschland lebende Juden hatte der Boykott trotz seines prinzipiellen Scheiterns unerwartete und unangenehme Konsequenzen. Ein solcher Fall war der des Arthur B., eines polnischen Juden, der am 1. Februar mit seiner Kapelle von «vier deutschen Musikern (darunter eine Frau)» angestellt worden war, um im Café Corso in Frankfurt am Main zu spielen. Einen Monat später wurde B.s Vertrag bis zum 30. April verlängert. Am 30. März wurde B. von der Besitzerin des Cafés gekündigt, weil er Jude war. B. wandte sich an das Arbeitsgericht in Frankfurt, um die Zahlung des ihm für den Monat April geschuldeten Geldes zu erreichen. Die Besitzerin, so argumentierte er, hatte, als sie ihn einstellte, gewußt, daß er polnischer Jude sei. Sie sei mit der Leistung der Kapelle zufrieden gewesen und habe daher kein Recht, ihn fristlos und ohne Zahlung zu entlassen. Das Gericht wies seine Klage ab und erlegte ihm die Kosten auf; es entschied, daß die durch jüdische Hetze gegen Deutschland geschaffenen Umstände – die dazu geführt hatten, daß einige Gäste die Entlassung des Kapellmeisters verlangt und Drohungen von der zuständigen Gauführung überbracht hatten, das Café Corso werde als jüdisches Unternehmen boykottiert werden, falls Arthur B. noch weiter dort tätig sein sollte – der Beklagten erheblichen Schaden hätten zufügen können und daher einen hinlänglichen Grund für die Entlassung darstellten. «Ob die Beklagte bereits bei dem Engagement wußte, daß der Kläger ein Jude war, ist unerheblich», schloß das Gericht, «da die nationale Revolution mit ihren für das Judentum einschneidenden Folgen erst nach der Einstellung des Klägers erfolgte und die Beklagte damals gar nicht wissen konnte, daß die Zugehörigkeit des Klägers zur jüdischen Rasse späterhin noch eine so bedeutende Rolle spielen sollte.»[68]
Die Möglichkeit weiterer Boykottaktionen blieb offen. «Wir geben Ihnen hiermit davon Kenntnis», hieß es in einem Brief des Zentralkomitees der Boykottbewegung in München an die Gauleitung Hannover Süd, «daß das … Zentralkomitee zur Abwehr der jüdischen Greuel- und Boykotthetze (Zentralkomitee der Boykottbewegung) nach wie vor weiterarbeitet. Die Tätigkeit dieser Dienststelle soll sich jedoch mehr im Stillen abspielen. Wir bitten Sie um Beobachtung und Meldung von Korruptionsfällen und anderen wirtschaftlichen Vorgängen, bei welchen Juden eine üble Rolle spielen. Ihre Kreisleitungen bzw. Ortsgruppen wollen Sie dann in geeigneter Form mit obigem Sachverhalt bekannt machen. Der letzten intern-parteilichen Anordnung des stellvertretenden Führers, Pg. Hess, gemäß sollen Verlautbarungen des Zentralkomitees vorher vorgelegt werden.»[69]
Zugleich wurde es allerdings Hitler selbst zunehmend klar, daß das jüdische Wirtschaftsleben nicht offen beeinträchtigt werden durfte, jedenfalls so lange nicht, wie die deutsche Wirtschaft in einer prekären Lage war. Eine Furcht vor ökonomischer Vergeltung durch das Ausland, ob von den Juden inszeniert oder als Ausdruck echter Empörung über die Verfolgungen durch die Nazis, verband die Nationalsozialisten mit ihren konservativen Verbündeten und zwang zu zeitweiliger Mäßigung. Als im Sommer 1934 Hjalmar Schacht die Leitung der Reichsbank verlassen hatte, um Wirtschaftsminister zu werden, wurde die Nichteinmischung in jüdische Geschäftstätigkeit quasi offiziell vereinbart. So ergab sich eine potentielle Quelle der Spannung zwischen Parteiaktivisten und den oberen Rängen von Partei und Staat.
Wie die deutsche kommunistische Zeitschrift Rundschau, die mittlerweile in der Schweiz erschien, schrieb, wurden nur die kleineren jüdischen Geschäfte – also die ärmeren Juden – durch den Boykott der Nationalsozialisten geschädigt. Große Unternehmen wie das in Berlin ansässige Verlagsimperium Ullstein oder in jüdischem Besitz befindliche Banken – also das jüdische Großkapital – wurden angeblich überhaupt nicht in Mitleidenschaft gezogen.[70] Was hier lediglich als Äußerung marxistischer Orthodoxie erschien, war zum Teil wahr, denn wenn man eine jüdische Warenhauskette wie Tietz geschädigt hätte, dann hätte das deren 14.000 Angestellte arbeitslos machen können.[71] Genau aus diesem Grund billigte Hitler persönlich die Bewilligung eines Kredits an Tietz, um dessen aktuelle finanzielle Schwierigkeiten zu lindern.[72]
Bei Ullstein, einem der größten Verlage in Deutschland (er hatte ein eigenes Druckhaus und gab Zeitungen, Zeitschriften und Bücher heraus), richtete die in dem Unternehmen tätige NS-Betriebszelle am 21. Juni einen Brief an Hitler, in dem sie die katastrophalen Folgen eines heimlichen fortgesetzten Boykotts für die Beschäftigten der jüdischen Firma schilderte: «Der Verlag Ullstein, der am Tage des offiziellen Boykotts als lebenswichtiger Betrieb vom Boykott ausgenommen war», schrieb der Zellenleiter an Hitler, «hat z.Zt. besonders stark durch die Boykott-Bewegung zu leiden. Die Belegschaft ist zu einem großen Teil in der Partei, zum noch größeren Teil in der Zelle organisiert. Diese Belegschaft wird mit jedem Tag über die wöchentlich und monatlich vorgenommenen Entlassungen erregt und ersucht mich dringend, bei den zuständigen Stellen vorstellig zu werden, damit nicht die Existenz vieler Tausender braver Volksgenossen gefährdet wird. Die Verlagserscheinungen sind z.T. bis über die Hälfte der früheren Auflagenziffern zurückgegangen. Mir werden täglich geradezu haarsträubende Boykottfälle gemeldet. Z.B. wird seit langer Zeit die Aufnahme des Leiters der Ullstein-Agentur Freienwalde in die Partei mit der Begründung verweigert, daß er als Angestellter des Verlages ein Schädling der Bewegung wäre.[73]
Dies war auch so schon kompliziert genug, aber die kommunistische Rundschau hätte noch mehr Anlaß zum Grübeln gehabt, wenn sie von den vielen Widersprüchen in den Einstellungen großer deutscher Banken und Aktiengesellschaften gegenüber antijüdischen Maßnahmen gewußt hätte. Zunächst einmal gab es Überbleibsel der Vergangenheit. So saßen im März 1933, als Hans Luther als Präsident der Reichsbank durch Schacht abgelöst wurde, im achtköpfigen Arbeitsausschuß der Bank immer noch drei jüdische Bankiers und unterzeichneten die Genehmigung seiner Ernennung.[74] Diese Situation blieb nicht mehr sehr lange bestehen. Infolge des Drängens von Schacht und des ständigen Drucks der Partei vertrieben die Banken des Landes Juden aus ihren Vorständen; so wurden beispielsweise Oskar Wassermann und Theodor Frank aus dem Vorstand der Deutschen Bank entlassen.[75] Symptomatisch für ein gewisses Maß an Unbehagen über diesen Schritt ist, daß die Entlassungen mit (natürlich nie erfüllten) Versprechungen einer möglichen Wiederbeschäftigung verknüpft wurden.[76]
In den ersten Jahren des Regimes gibt es jedoch Anzeichen für eine ziemlich unerwartete Mäßigung und sogar Hilfsbereitschaft von seiten der Großunternehmen bei ihrem Umgang mit nichtarischen Firmen. Ein Drängen auf Geschäftsübergabe und sonstige Formen rücksichtsloser Ausnutzung des geschwächten Status der Juden kamen hauptsächlich von kleineren oder mittleren Unternehmen und zumindest bis Herbst 1937 viel weniger aus den höheren Rängen der Wirtschaft.[77] Einige große Gesellschaften behielten sogar jahrelang jüdische leitende Angestellte in ihren Diensten. Doch es wurden gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. So wurden bei der I. G. Farben, obwohl die meisten jüdischen Vorstandsmitglieder des Chemiegiganten noch eine Zeitlang blieben, die engsten jüdischen Mitarbeiter des Präsidenten Carl Bosch wie Ernst Schwarz und Edmund Pietrowski auf Positionen außerhalb des Reiches versetzt, der eine nach New York, der andere in die Schweiz.[78]
Sehr exponierte Juden mußten natürlich gehen. Innerhalb von wenigen Monaten wurde der Bankier Max Warburg aus einem Aufsichtsrat nach dem anderen ausgeschlossen. Als er aus dem Aufsichtsrat der Hamburg-Amerika-Linie vertrieben wurde, wurden die Würdenträger, die sich zu seiner Verabschiedung versammelt hatten, Zeugen einer seltsamen Szene. Da angesichts der Umstände anscheinend niemand anders eine Abschiedsrede parat hatte, hielt der jüdische Bankier selbst eine Ansprache: «Zu unserem großen Bedauern», so begann er, «haben wir davon Kenntnis nehmen müssen, daß Sie den Entschluß gefaßt haben, aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft auszuscheiden, ja, diesen Entschluß als unwiderruflich bezeichneten», und er schloß nicht weniger passend: «Und nun wünsche ich Ihnen, lieber Herr Warburg, einen ruhigen Lebensabend, Glück und Segen in ihrer Familie.»[79]