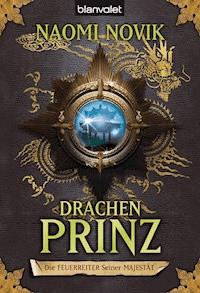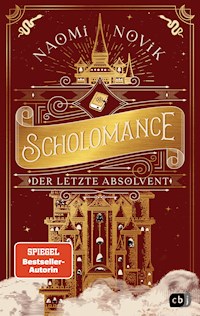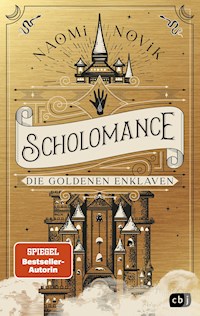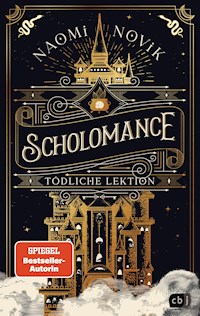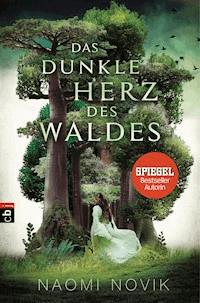
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Agnieszka liebt das Tal, in dem sie lebt: das beschauliche Dorf und den silbern glänzenden Fluss. Doch jenseits des Flusses liegt der Dunkle Wald, ein Hort böser Macht, der seine Schatten auf das Dorf wirft. Einzig der »Drache«, ein Zauberer, kann diese Macht unter Kontrolle halten. Allerdings fordert er einen hohen Preis für seine Hilfe: Alle zehn Jahre wird ein junges Mädchen ausgewählt, das ihm bis zur nächsten Wahl dienen muss – ein Schicksal, das beinahe so schrecklich scheint wie dem bösen Wald zum Opfer zu fallen. Der Zeitpunkt der Wahl naht und alle wissen, wen der Drache aussuchen wird: Agnieszkas beste Freundin Kasia, die schön ist, anmutig, tapfer – alles, was Agnieszka nicht ist. Niemand kann ihre Freundin retten. Doch die Angst um Kasia ist unbegründet. Denn als der Drache kommt, wählt er nicht Kasia, sondern Agnieszka.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 904
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Naomi Novik
Aus dem amerikanischen
von Marianne Schmidt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2016 cbj Kinder- und Jugendbuch Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
© 2015 by Temeraire LLC
Die amerikanische Originalausgabe erschien
2016 unter dem Titel »Uprooted« bei Del Rey, einem Imprint von
Random House in der Penguin Random House Verlagsgruppe LLC, New York.
This translation published by arrangement with Del Rey,
an imprint of Random House, a division of Random House LLC, New York.
Del Rey and the House colophon are
registered trademarks of Random House LLC.
Aus dem amerikanischen Englisch Von Marianne Schmidt
Lektorat: Julia Przeplaska
Covergestaltung: Carolin Liepins, München
unter Verwendung mehrerer Motive von Shutterstock
(Khomenko Maryna/Honza Krej/Dudarev Mikhail/Daimond Shutter)
kk · Herstellung: UK
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-17140-7 V010
www.cbj-verlag.de
Kapitel 1
Es stimmt nicht, dass der Drache die Mädchen, die er sich holt, verspeist. Ganz gleich, was für Geschichten man außerhalb unseres Tales erzählen mag. Manchmal hören wir diese Gerüchte von Reisenden, die in unser Dorf kommen. Bei ihnen klingt es, als würden wir ihm Menschenopfer darbringen – und als ob er tatsächlich ein Drache wäre. Natürlich stimmt das nicht. Er mag ein Magier und unsterblich sein, aber er ist und bleibt ein Mann. Abgesehen davon würden sich unsere Väter zusammentun und ihn töten, wenn er alle zehn Jahre eine von uns verschlingen würde. Er verteidigt uns gegen den Dunklen Wald und wir sind ihm dankbar dafür – aber so dankbar nun auch wieder nicht.
Er verschlingt seinen Tribut nicht wortwörtlich. Es kommt einem lediglich so vor, weil er das ausgewählte Mädchen in seinen Turm bringt, und dann, zehn Jahre später, wieder freilässt. Doch bis dahin ist es längst ein anderes geworden, trägt viel zu kostbare Kleider und spricht wie eine Edelfrau. Nachdem sie zehn Jahre lang mit einem Mann zusammengelebt hat, ist ihr Ruf natürlich für alle Zeit ruiniert, obwohl alle weggeholten Mädchen beschwören, er sei nie zudringlich geworden. Was sollen sie auch sonst sagen? Aber das ist noch nicht einmal das Schlimmste – immerhin stattet der Drache sie mit einer Börse voller Silbermünzen als Brautgabe aus, wenn er sie gehen lässt. Schon allein deshalb würde sie jeder mit Kusshand nehmen und ungeachtet ihres Rufes heiraten. Doch sie weigern sich, einen der Unsrigen zum Ehemann zu nehmen. Sie wollen nicht mehr bei uns bleiben.
»Sie verlernen es, sich hier zu Hause zu fühlen«, sagte mein Vater einmal völlig unerwartet zu mir. Ich saß neben ihm auf dem Kutschbock unseres großen, leeren Wagens, als wir heimfuhren, nachdem wir das Feuerholz für die Woche ausgeliefert hatten. Wir lebten in Dvernik, das weder das größte noch das kleinste Dorf im Tal war und sich auch nicht am nächsten am Rande des Dunklen Waldes befand; rund sieben Meilen trennten unser Dorf von ihm. Die Straße führte uns allerdings über einen mächtigen Hügel und an einem klaren Tag konnte man den ganzen Weg des Flusses vom Gipfel aus verfolgen. Er schlängelte sich bis zu dem hellgrauen Streifen verbrannter Erde unmittelbar vor der Grenze zum Dunklen Wald, der wie eine dichte dunkle Wand von Bäumen dahinter aufragte. Der Drachenturm lag weit entfernt in der entgegengesetzten Richtung: ein weißer Kreideklotz am Fuße des westlichen Gebirges.
Ich war damals noch sehr jung – nicht älter als fünf, glaube ich. Doch ich wusste bereits, dass über den Drachen nicht gesprochen wurde und auch nicht über die Mädchen, die er sich holte. Vielleicht brannte es sich mir deshalb so fest ins Gedächtnis, als mein Vater diese Regel brach.
»Aber sie wissen, wie man sich fürchtet«, fuhr mein Vater fort. Das war alles. Dann machte er ein schnalzendes Geräusch, und die Pferde zogen wieder an, den Hügel hinunter, bis wir zwischen Bäumen verschwanden.
Zu jener Zeit ergaben seine Worte nicht viel Sinn für mich. Wir alle fürchteten uns vor dem Dunklen Wald. Aber das Tal war unser Zuhause. Wie konnte man das verlassen wollen? Und doch kamen jene Mädchen niemals zurück, um wieder daheim zu leben. Wenn der Drache sie aus dem Turm gelassen hatte, kehrten sie für kurze Zeit zu ihren Familien zurück – für eine Woche, manchmal auch für einen Monat, aber niemals für viel länger. Dann nahmen sie das Drachensilber und gingen fort. Die meisten von ihnen zogen nach Kralia und besuchten dort die Universität. Fast immer heirateten sie irgendeinen Mann aus der Stadt. Wenn nicht, dann wurden sie Gelehrte oder betrieben ein Ladengeschäft. Aber man erzählte sich auch hinter vorgehaltener Hand von Jadwiga Bach, die vor sechzig Jahren vom Drachen geholt worden war und danach die Kurtisane und Geliebte eines Barons und eines Herzogs wurde. Zu der Zeit, als ich geboren wurde, war sie nur noch eine reiche alte Dame, die ihren Großnichten und -neffen herrliche Geschenke zukommen ließ, aber niemals zu Besuch kam.
Nun ist es zwar keineswegs so, dass man dem Drachen seine Tochter übergibt, damit er sie verspeisen kann, aber es ist trotzdem alles andere als eine erfreuliche Sache. Es gibt nicht so viele Dörfer in unserem Tal, dass die Chancen, von ihm auserwählt zu werden, besonders gering wären. Wenn zehn Jahre verstrichen sind, nimmt er sich immer ein Mädchen von siebzehn Jahren, das zwischen dem betreffenden Oktober des einen und dem des nächsten Jahres geboren wurde. In meinem Jahrgang gab es elf Mädchen, die zur Auswahl standen, und die Gefahr, dass es eine Bestimmte treffen würde, war größer, als würde man zwei Würfel werfen.
Alle sagen, dass man ein Mädchen, das für den Drachen infrage kommt, anders liebt, wenn es älter wird. Dagegen könne man gar nichts tun, denn schließlich wisse man immer, wie leicht man es verlieren könnte. Aber bei mir und meinen Eltern war es nicht so. Als ich alt genug war, um zu begreifen, dass ich geholt werden könnte, wussten wir alle längst, dass er sich Kasia holen würde. Nur durchziehende Reisende, die ahnungslos waren, lobten Kasias Eltern gegenüber, wie wunderschön ihre Tochter sei oder wie klug oder wie freundlich. Dabei beanspruchte der Drache gar nicht immer das hübscheste Mädchen. Aber er suchte sich stets eine junge Frau aus, die in irgendeiner Hinsicht aus der Menge hervorstach. Wenn es ein Mädchen gab, das weit und breit das schönste war oder das klügste oder die beste Tänzerin oder am liebreizendsten, dann entschied er sich für sie, obwohl er kaum je ein Wort mit ihnen wechselte, ehe er seine Wahl traf.
Kasia war all das in einer Person. Sie hatte dichtes Haar in der Farbe goldenen Weizens, das sie zu einem Zopf flocht, der ihr bis auf die Hüfte hing. Ihre Augen waren von einem warmen Braun und ihr Lachen klang wie ein Lied, bei dem man einstimmen wollte. Ihr fielen immer die besten Spiele ein und sie ersann immerzu Geschichten und neue Tänze. Sie konnte für ein ganzes Festgelage kochen, und wenn sie die Wolle der Schafe ihres Vaters spann, kam der Faden glatt und gleichmäßig vom Rad ohne einen einzigen Knoten.
Ich weiß, wenn ich von ihr spreche, hört es sich so an, als wäre sie aus einer Geschichte entsprungen, aber es war andersherum. Wenn mir meine Mutter die Märchen von der spinnenden Prinzessin oder dem mutigen Gänsemädchen oder den Flussjungfrauen erzählte, stellte ich mir diese Mädchen allesamt ein bisschen so wie Kasia vor. Da ich noch nicht alt genug war, um weise zu sein, liebte ich sie umso mehr, und nicht etwa weniger, weil ich wusste, dass sie mir schon bald genommen werden würde.
Kasia selbst sagte, es kümmere sie nicht. Sie war nämlich auch furchtlos. Dafür sorgte ihre Mutter Wensa. Ich erinnere mich daran, wie ich sie einmal zu meiner Mutter sagen hörte: »Sie wird tapfer sein müssen«, während sie Kasia drängte, noch weiter an einem Baum hinaufzuklettern, an dem sie kopfüber baumelte. Meiner Mutter stiegen bei dieser Bemerkung die Tränen in die Augen, und sie umarmte Wensa.
Wir lebten nur drei Häuser voneinander entfernt. Ich selbst hatte keine eigene Schwester, nur drei Brüder, die viel älter waren als ich. Kasia war meine beste Freundin. Von der Wiege an spielten wir miteinander. Zunächst krabbelten wir unseren Müttern zwischen den Beinen herum, später dann vertrieben wir uns auf der Straße vor unseren Elternhäusern die Zeit, bis wir alt genug waren, allein im Wald herumzutollen. Ich wollte nie drinnen herumsitzen, wenn wir stattdessen auch Hand in Hand unter Ästen hindurchrennen konnten. Ich stellte mir immer vor, dass die Bäume ihre Arme zu uns hinunterbogen, um uns Schutz zu geben. Ich wusste nicht, wie ich es ertragen sollte, wenn der Drache meine Freundin holen würde.
Meine Eltern hätten sich auch dann keine allzu großen Sorgen um mich gemacht, wenn es Kasia nicht gegeben hätte. Mit siebzehn war ich immer noch ein viel zu dürrer Wildfang mit großen Füßen und zerzaustem, schmutzig braunem Haar. Meine einzige Gabe, wenn man es denn so nennen konnte, bestand darin, dass ich innerhalb eines einzigen Tages alles, was ich anzog, zerriss, verlor oder schmutzig machte. Als ich zwölf Jahre alt war, war meine Mutter so verzweifelt, dass sie aufgab und mich in der abgelegten Kleidung meiner Brüder herumlaufen ließ. Die einzige Ausnahme bildeten die Festtage, an denen ich mich erst zwanzig Minuten, bevor wir aufbrachen, umziehen durfte. An diesen Tagen musste ich dann auf der Bank vor unserem Haus sitzen, bis wir zur Kirche gingen. Trotzdem gab es keine Garantie, dass ich auf dem Weg zum Festplatz nicht doch an einer Ranke hängen blieb oder mich mit Schlamm vollspritzte.
»Du musst einen Schneider heiraten, meine kleine Agnieszka«, pflegte mein Vater lachend zu sagen, wenn er abends aus dem Wald zurückkam und ich mit schmuddeligem Gesicht auf ihn zustürmte. Immer hatte ich mindestens ein Loch in irgendeinem Kleidungsstück und dafür nie ein Taschentuch. Natürlich hob er mich trotzdem hoch in die Luft und küsste mich; meine Mutter seufzte, aber nur ein bisschen: Welche Eltern würden sich schon ernsthaft darüber beklagen, wenn sie bei ihrer möglicherweise für den Drachen bestimmten Tochter ein paar Unzulänglichkeiten feststellten?
Unser letzter Sommer, bevor der Drache kam, war lang und warm und tränenreich. Es war nicht Kasia, die weinte, sondern ich. Bis spät in die Nacht hinein blieben wir im Wald und versuchten, jeden einzelnen goldenen Tag so lange wie möglich auszukosten. Ich kam spät nach Hause, müde und hungrig, und verkroch mich sofort in die Dunkelheit meines Bettes. Meine Mutter kam immer noch einmal zu mir, streichelte meinen Kopf und sang leise, während ich mich in den Schlaf weinte. Sie stellte mir auch einen Teller mit Essen neben das Bett für den Fall, dass mich der Hunger mitten in der Nacht aufwecken würde. Abgesehen davon unternahm sie keinen Versuch, mich zu trösten: Was hätte sie auch sagen sollen? So viel wussten wir beide: Ganz gleich, wie sehr sie Kasia und deren Mutter Wensa auch liebte, da war dennoch dieser kleine Knoten der Erleichterung in ihrem Bauch – nicht meine Tochter, nicht mein einziges Mädchen! Und natürlich hätte ich nicht ernsthaft gewollt, dass sie etwas anderes empfindet.
Beinahe den ganzen Sommer über gab es nur Kasia und mich. So war es schon lange vorher gewesen. Als wir noch jünger waren, hatten wir uns den anderen Dorfkindern angeschlossen, aber als wir heranwuchsen und Kasia immer schöner wurde, hatte ihre Mutter zu ihr gesagt: »Es wäre besser, wenn du dich von den Jungen fernhalten würdest. Für dich und auch für sie.« Ich aber klammerte mich an sie, und meine Mutter liebte Kasia und Wensa genug, um nicht zu versuchen, mich von meiner Freundin zu trennen. Auch wenn sie wusste, dass es mir am Ende nur umso mehr wehtun würde.
Am letzten Tag streiften wir durch den Wald, dort, wo die goldenen und flammend roten Blätter noch immer raschelnd an den Bäumen über uns hingen. Überall am Boden lagen reife Kastanien. Aus Zweigen und trockenem Laub machten wir ein kleines Feuer und rösteten ein paar davon. Der nächste Tag war der erste Oktober und morgen würde das große Fest zu Ehren unseres Beschützers und Herrn stattfinden. Am nächsten Tag würde der Drache kommen.
»Ich wünschte, ich wäre ein Troubadour«, sagte Kasia, die mit geschlossenen Augen auf dem Rücken lag. Sie summte ein bisschen vor sich hin. Ein fahrender Sänger war bereits für das Fest angereist und hatte an diesem Morgen auf dem Festplatz seine Lieder geprobt. Schon die ganze Woche über waren Wagen mit Tributgütern eingetroffen.
»Durch ganz Polnya würde ich ziehen und für den König singen.« Sie sprach bedächtig und nicht wie ein Kind, das Luftschlösser baut. Bei ihr klang es so, als würde sie ernsthaft darüber nachdenken, das Dorf zu verlassen und für immer wegzugehen.
Ich streckte meine Hand aus und griff nach der ihren. »Und jeden Mittwinter würdest du heimkommen«, sagte ich, »und all die Lieder für uns singen, die du unterwegs gelernt hast.« Wir hielten uns umklammert, und ich ließ den Gedanken nicht zu, dass keines der Mädchen, die vom Drachen geholt worden waren, jemals wieder nach Hause zurückkehren wollte.
Natürlich verabscheute ich den Drachen zu diesem Zeitpunkt aus tiefstem Herzen. Aber er war kein schlechter Herr. Auf der anderen Seite der nördlichen Berge gab es den Baron der Gelben Marschen, der eine Armee von fünftausend Mann unterhielt, die für ihn in den Kriegen Polnyas zu kämpfen hatten. Er besaß eine Burg mit vier Türmen und eine Ehefrau, die Juwelen in der Farbe von Blutstropfen trug und einen Mantel aus weißem Fuchsfell. Dabei war das Gebiet des Barons nicht wohlhabender als unser Tal. Alle Männer mussten einen Tag pro Woche auf den Äckern ihres Herrn arbeiten, dem die fruchtbarsten Böden gehörten, und die besten ihrer Söhne wurden für sein Heer eingezogen. Außerdem gab es da noch seine Soldaten, die dafür sorgten, dass die Mädchen im Haus bleiben mussten und nur noch in Begleitung hinausdurften, sobald sie zu Frauen heranreiften. Und nicht einmal er war ein schlechter Herr.
Der Drache hatte nur den einen Turm und nicht einen einzigen Mann unter Waffen, ja, nicht einmal einen Bediensteten, abgesehen von dem Mädchen, das er sich holte. Er brauchte auch keine Armee: Den Dienst, den er seinem König schuldete, verrichtete er aus eigener Kraft, und zwar mithilfe seiner Magie. Manchmal musste er zum königlichen Hof reisen, um seinen Treueeid zu erneuern, und ich nehme an, dass der König ihn zur Beteiligung an einem Krieg heranziehen konnte. Aber der Großteil seiner Verpflichtung bestand darin hierzubleiben, um den Dunklen Wald zu beobachten und das Königreich vor dessen Schrecken zu beschützen.
Die einzige Extravaganz, die er sich leistete, waren Bücher. Für Dorfbewohner waren wir allesamt sehr belesen, was daran lag, dass er bereit war, bares Gold für einen dicken Wälzer zu bezahlen. Deshalb nahmen die fahrenden Buchhändler den langen Weg zu uns auf sich, obwohl wir am äußersten Rand von Polnya lebten. Und da es immer ein weiter Weg für sie war, füllten sie die Satteltaschen ihrer Maultiere mit zerfledderten und billigen Büchern, die sie uns für wenige Münzen verkauften. Ein Haus, das nicht mindestens zwei oder drei Bücher besaß, die stolz auf einem Wandregal zur Schau gestellt wurden, galt als armselig.
Das mag nach kleinen, unwichtigen Dingen klingen, wenn man nicht nah genug am Rande des Dunklen Waldes lebt, um das alles zu verstehen. Nach Dingen, die nicht Grund genug sein können, eine Tochter aufzugeben. Ich aber habe den Grünen Sommer miterlebt, in dem ein heißer Wind Pollen aus dem Dunklen Wald im Westen bis in unser Dorf, auf unsere Felder und hinein in unsere Gärten trug. Das Getreide schoss üppig auf, war aber seltsam und missgebildet. Jeder, der davon aß, wurde krank und von einer Wut gepackt, die ihn dazu brachte, auf seine Familie loszugehen. Am Ende rannten diese Unglücklichen in den Wald und verschwanden, wenn man sie nicht bereits vorher eingesperrt hatte.
Damals war ich erst sechs Jahre alt. Meine Eltern versuchten, mich so gut es ging vor all dem abzuschirmen, aber trotzdem erinnere ich mich lebhaft an das kalte, klamme Gefühl von Entsetzen überall. Ich erinnere mich daran, dass sich alle fürchteten, und an den ständig beißenden Hunger in meinem Bauch. Wir hatten bereits unsere gesamten Vorräte des vergangenen Jahres aufgebraucht und warteten sehnsüchtig auf den Frühling. Einer unserer Nachbarn schlang ein paar grüne Bohnen hinunter, denn der Hunger hatte ihn unvorsichtig gemacht. Ich erinnere mich an die Schreie, die in dieser Nacht aus seinem Haus gellten, und daran, dass ich aus dem Fenster lugte und sah, wie mein Vater sich die Mistgabel griff, die immer an unserer Scheune lehnte, und der Familie zu Hilfe eilte.
Irgendwann in diesem Sommer, in dem ich noch zu jung war, um das ganze Ausmaß der Gefahr zu begreifen, entwischte ich meiner müden, abgehärmten Mutter und rannte in den Wald. Ich fand ein halb verdorrtes Dornengebüsch in einem vom Wind verschonten Winkel. Schnell schob ich mich durch die toten Zweige bis in das geschützte Herz des Gebüsches und entdeckte dort Brombeeren, rund und saftig und vollkommen, ohne jede Missbildung. Jede einzelne davon löste ein kleines Glücksgefühl in mir aus, als ich sie mir in den Mund schob. Zwei Hände voll aß ich, dann pflückte ich so viel, wie ich in meinem aufgeschürzten Rock tragen konnte. Damit rannte ich nach Hause. Die Beeren hinterließen lilafarbene Flecken auf meinem Kleid, und meine Mutter weinte vor Entsetzen, als sie mein verschmiertes Gesicht sah. Ich wurde aber nicht krank: Irgendwie war der Busch dem Fluch entgangen und die Brombeeren hatten keinen Schaden genommen. Doch die Tränen meiner Mutter verängstigten mich zutiefst. Noch Jahre später machte ich einen Bogen um Brombeeren.
In diesem Jahr war der Drache an den Königshof gerufen worden. Er kam schnell wieder zurück und ritt geradewegs zu den Feldern, wo er ein magisches Feuer heraufbeschwor, um die vergiftete Ernte Halm für Halm zu vernichten. Das war seine Pflicht. Danach jedoch ging er zu jedem einzelnen Haus, in dem jemand krank geworden war, und gab den Befallenen einen Schluck eines magischen Tranks, der ihren Geist wieder klärte. Als Nächstes erging der Befehl von ihm, dass die Dörfer, die von der Plage verschont geblieben waren, ihre Ernte mit uns teilen mussten. Er überließ uns sogar die gesamten Tributzahlungen, die er erhalten hatte, sodass niemand von uns verhungern musste. Im nächsten Frühjahr, unmittelbar vor der Aussaat, schritt er noch einmal die Felder ab, um die letzten Überreste des Übels auszurotten, welches die Pflanzen befallen hatte, ehe sie wuchern und sich ausbreiten konnten.
Doch obwohl er uns gerettet hatte, liebten wir ihn nicht. Niemals kam er aus seinem Turm, um in der Erntezeit das Glas auf die Männer zu erheben, wie es der Baron der Gelben Marschen tat, oder um etwas auf dem Markt zu kaufen, wie es die Ehefrau des Barons und ihre Töchter zu tun pflegten. Manchmal wurden Theaterstücke von fahrenden Kompanien aufgeführt oder Sänger fanden von Rosya aus den Weg über den Gebirgspass zu uns. Der Drache kam nie, um ihnen zu lauschen. Wenn die Fuhrmänner ihm ihre Tribute brachten, öffneten sich die Tore von selbst. Burschen schleppten ihre Güter in den Keller, ohne den Drachen zu Gesicht zu bekommen. Niemals wechselte er mehr als ein paar Worte mit unseren Dorfältesten, nicht einmal mit dem Vorsteher von Olshanka, dem größten Dorf im Tal, das ganz nah bei seinem Turm lag. Der Drache gab sich keinerlei Mühe, uns für sich einzunehmen; keiner von uns kannte ihn wirklich.
Und natürlich war er auch ein Meister der dunklen Magie. In einer klaren Nacht konnte man Blitze um seinen Turm herum zucken sehen, sogar im Winter: Es waren fahle Lichtbündel, die von seinen Fenstern aus losschossen, durch die Straßen und den Fluss hinab bis zum Dunklen Wald, den er auf diese Weise bewachte. Manchmal, wenn der Dunkle Wald jemanden geholt hatte – eine junge Schäferin, die ihrer Herde gefolgt war und sich zu nah an den Waldrand gewagt hatte, oder einen Jäger, der aus der falschen Quelle getrunken hatte, oder einen unglückseligen Reisenden, der über den Gebirgspass kam und eine kleine Melodie summte, die sich im Kopf festzusetzen begann –, dann, ja dann verließ der Drache seinen Turm auch für sie. Und wenn er jemanden weggebracht hatte, wurde er niemals mehr gesehen.
Er war nicht böse, aber er war unnahbar und Furcht einflößend. Und er würde Kasia für sich beanspruchen, weshalb ich ihn hasste, und zwar schon seit vielen, vielen Jahren.
Auch in dieser letzten Nacht veränderten sich meine Gefühle nicht. Kasia und ich genossen unsere Kastanien. Die Sonne war bereits untergegangen und unser Feuer heruntergebrannt, aber wir blieben auf dieser Lichtung, solange die Glut noch nicht erloschen war. Wir würden am nächsten Morgen nicht weit laufen müssen. Gewöhnlich fand das Erntedankfest in Olshanka statt, aber in einem Jahr der Auswahl wurde es immer in einem Dorf abgehalten, in dem mindestens eines der infrage kommenden Mädchen lebte. Auf diese Weise wollte man die Sache für die betroffene Familie etwas leichter machen. Und unser Dorf hatte Kasia.
Am nächsten Morgen, als ich mein neues grünes Überkleid anzog, hasste ich den Drachen sogar noch mehr. Die Hände meiner Mutter zitterten, als sie mir die geflochtenen Haare hochsteckte. Wir wussten, dass es Kasia treffen würde, aber das bedeutete nicht, dass wir anderen uns nicht fürchteten. Trotzdem raffte ich meinen Rock und hob ihn zur Sicherheit vom Boden hoch, dann kletterte ich so vorsichtig wie möglich auf den Wagen. Zweimal suchte ich den Sitz nach Splittern ab und ich ließ mir von meinem Vater helfen, so entschlossen war ich, mir Mühe zu geben. Ich wusste, dass es nichts nutzen würde, aber ich wollte Kasia zeigen, dass ich sie genug liebte, um ihr eine faire Chance zu geben. Ich wollte auf keinen Fall schlampig erscheinen oder schielen oder hinken, wie es andere Mädchen taten.
Wir stellten uns auf dem Gemeindeanger in einer Reihe auf; alle elf Mädchen, eines neben dem anderen. Die Festtafeln waren zum Quadrat zusammengeschoben worden und bogen sich unter ihrer Last. Sie waren nicht groß genug, um den Tributen des ganzen Tales Platz zu bieten. Die Leute hatten sich dahinter versammelt. Säcke mit Weizen und Hafer waren an den Ecken des Platzes auf dem Gras zu Pyramiden aufgestapelt worden. Wir Mädchen, die zur Auswahl standen, waren die Einzigen, die zusammen mit unseren Familien ebenfalls auf dem Grün warteten. Nur die Dorfälteste, Danka, war noch bei uns und lief nervös auf und ab, während sich ihr Mund bewegte, ohne dass ein Laut herausgekommen wäre; sie probte ihre Begrüßungsworte.
Die anderen Mädchen kannte ich nicht besonders gut. Sie stammten nicht aus Dvernik. Wir alle waren schweigsam und steif in unserer Festtagskleidung und mit unseren geflochtenen Haaren, während wir die Blicke nicht von der Straße abwenden konnten. Noch gab es kein Anzeichen für die nahende Ankunft des Drachen. Mein Kopf schwirrte von den wildesten Fantasien. Ich malte mir aus, wie ich mich vor Kasia stellen würde, sobald der Drache da wäre, und ihn anflehen würde, mich an ihrer Stelle zu nehmen. Oder wie ich sagen würde, dass Kasia nicht mit ihm gehen wolle. Aber in Wahrheit wusste ich natürlich, dass ich nichts dergleichen tun würde, weil mir der Mut fehlte.
Und als er dann kam, geschah es auf Furcht einflößende Weise. Er erschien nämlich keineswegs auf der Straße, sondern trat einfach aus dem Nichts auf uns zu. Ich sah gerade in seine Richtung, als er eintraf: Zuerst erschienen seine Finger mitten in der Luft, dann ein Arm und ein Bein, schließlich ein halber Mann. Das alles schien so unmöglich und unecht, dass ich den Blick nicht abwenden konnte, obwohl sich mir beinahe der Magen umdrehte. Die anderen hatten mehr Glück: Sie bemerkten ihn nicht einmal, bis er den ersten Schritt auf uns zu machte. Alle um mich herum versuchten, nicht vor Überraschung zusammenzuzucken.
Der Drache war anders als alle Männer in unserem Dorf. Er sollte eigentlich alt und gebeugt und grauhaarig sein, denn er lebte schon seit bestimmt hundert Jahren in seinem Turm. Doch er war groß gewachsen und hielt sich aufrecht; er hatte keinen Bart und seine Haut war fest und glatt. Wenn ich ihn nur flüchtig auf der Straße gesehen hätte, hätte ich ihn für einen jungen Burschen gehalten, nur ein wenig älter als ich: für jemanden, dem ich über die Festtagstafeln hinweg zulächeln würde und der mich vielleicht um einen Tanz bitten könnte. Aber irgendetwas an seinem Gesicht war unnatürlich. Seine Augen waren von einem Krähennest von Falten umgeben, als ob ihm zwar die Jahre nichts hatten anhaben können, wohl aber die ständige Belastung. Es war zwar trotzdem kein hässliches Gesicht, doch die Kälte darin machte es unangenehm. Alles an ihm sprach eine deutliche Sprache: Ich bin keiner von euch und ich will es auch nicht sein.
Natürlich war seine Kleidung kostbar. Der Brokatstoff seines Kontusz hätte auch ohne seine goldenen Knöpfe ein ganzes Jahr lang eine Familie ernährt. Aber der Drache war so hager wie ein Mann, dessen Ernte in drei von vier Jahren ungenießbar gewesen war. Er hielt sich sehr aufrecht und gerade mit der nervösen Energie eines Jagdhundes, als ob er nichts lieber wollte, als möglichst schnell wieder zu verschwinden. Es war der schlimmste Tag in unser aller Leben, aber er hatte keine Geduld mit uns. Als unsere Dorfälteste Danka sich vor ihm verbeugte und ansetzte: »Mein Herr, darf ich Euch diese …«, unterbrach er sie und sagte: »Ja, lasst es uns schnell hinter uns bringen.«
Die Hand meines Vaters legte sich liebevoll auf meine Schulter, als er neben mich trat und sich verbeugte. Meine Mutter, die an meiner anderen Seite stand, hielt meine Hand fest umklammert. Dann traten die beiden gemeinsam zögerlich einen Schritt zurück; genau wie die anderen Eltern. Instinktiv drängten wir elf Mädchen uns enger aneinander. Kasia und ich standen beinahe am Ende der Reihe. Ich wagte es nicht, nach ihrer Hand zu greifen, aber ich war nahe genug neben ihr, dass sich unsere Arme berührten, während ich den Drachen beobachtete und ihn verabscheute. Mein Hass wuchs noch, als er unsere Reihe abschritt und jedes Mädchen am Kinn packte, damit es den Kopf hob und er es mustern konnte.
Er sprach nicht mit jeder von uns. Zu der jungen Frau neben mir, die aus Olshanka stammte, sagte er kein Wort, obwohl ihr Vater Borys der beste Pferdezüchter im Tal war, sie ein Kleid aus leuchtend rot gefärbter Wolle trug und ihr schwarzes Haar in zwei wunderschön geflochtenen, mit roten Schleifen geschmückten Zöpfen herabhing. Als ich an der Reihe war, bedachte er mich mit einem stirnrunzelnden Blick. Seine schwarzen Augen waren kalt und seine bleichen Lippen zusammengekniffen, bis er fragte: »Dein Name, Mädchen?«
»Agnieszka«, versuchte ich zu antworten, doch ich musste feststellen, dass mein Mund wie ausgetrocknet war. Ich schluckte. »Agnieszka«, versuchte ich es noch einmal, und meine Stimme war nur ein Flüstern, »mein Herr«.
Mein Gesicht glühte. Ich schlug die Augen nieder. Da fiel mir auf, dass sich trotz all der Mühe, die ich mir gegeben hatte, am Saum meines Rockes drei große Schmutzflecken ausgebreitet hatten.
Der Drache setzte seinen Weg fort. Und dann machte er halt und heftete seinen Blick auf Kasia. Bei keiner anderen hatte er sich so viel Zeit gelassen. Er blieb vor ihr stehen, legte seine Hand unter ihr Kinn und ein dünnes, erfreutes Lächeln krümmte seinen harten Mund. Kasia hielt seinem Blick tapfer stand und zuckte nicht zusammen. Sie versuchte nicht, ihre Stimme rau oder zu hoch klingen zu lassen oder sie sonst irgendwie zu verstellen. Sie war fest und melodisch, als sie auf seine Frage hin antwortete: »Kasia, mein Herr.«
Wieder lächelte er sie an, nicht angenehm, sondern mit dem Ausdruck einer zufriedenen Katze. Danach lief er nur noch der Form halber bis ans Ende der Reihe und würdigte die beiden Mädchen, die neben Kasia standen, kaum eines Blickes. Ich hörte, wie Wensa hinter uns scharf den Atem einsog, und es klang beinahe wie ein Schluchzen, als der Drache kehrtmachte und Kasia erneut fixierte, noch immer den befriedigten Ausdruck im Gesicht. Dann jedoch legte er wieder seine Stirn in Falten, drehte seinen Kopf zur Seite und sah mich unverwandt an.
Ohne es zu merken, hatte ich Kasias Hand genommen und drückte sie verzweifelt, und Kasia drückte zurück. Dann löste sie sich rasch aus dem Griff und ich faltete meine Hände vor meinem Bauch. Ich war verängstigt und meine Wangen hatten sich glühend rot verfärbt. Der Drache kniff seine Augen noch mehr zusammen und starrte mich wortlos an.
Plötzlich hob er seine Hand. Auf seiner Handfläche formte sich ein kleiner Feuerball aus blauweißen Flammen. »Sie wollte nichts Böses tun«, sagte die mutige, mutige, mutige Kasia und tat für mich, was ich für sie nicht hätte tun können. Ihre Stimme zitterte, war aber gut zu hören, während ich wie ein verängstigtes Kaninchen auf den Feuerball starrte. »Bitte, mein Herr …«
»Schweig, Mädchen«, fauchte der Drache und streckte mir seine Hand entgegen. »Nimm das!«
»Ich … Wie bitte?«, fragte ich verblüffter, als wenn er mir die Kugel ins Gesicht geschleudert hätte.
»Steh nicht herum wie ein Tölpel«, sagte er schneidend. »Nimm sie.«
Als ich meine Hand hob, zitterte sie so stark, dass ich es nicht verhindern konnte, seine Finger zu streifen, während ich versuchte, ihm den Feuerball aus der Hand zu nehmen. Ganz gleich, wie verhasst mir diese Berührung war. Seine Haut fühlte sich fiebrig heiß an. Die Flammenkugel jedoch war kühl wie eine Glasmurmel, und ich verspürte keinerlei Schmerzen, als ich sie anfasste. Überrascht und erleichtert hielt ich sie zwischen meinen Fingern und starrte sie an. Der Drache musterte mich mit verärgerter Miene.
»Nun«, sagte er barsch, »dann bist du es wohl.« Er nahm mir die Feuerkugel aus der Hand und umschloss sie einen kurzen Moment lang mit der Faust, woraufhin sie ebenso schnell verschwand, wie sie erschienen war. Der Drache drehte sich um und sagte zu Danka: »Schick die Tribute so bald wie möglich zum Turm.«
Ich begriff noch immer nicht. Ich glaube, niemand verstand es sofort, nicht einmal meine Eltern. Alles geschah viel zu schnell, und ich war schockiert, weil ich überhaupt seine Aufmerksamkeit auf mich gezogen hatte. Mir blieb nicht einmal die Gelegenheit, zurückzuschauen und ein letztes Abschiedswort zu sagen, ehe der Drache sich zum Gehen anschickte. Seine Finger hatten sich fest um mein Handgelenk geschlossen. Nur Kasia bewegte sich. Mein Blick schoss zu ihr, und ich bemerkte, dass sie protestierend nach mir greifen wollte. Doch der Drache zerrte mich ungeduldig und unsanft fort. Ich stolperte ihm hinterher, als er mich mit sich hoch in die Luft riss.
Ich würgte und presste meine freie Hand auf meinen Mund, als wir wieder aus der Luft heraustraten. Der Drache ließ mein Handgelenk los, und ich sank auf die Knie und erbrach mich, ohne auch nur zu sehen, wo wir uns befanden. Mit einem unterdrückten Aufschrei brachte der Drache seinen Ekel zum Ausdruck, denn ich hatte die längliche Spitze seines Lederstiefels besudelt.
»Wie unnütz«, sagte er barsch. »Hör auf zu spucken, Mädchen, und mach diesen Dreck weg.«
Dann ließ er mich zurück, und seine Absätze klapperten laut über den Boden, bis er schließlich verschwunden war.
Zitternd blieb ich hocken, bis ich mir sicher sein konnte, dass nichts mehr kommen würde. Dann wischte ich mir mit dem Handrücken über den Mund und hob den Kopf, um mich ungläubig umzusehen. Ich kauerte auf einem steinernen Fußboden, und ich sah, dass es sich nicht um irgendwelchen Stein handelte, sondern um reinen weißen Marmor, der von leuchtend grünen Adern durchzogen war. Der Raum war klein und rund. Ich entdeckte schmale Schlitzfenster, die zu hoch in die Wand eingelassen waren, als dass ich hätte hinaussehen können. Hoch über meinem Kopf lief die Decke spitz zusammen. Ich befand mich also ganz oben in einem Turm.
Es gab keinerlei Möbel in diesem Zimmer und nichts, was ich hätte benutzen können, um den Boden aufzuwischen. Schließlich verwendete ich den Rockteil meines Kleides dafür, der ohnehin schmutzig geworden war. Dann, nachdem ich eine Weile herumgesessen und von Minute zu Minute, in der nichts geschah, immer ängstlicher geworden war, stand ich auf und schlich eingeschüchtert den Flur hinunter. Ich hätte jeden Weg aus dem Zimmer hinaus genommen, außer den, den er gewählt hatte, wenn es denn einen anderen Ausgang gegeben hätte. Aber das war nicht der Fall.
Der Drache war jedoch bereits verschwunden und der kurze Flur war leer. Auch hier bestand der Boden aus dem gleichen kalten, harten Marmor, der von den Hängelampen in ein gespenstisches Weiß getaucht wurde. Es waren keine wirklichen Lampen, sondern lediglich große Blöcke aus glatt poliertem Stein, die von innen heraus leuchteten. Nur eine einzige Tür konnte ich entdecken und ganz am Ende des Flurs einen Bogendurchgang, der zu einer Treppe führte.
Ich stieß die Tür auf und schaute nervös in das dahinterliegende Zimmer. Dies erschien mir besser, als einfach nur vorbeizuhuschen und nicht zu wissen, was sich hinter der Tür verbarg. Aber es war nur ein kleiner, kahler Raum mit einem schmalen Bett, einem winzigen Tisch und einer Waschschüssel. Auf der gegenüberliegenden Seite befand sich ein großes Fenster und ich konnte den Himmel sehen. Rasch rannte ich dorthin und beugte mich über den Sims hinaus.
Der Turm des Drachen erhob sich inmitten der Bergausläufer an der westlichen Grenze seines Landes. Unser gesamtes lang gestrecktes Tal mit seinen Dörfern und Höfen breitete sich nach Osten hin aus. Dort am Fenster stehend, konnte ich den silberblauen Lauf des Flusses Spindel nachverfolgen, der das Tal durchschnitt, und auch die staubig braune Straße direkt daneben. Die Straße und der Fluss verliefen den ganzen Weg bis zum Ende der Ländereien des Drachen nebeneinander. Zwischendurch verschwanden sie in kleinen Wäldchen und kamen beim nächsten Dorf wieder zum Vorschein, ehe der Weg kurz vor dem schwarzen Dickicht des Dunklen Waldes im Nichts auslief. Der Fluss verschwand allein in den Tiefen des Dunklen Waldes, ohne jemals wieder irgendwo aufzutauchen.
Dort befand sich auch Olshanka, die Stadt, die dem Turm am nächsten lag und wo an Sonntagen der Große Markt abgehalten wurde. Zweimal hatte mein Vater mich dorthin mitgenommen. Dahinter schmiegten sich die Dörfer Poniets und Radomsko an die Ufer ihres kleinen Sees und da war auch mein Dvernik mit seinem großen grünen Dorfanger. Ich konnte sogar die langen weißen Tafeln erkennen, die für das Fest geschmückt worden waren, an dem der Drache nicht hatte teilnehmen wollen. Und da sank ich auf die Knie, legte meine Stirn auf den Sims und weinte wie ein kleines Kind.
Aber meine Mutter kam nicht, um mir tröstend die Hand auf den Kopf zu legen; mein Vater zog mich nicht auf die Beine und brachte mich nicht zum Lachen, bis meine Tränen vergessen waren. Ich schluchzte, bis mein Kopf zu sehr schmerzte, um noch weiterzuweinen. Danach war ich durchgefroren, weil ich auf dem harten Fußboden gekauert hatte. Meine Nase lief, und ich hatte nichts, um sie abzuwischen. Also benutzte ich auch dafür meinen Rock, ließ mich aufs Bett sinken und versuchte, mir zu überlegen, was ich nun tun sollte. Der Raum war leer, aber gut gelüftet und sauber, als ob er gerade eben erst von jemandem verlassen worden wäre. Wahrscheinlich war genau das der Fall. Ein anderes Mädchen hatte hier zehn Jahre lang ganz allein gelebt und in das Tal hinabgeschaut. Nun war die junge Frau nach Hause gegangen, um ihrer Familie Lebewohl zu sagen, und der Raum gehörte mir.
Ein einziges Gemälde in einem großen goldenen Rahmen hing an der Wand gegenüber von meinem Bett. Es passte nicht hierher und war viel zu pompös für den kleinen Raum. Eigentlich war es auch überhaupt kein richtiges Bild, nur ein breiter, blasser hellgrüner Fleck, der an den Seiten graubraun auslief, in der Mitte von einer glänzenden blausilbernen, sanft geschwungenen Linie durchschnitten. Schmalere Silberstreifen liefen vom Bildrand aus darauf zu, bis sie sich trafen. Ich starrte darauf und fragte mich, ob auch das Magie war. Noch nie hatte ich etwas Derartiges gesehen. Doch dann fiel mir auf, dass entlang der Silberlinie in unterschiedlichen Abständen Kreise gemalt waren, die mir vertraut vorkamen. Einen Augenblick später begriff ich, dass das Bild das Tal zeigte, so flach und eben, wie ein Vogel es von weit oben wahrnehmen würde. Der Silberstreifen war der Fluss Spindel, der von den Bergen in den Dunklen Wald floss, und die Kreise waren die Dörfer. Die Farben leuchteten und glänzten und an einigen Stellen war das Malmaterial zu winzigen Erhöhungen aufgeworfen. Ich konnte beinahe die Wellen auf dem Fluss und das Glitzern des Sonnenlichtes auf dem Wasser sehen. Es zog meine Blicke auf sich und ich wollte es immer weiter betrachten. Und gleichzeitig gefiel mir nicht, was ich da sah. Das Tal, sonst so voller Leben, wirkte auf dem Gemälde wie vom Rahmen eingepfercht, und je länger ich es betrachtete, desto mehr fühlte ich mich selber eingeschlossen.
Schließlich riss ich mich los. Ich konnte nicht ewig in diesem Zimmer bleiben. Zum Frühstück hatte ich keinen Bissen hinunterbekommen, genauso wenig wie beim Abendessen tags zuvor; alles hatte wie Asche in meinem Mund gelegen. Jetzt, wo mir etwas Schrecklicheres zugestoßen war, als ich es mir je hätte vorstellen können, sollte ich eigentlich noch weniger Appetit haben. Stattdessen jedoch quälte mich der Hunger, und da es keine Dienstboten im Turm gab, würde mir auch niemand mein Abendbrot bringen. In diesem Moment kam mir ein weitaus schlimmerer Gedanke: Was, wenn der Drache von mir erwartete, ihm seine Mahlzeit zu bringen? Und dann drängte sich mir eine noch entsetzlichere Vorstellung auf: Was würde nach dem Essen geschehen? Kasia hatte immer gesagt, dass sie den zurückgekehrten Frauen glaubte, die beschworen, der Drache hätte sie niemals angerührt. »Er holt sich jetzt schon seit hundert Jahren Mädchen«, hatte sie im Brustton der Überzeugung gesagt. »Wenigstens eine von ihnen hätte es zugegeben, wenn es anders gewesen wäre. Und ein solches Eingeständnis hätte sich wie ein Lauffeuer verbreitet.«
Doch vor ein paar Wochen hatte sie meine Mutter unter vier Augen gebeten, ihr zu verraten, was geschah, wenn ein Mädchen heiratete – das preiszugeben, was meine Großmutter ihr am Abend vor ihrer eigenen Eheschließung gesagt habe. Als ich aus dem Wald zurückkam, hörte ich sie durchs Fenster miteinander flüstern. Während ich lauschte, liefen mir heiße Tränen die Wangen hinunter, denn ich war zornig wegen Kasias Schicksal, so zornig.
Und nun würde ich es sein. Und ich war nicht tapfer. Ich glaubte nicht, dass ich ruhig ein- und ausatmen und verhindern könnte, dass ich mich verkrampfte, so wie meine Mutter es Kasia geraten hatte, damit sie keine Schmerzen erdulden musste. Unwillkürlich stellte ich mir einen entsetzlichen Moment lang das Gesicht des Drachen so nahe vor meinem vor. Sogar noch näher als in dem Augenblick, in dem er auf dem Fest seine Wahl getroffen hatte. Ich sah seine schwarzen Augen vor mir, kalt und glänzend wie Steine, diese eisenharten Finger, so seltsam warm, die mir mein Kleid von der Haut schieben würden, während er mit seinem glatten, zufriedenen Lächeln zu mir hinunterblicken würde. Was, wenn er überall so fieberheiß war, sodass ich ihn wie Glut auf meinem Körper spüren würde, sobald er sich auf mich legte und …
Schaudernd schüttelte ich den Gedanken ab und stand auf. Ich warf einen Blick auf das Bett und sah mich in dem kleinen, engen Raum um, in dem ich mich nirgends würde verstecken können. Dann hastete ich wieder hinaus und durchquerte den Flur.
Am Ende gab es eine schmale Wendeltreppe, die mich nicht sehen ließ, was hinter der nächsten Biegung auf mich wartete. Es klingt lächerlich, wenn man sich davor fürchtet, eine Treppe hinunterzusteigen, aber ich war verängstigt. Beinahe wäre ich wieder umgekehrt und in mein Zimmer zurückgegangen. Doch schließlich legte ich eine Hand auf die glatte Steinwand und stieg langsam hinab. Auf jeder Stufe blieb ich zunächst mit beiden Füßen stehen, hielt inne und lauschte einen Augenblick lang, ehe ich mich ein Stückchen weitertraute.
Nachdem ich auf diese Weise eine ganze Umdrehung zurückgelegt hatte, ohne dass mich etwas angesprungen wäre, begann ich, mich wie eine Närrin zu fühlen, und beschleunigte meine Schritte. Doch nach einer weiteren Umdrehung hatte ich noch immer keinen Absatz erreicht und auch nach der nächsten nicht. Schon wieder überfiel mich diese Furcht. Diesmal hatte ich Angst davor, dass diese Treppe magisch wäre und endlos immer weiter hinabführen würde und … nun ja. Ich wurde schneller und schneller. Irgendwann sprang ich drei Stufen auf einmal hinunter und prallte geradewegs mit dem Drachen zusammen.
Ich war dürr, aber mein Vater war hochgewachsen und der größte Mann im Dorf. Ihm reichte ich bis zur Schulter und der Drache war nicht besonders groß. Beinahe wären wir gemeinsam die nächsten Stufen hinuntergefallen. Der Drache griff rasch mit einer Hand nach dem Geländer, mit der anderen nach meinem Arm, und irgendwie gelang es ihm, uns vor einem Sturz zu bewahren. Ich stützte mich schwer auf ihn, umklammerte seinen Mantel und starrte in sein verblüfftes Gesicht. Einen Moment lang war er zu überrascht, um einen klaren Gedanken zu fassen, und sah wie ein ganz gewöhnlicher Mann aus, der einen Schreck bekommen hatte, als er plötzlich unvermutet angesprungen wurde. Ein bisschen albern wirkte er und weich. Sein Mund stand offen. Seine Augen waren weit aufgerissen.
Ich selbst war so überrascht, dass ich mich nicht bewegte. Ich blieb einfach reglos stehen und starrte ihn hilflos an. Er fing sich schnell wieder. Zorn flackerte über sein Gesicht, und er schob mich von sich weg, bis ich wieder richtig auf den Beinen stand. Da dämmerte mir, was ich gerade getan hatte, und in meiner Panik platzte ich heraus, bevor er etwas sagen konnte: »Ich suche die Küche.«
»Ach, tatsächlich?«, fragte er mit seidenweicher Stimme. Sein Gesicht hingegen sah überhaupt nicht mehr weich aus, sondern hart und wütend. Meinen Arm hatte er noch immer nicht losgelassen. Sein Griff war schmerzhaft wie ein Schraubstock und ich konnte die davon ausgehende Hitze durch den Ärmel meines Kleides spüren. Er riss mich zu sich heran und beugte sich näher zu mir – ich glaube, er hätte sich gerne über mir aufgebaut, und weil ihm das körperlich nicht möglich war, wurde er nur noch ärgerlicher. Wenn ich einen Moment Zeit gehabt hätte, um darüber nachzudenken, hätte ich mich zurückgelehnt und versucht, mich kleiner zu machen; aber ich war zu müde und zu verängstigt. Stattdessen befand sich also sein Gesicht unmittelbar vor meinem, so nahe, dass ich seinen Atem auf meinen Lippen fühlen und sein kaltes, bösartiges Flüstern ebenso sehr spüren wie hören konnte: »Vielleicht sollte ich dir den Weg dorthin besser zeigen.«
»Ich kann … ich kann …«, setzte ich vergebens an. Ich bebte und versuchte, ein wenig Abstand zwischen ihm und mir zu schaffen. Er drehte sich jedoch weg und zerrte mich hinter sich die Treppe hinunter, immer im Kreis, weiter und weiter hinab. Nach fünf Umrundungen erreichten wir den nächsten Absatz, dann folgten noch einmal drei weitere. Das Licht wurde immer schummriger, bis er mich schließlich aus dem Treppenschacht hinaus auf die unterste Ebene des Turmes zog. Ich befand mich in einem großen, verliesartigen Raum aus behauenem Gestein mit kahlen Wänden und einer riesigen Feuerstelle in der Form eines nach unten geöffneten Mauls, in dem die Flammen wie in einem Höllenfeuer tanzten.
Er riss mich hinter sich her und darauf zu. In einem kurzen Moment blinden Entsetzens war ich überzeugt davon, dass er mich hineinstoßen würde. Er war so stark, viel stärker, als er seiner Größe nach hätte sein dürfen, und er hatte mich mühelos hinter sich die Treppe hinunterstolpern lassen. Aber ich würde mich nicht von ihm ins Feuer drängen lassen. Ich war kein sanftes, damenhaftes Mädchen; mein ganzes Leben lang war ich in den Wäldern herumgetollt, war auf Bäume gestiegen und auch vor Dornenbüschen nicht zurückgeschreckt, und das Gefühl der Panik, das sich in mir ausgebreitet hatte, verlieh mir Kraft. Ich schrie, als er mich näher an die Flammen zog. Dann wand ich mich, krallte mich an ihn und schlug ihn, sodass ich ihn dieses Mal wirklich zu Boden zwang.
Ich fiel mit ihm zusammen. Gemeinsam stießen wir uns auf den Steinfliesen die Köpfe und blieben einen Moment lang benommen und mit ineinander verkeilten Gliedmaßen liegen. Neben uns loderte und knisterte das Feuer, und da meine Panik langsam abflaute, bemerkte ich in der Mauer neben der Feuerstelle kleine eiserne Ofentüren; davor hing ein Rostspieß und darüber ein breites Regal mit Kochtöpfen. Dieser Raum war nichts weiter als eine Küche.
Nach einem Augenblick fragte er beinahe nachdenklich: »Bist du wahnsinnig?«
»Ich dachte, Ihr würdet mich in den Ofen stoßen«, antwortete ich noch immer wie benebelt. Dann begann ich zu lachen.
Es war kein richtiges Gelächter – ich war in diesem Moment halb hysterisch, auf tausend verschiedene Arten erschöpft und hungrig. Meine Knöchel und Knie waren von dem gewaltsamen Treppenabstieg angeschlagen, und mein Kopf schmerzte, als ob ich mir den Schädel gebrochen hätte. All das sind Gründe, warum ich das in mir aufsteigende Kichern einfach nicht unterdrücken konnte.
Aber er wusste natürlich nichts von meinem Zustand. Alles, was er wusste, war, dass das dumme Dorfmädchen, welches er ausgesucht hatte, über ihn lachte: über ihn, den größten Magier des Reiches, meinen Herrn und Meister. Ich glaube kaum, dass er in den letzten hundert Jahren von irgendjemandem ausgelacht worden war. Bis zu diesem Moment. Er rappelte sich auf, befreite unsanft seine Beine von meinem Gewicht, erhob sich und starrte wie ein empörter Kater auf mich hinunter. Ich lachte nur noch mehr, woraufhin er sich abrupt umdrehte und mich dort lachend auf dem Boden sitzen ließ. Scheinbar fiel ihm nichts anderes mehr ein, was er noch mit mir hätte tun können.
Nachdem er gegangen war, beruhigte ich mich langsam wieder und fühlte mich irgendwie ein bisschen weniger ausgehöhlt und verängstigt. Schließlich hatte er mich nicht in den Ofen geworfen und mich nicht einmal geschlagen. Ich stand ebenfalls auf und sah mich im Raum um. Viel konnte ich nicht erkennen, denn die Feuerstelle leuchtete sehr hell, und es gab keine anderen Lichtquellen. Doch als ich den Flammen den Rücken kehrte, konnte ich langsam Umrisse in dem riesigen Raum ausmachen, der in Alkoven unterteilt war. Die Wände waren niedrig und standen voller glänzender Flaschen – Weinflaschen, wie ich feststellte. Mein Onkel hatte mal zum Mittwinterfest eine solche Flasche in das Haus meiner Großmutter mitgebracht.
Überall lagerten Vorräte: Fässer mit in Stroh verpackten Äpfeln, säckeweise Kartoffeln, Karotten und Pastinaken und lange Zwiebelzöpfe. Auf einem Tisch mitten im Raum lag ein Buch mit einer Kerze daneben, die nicht brannte, und einem Tintenfass samt Federkiel. Als ich das Buch aufschlug, fand ich dort in kräftiger Handschrift alle Vorräte verzeichnet. Ganz unten auf der ersten Seite gab es eine ganz klein geschriebene Notiz. Ich zündete die Kerze an, beugte mich mit zusammengekniffenen Augen vor und entzifferte mühsam:
Frühstück um acht, Mittagessen um eins, Abendbrot um sieben. Bring das Essen fünf Minuten früher in die Bibliothek und du musst ihn den ganzen Tag über nicht sehen. Nur Mut!
Es war unnötig dazuzuschreiben, wem ich auf diese Weise aus dem Weg gehen konnte.
Ein unbezahlbarer Ratschlag und die Bemerkung »Nur Mut!« war wie die Berührung von der Hand einer Freundin. Ich presste das Buch an mich und fühlte mich weniger allein als den ganzen Tag zuvor. Es schien später Nachmittag zu sein. Der Drache hatte in unserem Dorf nichts gegessen, und so machte ich mich daran, etwas zu essen auf den Tisch zu bringen. Ich war keine große Köchin, aber meine Mutter hatte nicht lockergelassen, bis ich wusste, wie man eine Mahlzeit zubereitete, und ich hatte für die Speisen auf allen Familienzusammenkünften gesorgt. Also wusste ich, wie man frische Dinge von verdorbenen unterscheidet und wann ein Stück Obst reif und süß ist. Noch nie hatte ich so viele Vorräte gehabt, aus denen ich mich bedienen konnte; es gab sogar Schubladen voller Gewürze, die wie ein Mittwinterkuchen dufteten, und ein ganzes Fass mit frischem, weichem grauem Salz.
Am Ende des Raumes gab es eine merkwürdig kalte Stelle. Dort war Fleisch aufgehängt worden: ein ganzer Hirsch und zwei große Hasen. Ich stieß auch auf eine mit Stroh ausgelegte Kiste, in der Eier aufbewahrt wurden. Auf dem Ofen lag ein frisch gebackener Laib Brot, eingewickelt in ein Webtuch, und daneben entdeckte ich einen ganzen Topf mit Kaninchenfleisch, Buchweizen und kleinen Erbsen. Ich kostete davon: Es schmeckte wie für einen Festtag gemacht, so salzig und auch ein kleines bisschen süß, das Fleisch so zart, dass es auf der Zunge zerging. Ein weiteres Geschenk von der unbekannten Hand, die in das Buch geschrieben hatte.
Ich hatte keine Ahnung, wie man ein solches Essen zubereitete, und ich verzagte bei dem Gedanken daran, der Drache könnte das vielleicht von mir erwarten. So war ich von einem Gefühl verzweifelter Dankbarkeit erfüllt, dass dieser Eintopf bereits fertig vor mir stand. Ich stellte ihn zurück auf den Sims über dem Feuer, um ihn aufzuwärmen, und verschüttete bei dieser Gelegenheit einige Tropfen auf meinem Kleid. Dann schlug ich zwei Eier auf, schüttete sie auf einen Teller, den ich in den Ofen schob, und suchte ein Tablett, eine Schale, einen weiteren Teller und einen Löffel. Als der Kanincheneintopf fertig war, stellte ich ihn auf das Tablett und gab das Brot dazu. Ich musste es aufschneiden, denn ich hatte bereits den Kanten des Brotlaibes abgerissen und aufgegessen, während ich darauf wartete, dass die Suppe heiß wurde. Ich strich Butter auf die Scheiben und schmorte sogar einen Apfel, den ich mit Gewürzen bestreute. So hatte meine Mutter es mir beigebracht und so wurde es bei mir zu Hause im Winter bei einem Sonntagsessen serviert. Da es so viele Kochstellen in dieser Küche gab, konnte ich das tun, während gleichzeitig die anderen Gerichte garten. Ich war ein bisschen stolz auf mich, als alles zusammen auf dem Tablett stand: Es sah aus wie für ein Fest angerichtet – allerdings für ein sehr merkwürdiges, da es nur für einen einzigen Mann reichen würde.
Vorsichtig trug ich das Tablett die Treppe hoch, und erst da merkte ich mit einiger Verspätung, dass ich überhaupt nicht wusste, wo sich die Bibliothek befand. Wenn ich nur ein bisschen darüber nachgedacht hätte, wäre mir vielleicht eingefallen, dass sie wohl kaum in der untersten Etage sein dürfte. Dort war sie tatsächlich nicht, doch um das herauszufinden, musste ich erst mit dem Tablett in den Händen eine riesige runde Halle durchqueren. Die Fenster waren mit Vorhängen geschmückt und ganz am Ende stand ein schwerer, thronähnlicher Stuhl. Dort gab es auch noch eine andere Tür, aber als ich sie öffnete, fand ich dahinter nur die Eingangshalle des Turmes mit den enormen Türen. Sie waren dreimal so hoch wie ich und mit einem dicken Holzriegel und eisernen Verschlüssen versehen.
Ich drehte mich um und ging wieder durch die Halle zurück zur Treppe, stieg hinauf bis zum nächsten Absatz, wo ich feststellte, dass der Marmorfußboden hier mit einem weichen pelzigen Stoff überzogen war. Noch nie zuvor hatte ich einen Teppich gesehen. Dies war der Grund dafür, warum ich die Schritte des Drachen nicht hatte hören können. Voller Angst schlich ich durch den abgehenden Flur und spähte durch die erste Tür. Schnell zog ich den Kopf wieder zurück: Der Raum dahinter war voller langer Tische mit seltsamen Flaschen darauf. Überall blubberten Flüssigkeiten und züngelten Flammen in unnatürlichen Farben, die nicht von einer Feuerstelle herrührten. Keinen einzigen Augenblick länger wollte ich in diesem Zimmer verbringen. Allerdings verfing ich mich bei der Flucht mit meinem Kleid in der Tür, sodass es einen langen Riss bekam.
Die nächste Tür auf der anderen Seite des Gangs öffnete sich schließlich zu einem Raum voller Bücher: Die hölzernen Regale vom Boden bis zur Decke waren förmlich vollgestopft. Hier roch es nach Staub, und es gab nur ein paar wenige schmale Fenster, durch die Licht hereinfiel. Ich war so erleichtert, die Bibliothek gefunden zu haben, dass mir zuerst gar nicht auffiel, dass der Drache dort war. Er saß in einem schweren Sessel mit einem Buch vor sich auf einem kleinen Pult, das auf seinen Oberschenkeln ruhte. So groß war das Buch, dass jede Seite die Länge meines Vorderarms hatte. Ein großes goldenes Schloss hing baumelnd am Buchdeckel.
Ich blieb wie angewurzelt stehen, starrte ihn an und fühlte mich von dem Ratschlag im Haushaltsbuch unten in der Küche hinters Licht geführt. Irgendwie war ich davon ausgegangen, dass sich der Drache zurückziehen würde, bis ich die Gelegenheit gehabt hätte, das Tablett mit seinem Essen abzustellen. Er hob nicht den Kopf, um mich anzuschauen. Doch anstatt einfach schweigend mit dem Tablett zum Tisch in der Mitte des Raumes zu gehen, dort zu decken und dann eilig wieder zu verschwinden, drückte ich mich im Eingang herum und stotterte: »Ich … ich habe Euch Euer Abendbrot gebracht.« Ich wollte nicht eintreten, für den Fall, dass er wieder nach mir greifen würde.
»Ach, wirklich?«, erwiderte der Drache mit schneidender Stimme. »Ganz ohne dabei ins Feuer zu fallen? Das überrascht mich.« Erst in diesem Moment blickte er auf und sah mich stirnrunzelnd an. »Oder täusche ich mich und du bist vielleicht doch hineingefallen?«
Ich ließ den Blick an mir hinunterwandern. Auf meinem Rock zeichnete sich deutlich ein enorm großer hässlicher Fleck von meinem Erbrochenen ab – ich hatte ihn in der Küche, so gut es ging, herauszuwaschen versucht, jedoch ohne nennenswerten Erfolg –, und ein weiterer Schmutzfleck prangte dort, wo ich mich hineingeschnäuzt hatte. Es gab drei oder vier Flecken von verschüttetem Eintopf und weitere von der Waschschüssel, in der ich die Töpfe sauber gemacht hatte. Mein Rocksaum war noch von heute Morgen dreckig, und ich hatte mir noch ein paar weitere Löcher in den Stoff gerissen, ohne es auch nur zu bemerken. Meine Mutter hatte am Morgen mein Haar geflochten und eingedreht und es schließlich hochgesteckt, aber ein Großteil der Locken hatte sich wieder befreit. Mittlerweile hing nur noch ein großer filziger Haarknoten in meinem Nacken.
Mir war das gar nicht aufgefallen; für mich war das schließlich nicht ungewöhnlich, abgesehen von der Tatsache, dass ich zu dieser unglücklichen Frisur mein schönstes Kleid trug. »Ich habe … Ich habe gekocht und geputzt …«, versuchte ich zu erklären.
»Es gibt in diesem Turm nichts, das schmutziger ist als du«, bemerkte der Drache, was zwar zweifellos richtig, aber auch sehr unhöflich war. Ich errötete und trat mit gesenktem Kopf zum Tisch. Dort stellte ich alles ab und warf einen Blick darauf. In diesem Moment wurde mir schmerzhaft bewusst, dass alles kalt geworden war, während ich suchend durch den Turm gelaufen war. Außer natürlich der Butter, die auf ihrem Teller zu einer weichen Masse zerlaufen war. Selbst mein köstlicher geschmorter Apfel war völlig verdorben.
Unglücklich starrte ich auf das Essen und versuchte, mir zu überlegen, was ich nun tun konnte: Sollte ich alles wieder nach unten tragen? Oder war ihm die Temperatur seiner Speisen vielleicht gleichgültig? Als ich mich zu ihm umdrehte, hätte ich beinahe aufgeschrien: Er stand unmittelbar hinter mir und schaute über meine Schulter auf die Mahlzeit. »Ich beginne zu verstehen, warum du fürchtetest, ich könnte dich ins Feuer werfen«, bemerkte er spitz. Er beugte sich vor, nahm einen Löffel, brach damit durch das kalt und hart gewordene Fett auf dem Eintopf, schöpfte etwas von der Suppe heraus und ließ sie dann wieder zurückfließen. »Etwas Besseres als das solltest du schon zustande bringen.«
»Ich bin vielleicht keine herausragende Köchin, aber …«, setzte ich an und wollte ihm erklären, dass ich so schlecht nun auch wieder nicht sei und ich mich einfach nur auf dem Weg hierher verlaufen hätte, aber er unterbrach mich mit einem Schnauben.
»Gibt es denn überhaupt etwas, das du kannst?«, fragte er spöttisch.
Wenn ich doch nur besser ausgebildet worden wäre, jemandem zu dienen; wenn ich doch nur je ernsthaft in Betracht gezogen hätte, dass ich ausgewählt werden könnte und besser auf all das hier vorbereitet gewesen wäre; wenn ich mich doch nur ein bisschen weniger müde und elend gefühlt hätte. Und wenn ich in der Küche doch bloß keinen Anflug von Stolz auf mich selber verspürt hätte; wenn er mich nicht damit aufgezogen hätte, dass ich wie eine Lumpensammlerin aussah, so wie es all jene taten, die mich liebten. Doch in seiner Stimme schwang Boshaftigkeit statt liebevoller Zuneigung mit, als er das sagte. Wenn, ja wenn … Und wenn ich nicht auf der Treppe mit ihm zusammengestoßen wäre und rechtzeitig herausgefunden hätte, dass er nicht vorhatte, mich ins Feuer zu stoßen, dann wäre ich vermutlich nur rot geworden und davongelaufen.
Stattdessen knallte ich nun hitzig das Tablett auf den Tisch und schrie: »Warum habt Ihr mich ausgewählt? Warum habt Ihr nicht Kasia genommen?«
Kaum waren mir die Worte über die Lippen gekommen, schloss ich erschrocken den Mund und schämte mich. Eilig wollte ich das, was ich gesagt hatte, zurücknehmen und ihm versichern, dass es mir leidtäte und ich es nicht so gemeint hätte; dass ich nicht ernstlich glaubte, er hätte lieber Kasia nehmen sollen; dass ich sofort ein neues Tablett für ihn fertig machen würde …
Da fragte er ungeduldig: »Wen?«
Ich starrte ihn mit offenem Mund an, dann wiederholte ich: »Kasia!« Er schaute mich nur an, als hätte ich ihm ein weiteres Beispiel dafür geliefert, wie beschränkt ich war. In meiner Verwirrung vergaß ich meine guten Vorsätze. »Ihr hättet sie nehmen sollen. Sie ist klug und mutig und eine hervorragende Köchin, und …«
Er sah von Sekunde zu Sekunde erboster aus. »Ja«, stieß er hervor und schnitt mir damit das Wort ab. »Ich erinnere mich an sie. Sie war weder pferdegesichtig noch ein liederliches, schlampiges Mädchen. Ich schätze, sie würde mich in diesem Augenblick nicht mit ihrem Gejammer langweilen. Genug! Ihr Dorfmädchen seid am Anfang alle ermüdend, manche von euch mehr, andere weniger. Du aber erweist dich wirklich als ein Paradebeispiel von Unfähigkeit.«
»Na, dann müsst Ihr mich ja nicht hierbehalten!«, fuhr ich auf. Ich war zornig und verletzt – pferdegesichtig hatte mich hart getroffen.
»Da irrst du dich, sehr zu meinem Bedauern«, sagte er.
Er packte mich am Handgelenk und riss mich zu sich herum: Er stand ganz eng hinter mir und hielt meinen ausgestreckten Arm über die Speisen auf dem Tisch. »Lirintalem«, sagte er; ein merkwürdiges Wort, das ihm flüssig über die Lippen kam und in meinen Ohren einen scharfen Widerhall fand. »Sag es mit mir im Chor.«
»Was?«, fragte ich, denn ich hatte das Wort noch nie zuvor gehört. Er aber drückte sich noch fester an meinen Rücken und mit dem Mund ganz nah an meinem Ohr flüsterte er drohend: »Sag es!«
Ich zitterte, und da ich nichts anderes wollte, als dass er mich losließe, sagte ich »Lirintalem!«, während er noch immer meine Hand über das Essen hielt.
Die Luft über seiner Mahlzeit verschwamm, was ein entsetzlicher Anblick war, als wäre die ganze Welt ein Teich, in den der Drache Steine werfen konnte. Als sich die Turbulenzen wieder gelegt hatten, waren die Speisen verändert. Wo die gebackenen Eier gelegen hatten, befand sich nun ein Brathuhn; statt der Schale mit Kanincheneintopf lag dort ein Haufen frischer Frühlingsbohnen, obwohl die Saison dafür bereits seit sieben Monaten vorbei war; statt des geschmorten Apfels lag vor mir ein honigglasiertes Törtchen mit papierdünnen Apfelscheiben und fetten Rosinen.
Er ließ mich los. Jetzt, wo er mich nicht mehr hielt, geriet ich ins Schwanken und klammerte mich an der Tischkante fest. Alle Luft war aus meinen Lungen gewichen, als hätte sich jemand auf meine Brust gesetzt. Ich fühlte mich, als hätte man mich wie eine Zitrone ausgepresst. An den Rändern meines Sichtfeldes tanzten Sterne und ich beugte mich halb ohnmächtig vor. Benommen sah ich, wie der Drache auf das Tablett hinunterschaute und eine seltsam grimmige Miene aufsetzte, als wäre er gleichzeitig wütend und erstaunt.
»Was habt Ihr mit mir getan?«, flüsterte ich, als ich wieder atmen konnte.
»Hör auf zu heulen«, winkte er ab. »Das ist nicht mehr als ein einfacher Zauber.« Alle Verblüffung, die er verspürt haben mochte, war verschwunden. Stattdessen wedelte er mit der Hand in Richtung Tür, als er am Tisch vor seinem Essen Platz nahm. »Schon gut, verschwinde. Wie ich sehe, wirst du mir viel zu viel meiner kostbaren Zeit rauben, aber für heute reicht es mir.«