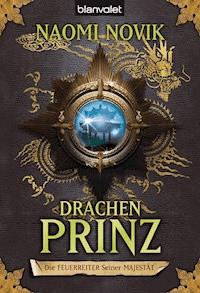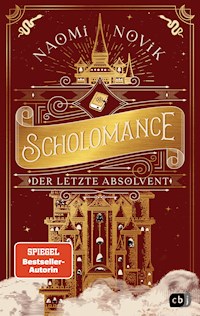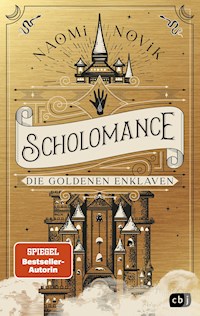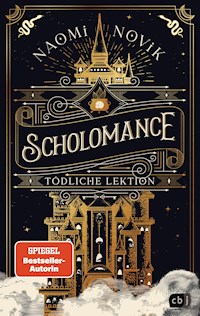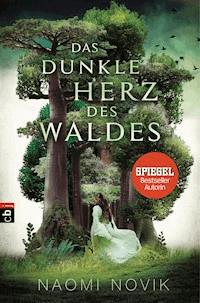8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Feuerreiter-Serie
- Sprache: Deutsch
Das fünfte spannende Abenteuer mit Will Laurence und seinem Drachen Temeraire
Der Feuerreiter seiner Majestät Will Laurence und sein Drache Temeraire retteten die französischen Drachen vor einer tödlichen Seuche – und machten sich damit des Hochverrats an Großbritannien schuldig. Nun wird Will Laurence degradiert und Temeraire in ein Zuchtgehege nach Schottland verbannt. Da überquert Napoleon mit seiner Armee den Kanal, und jeder Feuerreiter wird gebraucht. Sofort eilt Laurence nach Schottland – doch sein treuer Freund ist verschwunden …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Für Dr. Sonia Novik, die diesem Buch ein Zuhause gegeben hat
Teil I
1
Das Zuchtgehege trug den Namen Pen Y Fan, benannt nach dem schroffen, zerklüfteten Einschnitt im Berg, der wie eine Axtklinge aussah. Sein Grat war eisbedeckt, kahl erhob er sich über dem Moorland. Es war ein kalter, nasser, walisischer Herbst, der bereits auf den Winter zuging, und die anderen Drachen waren schläfrig und machten einen gedankenverlorenen Eindruck. Sie interessierten sich für nichts als ihre Mahlzeiten. Einige Hundert der Tiere waren auf dem Gelände verstreut und zumeist in Höhlen oder auf Felsvorsprüngen untergebracht – wo auch immer sie einen Platz gefunden hatten. Man versuchte nicht, es ihnen behaglich zu machen oder für Regeln zu sorgen, sondern kümmerte sich lediglich um ihre Fütterung und den niedergemähten Streifen Grenzland, auf dem nachts Fackeln entzündet wurden, um die Linien zu markieren, die nicht überquert werden durften. In der Ferne funkelten die Lichter der Stadt: verheißungsvoll, aber verboten.
Temeraire hatte nach seiner Ankunft eine große Höhle ausfindig gemacht und von Schutt und Geröll befreit. In ihr konnte er schlafen, doch sie blieb klamm, welche Anstrengungen er auch unternehmen mochte. Er legte sie mit Gras aus und schlug mit den Flügeln, um die Luft in Bewegung zu versetzen, was sich allerdings nur schwer mit seinen Vorstellungen von Würde vereinbaren ließ. Es mochte klüger sein, alle Unbill mit stoischer Geduld zu ertragen, doch war das wenig befriedigend, wenn niemand seine Anstrengungen würdigte. Den anderen Drachen war all das zweifellos vollkommen gleichgültig.
Temeraire war sich sicher, dass er und Laurence das Richtige getan hatten, als sie das Heilmittel nach Frankreich gebracht hatten, und niemand konnte ernstlich anderer Meinung sein. Nur für alle Fälle jedoch hatte sich Temeraire darauf gefasst gemacht, sich mit Missbilligung oder Verachtung konfrontiert zu sehen, und er hatte sich einige sehr schlagkräftige Argumente zu seiner Verteidigung überlegt. Am wichtigsten war natürlich die Tatsache, dass es eine äußerst feige, verstohlene Art des Kampfes gewesen wäre. Wenn die Regierung danach trachtete, Napoleon zu schlagen, dann sollte sie sich ihm im direkten Kampf stellen, anstatt seine Drachen krank zu machen, um auf diese Weise einen leichten Sieg über ihn zu erringen. Das war, als könnten die englischen Drachen die französischen nicht schlagen, ohne auf einen schändlichen Trick zurückzugreifen. »Und das ist noch nicht alles«, fügte er für sich hinzu, »sondern es wären nicht nur die französischen Drachen gewesen, die gestorben wären. Es hätte ebenso unsere Freunde aus Preußen getroffen, die – in ihren Zuchtgehegen eingepfercht – sich ebenfalls angesteckt hätten, und vielleicht hätte sich die Krankheit sogar bis nach China ausgebreitet, und das wäre, als würde man jemandem seine Nahrung stehlen, ohne selbst hungrig zu sein, oder als würde man ihre Eier zerbrechen.«
Er trug diese beeindruckende Rede vor der Wand seiner Höhle vor, um sie einzuüben. Man hatte sich geweigert, ihm seinen Sandtisch zur Verfügung zu stellen, und er hatte auch niemanden aus seiner Mannschaft an seiner Seite, der seine Worte für ihn hätte niederschreiben können. Überdies war Laurence nicht bei ihm, der ihm ansonsten dabei geholfen hätte, sich zu überlegen, was zu sagen war. Stattdessen sprach Temeraire seine Argumente immer wieder leise vor sich hin, um sie nicht zu vergessen. Und wenn diese Rechtfertigungen nicht ausreichen würden, um sie zu überzeugen, so dachte er, dann könnte er auch noch darauf hinweisen, dass schließlich er derjenige gewesen war, der das Heilmittel überhaupt nach England gebracht hatte, er und Laurence, zusammen mit Maximus und Lily und dem Rest ihrer Formation. Und wenn irgendjemand das Recht hätte zu entscheiden, mit wem man das Mittel teilen sollte, dann wären sie es. Niemand hätte auch nur davon Kenntnis, wenn es Temeraire nicht gelungen wäre, seine Krankheit in Afrika zu überstehen, wo die Pilze wuchsen, die ihn hatten genesen lassen …
Er hätte sich die Mühe sparen können. Keiner hatte ihm irgendetwas vorgeworfen; allerdings hatte ihn auch kein Einziger – wie er im Stillen gehofft, aber für recht unwahrscheinlich gehalten hatte – als Helden gefeiert, denn es kümmerte niemanden.
Die älteren Drachen waren keine Wilddrachen, sondern irgendwann aus dem Dienst ausgeschieden, und so interessierten sie sich immerhin ein wenig für die letzten Entwicklungen im Kriegsgeschehen, doch sie waren zerstreut und neigten eher dazu, von ihren eigenen Schlachten in früheren Kriegen zu berichten. Die anderen Drachen waren zwar entsetzt angesichts der Epidemie, jedoch auf eine sehr engstirnige Art und Weise. Es bekümmerte sie, dass sie selbst und ihre eigenen Kameraden krank geworden und einige von ihnen gestorben waren; es beschäftigte sie, dass es so lange gedauert hatte, bis das Heilmittel sie erreicht hatte. Es bedeutete ihnen jedoch überhaupt nichts, dass die Drachen in Frankreich ebenfalls krank geworden waren oder dass sich das Leiden ausgebreitet und Tausende getötet hätte, wenn Temeraire und Laurence nicht das Gegenmittel nach Europa gebracht hätten. Und es kümmerte sie auch kein bisschen, dass die Lords der Admiralität es Hochverrat genannt und Laurence zum Tode verurteilt hatten.
Sie hatten allerdings auch gar keine Veranlassung, sich um irgendetwas zu kümmern. Sie wurden gefüttert, und es gab genug Nahrung für alle. Zwar war ihre Unterkunft nicht eben komfortabel, aber sie war nicht schlimmer als das, woran diejenigen Drachen, die sich zur Ruhe gesetzt hatten, aus den Tagen ihres aktiven Dienstes gewöhnt waren. Keiner von ihnen hatte je von einem Pavillon gehört oder daran gedacht, dass man es ihnen behaglicher machen könnte, als es augenblicklich der Fall war. Niemand musste sich je um ein Ei kümmern; die Wärter des Geheges schafften sie mit unendlicher Sorgfalt fort, um sie in kleinen Wägelchen zu verwahren, die mit Stroh ausgelegt waren und in denen im Winter zusätzliche Wärmflaschen und Wolldecken die Eier wärmten. Die Wärter erstatteten den Drachen so lange Bericht, bis ein Tier geschlüpft war und damit nicht mehr in ihre Zuständigkeit fiel. Alle wussten, dass die Eier bei ihnen in guten Händen waren – und dass es sogar sicherer war, als sie bei sich zu behalten, sodass auch die Drachen, die selbst keinen Kapitän gewählt hatten, den Wärtern gerne ihre eigenen Eier überließen. Sie konnten nicht weit wegfliegen, denn sie wurden nicht zu einer festgesetzten Zeit, sondern jeden Tag zu einer anderen Stunde gefüttert. Flogen sie außer Hörweite der Glocken, konnte es gut passieren, dass sie zu spät kamen und den ganzen Tag über hungrig blieben. So hatten sie kaum Gesellschaft, und es gab keinen Kontakt mit anderen Zuchtgehegen oder den Stützpunkten, außer es kam ein anderer Drache von weiter weg, um sich zu paaren, und selbst das wurde von den Wärtern arrangiert. Die Drachen lebten als willige Gefangene auf ihrem eigenen Gebiet, dachte Temeraire verbittert. Er hätte das nie ertragen, wenn er es nicht für Laurence auf sich genommen hätte, nur für Laurence, den man mit Sicherheit hängen würde, wenn Temeraire nicht mehr gehorchte.
Zunächst mied Temeraire den Umgang mit den anderen Drachen, denn er musste sich um seine Höhle kümmern. Trotz der prächtigen Aussicht, die sie bot, war sie unbewohnt gewesen, weil sie ungemütlich klein war, und er hatte sich hineinzwängen müssen. Dahinter jedoch lag noch eine weitere Höhle, die man durch Öffnungen in der hinteren Wand erkennen konnte. Nach und nach schaffte Temeraire einen Zugang dorthin, indem er vorsichtig sein Grollen, den Göttlichen Wind, einsetzte. Möglicherweise arbeitete er langsamer, als es nötig gewesen wäre, und ließ bereitwillig zu, dass die Aufgabe mehrere Tage in Anspruch nahm. Dann musste die Höhle von Schutt und von alten, abgenagten Knochen und störenden Felsbrocken befreit werden, die er unter großen Mühen selbst aus etlichen Ecken entfernte – viel zu enge Ecken, als dass er darin hätte liegen können, doch er wollte es halt sauber und ansprechend haben. Im Tal fand er einige raue Gesteinsbrocken, die er benutzte, um die Wände der Höhle durch Hin-und-her-Schaben etwas zu glätten, wobei er eine enorme Staubwolke aufwirbelte, was ihn zum Niesen brachte. Er setzte seine Arbeit jedoch fort, denn er hatte nicht vor, in einem unbehaglichen und unwirtlichen Loch zu hausen. Er schlug die Stalaktiten von der Höhlendecke und klopfte Erhebungen im Boden glatt. Als er zufrieden war, schob er vorsichtig mit seinen Klauen an den Seiten seines neu entstandenen Vorzimmers einige hübsch aussehende Steine und alte, verdorrte Zweige zurecht, die spiralförmig gedreht und ausgeblichen waren und die er in den Wäldern und Schluchten gesammelt hatte. Zu gerne hätte er einen Teich und einen Springbrunnen gehabt, doch ihm fiel nicht ein, wie er das Wasser hochschaffen sollte oder zum Fließen bringen könnte, falls ihm Ersteres gelänge. So gab er sich damit zufrieden, sich einen Felsvorsprung des Llyn y Fan Fawr zu suchen, der hinaus in den See ragte, und diesen ebenfalls als sein Eigen zu betrachten.
Er beendete sein Werk damit, dass er die Schriftzeichen seines Namens in den Fels über seinem Eingang ritzte, in der Zeile darunter dann die Buchstaben seines englischen Namens. Allerdings bereitete ihm das »R« einige Schwierigkeiten und sah am Schluss eher wie die gespiegelte Zahl 4 aus. Dann war alles getan, und Gleichförmigkeit legte sich lähmend über seine Tage. Aufstehen, wenn die Sonne in den Eingang seiner Höhle fiel, ein bisschen herumfliegen, ein Schläfchen halten, wieder aufstehen, wenn die Hirten die Glocke läuteten, um etwas zu fressen, dann etwas dösen, wieder herumfliegen und schließlich erneut schlafen. Damit war der Tag zu Ende, und es gab nichts, was die Routine durchbrach. Einmal ging er selbst auf die Jagd, anstatt bei der täglichen Fütterung zu erscheinen. Noch am gleichen Tag brachte einer der kleineren Drachen den Leiter des Geheges, Mr. Lloyd, und einen Arzt zu ihm, die sich vergewissern wollten, dass er nicht krank war. Dann hielten sie ihm einen strengen Vortrag über Wilderei, sodass er sich Sorgen machte, sein Verhalten könnte womöglich Laurence Ungemach bereiten.
Trotz alledem hielt Lloyd ihn nicht für einen Verräter. Genau genommen dachte er gar nicht oft genug an ihn, um ihn überhaupt für irgendetwas zu halten. Der Leiter des Geheges scherte sich nicht um die ihm anvertrauten Tiere, solange sie sich innerhalb der Grenzen des Zuchtgebietes aufhielten, ordentlich fraßen und sich paarten. Er kannte weder Würde noch Seelenruhe, und alles, was Temeraire vom Gewohnten abweichen ließ, war ihm lästig. »Komm schon, heute haben wir eine neue Schwenkflügler-Dame zu Besuch«, pflegte Lloyd heiter zu sagen, »ein prächtiges Tierchen. Da machen wir uns einen netten Abend, was? Wollen wir vielleicht einen Happen Kalbfleisch vorher? Ja, wollen wir, da bin ich mir sicher.« Auf all seine Fragen hatte er bereits eine Antwort, sodass Temeraire einfach nur dasitzen und zuhören musste, vor allem, da Lloyd schwerhörig zu sein schien, wenn Temeraire den Versuch einer Erwiderung unternahm. Sagte er beispielsweise: »Nein, ich hätte lieber Wildbret, und Sie könnten es vorher braten«, dann konnte er sich sicher sein, ignoriert zu werden.
Es ging fast so weit, dass ihm die Lust darauf verging, für Eier zu sorgen, und Temeraire war sich ohnehin in zunehmendem Maße sicher, dass seine Mutter es keineswegs gutgeheißen hätte, wie häufig und wie wahllos man ihn zur Paarung bewegen wollte. Lien hätte jedenfalls mit Sicherheit in höchst beleidigender Weise geschnaubt. Es lag nicht an den weiblichen Drachen, die man ihm zu Besuch schickte. Sie waren alle sehr angenehm, aber die meisten von ihnen hatten noch nie zuvor ein Ei gehabt, und einige hatten noch nicht einmal in einer Schlacht gekämpft oder sonst irgendetwas Interessantes gemacht. Und sie waren alle sehr verlegen, weil sie kein angemessenes Geschenk für ihn hatten, welches ihn für sie hätte einnehmen können. Auch hätte er nicht so tun können, als wäre er kein beeindruckender Drache, selbst wenn er es gewollt hätte – was allerdings selten der Fall war. Lediglich bei Bellusa verspürte er eine solche Regung, denn sie war ein armes, junges Malachit-Schnitter-Weibchen, das sich nicht eine einzige Schlacht auf die Fahnen schreiben konnte. Sie war ihm von der Admiralität in Edinburgh geschickt worden, und sie bot ihm mit kläglicher Miene eine kleine Häkeldecke an. Mehr wollte ihr überrumpelter Kapitän nicht erübrigen, auch wenn die Handarbeit von der Größe her gerade eben ausgereicht hätte, um Temeraires längste Kralle zu umwickeln.
»Die ist sehr hübsch«, bemerkte Temeraire wenig überzeugend, »und so geschickt gemacht. Ich bewundere die Farben sehr.« Dann versuchte er, sie sorgfältig über einen kleinen Stein neben dem Eingang zu drapieren, doch allein die Geste ließ das Drachenweibchen noch unglücklicher aussehen, und Bellusa platzte heraus: »Oh, ich bitte um Entschuldigung; er wollte mich einfach nicht verstehen und dachte, ich versuche zu sagen, dass ich mich nicht paaren will, und dann meinte er…« An dieser Stelle brach sie in noch größerer Verlegenheit ab, und Temeraire war sich sicher, dass alles, was auch immer ihr Kapitän gesagt hatte, nicht sehr nett gewesen sein konnte. Er fühlte sich getroffen, und er hatte noch nicht einmal die Genugtuung, eine seiner wohldosierten Erwiderungen anzubringen, denn es war ja nicht so, dass Bellusa selber etwas Unhöfliches gesagt hätte. Große Lust verspürte er nicht, ließ sich jedoch trotzdem auf den Paarungsakt ein. Er war entschlossen, geduldig zu sein, in allen Belangen die Ruhe zu bewahren und keinen Ärger zu machen. Ja, er würde sich in jeder Hinsicht gut benehmen.
Temeraire gestattete sich nicht allzu oft, an Laurence zu denken, denn er traute sich selber nicht über den Weg. Es war schwer, das ständige Gefühl tiefer Sorge zu ertragen, das ihn so manches Mal zu überwältigen drohte, wenn er daran dachte, dass er nicht wusste, wie es Laurence ging und in welcher Verfassung er sich befand. Temeraire sorgte dafür, dass er stets wusste, wo sich seine Brustplatte und seine schmale, goldene Kette befanden, und so verwahrte er sie selbst. Seine Krallenscheiden hatte er bei Emily gelassen, und er war sich ziemlich sicher, dass man ihr zutrauen konnte, gut darauf aufzupassen. Gewöhnlich hätte er sich auch darauf verlassen, dass Laurence auf sich selbst Acht gab, zumindest, solange er nicht ohne jeden ersichtlichen Grund etwas Gefährliches zu tun beabsichtigte, wozu er traurigerweise immer mal wieder neigte. Aber die Umstände waren nicht so, wie sie sein sollten, und es war schon sehr viel Zeit vergangen. Die Admiralität hatte versprochen, dass man Laurence nicht hängen würde, solange Temeraire sich gut benähme, aber man konnte ihr nicht vertrauen, kein bisschen. Jede Woche fasste Temeraire mindestens zweimal den Beschluss, sofort in Richtung Dover aufzubrechen, nur um Nachforschungen anzustellen und mit eigenen Augen zu sehen, dass man Laurence noch nicht aufgeknüpft hatte. Er wollte nur ganz sichergehen. Doch er nahm schweren Herzens immer wieder Vernunft an, noch ehe er aufgebrochen war. Er durfte nichts tun, was die Regierung zu der Überzeugung kommen lassen könnte, er sei nicht zu bändigen, was zur Folge hätte, dass Laurence für sie nicht mehr von Nutzen wäre. Also musste er sich so zuvorkommend und gefällig verhalten, wie es nur irgend möglich war.
Dieser Vorsatz war jedoch am Ende der dritten Woche bereits arg auf die Probe gestellt worden, als Lloyd einen Besucher zu ihm brachte. Lauthals ermahnte er den Gentleman: »Denken Sie daran, das gute Tier nicht zu verschrecken, sondern liebenswürdig, langsam und mit sanfter Stimme zu ihm zu sprechen, wie Sie es bei einem Pferd tun würden.« Diese Bemerkung brachte Temeraire in Rage, noch ehe der Herr ihm als Reverend Daniel Salcombe vorgestellt worden war.
»Oh, Sie sind es«, sagte Temeraire in einem Tonfall, der den Mann zusammenfahren ließ. »Ja, ich weiß nur allzu gut, wer Sie sind. Ich habe Ihren äußerst törichten Brief an die Königliche Gesellschaft gelesen, und ich nehme an, Sie sind gekommen, um sich davon zu überzeugen, dass ich mich wie ein Papagei oder wie ein Hund benehme.«
Salcombe brachte stammelnd Entschuldigungen hervor; Temeraire hatte augenscheinlich recht gehabt. Mühsam las er Temeraire eine vorbereitete Liste mit Fragen vor, von denen einige die Vorherbestimmung des Schicksals zum Thema hatten und recht wenig Sinn ergaben, doch Temeraire wollte keine von ihnen beantworten. »Bitte seien Sie still: Der heilige Augustinus hat das viel besser als Sie erklärt, und selbst dort war es ziemlich sinnlos. Auf jeden Fall werde ich keinerlei Vorführungen für Sie veranstalten, als wäre ich ein Zirkustier. Ich kann wirklich nicht meine Zeit mit jemandem verschwenden, der so ungebildet ist, dass er nicht einmal Augustinus’ Sentenzen gelesen hat«, fügte er hinzu und nahm im Hinterkopf schuldbewusst Laurence von dieser Regel aus. Aber Laurence spielte sich immerhin nicht selbst als Gelehrter auf und schrieb auch keine beleidigenden Briefe über Leute, die er gar nicht kannte. »Und was die Behauptung angeht, dass Drachen nichts von Mathematik verstünden, so kann ich Ihnen versichern, dass ich mehr als Sie darüber weiß.«
Mit einer Kralle kratzte er ein Dreieck in die Erde und beschriftete die zwei kürzeren Seiten. »Bitte schön. Nennen Sie mir die Länge der dritten Seite, dann werde ich mich mit Ihnen unterhalten. Wenn nicht, hauen Sie ab und hören Sie auf, so zu tun, als ob Sie irgendetwas über Drachen wüssten.«
Die simple Aufgabe hatte diverse Gentlemen in Schwierigkeiten gebracht, als Temeraire sie ihnen während einer Feierlichkeit auf dem Londoner Stützpunkt gestellt hatte. Dies hatte dazu geführt, dass Temeraire jede Illusion über das mathematische Grundverständnis der Menschheit hinsichtlich der Mathematik verloren hatte. Auch Reverend Salcombe hatte offenkundig diesem Teil seiner Ausbildung wenig Aufmerksamkeit gewidmet, denn er starrte zu Boden, errötete bis zur Spitze seines beinahe kahlen Schädels, drehte sich wutentbrannt zu Lloyd um und schnaubte: »Ich schätze, Sie haben das Tier dazu angestiftet! Sie haben diese Bemerkungen mit ihm einstudiert …« Vielleicht dämmerte ihm, wie unsinnig diese Anschuldigung war, als er einen Blick in Lloyds ungläubiges, verständnisloses Gesicht warf, denn sofort fügte er hinzu: »Jemand hat Ihnen diese Worte in den Mund gelegt, und Sie haben sie an das Tier weitergegeben, um mich zu beschämen …«
»Keineswegs, Sir«, protestierte Lloyd vergeblich, was Temeraire so verärgerte, dass er sich beinahe zu einem leisen, ganz leisen Röhren hätte hinreißen lassen. Im letzten Augenblick jedoch nahm er sich zusammen und knurrte nur. Trotzdem floh Salcombe hastig, und Lloyd rannte ihm hinterher und forderte aufgebracht sein Trinkgeld ein. Er hatte sich also dafür bezahlen lassen, dass Salcombe kommen und Temeraire anstarren durfte, als wäre er tatsächlich ein Zirkustier. Nun bereute Temeraire, dass er nicht gebrüllt oder wenigstens beide in den See geworfen hatte, was noch viel besser gewesen wäre.
Doch dann legte sich sein Zorn, und er ließ den Kopf hängen. Zu spät war ihm der Gedanke gekommen, dass er vielleicht doch mit Salcombe hätte sprechen sollen. Lloyd wollte ihm nichts vorlesen und ihm auch nichts über das Weltgeschehen berichten, selbst wenn Temeraire so langsam und deutlich darum bat, dass er ihn verstanden haben musste. Stattdessen antwortete er zu Temeraires Verdruss: »Nun ja, wir wollen uns doch nicht über solche Dinge sorgen; es macht keinen Sinn, sich aufzuregen.« Salcombe, wie ignorant er auch sein mochte, hatte sich unterhalten wollen, und vielleicht hätte er sich sogar dazu überreden lassen, ihm etwas aus den letzten Gesetzesvorlagen oder aus einer Zeitung vorzulesen – oh, was hätte Temeraire nicht alles für eine Zeitung gegeben!
Die ganze Zeit über waren die anderen schwergewichtigen Drachen mit ihrem Mittagsmahl beschäftigt gewesen. Der größte von ihnen, ein gewaltiger Königskupfer, spuckte ein gut durchgekautes, graues und blutbesudeltes Fellknäuel aus, rülpste lauthals und erhob sich in die Luft, um zu seiner eigenen Höhle zurückzukehren. Sein Abflug gab eine weite Fläche des Feldes frei, und die anderen Drachen drängten näher. Bei ihnen handelte es sich um Mittel- und Leichtgewichte, und auch einige kleinere Tiere vom Gewicht eines Kurierdrachens landeten, um sich ihren Anteil an Schafen und Rindern zu holen und sich Bemerkungen zuzurufen. Temeraire rührte sich nicht, sondern kauerte sich lediglich noch ein bisschen weiter zusammen, während die anderen um ihn herum plauderten und spielten. Er hob nicht einmal den Blick, als ein Mittelgewicht mit schmalen, blaugrünen Beinen näher kam und unmittelbar vor ihm landete, um zu fressen. Lautstark knabberte das Drachenweibchen an einigen Schafsknochen.
»Ich habe über die Angelegenheit nachgedacht«, teilte der Neuankömmling Temeraire nach einer Weile mit vollem Maul mit, »und in allen Fällen, wo der Winkel neunzig Grad beträgt – und ich nehme an, so wolltest du es zeichnen –, muss das Maß der längsten Seite eine Zahl sein, die mit sich selbst multipliziert gleich der Länge der beiden kürzeren Seiten, mit sich selbst malgenommen und addiert, ist.« Sie schluckte geräuschvoll und leckte ihre Lefzen sauber. »Eine nette Beobachtung. Wie bist du darauf gekommen?«
»Bin ich nicht«, murmelte Temeraire, »es ist der Satz des Pythagoras. Jeder Gebildete kennt ihn. Mir hat Laurence ihn beigebracht«, fügte er hinzu, woraufhin er sich noch elendiger als zuvor fühlte.
»Hmh«, antwortete das Drachenweibchen recht herablassend und flog davon.
Doch am nächsten Morgen erschien es uneingeladen erneut vor Temeraires Höhle, stieß ihn mit der Nase an, um ihn aufzuwecken, und sagte: »Vielleicht interessiert es dich zu erfahren, dass ich eine Formel entdeckt habe, mit der man jede Gleichung lösen kann. Was sagt Pythagoras dazu?«
»Die hast du überhaupt nicht entdeckt«, sagte Temeraire, der ausgesprochen verärgert darüber war, so früh am Morgen geweckt worden zu sein, wo doch nur ein weiterer leerer Tag vor ihm lag. »Das ist die binomische Formel. Yang Hui kannte sie schon vor Ewigkeiten.« Und damit steckte er den Kopf unter den Flügel und hoffte, wieder in einen Dämmerschlaf fallen zu können.
Er dachte, damit sei die Angelegenheit ausgestanden, doch als er vier Tage später neben seinem See lag, landete der seltsame Drache mit wütendem Zischen neben ihm. Empört sprudelten die Worte aus dem Weibchen hervor, sodass es sich bei dem Versuch, sie gleichzeitig auszuspucken, beinahe überschlug. »Bitte schön, diesmal habe ich was ganz Neues gefunden: Die soundsovielte Primzahl, zum Beispiel die zehnte Primzahl, ist immer dann sehr nahe an ihrem Wert, wenn man ihre Position mit der Zahl multipliziert, mit der man ein bestimmtes p potenzieren müsste, um auf denselben Wert zu kommen – die Zahl p«, fügte sie hinzu, »ist eine sehr erstaunliche Zahl, wie ich ebenfalls herausgefunden und sie deshalb nach mir benannt habe …«
»Ganz bestimmt nicht«, höhnte Temeraire, durch eine wohltuende Verachtung angestachelt, als er bemerkte, worüber sie sprach. »Du sprichst von e und vom natürlichen Logarithmus, und was den Rest mit den Primzahlen angeht, ist auch alles Quatsch. Denk doch nur an die fünfzehnte Primzahl …« Und damit brach er ab, um das Ergebnis im Kopf auszurechnen.
»Siehst du«, sagte sie triumphierend, und nachdem Temeraire zwei Dutzend weitere Beispiele durchprobiert hatte, musste er zugeben, dass das lästige Drachenweibchen vielleicht sogar recht haben könnte.
»Und du brauchst mir nicht zu erzählen, dass Pythagoras das zuerst entdeckt hat«, fügte sie hinzu und warf sich in die Brust, »oder Yang Hui, denn ich habe Erkundigungen angestellt, und niemand hat je von einem der beiden gehört. Sie leben auf keinem der Stützpunkte oder in einem der Zuchtgehege, also kannst du dir diese billigen Tricks sparen. Ich habe mir das ja gleich gedacht; wer hat schon je von einem Drachen gehört, der Yang Hui heißt, so ein Unsinn.«
Temeraire war im Augenblick weder verzweifelt noch müde genug, um zu vergessen, wie entsetzlich langweilig ihm war, und so war er weniger als sonst in der Stimmung, beleidigt zu sein. »Bei beiden handelt es sich nicht um Drachen«, sagte er, »und sie sind ohnehin schon seit vielen, vielen Jahren tot. Pythagoras war ein Grieche, und Yang Hui stammte aus China.«
»Und woher willst du dann wissen, was sie entdeckt haben?«, fragte sie misstrauisch.
»Laurence hat mir darüber vorgelesen«, sagte Temeraire. »Woher weißt du denn davon, wenn nicht aus irgendwelchen Büchern?«
»Ich bin von allein draufgekommen«, sagte der andere Drache. »Hier gibt es ja nicht so viel anderes zu tun.«
Ihr Name war Perscitia. Bei ihr handelte es sich um einen Kreuzungsversuch zwischen einem Malachit-Schnitter und einem leichtgewichtigen Pascalblauen. Doch das Ergebnis hatte sich als größer, langsamer und nervöser entpuppt, als die Züchter es sich erhofft hatten. Ihre Färbung war alles andere als ideal für jede Art von Tarnung, denn der Körper und die Flügel waren zum größten Teil leuchtend blau, von blassgrünen Streifen durchzogen, und entlang ihrem Rücken liefen in unregelmäßigen Abständen weitverteilte Stacheln. Sie war auch noch nicht sehr alt, anders als die meisten Drachen im Zuchtgehege, die einst angeschirrt gewesen waren, und sie hatte sich von ihrem Kapitän getrennt. »Nun«, sagte Perscitia, »ich hatte nichts gegen meinen Kapitän. Er hat mir beigebracht, Gleichungen zu lösen, als ich klein war, aber ich sehe keinen Sinn darin, in den Krieg zu ziehen und auf mich schießen oder mich von Klauen zerreißen zu lassen, ohne dass mir irgendjemand einen Grund dafür hätte nennen können. Und als ich nicht kämpfen wollte, wollte er mich nicht mehr.« Die letzte Bemerkung klang leichthin, aber Perscitia mied Temeraires Blick bei diesen Worten.
»Wenn du von Formationskämpfen sprichst, kann ich es dir nicht verübeln; es ist ausgesprochen ermüdend«, sagte Temeraire. »In China mochten sie mich nicht, weil ich gerne kämpfe«, fügte er hinzu, um mitfühlend zu sein. »Das gehört sich nicht für Himmelsdrachen.«
»China muss ein sehr angenehmer Ort sein«, sagte Perscitia sehnsüchtig, und dem konnte Temeraire nicht widersprechen. Wenn Laurence es nur gewollt hätte, dachte er traurig, dann könnten sie jetzt gemeinsam in Peking sein und vielleicht durch die Gärten des Sommerpalastes streifen. Er hatte keine Gelegenheit gehabt, sie im Herbst zu sehen.
Dann stockte er, hob mit einem Ruck seinen Kopf und fragte eifrig: »Du hast gesagt, du habest Erkundigungen eingezogen: Was soll das heißen? Du kannst doch das Gehege nicht verlassen haben.«
»Natürlich nicht«, entgegnete Perscitia. »Ich habe Moncey die Hälfte meines Abendessens überlassen, damit er für mich nach Brecon fliegt und die Frage mit auf die Kurierrunde gibt. Heute Morgen ist er wieder losgeflogen, und er kam mit der Nachricht zurück, dass keiner jemals von irgendjemandem mit einem dieser Namen gehört hat.«
»Oh …«, machte Temeraire und stellte seine Halskrause auf. »Oh, bitte, wer ist Moncey? Ich werde ihm alles geben, was er möchte, wenn er nur herausfinden kann, wo sich Laurence befindet. Er kann eine Woche lang mein Abendessen haben.«
Moncey war ein Winchester, der sich nicht hatte anschirren lassen. Stattdessen hatte er sich durch die Tür der Scheune, in der er geschlüpft war, geschummelt, an einem möglichen Kapitän vorbei, der ihm nichts bedeutet hatte, und war so dem Dienst im Korps entgangen. Schließlich hatte man ihn ins Zuchtgehege gelockt, vor allem mit dem Versprechen, er würde dort in einer Gemeinschaft leben können, denn er war ein geselliger Bursche. Er war klein und dunkellila, was ihn aus der Ferne nicht anders als jeden anderen Winchester aussehen ließ. So fiel es nicht weiter auf, ob er bei den täglichen Fütterungen anwesend war oder nicht, und solange er eine Entschädigung für die ihm entgangenen Mahlzeiten bekam, war er gerne zu Diensten bereit.
»Wie wäre es, wenn du mir eine dieser Kühe überließest, von der schönen, fetten Sorte, die sie extra für dich aufheben, wenn du dich paaren sollst«, sagte Moncey. »Ich würde Laculla gerne eine besondere Freude machen«, fügte er freudestrahlend hinzu.
»Wegelagerer«, fauchte Perscitia empört, doch Temeraire war das völlig egal. Inzwischen hasste er den Geschmack der Kühe ohnehin, da sie nichts als eine weitere erbärmlich unangenehme Abendbeschäftigung bedeuteten, und so stimmte er dem Handel zu.
»Aber denk daran, dass ich nichts versprechen kann«, warnte Moncey. »Keine Sorge, ich versuche mein Bestes, aber es kann einige Wochen dauern, bis Nachrichten eintreffen, wenn du willst, dass auf allen Stützpunkten, auch in Irland, gefragt wird. Und selbst dann kann es sein, dass niemand etwas gehört hat.«
Leise sagte Temeraire: »Wenn er tot ist, weiß bestimmt jemand davon.«
Die Kanonenkugel drang durch den Rumpf des Schiffes ein und zerschlug das Unterdeck der Länge nach. Das Donnern auf ihrem Weg wurde begleitet vom Kastagnettenklang der Splitter, die gegen die Wände prasselten. Der junge Matrose, der das Schiffsgefängnis bewachte, hatte nicht mehr zu zittern aufgehört, seitdem alle auf ihre Gefechtsstationen beordert worden waren. Laurence hielt das Schlottern für eine Mischung aus Furcht, dem Wunsch, etwas zu tun, und der niederschmetternden Erkenntnis, auf einem so nutzlosen und elenden Posten festzusitzen. Dieses Gefühl kannte er gut, befand er sich doch in einer noch nutzloseren Position in der Zelle. Als sich die Kugel dem Schiffsgefängnis näherte, kullerte sie nur noch in gemütlichem Tempo und bot dem Wachposten der Marine die erste Gelegenheit, etwas zu tun: Er versuchte, sie mit dem Fuß aufzuhalten, noch ehe Laurence auch nur ein warnendes Wort von sich geben konnte.
Schon auf anderen Schlachtfeldern hatte Laurence gesehen, wie ähnliche Impulse ganz ähnliche Ergebnisse gezeitigt hatten. Die Kugel riss den größten Teil des Fußes weg und rollte ungehindert weiter auf die Metalleinfassung der Tür zu und durch sie hindurch. Sie stieß die Tür aus der oberen Angel und grub sich noch sechs Zentimeter tief in die massive Eichenwand de Schiffes, wo sie endlich liegen blieb. Laurence öffnete die wild hin und her schwingende Tür und kletterte aus dem Gefängnis, während er sein Halstuch abnahm, um den Fuß des Seemannes zu verbinden. Der Wachposten starrte fassungslos auf den blutigen Stumpf, und es bedurfte guten Zuredens, damit er aufs unterste Deck humpelte. »Eine saubere Schusswunde. Die Reste werden sich ohne Probleme abschneiden lassen«, sagte Laurence tröstend und überließ ihn den Ärzten. Über ihnen brach das Donnern des Kanonenfeuers nicht ab.
Laurence kletterte das hintere Fallreep hinauf und tauchte ein in das tosende Durcheinander auf dem Waffendeck. Durch ausgefranste, klaffende Löcher im Rumpf Richtung Osten fiel Tageslicht herein und ließ eine Wolke aus Rauch und Staub, die sich von der Kanone ausbreitete, glitzern. Die Donnernde Martha hatte sich aus ihrer Verankerung gerissen, und fünf Männer kämpften darum, sie trotz des Schlingerns des Schiffes lange genug festzuhalten, damit sie wieder gesichert werden konnte. Jeden Augenblick konnte sich die Kanone gänzlich lösen und über das Deck walzen, Männer unter sich begraben und vielleicht durch die Seitenwand brechen.
»So, mein Mädchen, ruhig, ruhig…« Der Kapitän der Geschützmannschaft sprach mit ihr wie mit einem nervösen Pferd; seine Hände zuckten von der glühend heißen Trommel zurück. In einer Seite seines Gesichts steckten Splitter, die wie die Stacheln eines Igels in alle Richtungen hin abstanden.
Im Rauch und im feuerroten Licht erkannte niemand Laurence, und er war nicht mehr als ein weiteres Paar helfender Hände. Seine Flughandschuhe steckten noch immer in seiner Manteltasche; er streifte sie sich über und stemmte sich vorne gegen das Kanonenrohr, doch das Metall brannte auf seinen Handflächen, selbst durch das dicke Leder hindurch. Nach einem letzten Ruck rastete die Kanone wieder auf der Lafette ein. Die Männer befestigten das Geschütz und standen anschließend im Kreis herum wie Pferde nach einem anstrengenden Rennen, keuchend und schwitzend.
Das Feuer wurde nicht erwidert, keine Rufe waren auf dem Achterdeck zu hören, und durch die Kanonenlöcher war kein Schiff zu erkennen. Als Laurence eine Hand gegen die Wand presste, spürte er, wie das ganze Schiff wütend arbeitete; es war eine Art leise stöhnender Klage, als ob es versuchte, zu hart am Wind zu segeln. An den Seiten gluckste das Wasser auf merkwürdige Weise; es war ein gänzlich unvertrauter Klang, und Laurence kannte die Goliath eigentlich gut. Vier Jahre lang hatte er auf ihr in der Offiziersmesse gedient, als er noch ein Junge war, zwei weitere als Leutnant, und er war bei der Schlacht auf dem Nil dabei gewesen. Er hätte immer behauptet, jede Nuance ihrer Stimme zu kennen.
Er steckte seinen Kopf durch ein Kanonenloch hinaus und sah, wie der Feind wendete und zurückkehrte, um sie ein weiteres Mal zu passieren. Es war nur eine Fregatte, ein wunderschön getakeltes Sechsunddreißig-Kanonen-Schiff – nicht einmal die Hälfte aller Geschütze der Goliath. In Anbetracht dieser Tatsache war es ein absurder Kampf, und Laurence konnte nicht verstehen, warum sie selbst nicht gewendet hatten, um ihr Achterdeck zu beschießen.
Stattdessen war nur ein leises Grollen von den Heckgeschützen über ihnen zu hören, was keine große Erwiderung provozierte, und nur eine Menge Rufe und Schreie. Als Laurence den Blick an der Goliath entlangwandern ließ, sah er, dass sie von einer riesigen Harpune getroffen worden war, die aus der Seite herausstach, als ob sie ein Wal wäre. Das Ende, das im Schiffsrumpf steckte, verfügte über mehrere bösartig gebogene Widerhaken, die so geschliffen waren, dass sie sich ins Holz gruben. Das Tau am anderen Ende der Harpune reichte hoch und immer höher in die Luft, wo zwei riesige, schwergewichtige Drachen es festhielten: ein älterer Parnassianer, der vermutlich in früheren Friedenszeiten an Frankreich verkauft worden war, und ein Grand Chevalier.
Dies war nicht die einzige Harpunenspitze: Drei weitere Tau-Enden baumelten von ihren Klauen hin zum Bug, und zwei weitere konnte Laurence achtern ausmachen. Die Drachen waren für ihn zu weit oben, als dass er irgendwelche Details hätte ausmachen können, solange das Schiff so unter ihm schaukelte, aber irgendwie waren die Taue an ihren Geschirren befestigt, und allein dadurch, dass die Tiere gemeinsam flogen und zogen, drehten sie die Schiffsspitze in den Wind: Alle Segel schienen gestrichen worden zu sein, und die Drachen waren zu hoch in der Luft, als dass man sie mit einer Kanonenkugel hätte treffen können. Einer von ihnen musste von den unablässig feuernden Schrapnellgeschützen niesen, aber die Tiere schlugen einfach ein wenig kräftiger mit den Flügeln, um den Geschossen zu entkommen. Das Schiff zogen sie dabei ebenfalls weiter.
»Äxte, Äxte«, schrie der Leutnant, und schon hörte man das Scheppern von Eisen, denn die Schiffsmatrosen schleuderten ihnen auf dem Boden Waffen zu: Handäxte, Entermesser und gewöhnliche Messer. Die Männer griffen danach und streckten die Arme durch die Kanonenöffnungen in dem verzweifelten Versuch, das Schiff zu befreien. Aber die Harpunen waren vom Haken aus sechzig Zentimeter lang, und die Seile hingen genügend durch, sodass die Versuche, sie zu durchtrennen, fruchtlos blieben. Jemand würde durch ein Kanonenloch hinausklettern müssen, um nach ihnen zu hacken. Doch derjenige würde gut zu sehen sein und schutzlos am Schiffsrumpf hängen, während die Fregatte einen neuerlichen Angriff startete.
Zunächst setzte sich niemand in Bewegung. Dann griff sich Laurence ein kurzes, geschärftes Entermesser aus dem Haufen. Der Leutnant blickte ihm ins Gesicht und erkannte ihn, sagte jedoch nichts. Laurence drehte sich zum Kanonenloch, schob die Schultern hindurch und zog sich heraus. Schnell eilten Matrosen zu ihm und stützten seine Füße; der Leutnant rief noch einmal etwas. Ein kurzes Seil wurde vom darüberliegenden Deck hinuntergelassen, sodass Laurence am Rumpf Halt finden konnte. Ängstlich beugten sich Köpfe zu ihm hinab, aber es waren alles Fremde. Dann schob sich ein weiterer Mann über die Reling und schließlich noch einer, um sich um die anderen Harpunen zu kümmern.
Mit wütendem Eifer begann Laurence, das Tau zu bearbeiten, und nach und nach gaben die einzelnen Stränge nach: Das Seil war durch ein Drahtkabel verstärkt; drei Trossen aus je drei Strängen, gut gedreht und dick wie ein Männerhandgelenk, mit Segeltuch überzogen. Währenddessen hob sich Laurence für die Waffen der Fregatte als ein leuchtendes Ziel von der Farbe des Schiffsrumpfes ab. Immerhin würde seiner Familie die Schande seines Todes am Strang erspart bleiben, wenn er jetzt fiele. Er war nur deshalb noch am Leben, um Temeraire damit gleichsam anzuketten. Sobald die Admiralität entscheiden würde, dass der Drache vom Alter und aus Gewohnheit friedlich genug gestimmt war, wäre Laurence überflüssig, und das Todesurteil würde vollstreckt werden. Und bis dahin könnten noch Jahre vergehen – lange Jahre, in denen er in einem Gefängnis oder in den Tiefen eines Schiffes vermodern würde.
Weder war es ein vorsätzlicher Gedanke, noch handelte Laurence aus einem Schuldgefühl heraus; diese Überlegungen schossen ihm unwillkürlich durch den Kopf, während er sich abmühte. Er hatte dem Meer den Rücken zugekehrt und konnte weder die Fregatte noch die größere Schlacht dahinter sehen. Sein Gesichtsfeld war ausgefüllt von der abblätternden Farbe an der Seite der Goliath. Der Glanz des Lackes war durch Splitter und Salz verloren gegangen. Die eisige See schwappte am Rumpf empor und sprühte über Laurence’ Rücken. In der Ferne war das Dröhnen des Kanonenfeuers zu hören, aber die Waffen der Goliath waren verstummt. Sie sparte sich ihr Pulver und die Geschosse für die Gelegenheiten auf, wenn sie auch wirklich von Nutzen sein würden. Das lauteste Geräusch in Laurence’ Ohren war das angestrengte Stöhnen der Männer, die in seiner Nähe hingen und nach ihren eigenen Harpunenseilen hackten. Dann stieß einer von ihnen einen überraschten Schrei aus und ließ sein Tau los, sodass er in die schäumende See stürzte: Ein kleiner, pfeilschneller Kurierdrache, ein Chasseur-Vocifère, näherte sich der Schiffseite mit einer weiteren Harpune.
Das Tier hielt diese wie ein Ritter in einem mittelalterlichen Turnier. Das dicke Ende steckte wacklig in einem Gefäß, das am Geschirr befestigt war, um zusätzlich zu stützen, und zwei Männer auf dem Rücken umklammerten die behelfsmäßige Vorrichtung. Mit einem dumpfen Geräusch prallte die Harpune an die Seitenwand des Schiffes, ganz in der Nähe der Stelle, an der Laurence hing. Der Schwanz des Drachen spritzte ihm Salzwasser ins Gesicht, das ihm in der Nase brannte und seine Kehle hinunterrann, während er versuchte, es wieder emporzuwürgen. Der Drache drehte ab und entkam der wütenden Salve der Marinesoldaten. Die Harpune zog er an deren Seil hinter sich her: Die Widerhaken hatten sich nicht tief genug eingegraben. Der Schiffsrumpf war übersät mit Narben von früheren Versuchen – für jede versenkte Harpune verunzierten ein gutes Dutzend Scharten den in den Putzstunden auf Hochglanz gewienerten Schiffslack.
Laurence wischte sich mit einem Arm das Salzwasser aus seinem Gesicht und schrie den Seemann, der noch neben ihm hing, an: »Weitermachen, Mann, verdammt noch mal.« Endlich war der erste Strang seines eigenen Kabels durchtrennt; sein Entermesser war ausgefranst und sah wie ein Besen aus. Doch Laurence nahm sich sofort den zweiten Strang vor, auch wenn die Klinge langsam stumpf wurde.
Die Fregatte war noch immer neben ihnen und machte ihnen die Arbeit schwer, und Laurence kam nicht gegen die Versuchung an, seinen Kopf dem Donnern der Kanone, das so nah schien, zuzuwenden. Eine Kugel sauste über das Wasser und setzte zwei oder drei Mal auf den Wellenkämmen auf, als wäre sie ein Stein, den ein kleiner Junge geschleudert hatte. Es sah so aus, als käme sie unmittelbar auf ihn zu, doch der Eindruck täuschte. Das ganze Schiff stöhnte, als sich die Kugel in den Rumpf grub, und Splitter stoben wie bei einem plötzlichen Schneesturm durch die Kanonenöffnungen. Sie verschonten auch Laurence’ Beine nicht, sondern stachen sie wie ein wilder Bienenschwarm, und rasch waren seine Strümpfe feucht vom Blut. Er klammerte sich an die Harpune und schwang hin und her; unablässig feuerte die Fregatte, eine heulende Breitseite nach der anderen; die Goliath schwankte entsetzlich unter den schweren Treffern.
Laurence musste das Entermesser zurückreichen und nach einem neuen schreien, um den letzten Strang zu durchtrennen. Dann endlich war das Tau durchtrennt und baumelte haltlos hinunter, und die Matrosen zogen Laurence wieder an Bord. Er strauchelte, als er zu stehen versuchte, und sank auf dem blutigen Boden auf die Knie. Seine Strümpfe waren halb zerfetzt und rot durchtränkt, und seine besten Kniebundhosen, die er für den Prozess angezogen hatte, waren nun löchrig und fleckig. Ein paar Männer halfen ihm, sich gegen die Reling zu lehnen, und er zerschnitt sein eigenes Hemd mit dem Entermesser, um mit den so erhaltenen Verbänden die schlimmsten Schnitte zu versorgen. Man konnte auf niemanden verzichten, um Laurence zu den Ärzten zu bringen. Auch die übrigen Harpunen waren abgetrennt worden – endlich schwangen die Seile hin und her. Alle Mannschaftsmitglieder waren an ihren Geschützen beschäftigt. Mit gebleckten Zähnen und Gesichtern, die schwarz von Schweiß und Asche und voller Blut aus aufgesprungenen Lippen und Mündern waren, starrten sie wild durch das schwache, rote Glühen, bereit, Rache zu nehmen.
Plötzlich senkte sich ein lautes Prasseln wie von Regen oder einem Hagelsturm über sie: kleine Bomben mit kurzen Zündern, die von den französischen Drachen abgeworfen wurden und die gut sichtbar wie Blitze durch die Bohlen des Decks schlugen. Einige rollten die Fallreeps hinab und explodierten auf dem Kanonendeck. Alles war erfüllt vom heißen Qualm des Blendpulvers und dem stechenden Schein des Feuerwerks, das in den Augen schmerzte. Dann drehten die Drachen in Richtung Fregatte ab, und es kam die Anweisung zu feuern, immer wieder zu feuern.
Für einen langen Augenblick gab es nichts außer dem rücksichtslosen Zorn der donnernden Schiffskanonen. Es war unmöglich, in diesem Getöse und dem Durcheinander aus Rauch und Höllenfeuer im Innern, das allen Verstand verschluckte, einen einzigen klaren Gedanken zu fassen. Laurence hatte in einer Feuerpause nach der Kanonenöffnung gegriffen und sich hinaufgezogen, um einen Blick auf die Lage zu werfen. Die französische Fregatte hatte unter dem Beschuss abgedreht, ihr Fockmast war abgeknickt und trieb unter der Wasseroberfläche, und jede anrollende Welle ergoss sich ins Innere des Schiffes.
Aber es gab keinen Jubel. Hinter der abziehenden Fregatte öffnete sich der Blick auf die ganze Breite des Kanals, und es war zu sehen, dass alle großen Schiffe der Blockade, wie sie selber bis gerade eben noch, in Kämpfe verwickelt und unter Angriff standen. Die Aboukir und die mächtige Sultan mit vierundsiebzig Kanonen waren nahe genug, um sie zu erkennen. Kabeltaue reichten zu einmal drei, einmal vier Drachen empor, und die französischen Schwer- und Mittelgewichte zogen mit aller Macht in verschiedene Richtungen. Die Schiffe feuerten gleichmäßig, aber ohne etwas ausrichten zu können, und es waren Rauchwolken zu sehen, die die Drachen über den Schiffen nicht einmal erreichten.
Und zwischen ihnen befanden sich ein Dutzend französische Linienschiffe, die schließlich doch den sicheren Hafen verlassen und nun gleichmäßigen Kurs aufgenommen hatten. Sie eskortierten eine riesige Flottille: hundert Schiffe und mehr, Lastkähne und Fischerboote, ja sogar Flöße mit dreieckigen Segeln, allesamt mit dicht gedrängten Soldaten besetzt. Sie hatten den Wind im Rücken, und die Flut trug sie auf die Küste zu; stolz wehte die Trikolore an ihren Masten Richtung England.
Die Marine war wie betäubt, und nur die Drachen des Korps konnten ihr Vorrücken nun noch aufhalten. Aber die französischen Kriegsschiffe feuerten immer wieder in die Luft über die Flottille hinweg. Es sah aus wie Pfeffer, aber es kam in größeren Mengen, als man es sich bei diesem Gewürz hätte leisten können, und es brannte. Rotglühende Teilchen glommen wie Glühwürmchen vor den schwarzen Rauchwolken, die über den Schiffen hingen und sie vor Angriffen aus der Luft schützten. Eines der Transportboote war nahe genug, sodass Laurence erkennen konnte, dass die Männer ihre Gesichter mit nassen Taschentüchern und Lumpen bedeckt hatten oder sich unter Decken aus Öltuch verbargen. Die britischen Drachen unternahmen verzweifelte Versuche hinabzustoßen, schreckten jedoch vor den Wolken zurück und mussten stattdessen ihre Bomben aus zu großer Höhe abwerfen. Zehn von diesen stürzten ins weite Meer für jede einzelne, die auch nur nahe genug hinunterging, um eine Welle gegen den Schiffsrumpf schlagen zu lassen. Auch die kleineren französischen Drachen machten ihnen zu schaffen, indem sie vor ihnen hin und her flogen und in schrillen Tönen kreischten. Es waren so viele von ihnen; Laurence hatte noch nie eine so große Anzahl von ihnen gleichzeitig gesehen. Sie wirbelten beinahe wie Vögel durcheinander, schlossen sich zusammen und verteilten sich wieder, sodass sie für die englischen Drachen in ihrer festen Formation kein leichtes Ziel boten.
Ein großer Königskupfer hätte Maximus sein können: Rot, orange und gelb hob er sich vom blauen Himmel ab, und er flog an der Spitze einer Formation mit zwei Reihen Gelber Schnitter auf beiden Flanken. Aber Laurence konnte Lily nicht sehen. Der Königskupfer brüllte, was selbst auf diese Distanz noch schwach zu hören war, und kämpfte sich mit seiner Formation durch ein Dutzend französischer Leichtgewichte, um sich einem großen französischen Kriegsschiff zu nähern. Flammen blühten auf dessen Segeln, als die Bomben schließlich doch noch ihr Ziel fanden. Aber als die Formation am Ende aufstieg und abdrehte, tropfte es blutrot vom Bauch eines Schnitters, und ein anderer hatte Schlagseite. Auch eine Handvoll britischer Fregatten versuchte mutig, an den französischen Schiffen vorbeizuschießen, um sich den Transportern zu nähern, jedoch ohne viel Erfolg. Sie standen unter schwerem Beschuss, und wenn sie auch ein Dutzend Boote versenkten, wurde die Hälfte der Männer von anderen wieder an Bord gezogen, so nahe beieinander befanden sich die kleinen Transporter.
»Alle Mann an die Geschütze«, rief der Leutnant scharf. Die Goliath drehte sich, um den Transportern nachzujagen. Sie würde zwischen der Majestueux und der Héros passieren müssen, eine Breitseite von beinahe drei Tonnen zwischen ihnen. Laurence spürte es, als ihre Segel den Wind wieder richtig einfingen: Das Schiff schoss voran wie ein eifriges Rennpferd, das zu lange gezügelt worden war. Alle Segel waren gesetzt worden. Er berührte sein Bein. Das Blut hatte aufgehört zu fließen, dachte er und humpelte zurück zu einem unbesetzten Platz an einer Kanone.
Draußen kämpften sich die ersten Transporter bereits auf das Ufer zu; leichtgewichtige Drachen kreisten über ihnen, um sie abzuschirmen, während die Männer ihre Artillerie aufbauten, und ein Soldat stieß die Standarte in den Boden. Auf der Spitze thronte der Adler und fing das Sonnenlicht ein, sodass er wie eine Flamme funkelte. Napoleon war also am Ende doch noch in England gelandet.
2
Nachdem die Anfrage erst einmal losgeschickt worden war, fand Temeraire die Aussicht darauf, dass es eine Antwort gab, die ihn schon bald erreichen würde, beinahe noch schlimmer als die Ungewissheit. Zuvor war nicht sicher, ob Laurence noch in dieser Welt weilte oder nicht: Er konnte ebenso gut noch am Leben sein, wie das Gegenteil möglich war, und solange Temeraire nichts Gegenteiliges wirklich wusste, war Laurence wenigstens in seinen Gedanken noch lebendig. Auf viel mehr war nicht zu hoffen. Die besten Neuigkeiten, die es geben könnte, wären wohl, dass man ihn noch immer eingekerkert hielt. Während sich der Tag dahinschleppte, hatte Temeraire immer stärker das Gefühl, dass Gewissheit eine schwache Belohnung für das Risiko war, eine entsetzliche, gegenteilige Antwort zu erhalten. Temeraire konnte es kaum ertragen, sich diese Möglichkeit auch nur vorzustellen. Wenn er es doch versuchte, verschluckte ihn eine nicht enden wollende Leere, ein allgegenwärtiger Nebel, der ihn wie ein grauer Himmel voller Wolken umgab.
Er sehnte sich so sehr nach Ablenkung, aber es gab keine, wenn man von den Gesprächen mit Perscitia absah. Diese waren immerhin interessant, aber von Zeit zu Zeit auch höchst ärgerlich. Perscitia gefiel es, sich selbst für ein großes Genie zu halten, und ohne Zweifel war sie ungewöhnlich klug, auch wenn sie nicht richtig begreifen konnte, was es bedeutete, etwas aufzuschreiben. Manchmal wagte sie sich zu Temeraires Unbehagen sehr weit vor und äußerte eine seltsame Überlegung, die in keinem Buch aufgetaucht war, das Temeraire je gelesen hatte, die sich jedoch nicht widerlegen oder bestreiten ließ.
Aber sie war so kleinlich besorgt um ihre Entdeckungen, dass sie in Zorn geriet, wenn Temeraire ihr mitteilte, dass irgendeine ihrer Erkenntnisse schon zuvor von irgendjemandem erlangt worden war. Zudem hielt sie nichts von der Hierarchie des Zuchtgeheges, welche ihr ihrer Meinung nach den gerechten Lohn für ihre Brillanz vorenthielt. Aufgrund ihrer lediglich mittleren Größe musste sie sich mit einer ungemütlichen, winzigen Lichtung im Moorland zufriedengeben, über die sie sich unermüdlich beklagte, denn sie bot keine Aussicht und war kaum mehr als ein Klippenvorsprung, der ihr Schutz vor Regen bot.
»Warum beziehst du denn nicht eine bessere?«, fragte Temeraire gereizt. »Es gibt doch mehrere sehr nette, direkt dort drüben im Hang. Ich bin mir sicher, dass du es dort behaglicher hättest.«
»Man will doch keinen Ärger machen«, sagte Perscitia ausweichend und ganz und gar wahrheitswidrig: Sie liebte es, Ärger zu machen, und Temeraire verstand nicht, was das überhaupt mit einer leer stehenden Höhle zu tun haben sollte. Aber immerhin lenkte es vom eigentlichen Thema ab.
Der einzig bemerkenswerte Umstand war, dass es seit einer Woche ohne Unterlass regnete und ein stetiger Wind wehte, der die Nässe durch jede Höhlenöffnung trieb und den Boden durchweichte, sodass alle recht missmutig gestimmt waren. Temeraire war sehr froh über seine Vorhöhle, in der er das Wasser abschütteln und trocknen konnte, ehe er sich in die Gemütlichkeit seiner großen Höhle zurückzog. Mehrere der kleinsten Drachen mit dem Gewicht von Kuriertieren, die in Höhlen am Fluss wohnten, wurden gänzlich aus ihrem Zuhause hinausgespült. Temeraire tat ihr verschlammter und elendiger Zustand leid und er lud sie ein, in seiner Höhle Unterschlupf zu finden, solange der Regen nicht nachließ. Allerdings hatte er es zur Bedingung gemacht, dass sie zuvor den Schmutz abspülten. Dankbar und lautstark freuten sie sich über dieses Arrangement. Einige Tage später, als er wieder einmal ängstlich und einsam über Laurence nachgrübelte, fiel ein Schatten in den Eingang seiner Höhle.
Er stammte von einem großen Königskupfer, Requiescat, der sich duckte und sich dann durch das Vorzimmer in Temeraires Haupthöhle schob, ohne darauf zu warten, hereingebeten zu werden. Sichtlich erfreut sah er sich um, nickte und sagte: »Es ist wirklich so schön, wie man sich erzählt.«
»Danke«, erwiderte Temeraire, der bei diesem Kompliment etwas auftaute, auch wenn er wenig Lust auf Gesellschaft hatte. Dann erinnerte er sich daran, dass er höflich sein musste. »Willst du dich setzen? Es tut mir leid, dass ich dir keinen Tee anbieten kann.«
»Tee?«, wiederholte Requiescat gedankenverloren, ohne eine Antwort zu erwarten. Temeraire sah verärgert, dass er mit der Nase in den Ecken der Höhle herumstöberte und sogar seine Zunge herausstreckte, um sie zu betasten, als wäre er in seinem eigenen Heim. Temeraires Halskrause stellte sich auf und bebte.
»Ich muss um Verzeihung bitten«, sagte er steif. »Ich fürchte, ich bin auf Gäste nicht vorbereitet.« Er hielt das für eine gewitzte Möglichkeit anzudeuten, dass Requiescat jederzeit wieder gehen könne, wann immer es ihm gefiele.
Aber der Königskupfer ging auf diese Anspielung nicht ein; oder zumindest entschied er sich dagegen, schon wieder aufzubrechen. Stattdessen ließ er sich gemütlich am hinteren Ende der Höhle nieder und sagte: »Nun, alter Bursche, ich fürchte, wir werden tauschen müssen.«
»Tauschen?«, fragte Temeraire verwirrt, bis ihm dämmerte, dass Requiescat über die Höhlen sprach. »Ich will deine Höhle nicht«, fügte er hastig hinzu. »Nicht, dass sie nicht sehr schön wäre, da bin ich mir sicher, aber ich habe gerade diese hier so weit hergerichtet, dass sie meinen Bedürfnissen entspricht.«
»Sie ist jetzt viel größer«, erklärte Requiescat; jedenfalls legte sein Tonfall nahe, dass dies als Erklärung gemeint war. »Und bei diesem nassen Wetter ist sie viel angenehmer«, fügte er wehmütig hinzu. »Meine hingegen ist schon die ganze Woche lang voller Pfützen und bis zum Ende hin durchweicht.«
»Dann sehe ich keinen Grund, warum ich tauschen sollte«, erwiderte Temeraire noch verblüffter. Dann jedoch richtete er sich empört und erstaunt auf und ließ zu, dass sich seine Halskrause nun völlig ungehemmt sträubte. »Also, was bist du nur für ein Häufchen Abschaum«, stieß er hervor. »Wie kannst du es wagen, hierherzukommen und dich wie ein Besucher aufzuführen, wenn du die ganze Zeit auf eine Herausforderung aus bist? So etwas Verschlagenes habe ich ja mein ganzes Leben lang noch nicht gesehen.« Dann fügte er mit schneidender Stimme hinzu: »Ich schätze, das ist genau die Art, die Lien an den Tag gelegt hätte. Verschwinde auf der Stelle. Wenn du meine Höhle willst, dann kannst du ja versuchen, sie dir zu holen. Wir können das jederzeit ausfechten: jetzt oder morgen Abend.«
»Nun, nun, keine Aufregung«, unterbrach ihn Requiescat beschwichtigend. »Ich sehe schon, du bist noch ein junger Bursche. Eine Herausforderung, also wirklich! Nichts dergleichen! Ich bin der friedliebendste Drache der Welt und will mit niemandem kämpfen. Es tut mir leid, wenn ich die Sache ungeschickt angegangen sein sollte. Es ist keineswegs so, dass ich dir deine Höhle wegnehmen möchte, wie du sicher verstehst …« Temeraire verstand nicht das Geringste. »Es ist alles eine Frage der Außenwirkung. Du bist erst einen Monat hier und hast die schönste Höhle, und du bist keineswegs der Größte von uns.« Requiescat blähte sich ein wenig auf, und tatsächlich übertraf seine Größe die aller Drachen, die Temeraire je gesehen hatte, außer vielleicht Maximus und Laetificat. »Wir haben hier unsere eigene Art und Weise, wie wir die Dinge regeln, damit jeder zufrieden ist. Niemand will, dass unsere Ruhe hier durch Raufereien gestört wird, wenn es nicht nötig ist. Nur ein sehr übellauniger Drache würde wegen eines Höhlentausches mit einem anderen Drachen streiten, wenn beide Behausungen groß und hübsch sind. Aber man muss schon die Abstammung beachten.«
»So ein Unsinn«, sagte Temeraire. »In meinen Ohren klingt es so, als wenn die regelmäßigen Mahlzeiten und die Langeweile dich so träge gemacht hätten, dass du dir nicht einmal mehr die Mühe machen willst, andere Leute ordentlich zu tyrannisieren.« Dann fügte er hinzu: »Oder vielleicht bist du auch einfach nur ein Feigling und glaubst, ich wäre ebenfalls einer. Nun, das bin ich nicht, und ich werde dir auch meine Höhle nicht überlassen, egal, was du vorhast.«
Requiescat erhob sich bei diesen Bemerkungen nicht, sondern schüttelte nur missmutig den Kopf. »Da haben wir es. Ich bin kein so schlauer Kerl, deshalb habe ich mich wohl nicht klar ausgedrückt, und jetzt hast du auch noch deine Halskrause aufgestellt. Ich fürchte, wir müssen zusammen den Rat aufsuchen, sonst wirst du mir nie glauben. Es macht ein bisschen Mühe, aber schließlich ist es dein gutes Recht.« Schwerfällig stand er wieder auf und fügte zu Temeraires Empörung noch hinzu: »Bis dahin kannst du hier wohnen bleiben. Es wird mich ungefähr einen Tag kosten, bis ich jeden informiert habe.« Dann trottete er hinaus und ließ Temeraire zitternd vor Wut zurück.
»Seine Höhle ist die schönste«, sagte Perscitia später ängstlich, »jedenfalls haben wir das bislang immer gedacht. Ich bin mir sicher, du wirst sie mögen, und vielleicht kannst du sie dir ebenso behaglich einrichten wie diese hier. Warum gehst du nicht hin und siehst sie dir an, ehe du dich in einen Kampf stürzt?«
»Es wäre mir selbst dann ganz egal, wenn es Ali Babas Höhle voller Gold und Wunderlampen wäre«, sagte Temeraire und unternahm nicht einmal den Versuch, seinen Zorn zu zügeln. Es war besser, erbost als niedergeschlagen zu sein, und er war froh, dass er an irgendetwas anderes denken konnte als an das, worauf er ohnehin keinerlei Einfluss hatte. »Es ist eine Frage des Prinzips. Ich lasse mich nicht hinausdrängen, als ob ich ihm nicht gewachsen wäre. Wenn ich die andere Höhle herrichten würde, käme er sicherlich und würde versuchen, sie wieder zurückzutauschen, da bin ich mir ganz sicher. Oder ein anderer Drache würde versuchen, mich hinauszuwerfen. Nein, danke. Wie setzt sich denn dieser Rat zusammen?«
»Aus all den großen Drachen«, erläuterte Perscitia. »Und einem Langflügler, aber Gentius macht sich nicht mehr oft die Mühe, seine Höhle zu verlassen.«
»Ich nehme an, das sind alles seine Freunde«, sagte Temeraire.
»Keiner mag Requiescat wirklich«, warf Moncey ein, der auf dem Vorsprung über Temeraires Höhle hockte. »Er frisst so viel, und er verzichtet nie auf irgendetwas, selbst wenn die Versorgung knapp ist. Aber er ist der größte Drache, und deshalb sollte es keinen Kampf geben. Die allgemeine Regel ist, dass eine Höhle im Streitfall an denjenigen geht, der am stärksten ist. Und niemandem ist es gestattet, sich einen Ort auszusuchen, der seiner Rasse nicht angemessen ist, damit die anderen nicht neidisch und zänkisch werden.«
»Wie du siehst, ist es so ungerecht, wie ich es dir gesagt habe«, fügte Perscitia verbittert hinzu. »Als ob das Einzige, was wichtig ist, das Körpergewicht wäre oder wie gut jemand im Kratzen, Beißen und Treten ist, um seine Meinung durchzusetzen. Nie werden die wirklich wichtigen Eigenschaften berücksichtigt.«
»Ich verstehe, dass die Regelung Sinn macht, um sich eine Höhle auszusuchen«, sagte Temeraire. »Aber sie ist in diesem Fall unsinnig, denn schließlich habe ich eine gewählt, die er vor meiner Ankunft jederzeit hätte haben können. Es kann nicht sein, dass er sie mir jetzt wieder wegschnappen darf, nachdem ich sie mir mit so viel Mühe behaglich gemacht habe. Und er ist auch nicht stärker als ich, obwohl er mehr wiegt. Ich wüsste zu gerne, ob er schon einmal ganz allein eine Fregatte versenkt hat, während er einen Fleur-de-Nuit im Nacken hatte. Und was die Herkunft angeht: Meine Vorfahren waren Gelehrte in China, während seine noch in Löchern dahinvegetierten.«
»Das mag schon sein; aber er kennt alle Mitglieder des Rates und du nicht«, wandte Moncey vernünftig ein. »Du kannst nicht gegen ein Dutzend Schwergewichte gleichzeitig kämpfen, und du musst schon entschuldigen, aber niemand, der dich ansieht, würde sagen: ›Also wirklich, da hat der alte Requiescat mal einen würdigen Gegner gefunden.‹ Nicht, dass du klein bist, aber du siehst doch ein bisschen schmal um die Brust aus.«
»Das stimmt nicht, oder?«, fragte Temeraire und reckte besorgt den Kopf, um sich selbst betrachten zu können. Er hatte keine Stacheln auf dem Rücken wie Maximus oder Requiescat, sondern war schlank, und für englische Verhältnisse war er vielleicht ein bisschen lang für sein Gewicht. »Aber immerhin ist er ja auch kein Feuer-oder Säurespucker.«
»Und du?«, fragte Moncey.
»Ich auch nicht«, entgegnete Temeraire, »aber ich beherrsche den Göttlichen Wind. Laurence sagt, der ist noch viel besser.« Mit einiger Verspätung dämmerte es ihm, dass Laurence in dieser Angelegenheit ein wenig voreingenommen gewesen sein mochte. Moncey und Perscitia jedenfalls blickten verständnislos drein, und es war schwer zu erklären, wie der Göttliche Wind funktionierte. »Ich brülle auf eine bestimmte Art und Weise. Ich muss ganz tief einatmen, und dann habe ich ein angespanntes Gefühl in der Kehle, und dann… dann sorgt das Geräusch, das ich von mir gebe, dafür, dass die Dinge zerbersten … Bäume und so weiter«, endete Temeraire mit einem verschämten Murmeln, denn er war sich bewusst, dass es sehr einfach und nutzlos klang, wenn er es so beschrieb. »Es ist sehr unangenehm, wenn man das Brüllen abbekommt«, fügte er trotzig hinzu, »zumindest muss ich davon ausgehen, wenn ich daran denke, wie sich andere benommen haben, wenn sie vor mir standen und ich den Göttlichen Wind anwandte.«
»Wie interessant«, antwortete Perscitia höflich. »Ich habe mich oft gefragt, was Klang eigentlich genau ist. Wir sollten einige Experimente durchführen.«
»Experimente werden den Rat nicht beeindrucken«, gab Moncey zu bedenken.
Temeraire klopfte sich mit dem Schwanz gegen die Flanke, dachte nach und sagte dann angewidert: »Nein, ich verstehe schon, das ist alles eine Frage der Politik. Für mich ist die Sache klar: Ich muss mir überlegen, was Lien tun würde.«
Am nächsten Tag fing er Lloyd ab und sagte: »Lloyd, ich bin heute schrecklich hungrig. Könnte ich eine zusätzliche Kuh bekommen und sie mir zu meiner Höhle mitnehmen?«
»Na also, so ist es schon besser«, lobte ihn Lloyd, der alles andere als taub gegenüber einer Bitte war, die seinen eigenen Plänen bezüglich der Drachenfortpflanzung derartig entgegenkam. Sofort veranlasste er alles Nötige. Während sie warteten, versuchte Temeraire mit möglichst beiläufiger Stimme, als handele es sich um eine gewöhnliche Plauderei, zu fragen: »Sie wissen nicht zufällig, mit wem sich Gentius gepaart hat?«
Der alte Langflügler warf Temeraire einen desinteressierten Blick zu, als dieser landete, und wirkte wenig neugierig. »Ja?«, fragte er. Seine Höhle war nicht sonderlich groß, aber ein behaglich trockener Felseinschnitt, gut überdacht von einem Vorsprung im Hang. Sie lag etwas höher und eröffnete den Blick auf eine Flussbiegung, sodass Gentius nur ein Stück hinabkriechen musste, wenn er einen Schluck trinken wollte, ohne sich die Mühe machen zu müssen, mehr oder weniger weit zu fliegen. Danach ging es wieder bergauf zu einem breiten, flachen Felsen, der in der prallen Sonne lag. Auf diesem hatte er gerade ein Schläfchen gehalten. »Ich bitte um Verzeihung, dass ich nicht schon früher auf einen Besuch vorbeigekommen bin«, setzte Temeraire an und neigte seinen Kopf. »Ich habe die letzten drei Jahre in Dover gedient, gemeinsam mit Excidium – deinem dritten Spross«, fügte er hinzu, als Gentius verständnislos zu ihm aufsah.
»Ja, natürlich Excidium«, sagte Gentius, und während seine Zunge bereits probeweise hervorschnellte, legte Temeraire eine tote Kuh vor ihm auf den Boden. Er hatte sie mithilfe von Monceys kleinen Klauen so weit zerlegt, dass die großen Knochen griffbereit herausragten. »Ein unbedeutendes Geschenk, um meinen Respekt zu erweisen«, schleimte Temeraire, und Gentius’ Miene hellte sich auf. »Also das ist wirklich très gentil von dir«, sagte er mit haarsträubender Aussprache. Gerade noch rechtzeitig schluckte Temeraire jede
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Victory of Eagles« bei Del Rey Books, an imprint of the Random House Publishing Group, a division of Random House, Inc., New York.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2008 by Naomi Novik
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2009 by Penhaligon Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München Covergestaltung: © hilden_design, München unter Verwendung einer Illustration von © Archiv Uwe Luserke / Anne Stokes Redaktion: Werner Bauer Lektorat: Holger Kappel Herstellung: RF Satz: Uhl + Massopust, Aalen
eISBN 978-3-641-09178-1
www.penhaligon.de
www.randomhouse.de
Leseprobe