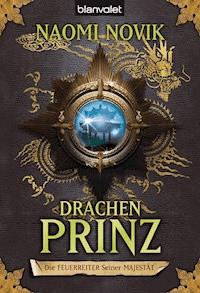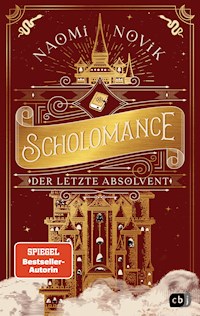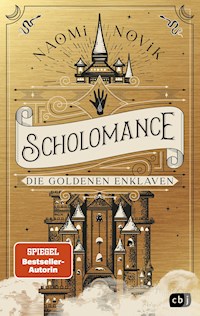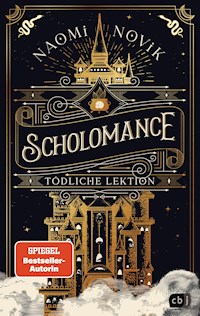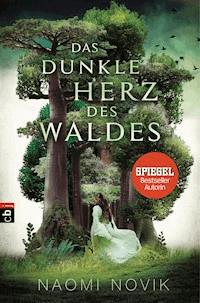6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Glitzernd, grandios und geheimnisvoll
Mirjem ist die Tochter eines gutherzigen Pfandleihers, der es nicht über sich bringt, Schulden einzutreiben. Als die Familie deshalb bittere Armut leidet, tritt Mirjem an die Stelle ihres Vaters. Unnachgiebig fordert sie zurück, was ihr zusteht. Sie ist erfolgreich, und bald heißt es, sie könne Silber zu Gold machen. Die Kunde davon dringt bis tief in die Wälder, zum gefürchteten Volk der Staryk – magische Wesen, die mehr aus Eis bestehen als aus Fleisch und Blut. Der König der Staryk entführt sie in sein Reich. Dort soll sie für ihn Silber zu Gold machen. Tut sie das nicht, wird der Staryk sie töten. Doch gleichzeitig versinkt die Menschheit nun in Kälte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 947
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Naomi Novik
DAS
KALTE REICH
DESSILBERS
Aus dem Amerikanischen
von Marianne Schmidt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Dieses Buch ist ein fiktionales Werk. Namen, Figuren, Orte und Vorfälle sind entweder ein Produkt der Fantasie der Autorin oder sind fiktiv gebraucht. Jegliche Ähnlichkeiten zu realen (lebenden oder toten) Personen, Ereignissen oder Schauplätzen sind rein zufällig.
© 2019 für die deutschsprachige Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuch Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
© 2018 by Temeraire LLC
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Spinning Silver« bei Del Rey, einem Imprint von Random House in der Verlagsgruppe Penguin Random House LLC, New York.
The right of Naomi Novik to be identified as the author of this work has been asserted by her in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988.
This translation is published by arrangement with Del Rey, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC, New York.
Aus dem Amerikanischen von Marianne Schmidt
Umschlaggestaltung: Carolin Liepins, München,
unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock (Jun Mu, Evgeniia Litovchenko, Dudarev Mikhail, Standret, Photos by D, Alexandra Cosmoss)
kk • Herstellung: AJ
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-23560-4V003
www.cbj-verlag.de
Kapitel 1
Die wahre Geschichte ist nicht halb so hübsch wie die, die man euch erzählt hat. Die wahre Geschichte geht so: Die Müllerstochter mit ihrem langen goldenen Haar will einen Adligen, einen Prinzen, zum Ehemann, den Sohn eines reichen Vaters. Also geht sie zum Geldverleiher und borgt sich genug von ihm, damit sie sich einen Ring und eine Halskette kaufen kann, um sich für das Fest auszustaffieren. Und sie ist schön genug, dass der Adlige, der Prinz, der Sohn eines reichen Vaters, auf sie aufmerksam wird und mit ihr tanzt. Und als der Tanz vorüber ist, lockt er sie in eine abgelegene Scheune. Danach kehrt er nach Hause zurück und heiratet die reiche Frau, die seine Familie für ihn ausgesucht hat. Die sitzen gelassene Müllerstochter erzählt jedem, dass der Geldverleiher mit dem Teufel im Bunde sei, und das Dorf jagt ihn davon oder steinigt ihn vielleicht sogar, sodass dem Mädchen zumindest der Schmuck als Mitgift bleibt. Und der Schmied heiratet sie, ehe das erste Kind ein wenig zu früh auf die Welt kommt.
Denn darum geht es in dieser Geschichte in Wahrheit: wie man es vermeidet, seine Schulden zu begleichen. Das wird normalerweise nicht erzählt. Ich aber weiß genau, wovon ich spreche. Mein Vater war nämlich ein Geldverleiher.
Er war nicht sehr gut darin. Wenn jemand seine Schulden nicht rechtzeitig beglich, dann erwähnte er es ihm gegenüber nicht einmal. Nur wenn unsere Schränke wirklich leer waren oder uns die Schuhe von den Füßen fielen, und wenn meine Mutter leise mit ihm sprach, nachdem wir zu Bett gegangen waren, dann machte er sich auf den Weg. Bedrückt brach er auf und klopfte an einige Türen, und es klang wie eine Entschuldigung, wenn er um einen Teil dessen bat, was man ihm noch zurückzugeben hatte. Wenn wir Geld im Haus hatten und jemand es leihen wollte, so hasste er es, ablehnen zu müssen, obwohl wir nicht mal genug für uns selbst hatten. Und so kam es, dass unser ganzes Geld, das zum größten Teil aus der Aussteuer meiner Mutter stammte, in den Häusern anderer Leute zu finden war. Allen anderen gefiel das gut, obschon sie wussten, dass sie sich schämen sollten, und so erzählten sie die Geschichte häufig, vor allem dann, wenn ich sie hören konnte.
Auch der Vater meiner Mutter war ein Geldverleiher, aber er war sehr erfolgreich in seinem Geschäft. Er lebte in Wisnja, vierzig Meilen die alte Handelsstraße mit den vielen Schlaglöchern hinunter, die sich von Dorf zu Dorf zog wie ein Seil voller kleiner, schmutziger Knoten. Mama nahm mich oft mit zu ihm, wenn sie ein paar Pfennige erübrigen konnte, damit wir hinten auf den Karren eines Hausierers oder auf einen Schlitten klettern konnten, der uns dorthin mitnahm. Unterwegs mussten wir uns oft fünf- oder sechsmal neue Mitfahrgelegenheiten suchen. Manchmal sahen wir kurz durch die Bäume hindurch die andere Straße, die den Staryk gehörte und die glänzte wie die Oberfläche des Flusses im Winter, wenn der Schnee davongeblasen worden war. »Sieh nicht hin, Mirjem«, pflegte meine Mutter zu sagen, aber ich spähte immer aus den Augenwinkeln und hoffte, sie nicht aus dem Blick zu verlieren. Doch wer auch immer den Wagen lenkte, trieb die Pferde an, bis die Straße wieder verschwunden war.
Einmal hörten wir Hufgetrappel hinter uns, das von der Straße der Staryk in den Wald wechselte, und es klang wie berstendes Eis. Unser Kutscher versetzte seinen Zugtieren einen raschen Schlag, um den Wagen hinter einen Baum zu lenken und dort zum Stehen zu bringen. Wir alle versteckten uns im Wagen zwischen den Säcken. Meine Mutter legte ihren Arm über meinen Kopf und drückte ihn nach unten, damit ich nicht in Versuchung geriet, doch einen Blick zu wagen. Sie ritten an uns vorbei, ohne haltzumachen. Wir saßen auf dem Karren eines Hausierers, voll mit matten Blechtöpfen, und die Ritter der Staryk hatten es einzig auf Gold abgesehen. Die Hufschläge verklangen und ein messerscharfer Wind blies über uns hinweg. Als ich mich wieder aufrichtete, war das Ende meines dünnen Zopfes mit Weiß überzogen, ebenso der Ärmel meiner Mutter, den sie um mich geschlungen hatte, und unser Rücken. Aber die Reifschicht verschwand nach und nach, und als sie nicht mehr zu sehen war, sagte der Hausierer zu meiner Mutter: »Nun, das war Rast genug, nicht wahr?«, als erinnerte er sich nicht mehr daran, warum wir angehalten hatten.
»Ja«, antwortete meine Mutter und nickte, als wüsste sie den Grund ebenso wenig, und der Fahrer kletterte wieder auf den Kutschbock, trieb die Pferde mit einem lauten Schnalzen an und nahm die Weiterfahrt auf. Ich war noch jung genug, um mich ein bisschen länger zu erinnern, und noch nicht alt genug, um mir über die Staryk ebenso viele Gedanken zu machen wie über die ständige Kälte, die durch meine Kleidung schnitt, und über das beißende Gefühl in meinem Magen. Ich wollte auf keinen Fall etwas sagen, was den Wagen wieder zum Stoppen bringen könnte, denn ich wartete ungeduldig darauf, endlich in der Stadt und bei meinen Großeltern zu Hause anzukommen.
Meine Großmutter hatte immer ein neues Kleid für mich, schlicht und in dunklem Braun, aber es war warm und gut gearbeitet. Außerdem bekam ich jedes Jahr ein neues Paar Lederschuhe, die nicht an meinen Zehen drückten und nicht voller Risse und Flicken an den Seiten waren. Sie sorgte dafür, dass ich mir dreimal am Tag den Bauch vollschlug, und am letzten Abend, ehe wir wieder aufbrachen, machte sie immer einen Käsekuchen – ihren Käsekuchen, der außen goldgelb gebacken und innen üppig gefüllt und weiß und krümelig war und ein kleines bisschen nach Apfel schmeckte. Gedeckt war er mit süßen, goldenen Rosinen. Nachdem ich langsam und genüsslich den letzten Bissen eines Stückes verzehrt hatte, das breiter als meine Handfläche gewesen war, wurde ich nach oben ins Bett geschickt, in das große, gemütliche Schlafzimmer, wo auch meine Mutter und ihre Schwestern als junge Mädchen geschlafen hatten, in dasselbe schmale Holzbett voller geschnitzter Tauben im Kopfteil. Meine Mutter setzte sich zu ihrer Mutter ans Feuer und lehnte ihren Kopf an deren Schulter. Sie sprachen nicht, aber als ich älter wurde und nicht mehr sofort einschlief, sah ich im Schein des Feuers, dass auf den Gesichtern beider Frauen dünne Tränenspuren glitzerten.
Wir hätten dortbleiben können. Es gab genug Platz im Haus meines Großvaters und wir waren willkommen. Aber wir kehrten immer wieder in unser eigenes Heim zurück, weil wir meinen Vater liebten. Er war schrecklich im Umgang mit Geld, aber er war unendlich warmherzig und gütig, und er versuchte, sein Versagen wiedergutzumachen. Beinahe jeden Tag war er von morgens bis abends in den kalten Wäldern unterwegs auf der Suche nach Nahrung und Feuerholz, und wenn er wieder zurück war, gab es nichts, was er nicht tat, um meiner Mutter zu helfen. In meinem Zuhause wurde niemals etwas als Frauenarbeit bezeichnet; wenn wir alle hungerten, dann darbte mein Vater am meisten, und verstohlen schob er Essen von seinem Teller auf unsere. Wenn er abends am Feuer saß, dann waren seine Hände immer in Bewegung und schnitzten ein neues kleines Spielzeug für mich oder irgendetwas für meine Mutter, wie eine Verzierung an einem Stuhl oder einen Holzlöffel.
Aber die Winter waren immer lang und bitter, und seitdem ich alt genug war, um mich daran zu erinnern, war jedes Jahr noch schlimmer als das Jahr davor. Unser Dorf war unbefestigt und praktisch namenlos; einige Leute behaupteten, es hieße Pakel, weil es nahe an der Straße lag. Aber jene, denen das nicht gefiel, weil es sie daran erinnerte, in der Nähe der Straße der Staryk zu wohnen, schrien sie nieder und behaupteten, das Dorf hieße Pavys, weil der Fluss nicht weit war. Niemand jedoch machte sich die Mühe, es auf einer Karte einzutragen, sodass niemals eine Entscheidung getroffen wurde. Wenn wir uns unterhielten, sprachen wir einfach nur von dem Dorf. Bei Reisenden war es beliebt, denn man erreichte es nach einem Drittel des Weges zwischen Wisnja und Minask, und ein kleiner Fluss kreuzte die Straße von Ost nach West. Viele Bauern brachten ihre Ware mit dem Boot, und so war immer eine Menge los an unserem Markttag. Mehr Bedeutung hatten wir allerdings nicht. Kein Lehnsherr kümmerte sich sonderlich um uns und dem Zaren in Koron waren wir völlig gleichgültig. Ich hätte nicht zu sagen vermocht, für wen der Steuereintreiber eigentlich arbeitete, bis ich einmal zu Besuch im Hause meines Großvaters war. Dort bekam ich zufällig mit, dass der Herzog von Wisnja zornig war, weil die Einkünfte aus unserem Dorf von Jahr zu Jahr geringer ausfielen. Die Kälte stahl sich immer früher aus den Wäldern und zehrte an unserer Ernte.
Und in dem Jahr, in dem ich sechzehn wurde, kamen auch die Staryk in der Woche, die die letzte des Herbstes sein sollte, noch ehe die ganze Gerste eingebracht war. Schon immer hatte die Suche nach Gold sie hin und wieder zu uns geführt, um uns auszuplündern; die Leute erzählten sich Geschichten von kurzen Blicken, die sie auf sie hatten werfen können und an die sie sich nur vage erinnerten, und an die Toten, die die Staryk zurückließen. Doch im Laufe der letzten sieben Jahre, während die Winter bitterer wurden, waren sie habgieriger geworden. Nun klammerten sich sogar noch ein paar Blätter an die Zweige der Bäume, als sie von ihrer Straße abbogen und ihren Weg auf der unsrigen fortsetzten. Sie ritten zu dem reichen Kloster am Ende der Straße, nur zehn Meilen von unserem Dorf entfernt, und dort töteten sie ein Dutzend Mönche und raubten die goldenen Kerzenleuchter und den goldenen Kelch und alle vergoldeten Ikonen. Diesen Goldschatz schleppten sie fort in das Königreich – wie auch immer es heißen mochte – am Ende ihrer eigenen Straße.
Der Boden gefror tief in jener Nacht, als sie vorüberritten, und danach fegte jeden Tag ein scharfer Wind aus dem Wald und trieb beißende Schneewirbel vor sich her. Unser kleines Haus stand abgelegen und ganz am Ende des Dorfes, ohne andere Mauern in der Nähe, die hätten helfen können, den Wind zu brechen, und wir wurden immer dünner und hungriger, zitternd vor Kälte. Mein Vater fand weiterhin Ausreden und mied die Arbeit, die zu tun er nicht ertragen konnte. Aber als meine Mutter ihn schließlich zwang und er es doch versuchte, kam er nur mit einer spärlichen Handvoll Münzen heim, und er nahm die Leute in Schutz: »Es ist ein schlimmer Winter. Ein harter Winter für jeden.« Ich aber war überzeugt, dass sich die Leute nicht einmal die Mühe gemacht hatten, eine solche Erklärung vorzuschieben. Am nächsten Tag lief ich durch das Dorf, um unseren Brotlaib zum Backen zu bringen, und ich hörte die Frauen, die uns Geld schuldeten, vom Festschmaus sprechen, den sie zu kochen gedachten, und von den schönen Sachen, die sie auf dem Markt erstehen wollten. Mittwinter rückte näher. Sie alle wollten etwas Gutes auf den Tisch bringen, etwas Besonderes für das Fest, für ihr Fest.
Und so hatten sie meinen Vater mit leeren Händen weggeschickt. Der Schein der Lichter aus ihren Häusern fiel hinaus auf den Schnee, und der Duft von gebratenem Fleisch drang durch die Risse in den Wänden, während ich langsam zurück zum Bäcker trottete, um ihm einen abgegriffenen Pfennig im Austausch für ein grobkörniges, halb verbranntes Brot zu geben, das nicht der Laib war, den ich selbst geknetet hatte. Er hatte den guten Laib einem seiner anderen Kunden gegeben und dieses misslungene Exemplar für uns aussortiert. Zu Hause bereitete meine Mutter dünne Kohlsuppe zu und kratzte das Öl zusammen, das sie zum Kochen verwendet hatte, um in dieser dritten Nacht unseres eigenen Festes die Lampe zu entzünden. Sie hustete bei ihrer Arbeit: Eine weitere eisige Kältewelle war aus den Wäldern herangerollt und hatte sich den Weg durch jede Spalte und jeden Riss in unserem heruntergekommenen, kleinen Häuschen gesucht. Unsere Lampe brannte erst einige Minuten, als ein Windstoß hereinfuhr und die Flamme löschte, und mein Vater sagte: »Nun, vielleicht heißt das, dass es Zeit fürs Bett wird«, anstatt sie wieder neu anzumachen, denn wir hatten beinahe all unser Öl aufgebraucht.
Am achten Tag war meine Mutter so erschöpft vom Husten, dass sie ihr Bett überhaupt nicht mehr verlassen konnte. »Es wird ihr schon bald wieder besser gehen«, sagte mein Vater und wich meinem Blick aus. »Bald wird die Kälte zu Ende gehen. Sie dauert doch jetzt schon so lange an.« Er schnitzte Kerzen aus Holz, kleine, schmale Holzstäbe, die wir anzündeten, weil wir in der Nacht zuvor die letzten Tropfen Öl verbraucht hatten. In unserem Haus würde es kein Lichtwunder geben.
Er ging hinaus, um unter der Schneedecke nach etwas mehr Feuerholz zu suchen. Auch unsere Brennvorräte gingen bereits zur Neige. »Mirjem«, sagte meine Mutter heiser, nachdem mein Vater aus dem Haus war. Ich brachte ihr einen Becher mit dünnem Tee mit ein wenig Honig darin, denn das war alles, was ich hatte, um ihr Linderung zu verschaffen. Sie nahm einen kleinen Schluck, ließ sich zurück in die Kissen sinken und sagte: »Wenn der Winter zu Ende geht, will ich, dass du zu meinem Vater ziehst. Dein Vater wird dich hinbringen.«
Das letzte Mal, als wir bei meinem Großvater zu Besuch gewesen waren, kamen eines Abends die Schwestern meiner Mutter mit ihren Ehemännern und Kindern zum Abendbrot. Sie alle trugen Kleider aus dicker Wolle und sie ließen ihre pelzbesetzten Umhänge im Flur. An den Händen trugen sie goldene Ringe und goldene Armreifen um die Handgelenke. Sie lachten und sangen, und der ganze Raum war warm, obwohl es tiefer Winter war. Wir aßen frisches Brot und gebratenes Huhn und heiße goldgelbe Suppe, köstlich gewürzt und mit viel Salz, und der Dampf aus der Schale stieg mir ins Gesicht. Als meine Mutter jetzt sprach, sog ich all die Wärme dieser Erinnerung zusammen mit ihren Worten auf, und ich sehnte mich danach, während sich meine kalten Finger schmerzhaft ineinanderkrallten. Ich dachte daran, wie es wäre, für immer dort hinzugehen, ein Bettelmädchen, das meinen Vater alleine und das Gold meiner Mutter für alle Zeiten in den Häusern unserer Nachbarn gelassen hatte.
Ich presste meine Lippen fest zusammen, küsste meine Mutter auf die Stirn und sagte zu ihr, sie solle sich ausruhen. Nachdem sie in einen unruhigen Schlaf gefallen war, ging ich zu der Kiste neben dem Ofen, in der mein Vater sein großes Kassenbuch aufbewahrte. Ich nahm es heraus, löste die abgenutzte Feder aus der Halterung, mischte aus der Asche im Ofen etwas Tinte an und machte eine Liste. Die Tochter eines Geldverleihers – auch wenn es ein schlechter ist – lernt, mit Zahlen umzugehen. Ich schrieb und rechnete und schrieb und berechnete die Zinsen und die Zeit und berücksichtigte auch die gelegentlichen unbedeutenden Rückzahlungen. Mein Vater hatte alles sorgfältig notiert, und er ließ einem jeden Schuldner eine solche Gewissenhaftigkeit zuteilwerden, wie niemand sie je für ihn selbst aufgebracht hatte. Als ich mit meiner Liste fertig war, räumte ich mein Strickzeug aus meiner Tasche, hüllte mich in meinen Umhang und machte mich auf in den kalten Morgen.
Ich ging zu jedem Haushalt, der uns etwas schuldete, und klopfte laut an die Tür. Es war früh, sehr früh, und noch dunkel, weil das Husten meiner Mutter uns mitten in der Nacht geweckt hatte. Alle waren noch zu Hause. Die Männer öffneten und starrten mich überrascht an, und ich blickte ihnen ins Gesicht und sagte mit kühler, harter Stimme: »Ich bin gekommen, damit Ihr Eure Schulden begleicht.«
Natürlich versuchten sie, mich loszuwerden, und manche lachten mich auch aus. Oleg, der Fuhrmann, ballte seine großen Hände zu Fäusten, stemmte sie in die Hüften und starrte mich an, während seine kleine Frau wie ein furchtsames Eichhörnchen mit gesenktem Kopf ins Feuer schaute und mir nur immer wieder rasche Blicke zuwarf. Kajus lächelte mich an. Er hatte sich im Jahr vor meiner Geburt zwei Goldstücke geliehen und betrieb ein einträgliches Geschäft mit Krupnik, den er in großen Kupferkesseln braute, die er vom geborgten Geld erstanden hatte. Er bat mich herein, damit ich mich aufwärmen und etwas Heißes trinken könnte. Ich lehnte ab. Ich wollte mich nicht aufwärmen. Ich blieb auf der Türschwelle stehen, holte meine Liste heraus und las den Leuten vor, wie viel sie sich geborgt und wie wenig sie zurückgezahlt hatten und wie viel an Zinsen sie uns außerdem mittlerweile schuldeten.
Sie stammelten und stritten und einige von ihnen schrien mich an. Niemand hatte mich in meinem ganzen bisherigen Leben angeschrien, nicht meine Mutter mit ihrer leisen Stimme, nicht mein sanftmütiger Vater. Aber ich fand etwas Bitteres in mir, etwas von diesem Winter, das in mein Herz eingedrungen war. Es war der Klang meiner hustenden Mutter und die Erinnerung an die Geschichte, wie sie so oft auf dem Marktplatz erzählt wurde, die von einem Mädchen handelte, das sich selbst mit geborgtem Geld zur Königin machte und ihre Schulden niemals beglich. Ich blieb vor ihren Türen stehen und rührte mich nicht. Meine Berechnungen stimmten, und das wussten sie. Und wenn sie genug herumgebrüllt hatten, fragte ich sie: »Habt Ihr das Geld?«.
Sie glaubten, hier ein Schlupfloch gefunden zu haben. Sie sagten, nein, natürlich nicht; sie hätten eine solche Summe nicht.
»Dann gebt mir jetzt ein bisschen und die nächsten Wochen ebenso, bis die Schulden abgetragen sind«, erwiderte ich, »und Ihr bezahlt Zinsen auf das, was Ihr mir noch nicht zurückgezahlt habt, wenn Ihr nicht wollt, dass ich mich an meinen Großvater wende, damit er es gerichtlich regelt.«
Keiner von ihnen war viel herumgekommen. Sie wussten, dass der Vater meiner Mutter reich war und in einem großen Haus in Wisnja lebte. Er war bekannt dafür, dass er Geld an Ritter und den Gerüchten nach sogar an einen Adligen verliehen hatte. Und so zahlten sie mir widerwillig ein bisschen was zurück – in einigen Häusern zwar nur ein paar Pfennige, aber jeder Einzelne von ihnen gab mir etwas. Mir war es auch recht, dass sie mich mit Waren bezahlten: mit fast elf Metern eines warmen tiefroten Wollstoffs, einem Krug mit Öl, zwei Dutzend guten, großen Kerzen aus weißem Bienenwachs oder einem neuen Küchenmesser vom Schmied. Ich machte ihnen einen gerechten Preis – das, was sie jemand anderem als mir dafür berechnet hätten, wenn sie die Sachen auf dem Markt verkauft hätten – und schrieb die Zahlen in ihrem Beisein in das Buch. Dann sagte ich, dass ich in der nächsten Woche wiederkommen würde.
Auf dem Heimweg machte ich bei Ludmilas Haus halt. Sie hatte sich kein Geld geborgt; sie hätte selbst welches verleihen können, aber sie wäre nicht in der Lage gewesen, Zinsen zu berechnen. Außerdem wäre niemand in unserem Dorf dumm genug gewesen, bei jemand anderem als bei meinem Vater Geld zu leihen, der zuließ, dass sie es nach Gutdünken zurückgaben oder einfach behielten. Ludmila öffnete die Tür mit einem geschäftstüchtigen Lächeln, denn sie nahm Durchreisende über Nacht auf. Es erstarb auf ihrem Gesicht, als sie mich sah. »Ja bitte?«, fragte sie scharf. Sie glaubte, ich wäre gekommen, um zu betteln.
»Meine Mutter ist krank, Panova«, sagte ich höflich, damit sie noch ein Weilchen länger in ihrem Glauben blieb, dann aber umso erleichterter war, als ich fortfuhr: »Ich bin gekommen, um etwas zu essen zu kaufen. Wie viel wollt Ihr für Suppe?«
Danach erfragte ich den Preis für Eier und Brot, als würde ich versuchen, herauszufinden, wie viel ich mit meiner schmalen Börse erstehen könnte; und weil sie es nicht besser wusste, nannte sie mir barsch die echten Preise, anstatt sie aufs Doppelte hochzusetzen. Es ärgerte sie, als ich schließlich sechs Pfennige für einen Topf mit heißer Suppe und einem halben Hühnchen darin, drei frische Eier, einen weichen Laib Brot und eine mit einem Tuch bedeckte Schale mit Honigwaben abzählte. Aber sie gab mir zähneknirschend das Gewünschte, und ich trug alles den langen Weg entlang bis zu unserem Haus.
Mein Vater war vor mir nach Hause gekommen; er schürte das Feuer und hob besorgt den Blick, als ich hereinpolterte; dann starrte er auf meine Arme, beladen mit Essen und roter Wolle. Ich setzte mein Bündel ab und legte die restlichen Pfennige und die eine silberne Kopeke in den Krug neben unserem Ofen, in dem gewöhnlich nur ein paar wenige Pfennige übrig waren. Danach reichte ich ihm die Liste mit den Rückzahlungen, drehte mich um und kümmerte mich darum, es meiner Mutter behaglich zu machen.
Seitdem war ich die Geldverleiherin in unserem Dorf. Und ich war eine gute Geldverleiherin. Viele Leute schuldeten uns Geld. Bald schon war der Boden in unserem Heim nicht mehr strohbedeckt, sondern bestand aus glatten Bohlen von goldfarbenem Holz. Die Risse in unserem Ofen waren mit gutem Lehm verschlossen und unser Dach frisch gedeckt. Meine Mutter hatte einen Pelzumhang, unter dem sie schlafen oder den sie tragen konnte, um ihre Brust warm zu halten. Ihr gefiel das alles ganz und gar nicht, ebenso wenig wie meinem Vater, der an dem Tag, als ich den Umhang nach Hause brachte, hinausging und leise vor sich hin weinte. Odeta, die Frau des Bäckers, hatte ihn mir angeboten, um die Schulden ihrer Familie auf einen Schlag abzuzahlen. Der Umhang war wunderschön, braun in hellen und dunklen Nuancen; sie hatte ihn mit in die Ehe gebracht, und er bestand aus Fellen von Hermelinen, die ihr Vater in den Wäldern des Bojaren erjagt hatte.
Es stellte sich heraus, dass der folgende Teil der alten Geschichte wahr war: Man musste grausam sein, wenn man ein guter Geldverleiher sein wollte. Aber ich war bereit dazu, ebenso gnadenlos mit unseren Nachbarn umzuspringen, wie sie es mit meinem Vater getan hatten. Ich holte nicht buchstäblich erstgeborene Kinder aus den Häusern. Einmal jedoch, in einer Woche im Spätfrühling, als die Straßen endlich wieder frei waren, ging ich zu einer der armen Bauersfamilien weit draußen bei den Feldern. Der Mann hatte nichts, was er mir geben konnte, nicht einmal ein überzähliges Brot. Gorek hatte sechs silberne Kopeken geborgt, eine Summe, die er niemals würde zurückzahlen können, selbst wenn er bis an sein Lebensende jedes Jahr eine gute Ernte einbringen würde. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er jemals mehr als fünf Pfennige zugleich in der Hand gehabt hatte. Zuerst versuchte er, mich einfach mit Flüchen aus dem Haus zu jagen, wie es schon so viele vor ihm versucht hatten, aber als ich standhaft blieb und ihm sagte, dass er sich dann vor dem Gesetz würde verantworten müssen, schlich sich echte Verzweiflung in seine Stimme. »Ich habe vier Mäuler zu stopfen!«, sagte er. »Man kann kein Blut aus einem Stein pressen.«
Ich schätze, er hätte mir leidtun sollen. Mein Vater hätte Mitleid mit ihm gehabt und meine Mutter ebenfalls, aber ich gab mich kalt und spürte nichts als die Gefahr des Augenblicks. Wenn ich nachgäbe und seine Ausflüchte gelten ließe, dann würde schon in der nächsten Woche jeder eine Entschuldigung parat haben, und von diesem Moment an würde alles wieder wie früher sein.
Da kam seine große Tochter ins Zimmer gewankt, ein dickes, graues Tuch über ihre langen, blonden Zöpfe gebunden und ein schweres Joch über den Schultern, um zwei Eimer Wasser zugleich zu tragen, doppelt so viel, wie ich heimbringen konnte, wenn ich selbst zum Brunnen ging. Und so sagte ich: »Dann wird deine Tochter mitkommen und in meinem Haus die Schulden abarbeiten, für einen halben Pfennig pro Tag.« Mit diesen Worten machte ich mich auf den Heimweg, zufrieden wie eine Katze, und unterwegs tanzte ich ein bisschen ganz für mich allein unter den Bäumen.
Ihr Name war Wanda. Schweigend kam sie am nächsten Morgen zu unserem Haus, schuftete bis zum Mittag wie ein Ochse und verließ uns danach ebenso wortlos wieder. Die ganze Zeit über hielt sie ihren Kopf gesenkt. Sie war sehr stark und sie erledigte beinahe die gesamte leidige Hausarbeit an diesem halben Tag. Sie schleppte das Wasser und hackte das Holz, kümmerte sich um die kleine Hühnerschar, die mittlerweile auf unserem Hof herumlief, schrubbte die Böden und unseren Ofen und all unsere Töpfe, und ich war sehr zufrieden mit der Lösung, die ich gefunden hatte.
Nachdem sie wieder fort war, hörte ich zum ersten Mal in meinem Leben, wie meine Mutter zornig die Stimme gegen meinen Vater erhob – etwas, das sie nicht einmal getan hatte, als sie gefroren hatte und krank gewesen war. »Und es kümmert dich nicht, was es aus ihr macht?« Ich hörte das erstickte Weinen in ihrer immer noch heiseren Stimme, während ich am Tor den Dreck von meinen Stiefelhacken klopfte. Da ich am Morgen keine Arbeit zu erledigen gehabt hatte, hatte ich mir einen Esel ausgeliehen und hatte den ganzen Weg bis zu den entlegensten Dörfern zurückgelegt, um das Geld von Leuten einzutreiben, die vermutlich geglaubt hatten, dass sie den Tag nicht mehr erleben würden, an dem jemand kommen und es zurückfordern würde. Die Wintergerste war eingebracht, und ich kam mit zwei prall gefüllten Getreidesäcken nach Hause, mit zwei weiteren mit Wolle und einem großen Beutel für meine Mutter mit ihren Lieblingshaselnüssen, die den ganzen Winter über draußen in der Kälte frisch geblieben waren. Mit dabei war auch ein alter, aber guter Nussknacker aus Eisen, sodass wir von jetzt an nicht mehr den Hammer dafür zu verwenden brauchten.
»Was soll ich ihr denn sagen?«, schrie mein Vater zurück. »Was soll ich sagen? Nein, du sollst lieber verhungern? Nein, du sollst frieren und in Lumpen gekleidet herumlaufen?«
»Nur wenn du die Kälte hättest, es selbst zu tun, könntest du kalt genug sein, es sie an deiner Stelle tun zu lassen«, erwiderte meine Mutter. »Sie ist unsere Tochter, Josef!«
In dieser Nacht versuchte mein Vater, leise mit mir zu sprechen, und er stolperte über die Worte: Ich hätte genug getan, es sei gar nicht meine Aufgabe, morgen solle ich zu Hause bleiben. Ich knackte weiter Nüsse, ohne aufzusehen, und ich gab ihm keine Antwort, und die Kälte war wie ein fester Knoten unter meinen Rippen. Ich dachte an die heisere Stimme meiner Mutter und nicht an die Worte, die sie gesprochen hatte. Nach einer Weile verstummte mein Vater. Die Eiseskälte in mir schlug ihm entgegen und ließ ihn zurückweichen, genauso wie es der Fall gewesen war, als man ihm im Dorf mit Kälte begegnet war, nur weil er um das bat, was man ihm schuldete.
Kapitel 2
Mein Vater sagte oft, dass er zum Geldverleiher gehen wolle. Dann hätte er genug Geld für einen neuen Pflug oder dafür, einige Schweine zu kaufen oder eine Milchkuh. Ich wusste gar nicht richtig, was Geld bedeutete. Unser Häuschen lag weit entfernt vom Dorf und unsere Steuern bezahlten wir in Form von Säcken mit Getreide. Bei Pa klang Geld wie etwas Magisches, aber bei Ma wie etwas sehr Gefährliches. »Geh nicht, Gorek«, pflegte sie zu sagen. »Wenn man jemandem Geld schuldet, gibt es früher oder später immer Ärger.« Dann schrie Pa sie an, sie solle sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, und schlug sie, aber am Ende ging er dann doch nicht.
Er ging erst, als ich elf Jahre alt war. Ein weiteres Baby war in der Nacht geboren worden und gestorben, und Mama war krank. Wir hatten kein weiteres Kind gebraucht, denn wir hatten schon Sergej und Stepon und die vier toten Kinder, die beim weißen Baum begraben lagen. Pa bestattete die Neugeborenen, die nicht überlebt hatten, immer dort, obwohl die Erde sich da nur schwer umgraben ließ, aber er wollte keinen Boden dafür abzwacken, auf dem sich vielleicht etwas anbauen ließe. Zu nah am weißen Baum jedoch konnte er ohnehin nichts säen, denn dieser würde alles ringsherum verschlingen. Die Roggensamen würden zwar sprießen, doch dann, eines kalten Morgens, würden sie alle verdorrt sein, während der weiße Baum stattdessen einige neue weiße Blätter tragen würde. Pa konnte den Baum aber auch nicht fällen. Er war ganz weiß, also gehörte er den Staryk. Würde er ihn fällen, würden sie kommen, um ihn zu töten. Und so gab es nichts, was wir dort in die Erde setzen konnten, außer toten Säuglingen.
Als Pa wieder zurückkam, zornig und verschwitzt von der Anstrengung, das neue tote Baby zu begraben, sagte er mit lauter Stimme: »Deine Mutter braucht Medizin. Ich werde zum Geldverleiher gehen.« Wir drei blickten uns an, ich und Sergej und Stepon. Sie waren noch klein und zu verängstigt, um irgendetwas zu sagen, und meine Mama war zu krank, um zu widersprechen. Auch ich sagte nichts dazu. Mama lag noch immer im Bett, und es war voller Blut, und sie war heiß und ihr Gesicht gerötet. Sie antwortete nicht, als ich etwas zu ihr sagte. Sie hustete nur. Ich wollte, dass Pa mit einem Zaubermittel zurückkehrte, damit sie wieder aus dem Bett aufstehen konnte und gesund würde.
Also brach er auf. Er vertrank zwei Kopeken im Dorf und verlor zwei beim Spielen, ehe er mit dem Doktor zurückkam. Der Doktor nahm die letzten beiden Kopeken und gab mir ein Pulver, das ich mit heißem Wasser mischen und Mama zu trinken geben sollte. Es half nicht gegen das Fieber. Drei Tage später versuchte ich, ihr heißes Wasser einzuflößen, doch sie hustete wieder. »Mama, ich habe Wasser für dich«, sagte ich. Sie schlug die Augen nicht auf. Stattdessen legte sie mir ihre große Hand auf den Kopf, seltsam zart und schwer zugleich. Und dann starb sie. Ich blieb den Rest des Tages bei ihr sitzen, bis Pa vom Feld nach Hause kam. Er sah schweigend auf sie hinunter und trug mir dann auf: »Wechsle das Stroh!« Er legte sich ihren Körper über die Schulter wie einen Sack Kartoffeln, trug sie nach draußen zum weißen Baum und begrub sie neben den toten Kindern.
Der Geldverleiher kam einige Monate später und verlangte sein Geld zurück. Ich ließ ihn herein, als er vor der Tür stand. Ich wusste, dass er ein Handlanger des Teufels war, aber ich hatte keine Angst vor ihm. Alles an ihm war abgezehrt, seine Hände und sein Körper und sein Gesicht. Mama hatte eine Ikone an die Wand genagelt, die aus einem schmalen Ast geschnitzt worden war. Genau so sah er aus. Seine Stimme war leise. Ich gab ihm einen Becher Tee und ein Stück Brot, denn ich erinnerte mich daran, dass Mama den Leuten immer etwas zu essen angeboten hatte, wenn sie unser Haus betraten.
Als Pa heimkam, tobte er und jagte den Geldverleiher zur Tür hinaus. Dann versetzte er mir fünf harte Hiebe mit seinem Gürtel, weil ich ihn überhaupt hereingebeten hatte, ganz zu schweigen davon, dass ich ihn mit Essen versorgt hatte. »Was hat er hier zu suchen? Du kannst aus einem Stein kein Blut herauspressen«, sagte er und schnallte sich seinen Gürtel wieder um. Ich verbarg mein Gesicht in der Schürze meiner Mutter, bis meine Tränen versiegt waren.
Er sagte dasselbe, als der Steuereintreiber zu unserem Haus kam, aber er sagte es so leise, dass es kaum zu hören war. Der Steuereintreiber kam immer an dem Tag, an dem wir das letzte Getreide ernteten, im Winter und im Frühjahr. Ich verstand nicht, wie er das immer wissen konnte, aber er wusste es. Wenn er fort war, waren die Steuern bezahlt. Was er nicht mitnahm, musste für uns zum Leben reichen. Das war niemals sehr viel. Im Winter pflegte Mama zu Pa zu sagen: »Wir werden das hier im November und das dort im Dezember essen«, und dabei zeigte sie auf dies und das, und auf die Art wurde alles bis zum Frühling aufgeteilt. Aber Mama war nicht mehr da. Und so brachte Pa eine der jungen Ziegen ins Dorf. In dieser Nacht kam er sehr spät zurück und war betrunken. Wir schliefen im Haus neben dem Ofen, und er stolperte über Stepon, als er hereinkam. Stepon schrie, und da wurde Pa wütend, nahm seinen Gürtel ab und schlug uns alle, bis wir aus dem Haus rannten. Die Ziegenmutter hörte auf, Milch zu geben, und so ging uns am Ende des Winters das Essen aus. Wir mussten bis zum Frühling im Schnee graben und nach alten Eicheln suchen.
Aber im nächsten Winter, als der Steuereintreiber kam, trug Pa wieder einen Getreidesack ins Dorf. Wir alle verkrochen uns im Stall und schliefen bei den Ziegen. Sergej und Stepon blieben verschont, aber Pa schlug mich am nächsten Tag, als er wieder nüchtern war, trotzdem, weil seine Mahlzeit nicht fertig gewesen war, als er nach Hause kam. Im Jahr darauf wartete ich also im Haus, bis ich ihn die Straße herunterkommen sah. Pa hatte eine Laterne in der Hand, die in großen Kreisen hin und her schwang, weil er so betrunken war. Ich stellte das heiße Essen in einer Schale auf den Tisch und rannte hinaus. Es war schon dunkel, aber ich nahm keine Kerze mit, weil ich nicht wollte, dass Pa mich aus dem Haus huschen sah.
Ich wollte eigentlich zum Stall gehen, aber ich schaute mich immerzu um, weil ich sehen wollte, ob Pa mir nachkam. Seine Laterne schaukelte im Innern des Hauses, sodass die Fenster wie Augen aussahen, die nach mir Ausschau hielten. Dann aber hörte das Flackern auf, also hatte er die Laterne auf dem Tisch abgestellt, und ich dachte, dass ich jetzt in Sicherheit wäre. Ich begann, auf den Weg zu schauen, auf dem ich lief, aber ich konnte in der Dunkelheit nichts sehen, weil ich zu lange in die hellen Fenster gestarrt hatte. Ich war nicht auf dem Weg zum Stall. Ich ging durch tiefen Schnee. Von den Ziegen oder gar den Schweinen war nichts zu hören. Es war eine finstere Nacht.
Ich glaubte, ich würde früher oder später zum Zaun oder zur Straße kommen. Also lief ich weiter, die Hände vor mir ausgestreckt, um den Zaun zu ertasten, aber es kam kein Zaun. Es war dunkel und zuerst fürchtete ich mich. Irgendwann war mir nur noch kalt und schließlich wurde ich schläfrig. Meine Zehen waren taub. Der Schnee war durch das Flechtwerk meiner Bastschuhe gekrochen.
Dann war plötzlich ein Licht vor mir. Darauf lief ich zu. Ich befand mich in der Nähe des weißen Baumes. Die Zweige waren dünn, und all die weißen Blätter hingen noch dran, obwohl Winter war. Der Wind fuhr hindurch, und sie machten ein Geräusch, als ob irgendjemand flüsterte, aber so leise, dass es nicht zu verstehen war. Auf der anderen Seite des Baumes gab es eine breite Straße, die sehr glatt und glänzend war, wie Eis. Ich wusste, dass dies die Straße der Staryk war. Aber sie war so wunderschön und ich fühlte mich immer noch sehr seltsam und kalt und schläfrig. Ich hatte vergessen, dass ich mich eigentlich fürchten sollte. Ich ging einfach weiter auf sie zu.
Die Gräber waren am Fuße des Stamms in einer Reihe angeordnet. Auf jedem lag nur ein flacher Stein. Mama hatte die Brocken für die Kinder aus dem Fluss geholt. Für sie und das letzte Baby hatte ich selbst einen Stein gesucht. Diese beiden waren kleiner als die anderen, denn ich konnte noch nicht so schwer wie Mama tragen. Als ich einen Schritt über die Steinreihe hinweg machte, um zur Straße zu gelangen, schlug mir ein Ast des Baumes auf die Schultern, und ich fiel hart auf den Boden. Meine ganze Atemluft wurde mir aus der Brust gepresst. Der Wind pustete durch die weißen Blätter, und ich hörte sie sagen, Lauf nach Hause, Wanda! Da war ich nicht mehr wie im Tran, sondern hatte solche Angst, dass ich aufsprang und den ganzen Weg zurück zum Haus rannte. Ich konnte schon von Weitem sehen, wie der Schein der Laterne noch immer durch die Fenster fiel. Pa schnarchte bereits in seinem Bett.
Ein Jahr später kam der alte Jakob, unser Nachbar, zu uns und bat Pa um meine Hand. Er wollte allerdings von Pa noch eine Ziege dazubekommen, und da warf ihn Pa aus dem Haus und schimpfte: »Eine Jungfrau, gesund, mit einem kräftigen Rücken, und er will eine Ziege von mir!«
Danach arbeitete ich hart. Ich übernahm so viel von Pas Arbeit, wie ich nur konnte. Ich wollte nicht auch eine Reihe von toten Babys haben und selbst sterben. Aber ich wurde groß, und mein Haar war blond und lang, und meine Brüste wuchsen. Im Laufe der nächsten zwei Jahre hielten noch zwei weitere Männer um mich an. Den letzten kannte ich überhaupt nicht. Er kam von der anderen Seite des Dorfs, sechs Meilen entfernt. Er bot sogar einen Brautpreis von einem Schwein an. Doch meine tüchtige Arbeit hatte Pa längst gierig gemacht, und er sagte, er wolle drei Schweine haben. Der Mann spuckte auf den Fußboden und verließ unser Haus.
Aber die Ernten fielen jetzt immer schlechter aus. Der Schnee schmolz jedes Jahr später im Frühling und setzte früher im Herbst ein. Nachdem der Steuereintreiber seinen Anteil geholt hatte, war nicht mehr viel übrig zum Vertrinken. Ich hatte gelernt, Essen zu verstecken, sodass wir im Winter nicht mehr so sehr darben mussten wie im ersten Jahr, aber Sergej und Stepon und ich wurden allesamt größer. In dem Jahr, in dem ich sechzehn wurde, nach der Frühlingsernte, kam Pa nur halb betrunken und schlecht gelaunt aus dem Dorf nach Hause. Er schlug mich nicht, aber er sah mich an, als wäre ich eines seiner Schweine, dessen Gewicht er im Kopf abschätzte. »Nächste Woche begleitest du mich auf den Markt«, teilte er mir mit.
Am nächsten Tag ging ich hinaus zum weißen Baum. Ich hatte mich stets von ihm ferngehalten seit jener Nacht, in der ich die Straße der Staryk gesehen hatte. Doch an diesem Tag wartete ich, bis die Sonne hoch am Himmel stand. Dann sagte ich, ich würde Wasser holen, ging aber stattdessen zum Baum. Ich kniete mich hin, unter die Äste, und flüsterte: »Hilf mir, Mama.«
Zwei Tage später kam die Tochter des Geldverleihers zu uns. Sie sah aus wie ihr Vater, ein dürres Ding mit dunkelbraunem Haar und schmalen Wangen. Sie reichte Pa nicht einmal bis zur Schulter. Aber sie stand vor der Tür, warf einen langen Schatten in unser Haus und sagte, sie würde ihn vor Gericht schleifen, wenn er ihr nicht das Geld zurückzahlen würde. Er schrie sie an, aber sie hatte keine Angst. Nachdem er ihr gesagt hatte, dass man aus einem Stein kein Blut pressen könne, und ihr unseren leeren Schrank zeigte, sagte sie: »Dann wird Eure Tochter kommen und für mich arbeiten, um Eure Schulden abzuarbeiten.«
Als sie fort war, ging ich zurück zum weißen Baum und sagte: »Danke, Mama.« Und zwischen den Wurzeln vergrub ich einen Apfel, einen ganzen Apfel, obwohl ich so hungrig war, dass ich ihn mit Stiel und Gehäuse hätte verschlingen können. Über meinem Kopf öffnete sich eine ganz kleine weiße Blüte an einem Zweig.
Am nächsten Tag ging ich zum Haus des Geldverleihers. Ich fürchtete mich davor, allein ins Dorf zu gehen, aber es war besser, als Pa zum Markt zu begleiten. Und überhaupt musste ich gar nicht wirklich ins Dorf hinein: Ihr Haus war das erste am Waldrand. In meinen Augen war es groß, mit zwei Räumen und einem Fußboden aus glatten, frisch riechenden Holzbohlen. Die Frau des Geldverleihers lag im Hinterzimmer im Bett. Sie war krank und hustete. Es tat weh, das zu hören, und meine Schultern verspannten sich.
Die Tochter des Geldverleihers hieß Mirjem. An diesem Morgen setzte sie einen Topf mit Suppe auf, und der Essensdampf erfüllte das Haus mit einem Duft, der meinen leeren Magen dazu brachte, sich wie ein Knoten fest zusammenzuziehen.
Dann nahm sie den Teig, der in der Ecke gestanden hatte und aufgegangen war, und verließ damit das Haus. Am späten Nachmittag kam sie wieder; ihr Gesicht hatte einen harten Ausdruck, ihre Schuhe waren staubbedeckt, und sie trug einen dunkelbraunen Brotlaib unter dem Arm, der frisch aus dem Ofen eines Bäckers stammte. Sie brachte auch einen Kübel Milch und einen Teller Butter mit und über der Schulter trug sie einen Sack voller Äpfel. Dann stellte sie Teller auf den Tisch, und sie deckte auch für mich mit, womit ich nicht gerechnet hatte. Nachdem wir uns gesetzt hatten, sagte der Geldverleiher einen Zauberspruch über dem Brot, aber ich aß es trotzdem. Es schmeckte gut.
Ich versuchte, so viel zu tun, wie ich konnte, damit sie wollten, dass ich wiederkam. Ehe ich das Haus verließ, fragte die Frau des Geldverleihers mit einer Stimme, die vom Husten ganz heiser war: »Verrätst du mir deinen Namen?« Nach einem kurzen Moment sagte ich ihn ihr. Sie antwortete: »Danke, Wanda. Du warst eine große Hilfe.« Nachdem ich das Haus schon verlassen hatte, hörte ich sie sagen, ich hätte so viel gearbeitet, dass die Schulden sicher bald abgetragen sein würden. Ich blieb vor dem Fenster stehen, um zu lauschen.
Mirjem antwortete ihrer Mutter: »Er hat sich sechs Kopeken geliehen! Bei einem halben Pfennig pro Tag braucht sie vier Jahre, bis alles zurückgezahlt ist. Versuch nicht, mir zu sagen, dass das kein angemessener Lohn ist, wo sie doch zusammen mit uns isst.«
Vier Jahre! Mein Herz hüpfte vor Freude.
Kapitel 3
Die Schneeschauer und der Husten meiner Mutter kehrten noch bis tief ins Frühjahr hinein immer wieder, aber dann endlich wurden die Tage wärmer und der Husten verging dank Suppe und Honig und Ruhe. Sobald meine Mutter wieder singen konnte, sagte sie zu mir: »Mirjem, nächste Woche werden wir meinen Vater besuchen.«
Ich wusste, dass es die schiere Verzweiflung war und dass sie nur versuchte, mich von meiner Arbeit abzuhalten. Ich wollte nicht fort, aber ich wollte meine Großmutter sehen und ihr zeigen, dass ihre Tochter nicht mehr frierend in der Kälte schlafen musste und dass ihre Enkelin nicht länger wie eine Bettlerin herumlief. Einmal wenigstens wollte ich sie besuchen, ohne sie weinen zu sehen. So brach ich ein letztes Mal zu meiner Runde auf und sagte jedem, dass ich in die Stadt gehen würde und dass ich zusätzliche Zinsen für diese Wochen, in denen ich fort sein würde, erheben müsste – es sei denn, dass sie ihre Zahlungen in meiner Abwesenheit zu unserem Haus bringen würden. Wanda teilte ich mit, dass sie trotzdem jeden Tag zu kommen habe, um meinem Vater das Abendessen zu richten, die Hühner zu füttern, das Haus zu putzen und den Hof in Ordnung zu halten. Sie nickte schweigend und gab keine Widerworte.
Und dann fuhren wir zum Haus meines Großvaters, aber dieses Mal bezahlte ich Oleg dafür, dass er uns den ganzen Weg mit seinen guten Pferden und auf dem bequemen Schlitten fuhr, der mit Stroh und Decken ausgelegt war. Am Geschirr klimperten kleine Glöckchen, und wir breiteten Felldecken über uns aus, um gegen den Wind geschützt zu sein. Als wir vor dem Haus vorfuhren, kam meine Großmutter überrascht heraus, um uns zu begrüßen, und meine Mutter fiel ihr wortlos in die Arme und verbarg ihr Gesicht. »Nun, kommt herein und wärmt euch auf«, sagte meine Großmutter und ließ ihren Blick über den Schlitten und unsere neuen Kleider aus roter Wolle gleiten, mit Kaninchenfell besetzt und mit einem goldenen Knopf oben an meinem Hals verziert, der aus der Truhe des Webers stammte.
Sie schickte mich los, meinem Großvater frisches, heißes Wasser in sein Arbeitszimmer zu bringen, sodass sie sich allein mit meiner Mutter unterhalten konnte. Mein Großvater hatte stets kaum mehr als ein Brummen für mich übriggehabt und mich unzufrieden von oben bis unten gemustert. Ich trug immer Kleider, die meine Großmutter gekauft hatte. Ich konnte mich nicht entsinnen, wieso ich wusste, was mein Großvater von meinem Vater hielt, denn ich hatte keine Erinnerung daran, dass er jemals ein Wort über ihn verloren hätte. Aber ich wusste es.
Dieses Mal begutachtete er mich unter seinen buschigen Augenbrauen hervor und runzelte die Stirn: »Jetzt also Pelz? Und Gold?«
Ich war gut erzogen und wusste, dass ich mit meinem Großvater nicht herumstreiten sollte, aber ich war bereits aufgebracht, weil meine Mutter so unglücklich war und auch meine Großmutter keineswegs erfreut gewirkt hatte. Und nun stichelte ausgerechnet er. »Warum sollte nicht ich diese Kleider tragen anstelle von irgendjemand anderem, der sie mit dem Geld meines Vaters gekauft hat?«, fragte ich.
Mein Großvater war außerordentlich überrascht, wie man sich gut vorstellen kann, als seine Enkelin in dieser Weise mit ihm sprach, aber er begriff, was ich gesagt hatte, legte die Stirn noch mehr in Falten und sagte: »Dann hat also dein Vater diese Sachen für dich gekauft?«
Loyalität und Liebe ließen mich an dieser Stelle verstummen, und ich blickte zu Boden, goss schweigend das heiße Wasser in den Samowar und fügte frische Teeblätter hinzu. Mein Großvater hielt mich nicht zurück, als ich ging, aber bis zum nächsten Morgen hatte er auf irgendeine Weise die ganze Geschichte in Erfahrung gebracht, nämlich dass ich die Arbeit meines Vaters übernommen hatte, und plötzlich war er, im Gegensatz zu allen anderen, so zufrieden mit mir wie noch nie zuvor.
Seine anderen zwei Töchter hatten eine bessere Partie als meine Mutter gemacht und reiche Männer aus der Stadt geheiratet, die erfolgreich waren. Doch keine von beiden hatte ihm einen Enkel geschenkt, der sein Geschäft fortführen wollte. In der Stadt gab es genug von unserem Volk, sodass wir nicht im Geldgeschäft tätig sein oder als Bauern arbeiten mussten, die für ihr eigenes Essen sorgten. Stadtmenschen waren eher bereit, unsere Waren zu kaufen, und es gab einen blühenden Markt im Viertel hinter unserer Mauer.
»Es schickt sich nicht für ein Mädchen«, setzte meine Großmutter an, aber mein Großvater schnaubte nur. »Gold weiß nichts über die Hand, in der es liegt«, sagte er und sah mich stirnrunzelnd, aber durchaus erfreut an. »Du wirst Bedienstete brauchen«, teilte er mir mit. »Für den Anfang reicht eine Hilfe, Mann oder Frau, gut, stark und mit schlichtem Gemüt. Das Wichtigste ist, dass es ihm oder ihr nichts ausmacht, für eine Jüdin zu arbeiten. Kannst du so jemanden finden?«
»Ja«, antwortete ich und dachte an Wanda. Sie war schon daran gewöhnt, zu uns zu kommen, und in unserem Dorf gab es sonst nicht viele Möglichkeiten für eine Tochter aus einer armen Bauernfamilie, etwas Geld zu verdienen.
»Gut. Mach dich von jetzt an nicht mehr selbst auf den Weg, um das Geld einzutreiben«, fuhr er fort. »Schick deinen Dienstboten, und wenn der Kunde herumstreiten will, dann muss er zu dir nach Hause kommen. Besorg dir einen Schreibtisch, hinter dem du sitzen kannst, während die Bittsteller stehen.«
Ich nickte, und als wir nach Hause aufbrachen, gab er mir eine Börse voller Pfennige im Wert von fünf Kopeken, damit ich sie in den Städten verleihen konnte, die in unserer Nähe lagen und keinen eigenen Geldverleiher hatten. Zu Hause angekommen, fragte ich meinen Vater, ob Wanda in meiner Abwesenheit da gewesen wäre. Er sah mich traurig an. Seine Augen waren tief eingesunken und hatten einen bedrückten Ausdruck, obwohl wir nun schon seit Monaten nicht mehr hungerten, und er antwortete leise: »Ja. Ich habe ihr gesagt, dass das nicht nötig sei, aber sie kam trotzdem jeden Tag.«
Zufrieden sprach ich sie noch am selben Tag an, nachdem sie mit ihrer Arbeit fertig geworden war. Ihr Vater war ein großer Mann, und auch sie war hoch aufgeschossen und hatte breite Schultern, große, quadratische Hände, die von der Arbeit gerötet waren; die Nägel waren kurz, das Gesicht schmutzig, und ihre langen, blonden Haare hatte sie unter einem Kopftuch versteckt. Sie war wortkarg und sah stumpfsinnig wie ein Ochse aus. »Ich brauche mehr Zeit, um die Buchhaltung zu erledigen«, begann ich. »Deshalb benötige ich jemanden, der für mich herumgeht und das Geld eintreibt. Wenn du die Arbeit übernehmen möchtest, dann bezahle ich dir einen ganzen Pfennig pro Tag anstatt nur einen halben.«
Sie stand für einen langen Moment da, als ob sie sich nicht sicher wäre, dass sie mich richtig verstanden hatte. »Die Schulden meines Vaters wären dann früher abgetragen«, sagte sie schließlich, als ob sie sich vergewissern müsste.
»Auch wenn sie getilgt sind, werde ich dich weiterhin bezahlen«, sagte ich ein wenig leichtsinnig. Aber wenn Wanda für mich das Geld eintrieb, konnte ich meine Runde durch die Nachbardörfer machen und wieder aufs Neue Geld verleihen. Ich wollte diesen kleinen Silbersee, den mein Großvater mir hatte zukommen lassen, unter die Leute bringen, und damit für einen stetigen Strom an Pfennigen sorgen, der zu mir zurückfließen würde.
Wanda war wieder still, dann sagte sie: »Ihr würdet mich mit Münzen bezahlen?«
»Ja«, sagte ich. »Was ist nun?«
Sie nickte und ich nickte zurück. Ich bot ihr nicht die Hand zum Schütteln an; niemand würde einer Jüdin die Hand schütteln, aber ich wusste, dass es ohnehin unredlich wäre, wenn sie es doch täten. Wenn Wanda sich nicht an die Abmachung hielt, würde ich aufhören, sie zu bezahlen. Das war eine verlässlichere Garantie als alles, was ich sonst kriegen würde.
Pa war wütend gewesen und hatte vor sich hingebrütet, seitdem ich angefangen hatte, im Haus des Geldverleihers zu arbeiten. Er konnte mich nun an niemanden mehr verschachern, und ich war nicht bei ihm, um zu arbeiten. Und noch immer hatten wir wenig zu essen. Er wurde jetzt noch leichter laut und schlug noch härter zu. Stepon und Sergej verbrachten einen Großteil ihrer Zeit bei den Ziegen. Ich duckte mich, so gut es ging, und ertrug den Rest schweigend. Das Zählen und das Rechnen halfen mir dabei, den Mund zu halten. Wenn bei einem halben Pfennig pro Tag in vier Jahren die Schulden meines Vaters getilgt wären, dann würden jetzt zwei Jahre dafür ausreichen. Zwei Jahre entsprachen demnach sechs Kopeken. Und ich würde zwei weitere Jahre arbeiten können, ehe mein Vater auf die Idee käme, dass das Geld nun zurückgezahlt wäre. Und ich wäre zu diesem Zeitpunkt im Besitz von sechs Kopeken. Sechs Silberstücke, ganz für mich allein.
Ich hatte nur einmal einen Bruchteil von so viel Geld gesehen, als mein Vater zwei glänzende Münzen in die ausgestreckte Hand des Doktors hatte gleiten lassen. Wenn er die anderen vier nicht vertrunken und verspielt hätte, hätte es vielleicht zum Leben gereicht.
Mir machte es nichts aus, zu den Häusern von Fremden zu gehen und sie nach dem Geld zu fragen. Nicht ich fragte danach, sondern Mirjem, und es war ihr Geld. Etwas davon würde sie mir geben. Wenn ich auf den Eingangsstufen stand, konnte ich in die Häuser hineinblicken und sah hübsche Möbel und warme Feuer. Bei diesen Leuten zu Hause hustete niemand. »Ich bin hier im Auftrag der Geldverleiherin«, begann ich, und dann sagte ich ihnen, wie viel sie ihr schuldeten. Wenn sie versuchten, mich zu überzeugen, dass die Summe falsch sei, antwortete ich nicht. In einigen Häusern wurde mir gesagt, dass man nicht bezahlen könne, und ich erwiderte dann, dass die Bewohner im Haus der Geldverleiherin vorsprechen müssten, wenn sie vermeiden wollten, dass sie die Sache gerichtlich klären lassen würde. Schließlich gaben sie mir doch etwas, was bedeutete, dass sie gelogen hatten. Dann machte mir meine Arbeit noch weniger aus.
Ich trug einen großen, robusten Korb mit mir herum, und da legte ich alles hinein, was man mir gab. Mirjem machte sich Sorgen, dass ich vergessen könnte, was von wem stammte, aber ich vergaß nichts. Ich erinnerte mich an jede Münze und all die unterschiedlichen Güter. Mirjem schrieb alles in ihr großes schwarzes Buch und die dicke Gänsefeder kratzte unablässig und sicher über die Seiten. An Markttagen sortierte Mirjem alle Waren aus, die sie nicht behalten wollte, und ich folgte ihr mit dem Korb ins Dorf. Sie verkaufte und handelte, bis der Korb leer und die Börse, die sie bei sich trug, gut gefüllt war. Auf diese Weise hatte sie Stoff und Früchte und Knöpfe in Münzen verwandelt. Manchmal ging sie noch einen Schritt weiter: Wenn ihr ein Bauer zehn Bündel Wolle gegeben hatte, dann brachte sie sie zu einem Weber, der in ihrer Schuld stand, und ließ ihn anstelle einer Rückzahlung daraus einen Umhang anfertigen, den sie dann auf dem Markt verkaufte.
Und am Ende des Tages schüttete sie ein Meer voller Pfennige auf den Boden und rollte sie in Papier ein, um sie gegen Silbermünzen einzutauschen. Eine Rolle Pfennige von der Länge meines Ringfingers war genauso viel wert wie eine Kopeke. Das wusste ich, weil sie beim nächsten Mal ganz früh am Morgen diese Rolle mit zum Markt nahm und einen Händler fand, der von außerhalb angereist war und noch damit beschäftigt war, seinen Stand aufzubauen. Ihm gab sie die Rolle, er öffnete sie, zählte die Pfennige und gab ihr im Gegenzug eine silberne Kopeke. Die Silbermünzen gab sie nicht auf dem Markt aus und wechselte sie auch nicht. Sie brachte sie nach Hause und wickelte sie wiederum in Papier ein und eine Rolle von der Länge meines kleinen Fingers entsprach einer Goldmünze. Die verstaute sie in der Lederbörse, die sie von ihrem Großvater bekommen hatte. Ich sah diese Börse niemals sonst, nur an den Markttagen, und dann lag sie schon auf dem Tisch, wenn ich kam, und sie lag noch immer dort, wenn ich nach meinem Tagewerk wieder nach Hause ging. Sie versteckte sie nicht, und ich konnte nicht sehen, wo sie sie herholte. Ihr Vater und ihre Mutter rührten sie niemals an.
Ich verstand nicht, wie sie einschätzen konnte, wie viele Münzen jede Sache jemand anderem wert sein würde, wo sie doch selbst keinerlei Interesse daran hatte, die Sachen zu behalten. Aber nach und nach lernte ich, die Zahlen zu lesen, die sie in ihr Buch schrieb, wenn sie den Wert von Waren anstelle von Rückzahlungen festlegte, und wenn ich die Preise mithörte, die sie auf dem Markt dafür verlangte, dann waren es beinahe jedes Mal dieselben Summen. Ich wollte verstehen, wie sie das schaffte. Aber ich fragte nicht. Ich wusste, dass sie über mich wie über ein Pferd oder einen Ochsen dachte – Tiere, die etwas beschränkt und schweigsam und stark waren. Und so fühlte ich mich auch, wenn ich bei ihr und ihrer Familie war.
Mir kam es so vor, als ob sie den ganzen Tag sprachen: Sie redeten oder sangen oder stritten sich sogar. Aber sie schrien sich nie an, und niemals wurde jemand geschlagen. Sie berührten sich ständig gegenseitig. Ihre Mutter legte ihr eine Hand auf die Wange, oder ihr Vater küsste sie auf den Kopf, wann immer sie nahe an ihnen vorbeiging. Manchmal, wenn ich abends ihr Haus verlassen hatte, die Straße hinuntergegangen und in die Felder eingebogen war, wo ich mich außer Sichtweite befand, legte ich mir meine eigene Hand auf den Hinterkopf – meine Hand, die groß und schwer und stark geworden war, und ich versuchte mich daran zu erinnern, wie sich die Hand meiner Mutter angefühlt hatte.
In meinem Zuhause gab es nur beharrliches Schweigen. Den ganzen Winter über waren wir ständig etwas hungrig gewesen, sogar ich, die ich ja täglich eine zusätzliche Mahlzeit bekam. Aber dafür musste ich auch einen Marsch von sechs Meilen bewältigen. Jetzt war der Frühling da, aber wir hungerten immer noch alle. Auf dem Heimweg sammelte ich Pilze, und wenn ich Glück hatte, fand ich auch eine wilde Rübe, oder ich entdeckte irgendetwas anderes Essbares. Es gab nicht viel. Das meiste war für uns ungenießbar und ging an die Ziegen. In unserem Garten grub ich ein paar der neuen Kartoffeln aus, die eigentlich noch zu klein waren, als dass es sich lohnte, sie aufzubrauchen, aber wir würden sie trotzdem essen. Ein winziges Stückchen rings um ein Auge würde ich herausschneiden und es wieder vergraben. Ich ging ins Haus und stocherte im Holz unter dem Topf mit unserem Kohl, den ich am Morgen aufgehängt hatte. Die kümmerlichen Kartoffeln warf ich mit den übrigen Fundstücken in den Topf. Beim Essen saßen wir mit gesenkten Köpfen rings um den Tisch und verloren nie ein Wort.
Nichts gedieh gut. Der Boden blieb noch bis in den April hinein hart gefroren und eisig und die Gerste wuchs nur zögerlich. Als Pa endlich Bohnen pflanzen konnte, schneite es nur eine Woche später erneut, sodass die Hälfte der Pflanzen einging. Als ich an diesem Morgen aufwachte, dachte ich, es sei noch mitten in der Nacht. Draußen war es grau in grau und dichter Schnee fiel. Wir konnten nicht einmal den Zaun unseres Nachbarn erkennen. Pa fluchte wie von Sinnen und jagte uns aus dem Bett. Wir alle stürzten aus dem Haus, um die fünf jungen Ziegen hereinzuholen. Eine von ihnen war bereits tot, die anderen brachten wir mitsamt ihren Müttern ins Haus. Sie meckerten und knabberten unsere Decken an und fielen beinahe ins Feuer, aber sie blieben am Leben. Als es aufgehört hatte zu schneien, zerlegten wir das tote Tier und pökelten das bisschen Fleisch, das dran war. Ich kochte eine Suppe aus den Knochen und wir aßen die Leber und die Lunge. Zumindest einen Tag lang hungerten wir nicht.
Sergej hätte die dreifache Menge seines Anteils essen können. Er wurde langsam groß. Ich glaube, manchmal ging er auf die Jagd, obwohl er wusste, dass man ihn für Wilderei hängen konnte oder dass ihm noch Schlimmeres drohte, wenn er sich Tiere aus dem Wald holte. Die einzigen Tiere, die wir im Wald erlegen durften, waren die gezeichneten, jene, die irgendwo schwarze oder braune Flecken hatten. Aber es waren so gut wie nie welche davon übrig, und die weißen – die reinweißen – gehörten den Staryk. Ich wusste nicht, was sie jemandem antun würden, der ihre Tiere jagte, denn das wagte niemand, aber ich wusste, dass es etwas Furchtbares sein würde. Man konnte den Staryk nichts wegnehmen, das ihnen gehörte. Sie kamen und stahlen von den Leuten, doch es gefiel ihnen gar nicht, wenn jemand ihnen etwas wegnahm.
Aber manchmal kam Sergej herein und aß, ohne den Kopf zu heben und ohne eine Pause zu machen, seinen ganzen Anteil auf, genauso, wie ich es mit meinem tat. Es war, als habe er ein schlechtes Gewissen, weil er mehr als die anderen am Tisch gegessen hatte. Und so kam ich zu dem Schluss, dass er irgendwo jagte, wo niemand es bemerkte. Ich sagte ihm nicht, dass er das bleiben lassen sollte: Das wusste er selbst. Und außerdem war es bei mir zu Hause nicht wie im Heim der Geldverleiherin. Das Wort Liebe gab es hier nicht. Es war mit meiner Mutter begraben worden. Sergej und Stepon waren nur weitere Babys gewesen, die meine Mutter krank gemacht hatten. Sie waren zwar nicht gestorben, aber so hatten sie ihr nur noch mehr Arbeit gemacht. Und die bürdeten sie nun mir auf. Sie bekamen etwas vom Essen ab und ich musste die Wolle der Ziegen spinnen und stricken und ihre Kleidung waschen. Deshalb machte ich mir nicht zu viele Gedanken darüber, was geschehen würde, wenn die Staryk Sergej etwas antun würden. Ich dachte darüber nach, ob ich ihn bitten sollte, mir die Knochen mitzubringen, damit ich daraus eine Suppe kochen konnte, aber dann wieder befürchtete ich, dass wir alle in Schwierigkeiten geraten könnten, wenn jeder von uns davon aß. Ein paar abgebrochene Knochen, die er schon abgenagt und ausgesaugt hatte, wären die Sache nicht wert.