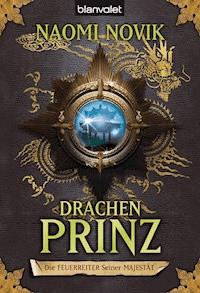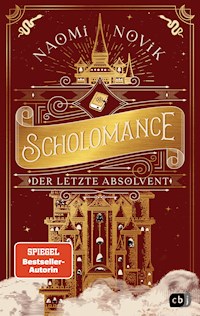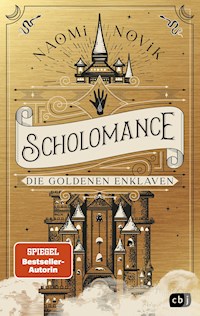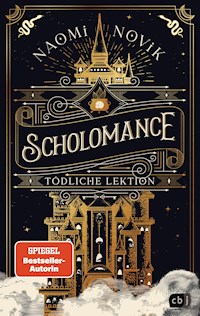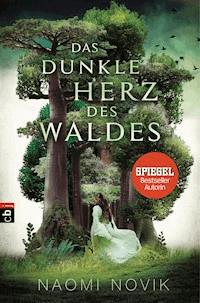8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Feuerreiter-Serie
- Sprache: Deutsch
Die dritte Folge des großartigen „All-Age“-Abenteuers!
Captain Will Laurence und sein Drache Temeraire werden ins ottomanische Imperium abkommandiert. In Istanbul warten drei Dracheneier auf sie, die die beiden Gefährten sicher und vor dem Ausschlüpfen nach Britannien bringen müssen – doch das bedeutet, sich erneut mit dem Drachenweibchen Lien anzulegen, das Temeraire die Schuld am Tode seines Herrn gibt und geschworen hat, sich blutig zu rächen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 617
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
DIE AUTORIN
Naomi Novik wurde 1973 in New York geboren und ist mit polnischen Märchen, den Geschichten um die Baba Yaga und J. R. R. Tolkien aufgewachsen. Sie hat englische Literatur studiert, im Bereich IT-Wissenschaften gearbeitet und war außerdem an der Entwicklung von äußerst erfolgreichen Computerspielen beteiligt. Doch dann schrieb Naomi Novik ihren Debüt-Roman, mit dem sie sofort die Herzen von Kritikern und Lesern gleichermaßen eroberte: »Drachenbrut«, den ersten Band um DIE FEUERREITER SEINER MAJESTÄT. Naomi Novik lebt mit ihrem Mann und sechs Computern in New York.
Von Naomi Novik ist bei cbt erschienen:
DIE FEUERREITER SEINER MAJESTÄT –
Drachenbrut
DIE FEUERREITER SEINER MAJESTÄT –
Drachenprinz
Inhaltsverzeichnis
Für meine Mutter –
als kleiner Dank für viele bajki cudowne
Prolog
Nicht einmal dann, wenn er nachts in die Gärten hinausschaute, konnte Laurence sich einbilden, wieder daheim zu sein, denn zu viele Lampions blitzten durch die Bäume hindurch. Rot und golden hingen sie unter den nach oben weisenden Ecken der Dächer, und auch das Gelächter hinter ihm hatte den Klang eines fremden Landes … Nur eine einzige Saite war auf das Instrument des Musikers gespannt, der darauf ein zitterndes, zartes Lied hervorbrachte. Wie ein Faden wob sich diese Melodie durch die Unterhaltungen, die selbst nichts anderes als Musik waren. Laurence war der Sprache noch immer kaum mächtig, und schnell verloren die Worte jegliche Bedeutung, wenn sich so viele Stimmen überlagerten. Er konnte nur lächeln, wenn ihn jemand ansprach, sein Unverständnis hinter einer Tasse mit blassgrünem Tee verstecken und sich bei erstbester Gelegenheit hinter eine Ecke der Terrasse davonstehlen. Kaum war er außer Sichtweite, stellte er seine nur halb geleerte Tasse auf einem Fenstersims ab. Für ihn schmeckte dieser Tee wie parfümiertes Wasser, und sehnsüchtig dachte er an starken, schwarzen Tee mit viel Milch oder, noch besser, an Kaffee. Seit zwei Monaten schon hatte er keinen Kaffee mehr getrunken.
Der Pavillon erlaubte eine freie Sicht auf den Mond und war auf einem kleinen Felsen errichtet worden, der aus dem Berghang hervorsprang und hoch genug war, um einen bezaubernden Blick über die Weiten der kaiserlichen Gärten zu ermöglichen, die sich unter ihm erstreckten. Es war eine seltsame Zwischenhöhe: weder so nahe am Boden wie ein gewöhnlicher Balkon noch so weit oben wie Temeraires Rücken, von dem aus Bäume zu Streichhölzern wurden und die großen Pavillons wie Spielzeuge aussahen. Laurence trat unter der Traufe hervor ans Geländer. Die Luft war angenehm kühl nach dem Regen, und die Feuchtigkeit machte Laurence nichts aus, denn der Nebel auf seinem Gesicht war ihm willkommen und durch die Jahre auf See weitaus vertrauter als der Rest seiner Umgebung. Angenehmerweise hatte der Wind die letzten hartnäckigen Gewitterwolken vertrieben. Nun wand sich der dampfende Nebel träge über die alten, sanft abgerundeten Steine auf den Wegen, und sie glänzten glatt und grau unter einem Dreiviertelmond. Die Brise war erfüllt vom Duft überreifer Aprikosen, die von den Bäumen gefallen und auf dem Kopfsteinpflaster zerplatzt waren.
Und noch ein Licht flackerte zwischen den gebeugten, uralten Bäumen hindurch. Es war ein schwaches, weißes Glänzen zwischen den Zweigen – mal gut zu erkennen, dann wieder verborgen –, das sich geradewegs auf das Ufer des nahe gelegenen, kunstvoll angelegten Teiches zubewegte und vom Klang gedämpfter Schritte begleitet wurde. Zunächst konnte Laurence nicht viel sehen, doch rasch löste sich eine seltsame kleine Prozession aus der Dunkelheit: Eine Handvoll Diener trat aus dem Schatten der Bäume, niedergedrückt vom Gewicht einer schlichten, hölzernen Bahre, auf der ein verhüllter Körper lag. Hinter ihnen her trotteten zwei junge Knaben, die Schaufeln trugen und immer wieder angsterfüllte Blicke über die Schultern warfen.
Laurence starrte die Menge verwundert an. Dann erschauderten die Baumwipfel und gaben den Blick auf Lien frei, die sich auf die Lichtung schob und hinter den Dienern haltmachte. Ihr Kopf über der breiten Halskrause war tief gesenkt, und ihre Flügel lagen eng am Körper an. Die schlanken Bäume hatten sich gebogen oder waren umgeknickt, als sie sich ihren Weg gebahnt hatte, und lange Zweige voller Weidenblätter hatten sich über ihre Schultern gelegt. Sie waren der einzige Schmuck des Drachen. All ihren sonstigen kunstvollen Rubin- und Goldschmuck hatte Lien abgelegt. Nun, da keine Edelsteine das durchscheinende Weiß ihrer gänzlich farblosen Haut belebten, sah sie blass und merkwürdig verletzlich aus; in der Dunkelheit wirkten ihre scharlachroten Augen schwarz und hohl.
Die Diener setzten ihre Last ab, um am Fuße einer alten, majestätischen Weide ein Loch zu graben. Hin und wieder stießen sie tiefe Seufzer aus, während sie die weiche Erde abtrugen. Im Laufe ihrer Arbeit begannen sie zu schwitzen, und schon bald zeichneten sich auf ihren bleichen, runden Gesichtern schwarze Streifen ab. Langsam schritt Lien die Baumreihen der Lichtung entlang, bückte sich, um kleinere Schösslinge auszureißen, die am Saum Wurzeln geschlagen hatten, und warf die gerade gewachsenen, jungen Bäume auf einen Haufen. Keine anderen Trauernden waren anwesend, abgesehen von einem Mann in dunklem, blauem Umhang, der hinter Lien herlief. Etwas an ihm und seinem Gang war vertraut, doch Laurence konnte sein Gesicht nicht erkennen. Der Mann blieb an einer Seite des Grabes stehen und sah schweigend zu, wie die Diener gruben. Es gab keine Blumen und auch keine lange Begräbnisprozession, wie sie Laurence zuvor auf den Straßen von Peking zu sehen bekommen hatte, wo Familien an ihrer Kleidung gerissen und kahl rasierte Mönche aus geschwenkten Gefäßen Wolken von Räucherwerk verbreitet hatten. Diese seltsame nächtliche Aktion hätte auch ein Armenbegräbnis sein können, wären da nicht im Hintergrund die goldbedachten, kaiserlichen Pavillons, halb verborgen von den Bäumen, und Lien gewesen, die über dem geschäftigen Treiben in der Grube aufragte wie ein riesiger, entsetzlicher, milchigweißer Geist.
Die Diener ließen den Körper verhüllt, als sie ihn in die Erde legten, denn schließlich war bereits mehr als eine Woche seit Yongxings Tod vergangen.
Nein, dieses Begräbnis schien eines kaiserlichen Prinzen nicht würdig zu sein, auch wenn er einen Mordanschlag geplant hatte und den Thron seines Bruders hatte an sich reißen wollen. Laurence fragte sich, ob die Beisetzung zunächst verboten worden war oder vielleicht selbst jetzt noch heimlich stattfand. Der kleine, in Tücher gewickelte Körper entschwand seinem Blick, und ein dumpfer Aufprall folgte. Lien schrie einmal, beinahe unhörbar, auf. Dieser Laut kroch Laurence unangenehm über den Nacken und verhallte zwischen den rauschenden Bäumen. Laurence fühlte sich mit einem Schlag wie ein Eindringling, obwohl er vermutlich vor dem hellen Glanz der Lampions, die hinter ihm hingen, gar nicht zu sehen war. Es würde wohl für mehr Unruhe sorgen, wenn er jetzt noch davonginge.
Die Diener hatten bereits damit begonnen, das Grab zuzuschütten. Weit ausholend beförderten sie die aufgetürmte Erde schwungvoll in das Loch und kamen rasch mit ihrer Arbeit voran. Schon bald war der Boden unter ihren Schaufeln wieder glatt geklopft, und nichts verriet das Grab außer dem frischen, unbewachsenen Erdfleck. Die niedrig hängende Weide mit ihren langen, wehenden Zweigen verbarg diesen Ort. Die beiden Jungen klaubten zwischen den Bäumen alte, verrottete Blätter und Nadeln zusammen, die sie über das Grab verteilten, bis es sich endgültig nicht mehr vom Erdboden ringsum unterschied und sich jedem Blick entzog. Als sie auch damit fertig waren, traten sie unsicher einen Schritt zurück: Ohne dass irgendjemand dem Ganzen einen angemessen feierlichen Rahmen verlieh, wussten sie nun nicht mehr weiter. Lien gab ihnen kein Zeichen. Sie hatte sich flach auf den Boden gelegt und war ganz in sich versunken. Endlich schulterten die Diener die Spaten, machten einen möglichst weiten Bogen um den weißen Drachen, um zwischen den Bäumen zu verschwinden, und überließen Lien somit sich selbst.
Der Mann mit dem blauen Umhang trat an das Grab und schlug vor seiner Brust ein Kreuz. Als er sich wieder umdrehte, wurde sein Gesicht vom Mond beschienen, und nun erkannte Laurence ihn. Es war De Guignes, der französische Botschafter – ganz sicherlich der letzte Trauernde, den Laurence hier erwartet hätte. Yongxings gewalttätige Ablehnung jeglichen Einflusses aus dem Westen hatte keine Günstlinge gekannt und keinerlei Unterschied zwischen Franzosen, Engländern und Portugiesen gemacht. Zu Lebzeiten wäre De Guignes niemals zum Vertrauten des Prinzen geworden, und es wäre undenkbar gewesen, dass Lien seine Gesellschaft geduldet hätte. Und doch waren dies seine ganz und gar französischen, aristokratischen Züge; seine Anwesenheit war gleichermaßen unbestreitbar wie unerklärlich. De Guignes blieb noch einige Augenblicke auf der Lichtung und sprach mit Lien. Auf diese Entfernung konnte Laurence nichts verstehen, doch seiner Haltung nach handelte es sich um eine Frage. Der Drache gab ihm keine Antwort. Lien machte überhaupt kein Geräusch, sondern verharrte weiter auf den Boden hingekauert und hielt den Blick unbeirrt auf das verborgene Grab gerichtet, als wollte sie sich diesen Ort ins Gedächtnis brennen. Einen Moment später verbeugte sich der Franzose und verließ sie.
Reglos blieb sie am Grab liegen, und ihre Haut wirkte streifig von den dahineilenden Wolken und den länger werdenden Schatten der Bäume. Obgleich Laurence den Tod des Prinzen nicht bereute, regte sich doch Mitleid in ihm. Er konnte sich nicht vorstellen, dass nun noch irgendjemand Lien als Gefährtin wählen würde. Lange Zeit beobachtete er sie, an das Geländer gelehnt, bis der Mond schließlich so weit gesunken war, dass sie vor seinen Blicken verborgen war. Um die Ecke der Terrasse schwappte eine neue Welle von Gelächter und Applaus: Die Musik hatte endlich geendet.
Teil eins
1
Träge blies der heiße Wind über Macao. Er erfrischte nicht, sondern rührte nur den faulig salzigen Geruch des Hafens nach totem Fisch und den großen Haufen schwarzroten Seetangs und den Gestank der Abfälle von Menschen und Drachen ein wenig auf. Trotzdem saßen die Matrosen dicht gedrängt und aneinandergelehnt entlang der Reling der Allegiance und versuchten, wenigstens einen winzigen Hauch frische Luft zu erhaschen. Ab und zu brach eine kleine Rangelei aus, verbissene Stöße in die eine und andere Richtung wurden ausgetauscht, doch in der gnadenlosen Hitze erstarben diese Streitigkeiten fast so schnell wieder, wie sie entstanden waren.
Temeraire lag auf dem Drachendeck und starrte in Richtung des Dunstes über dem Ozean, während die wachhabenden Flieger in seinem Schatten dösten. Da Laurence in der Krümmung von Temeraires Vorderbein saß, wo er vor allen Blicken verborgen war, hatte selbst er ein Zugeständnis an die Hitze gemacht und seine Jacke ausgezogen.
Nicht zum ersten Mal im Laufe dieser Woche sagte Temeraire: »Ich bin sicher, dass ich das Schiff aus dem Hafen ziehen könnte«, akzeptierte aber mit einem Seufzer, dass sein gut gemeinter Plan erneut abgelehnt wurde. Zwar wäre er in einer Flaute wohl tatsächlich in der Lage gewesen, selbst den enormen Drachentransporter hinter sich herzuziehen, angesichts des direkten Gegenwindes würde er sich jedoch nur sinnlos verausgaben.
»Auch bei Flaute könntest du die Allegiance nicht über eine größere Distanz schleppen«, fügte Laurence zum Trost hinzu. »Natürlich können einige Meilen auf dem offenen Ozean bereits von Nutzen sein, aber im Augenblick können wir genauso gut im Hafen bleiben, wo wir es wenigstens ein bisschen einfacher haben. Selbst wenn wir das Schiff hinausbekämen, würden wir kaum Fahrt aufnehmen.«
»Es ist eine Schande, dass wir immer auf den Wind warten müssen, wo doch alles vorbereitet ist und wir jederzeit aufbrechen könnten«, maulte Temeraire weiter. »Ich wäre gerne so schnell wie möglich zu Hause. Es gibt schließlich viel zu tun.« Zur Bekräftigung schlug sein Schwanz mit einem hohlen Geräusch auf die Bretter.
»Hoffentlich erwartest du nicht zu viel«, versuchte Laurence ihn zu beschwichtigen, doch er glaubte selber nicht, damit großen Erfolg zu erzielen. Schon früher hatte es wenig gebracht, Temeraire zur Zurückhaltung zu drängen, deshalb erwartete er auch jetzt kein anderes Ergebnis. »Du musst immer damit rechnen, dass alles seine Zeit braucht. Zu Hause gilt das genauso wie hier.«
»Oh! Ich verspreche, ich werde geduldig sein«, erklärte Temeraire. Sofort machte er jedoch Laurence’ Hoffnung, sich auf dieses Versprechen verlassen zu können, zunichte, indem er hinzufügte, ohne sich eines Widerspruchs bewusst zu sein: »Trotzdem bin ich sicher, dass die Admiralität sehr schnell erkennen wird, wie wichtig unser Anliegen für die Gerechtigkeit ist. Es ist doch nur angemessen, dass auch die Drachen entlohnt werden, wenn unsere Mannschaft ebenfalls eine Bezahlung erhält.«
Laurence, der seit seinem zwölften Lebensjahr zur See gefahren war, bevor ihn eine Laune des Schicksals zum Kapitän eines Drachen statt eines Schiffes gemacht hatte, hatte die ehrenwerten Gentlemen der Admiralität ausgiebig kennenlernen können. Sie waren für die Marine und das Luftkorps zuständig, und ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn gehörte kaum zu ihren herausragenden Eigenschaften. Vielmehr schienen sie in ihrem Amt jeden menschlichen Sinn für Anstand und andere wichtige Qualitäten verloren zu haben: Beinahe alle miteinander waren sie Kriecher, Pfennigfuchser und politische Wendehälse. Die weitaus besseren Lebensbedingungen der Drachen hier in China hatten Laurence gegen seinen Willen die Augen gegenüber den Missständen ihrer Behandlung im Westen geöffnet. Er ging jedoch nicht davon aus, dass die Admiralität diese Einschätzung teilen würde, sobald es auch nur einen Penny kostete.
Auf jeden Fall hoffte Laurence insgeheim, dass Temeraire, wenn er schon nicht ganz davon lassen konnte, doch wenigstens etwas bescheidenere Ziele verfolgen würde, sobald sie wieder auf ihrem Posten im Kanal mit dem ehrlichen Geschäft der Heimatverteidigung beschäftigt wären. Im Prinzip hatte Laurence zwar nichts gegen Temeraires Vorhaben einzuwenden, das nur natürlich und gerecht war. Aber England befand sich im Krieg, und anders als Temeraire war Laurence sich bewusst, wie unklug es unter diesen Umständen wäre, solche Zugeständnisse von der eigenen Regierung zu fordern. Höchstwahrscheinlich würde man es als Meuterei auffassen. Er hatte seine Unterstützung jedoch zugesagt und würde nun keinen Rückzieher machen. Immerhin hätte Temeraire auch hier in China bleiben können, um den Wohlstand und die Freiheiten zu genießen, die ihm als Himmelsdrache von Geburt her zustanden. Zwar kehrte er hauptsächlich Laurence zuliebe nach England zurück, doch auch die Hoffnung darauf, die Lebensbedingungen seiner Kameraden zu verbessern, hatte eine Rolle gespielt. Trotz aller Vorbehalte konnte Laurence kaum einen berechtigten Einwand anbringen, obwohl er sich manchmal unehrlich fühlte, wenn er zu Temeraires hochtrabenden Plänen schwieg.
»Dein Vorschlag, bei der Bezahlung anzusetzen, war sehr klug«, fuhr Temeraire fort und belastete Laurence’ Gewissen nur noch mehr. Er hatte diesen Punkt vor allem vorgeschlagen, weil es eine weniger radikale Veränderung bedeutete als viele Ideen, die Temeraire sonst noch hegte. Dazu gehörten beispielsweise die vollständige Zerstörung einiger Stadtviertel Londons, um Raum für Durchgangsstraßen zu schaffen, die Drachen genügend Platz böten, oder die Entsendung von Vertretern der Drachen ins Parlament, was abgesehen von der Schwierigkeit, diese überhaupt in das Gebäude zu bringen, mit Sicherheit auch zur sofortigen Flucht aller menschlichen Mitglieder geführt hätte. »Sobald wir eine Bezahlung eingeführt haben, wird ohne Zweifel alles andere leichter. Ab dann können wir den Leuten für alle Dinge dieses Geld anbieten, das sie so sehr mögen. Genau wie du es bei den Köchen gemacht hast, als du sie für mich angestellt hast. Das ist aber ein angenehmer Duft«, fügte er wenig zutreffend hinzu: Der intensive, rauchige Geruch verkohlten Fleisches wurde gerade so stark, dass er selbst den Gestank des Hafens überlagerte.
Laurence verzog das Gesicht und sah nach unten. Die Kombüse befand sich direkt unter dem Drachendeck, und dünne Rauchschwaden stiegen zwischen den Planken des Decks empor. »Dyer«, rief er und winkte einem seiner Burschen, »schauen Sie mal nach, was dort unten vor sich geht.«
Temeraire hatte eine Vorliebe für die chinesische Art der Drachenküche entwickelt. Weil der englische Quartiermeister, von dem sonst nur erwartet wurde, für frisch geschlachtetes Vieh zu sorgen, nicht in der Lage war, ihn zufriedenzustellen, hatte Laurence zwei chinesische Köche ausfindig gemacht, die für die Aussicht auf eine beträchtliche Entlohnung bereit waren, ihr Land zu verlassen. Die neuen Köche sprachen kein Englisch, es mangelte ihnen jedoch nicht an Selbstbewusstsein. Aus beruflichem Neid hatten sie dem Schiffskoch und seinen Gehilfen bereits beinahe den offenen Kampf um die Kombüsenöfen erklärt, und es hatte sich eine gewisse Atmosphäre des Wettbewerbs entwickelt.
Dyer trottete die Stufen zum Achterdeck hinunter und öffnete die Tür zur Kombüse. Sofort quoll eine gewaltige Rauchwolke hervor. »Feuer!«, schrien die Ausgucke in der Takelage, und der wachhabende Offizier begann, hektisch und unter Klirren und Kratzen des Klöppels, die Glocke zu läuten. Laurence rief: »Auf die Stationen!«, und schickte seine Männer zu ihren Feuermannschaften.
Alle Lethargie war verschwunden. Die Matrosen rannten zu den Eimern und Kübeln, ein paar mutige Kameraden sprangen in die Kombüse. Als sie wieder herauskamen, zogen sie schlaffe Körper hinter sich her: die Gehilfen des Kochs, die beiden Chinesen und einen der Schiffsjungen. Vom Schiffskoch selbst fehlte jede Spur. Wasser schwappte aus den Eimern, die jetzt in beständigem Strom weitergereicht wurden. Der Bootsmann brüllte und schlug gleichmäßig mit seinem Stock gegen den Hauptmast, um den Rhythmus vorzugeben, und ein Eimer nach dem anderen wurde durch die Kombüsentüren entleert. Aber der Rauch quoll weiter hervor, dichter nun, durch jede Ritze und jede Spalte des Decks. Die Poller des Drachendecks waren inzwischen sengend heiß geworden, und das Seil, das über zwei der eisernen Pfosten gelegt war, begann zu qualmen.
Geistesgegenwärtig hatte der junge Digby bereits die anderen Fähnriche zusammengetrommelt. Gemeinsam machten sich die Jungen daran, die Taue einzuholen. Verbissen schluckten sie ihren Schmerz hinunter, wenn sie sich die Hände an dem glühenden Eisen verbrannten. An der Reling aufgereiht, warfen die restlichen Flieger Eimer über die Seite und hievten Wasser herauf, um damit das Drachendeck zu begießen. Dampf stieg in weißen Wolken empor und hinterließ eine graue Salzkruste auf den Planken, die sich bereits verzogen. Das Deck ächzte. In langen, schwarzen Streifen floss der geschmolzene Teer aus den Zwischenräumen über die Deckoberfläche; er schwelte und verströmte einen ätzenden, süßlich riechenden Qualm, der in den Atemwegen stach. Temeraire stand inzwischen auf allen vieren und tigerte hin und her, um der Hitze zu entgehen, und das, obwohl Laurence ihn schon gesehen hatte, wie er zufrieden auf Steinen lag, die von der prallen Mittagssonne ofenheiß waren.
Kapitän Riley befand sich mitten unter den schwitzenden, arbeitenden Männern und feuerte sie an, während die Eimer vor- und zurückgereicht wurden. Doch ein Hauch von Verzweiflung lag in seiner Stimme. Das Feuer war zu heiß. Durch den langen Aufenthalt im Hafen war das Schiffsholz in der Gluthitze ausgetrocknet. Die riesigen Lagerräume waren mit Gütern für die Rückreise angefüllt: zerbrechlichem Porzellan, verpackt in trockenem Stroh, Ballen von Seide und frisch gewirktem Segeltuch für Reparaturen. Wenn sich das Feuer durch die vier Decks einen Weg nach unten suchte, würden die Bestände schnell lichterloh in Flammen stehen. Dann brauchte das Feuer nur den Weg bis zum Pulvermagazin zu finden, um das Schiff gänzlich zu zerstören.
Auf einmal tauchte hustend die Morgenwache auf. Die Männer hatten unten geschlafen und waren nur mit Mühe heraufgelangt. Jetzt brachten sie in ihrer Panik die Linien der Wasserträger durcheinander, als sie wild nach Luft schnappend an Deck stürzten. Obwohl die Allegiance ein wahrer Koloss war, konnten Achter- und Vorderdeck nicht die gesamte Mannschaft aufnehmen, jedenfalls nicht, solange das Drachendeck beinahe vollständig in Flammen stand. Laurence griff nach einem Stag und zog sich auf die Reling des Decks, um seine Mannschaft in der wogenden Menge auszumachen. Die meisten waren bereits draußen auf dem Drachendeck gewesen, aber eine Handvoll blieb weiter verschwunden: Therrowes, dessen Bein nach der Schlacht in Peking noch immer geschient war; Keynes, der Arzt, der wahrscheinlich in der Abgeschiedenheit seiner Kabine über seinen Büchern saß, und auch von seinem anderen Burschen, Emily Roland, fehlte jede Spur. Noch keine elf Jahre alt, war es wenig wahrscheinlich, dass sie sich einen Weg durch die Männer hatte bahnen können, die keuchend um ihr Leben kämpften.
Ein dünnes, schrilles Kesselpfeifen drang aus den Ofenrohren der Kombüse. Langsam, wie welke Pflanzen, begannen die metallenen Abzugskappen auf das Deck hinabzusinken. Instinktiv verabscheute Temeraire dieses Geräusch und zischte zurück. Den Kopf hatte er bereits, so weit es ging, gereckt, seine Halskrause lag eng am Nacken an. Seine kräftigen Hinterbeine waren bereits zum Sprung angespannt, ein Vorderbein ruhte auf der Reling. »Laurence, ist es dort sicher genug für dich?«, rief er besorgt.
»Ja, es ist alles in Ordnung. Steig sofort in die Luft«, rief Laurence voller Sorge um Temeraires Sicherheit und winkte den Rest seiner Männer zum Vorderdeck, da die Planken bereits nachzugeben begannen. »Vielleicht werden wir besser an das Feuer herankommen, sobald es erst einmal durch das Deck gebrochen ist«, fügte er hinzu, hauptsächlich, um die Männer zu ermutigen, die ihn hören konnten. In Wirklichkeit konnte er sich kaum vorstellen, wie das Feuer noch unter Kontrolle zu bringen sein sollte, sobald das Drachendeck eingestürzt war.
»Sehr gut, dann werde ich mich mal nützlich machen«, sagte Temeraire und erhob sich in die Luft.
Weniger um die Rettung des Schiffes als um die ihres eigenen Lebens besorgt, hatte eine Handvoll Männer bereits damit begonnen, das Beiboot am Heck zu Wasser zu lassen. Sie hofften wohl, dort entkommen zu können, ohne von den Offizieren bemerkt zu werden, die mit dem verzweifelten Kampf gegen das Feuer beschäftigt waren. Als Temeraire unerwartet um das Schiff herumschoss und auf sie zukam, verschwanden sie jedoch voller Panik. Er kümmerte sich nicht um sie, sondern schnappte sich das Boot mit seinen Klauen, tauchte es wie eine Schale ins Meer und hob es wieder in die Luft, sodass Wasser überschwappte und Ruder herausfielen. Vorsichtig balancierte er es aus, flog zurück und schüttete es über dem Drachendeck aus. Zischend und spritzend ergoss sich die plötzliche Flut über die Planken und stürzte wie ein Wasserfall über die Treppen nach unten.
»Holen Sie Äxte!«, rief Laurence, so laut er konnte. Es war eine verzweifelte, heiße und schweißtreibende Arbeit. Die Äxte rutschten auf dem nassen, teergetränkten Holz weg, als sie auf die Planken einhackten, zwischen denen der Dampf emporstieg. Aus jedem Loch schlug ihnen Rauch entgegen. Jedes Mal wenn Temeraire sie erneut mit einer Sturzflut überschüttete, mussten alle darum kämpfen, auf den Beinen zu bleiben, aber nur der ständige Nachschub an Wasser erlaubte ihnen, mit ihrer Aufgabe fortzufahren; der Qualm wäre ansonsten viel zu dicht gewesen. Mitten in der Arbeit taumelten einige der Männer und stürzten regungslos auf das Deck. Es blieb nicht einmal Zeit, sie zum Achterdeck hinunterzubringen, zu wertvoll waren die Minuten. Laurence arbeitete Seite an Seite mit Pratt, seinem Rüstwart. Lange, dünne Rinnsale schwarzfleckigen Schweißes breiteten sich auf ihren Hemden aus, während sie die Äxte in unregelmäßigen Abständen schwangen. Dann krachten mit einem Mal die Planken wie Kanonenschüsse, als ein großer Teil des Drachendecks plötzlich nachgab und in das gierige, hungrige Tosen der Flammen hinabstürzte.
Für einen Moment schwankte Laurence am Rande des Lochs, dann zog ihn sein Erster Leutnant, Granby, fort. Sie stolperten nach hinten. Laurence war halb blind und wäre beinahe in Granbys Armen gefallen, sein Atem ging schnell und flach, die Augen brannten. Granby zog ihn die Stufen hinunter, dann trug eine weitere Ladung Wasser sie in einem Rutsch den Rest des Weges hinunter und spülte sie bis vor eine der zweiundvierzigpfündigen Karronaden auf dem Vorderdeck. Laurence gelang es gerade noch rechtzeitig, sich an der Reling hochzuziehen, bevor er sich über die Seite erbrach. Dabei war selbst der bittere Geschmack in seinem Mund weniger ätzend als der Gestank in seinen Haaren und seiner Kleidung.
Der Rest seiner Männer verließ das Drachendeck, und nun konnten die enormen Fluten ungehindert auf die Flammen hinunterstürzen. Temeraire hatte einen beständigen Rhythmus gefunden, und die Rauchwolken lichteten sich bereits. Schwarzes rußiges Wasser rann aus den Kombüsentüren auf das Achterdeck. Laurence fühlte sich merkwürdig schwindelig, und ihm war übel. Keuchend versuchte er, tief durchzuatmen, doch seine Lunge schien sich nicht füllen zu wollen. Heiser krächzte Riley Befehle durch das Sprachrohr, kaum laut genug, um das Zischen des Wasserdampfes zu übertönen. Dem Bootsmann versagte die Stimme vollends den Dienst, sodass er die Männer mit bloßen Händen in die Reihen zurückstieß und zu den Luken winkte. Schnell war eine Kette organisiert. Die Männer, die unten bewusstlos zusammengebrochen waren oder die man niedergetrampelt hatte, wurden hochgereicht. Erleichtert sah Laurence, dass Therrowes unter ihnen war. Temeraire schüttete noch ein weiteres Mal Wasser über die letzten Glutherde; dann steckte Rileys Steuermann Basson seinen Kopf durch die Hauptluke. Er keuchte und rief: »Es kommt kein Rauch mehr durch, Sir. Die Planken über dem Schlafdeck sind nur leicht erhitzt. Ich denke, die Allegiance hat es überstanden.«
Heiserer Jubel brandete auf. Langsam setzte auch Laurence’ Atmung wieder ein, obwohl er noch immer mit jedem Husten etwas Schwarzes ausspuckte. Mit Granbys Hilfe kam er wieder auf die Füße. Wie nach Kanonenfeuer lag ein Schleier aus Rauch schwer auf dem Deck, und als Laurence die Treppenstufen hinaufstieg, fand er an Stelle des Drachendecks eine klaffende Grube voller Holzkohle vor. Die Ränder der übrig gebliebenen Planken waren mürbe wie verbranntes Papier. Inmitten der Trümmer lag der Körper des bedauernswerten Schiffskochs wie ein Stück Zunder. Sein Schädel war schwarz verkohlt, die beiden Holzbeine zu Asche verbrannt, und nur traurige Stümpfe waren übrig geblieben, die an den Knien endeten.
Temeraire ließ das Beiboot wieder hinab, blieb eine Zeit lang unentschlossen in der Luft stehen und ließ sich dann neben dem Schiff ins Wasser fallen. Es gab keinen Platz mehr an Bord, auf dem er sich hätte niederlassen können. Er paddelte näher, packte die Reling mit seinen Klauen und reckte seinen großen Kopf, um neugierig über die Seite zu blicken. »Geht es dir gut, Laurence? Ist meine Mannschaft wohlauf?«
»Ja, ich hab jeden ausfindig gemacht«, sagte Granby stellvertretend und nickte Laurence zu. Emily kam zu ihnen herüber. Ihr sandfarbener Haarschopf war mit grauen Rußflecken besprenkelt. Sie schleppte einen großen Krug Wasser aus der Trinkwassertonne, dessen Inhalt schal schmeckte und nach dem Hafen stank, jedoch köstlicher als jeder Wein war.
Riley gesellte sich ebenfalls zu ihnen. »Was für ein Trümmerhaufen«, seufzte er, als er auf das Wrack hinuntersah. »Nun, immerhin haben wir das Schiff gerettet. Dem Himmel sei Dank. Aber ich mag gar nicht daran denken, wie lange es jetzt noch dauern wird, bis wir aufbrechen können.« Dankbar nahm er den Krug von Laurence entgegen und nahm einen tiefen Schluck, bevor er ihn an Granby weiterreichte. »Es tut mir verdammt leid, aber ich vermute außerdem, dass all Ihre Sachen daran glauben mussten«, fügte er hinzu und wischte sich über den Mund. Die Senioroffiziere der Flieger hatten ihre Quartiere in Richtung Bug, nur eine Ebene unter der Kombüse.
»Guter Gott«, sagte Laurence tonlos, »und ich habe nicht die geringste Ahnung, was mit meiner Jacke passiert ist.«
»Vier, ja, vier Tage«, erklärte der Schneider in bescheidenem Englisch. Er hielt die Finger empor, um sicherzugehen, dass man ihn nicht missverstand. Laurence seufzte und antwortete: »Ja, sehr gut.« Die Gewissheit, dass es keinen Grund zur Eile gab, war nur ein schwacher Trost. Es würde zwei Monate oder mehr dauern, das Schiff zu reparieren. Bis dahin konnten er und seine Männer sich an Land die Zeit vertreiben. »Können Sie die andere noch retten?«
Zusammen musterten sie die Jacke, die Laurence als Muster mitgebracht hatte: Sie war eher schwarz als flaschengrün, wies eine eigentümliche, weiße Ablagerung auf den Knöpfen auf und roch streng nach Rauch und Salzwasser. Zwar sagte der Schneider nicht rundheraus »Nein«, aber sein Ausdruck sprach Bände. »Aber ich habe da was für Sie«, erklärte er stattdessen und holte aus dem hinteren Teil seiner Werkstatt ein anderes Kleidungsstück. Es war allerdings keine Jacke, wie Laurence sie kannte, sondern eher eine jener gesteppten Jacken, wie die chinesischen Soldaten sie trugen. Sie war wie eine Tunika vorne offen und hatte einen kurzen Stehkragen.
»Oh, äh …« Laurence betrachtete sie unbehaglich. Da sie aus Seide gefertigt war, hatte sie einen wesentlich strahlenderen Grünton als seine Jacke. An den Nähten war sie reichlich mit Scharlachrot und Gold bestickt, aber immerhin war sie nicht ganz so reichlich verziert wie all die Festkleidung, die er bei früherer Gelegenheit getragen hatte.
Außerdem würden er und Granby mit den Beauftragten der Ostindien-Kompanie zu Abend essen, da konnte er sich nicht nur halb angezogen zeigen oder sich in dem schweren Mantel verstecken, den er übergeworfen hatte, um hierher zum Laden zu kommen. Schließlich war er sogar ganz froh über das chinesische Kleidungsstück. Als er nämlich in sein neues Quartier am Ufer zurückkehrte, berichteten ihm Dyer und Roland, dass sich in der ganzen Stadt keine anständige Jacke mehr auftreiben ließe, gleichgültig, zu welchem Preis. Das war wenig überraschend, da respektable Ehrenmänner nicht wie Flieger aussehen wollten und das dunkle Grün des feinen Wollstoffs ihrer Uniform keine beliebte Farbe in der westlichen Enklave war.
»Vielleicht begründen Sie damit eine neue Mode«, sagte Granby, halb belustigt, halb tröstend. Da er selbst ein schlanker Bursche war, trug er eine Jacke, die er einem unglückseligen Leutnant abgenommen hatte. Ihnen war der Ruin ihrer Garderobe erspart geblieben, da sich ihre Quartiere auf den unteren Decks befanden. Zwar ragten einige Zentimeter von Granbys Handgelenken aus den Jackenärmeln hervor, und wie immer waren seine blassen Wangen von einem Sonnenbrand gerötet, sodass er jünger als seine sechsundzwanzig Jahre wirkte, doch wenigstens würde ihn niemand scheel ansehen. Mit seinen deutlich breiteren Schultern konnte Laurence keinen der jüngeren Offiziere auf die gleiche Weise berauben. Riley hatte ihm freundlich angeboten, ihm eine blaue Jacke auszuleihen, aber Laurence wollte nicht den Eindruck erwecken, sich immer noch als Kapitän der Marine ausgeben zu wollen.
Er und seine Mannschaft waren jetzt in einem geräumigen Haus untergebracht, das direkt am Ufer lag. Es gehörte einem örtlichen Kaufmann aus den Niederlanden, der mehr als glücklich gewesen war, sie einziehen zu lassen, und seinen Haushalt in Wohnungen weiter im Stadtinneren verlagert hatte, wo kein Drache vor seiner Türschwelle lauerte. Seit der Zerstörung des Drachendecks war Temeraire gezwungen gewesen, am Strand zu schlafen. Ihm missfiel das mindestens so sehr wie den westlichen Anwohnern, denn die Küste war von kleinen, aufdringlichen Krabben bevölkert, die sich nicht davon abbringen ließen, in ihm einen neuen Felsen zu sehen, in denen sie ihre Bauten einrichteten. Während er schlief, versuchten sie immer wieder, sich in ihm zu vergraben.
Laurence und Granby hielten auf ihrem Weg zum Abendessen kurz an, um sich von ihm zu verabschieden. Zumindest Temeraire gefiel Laurence’ neues Kleidungsstück; er fand den Farbton hübsch und bewunderte besonders die goldenen Knöpfe und Nähte. »Sie passt auch gut zu dem Säbel«, fügte er hinzu, nachdem er Laurence dazu gebracht hatte, sich im Kreis zu drehen, damit er ihn von allen Seiten begutachten konnte. Der fragliche Säbel war ein Geschenk von ihm und damit in seinen Augen natürlich der wichtigste Teil des ganzen Ensembles. Davon abgesehen war es wirklich das einzige Stück, das Laurence nicht die Schamesröte ins Gesicht trieb. Gott sei Dank hatte er sein Hemd, das alles Schrubben der Welt nicht wieder hatte reinigen können, unter der Jacke versteckt; auch die Hosen würden keine eingehende Musterung überstehen. Und da sich seine Strümpfe ebenfalls nicht mehr sehen lassen konnten, hatte er auf die schweren Schaftstiefel zurückgegriffen.
Als sie gegangen waren, wandte sich Temeraire unter den wachsamen Augen einiger Offiziere und einer Abteilung von uniformierten Soldaten der privaten Streitmacht der Ostindien-Kompanie seinem eigenen Abendessen zu. Sir George Staunton hatte die Männer der Kompanie ausgeliehen. Sie sollten helfen, Temeraire nicht etwa vor einer Gefahr, sondern vor allzu aufdringlichen Bewunderern abzuschirmen. Anders als die Westler, die aus ihren Heimen nahe der Küste geflohen waren, ließen sich die Chinesen durch Drachen nicht beunruhigen. Von Kindesbeinen an waren sie es gewohnt, dass sie in ihrer Mitte lebten. Und da die wenigen Himmelsdrachen so selten das Kaiserliche Viertel verließen, galt es als Ehre und Aussicht auf eine glückliche Zukunft, einen von ihnen zu sehen oder besser noch zu berühren.
Staunton war es auch, der dieses Abendessen arrangiert hatte, um den Offizieren ein wenig Unterhaltung und eine Ablenkung von den Schrecken des Unglücks zu bieten. Natürlich war ihm nicht bewusst, in welch verzweifelte Lage er die Flieger wegen der Frage ihrer Garderobe bringen würde. Deshalb hatte Laurence die großzügige Einladung auch nicht aus einem derart trivialen Grund ablehnen wollen. Bis zuletzt hatte er gehofft, etwas Respektableres zum Anziehen zu finden. Nun war er darauf vorbereitet, während des Abendessens vom kläglichen Scheitern seiner Anstrengungen zu berichten und den heiteren Spott der Gesellschaft zu ertragen.
Zunächst stieß sein Eintreten auf höfliches, wenn auch verblüfftes Schweigen, doch kaum hatte er Sir George seine Aufwartung gemacht und hielt ein Glas Wein in der Hand, begann das Tuscheln. Einer der älteren Beauftragten, ein Herr, der gern vorgab, taub zu sein, sagte recht deutlich: »Flieger und ihre Anwandlungen. Wer weiß, was sie sich als Nächstes in den Kopf setzen!« Granbys Augen funkelten vor unterdrücktem Zorn. Eine akustische Besonderheit des Raumes ließ jedoch noch andere, weniger vorsätzlich unhöfliche Bemerkungen hörbar werden.
»Was, glauben Sie, hat das zu bedeuten?«, erkundigte sich Mr. Catham, ein Herr, der erst vor kurzem aus Indien angekommen war, während er Laurence interessiert vom nächsten Fenster her musterte. Er unterhielt sich gedämpft mit Mr. Grothing-Pyle, einem beleibten Mann. Dessen Interesse galt allerdings vor allem dem Ziffernblatt seiner Uhr und der Frage, wann man endlich zum Abendessen hineingehen würde.
»Hm? Oh, vielleicht gefällt es ihm. Er hat ja jetzt das Recht, sich wie ein orientalischer Prinz zu kleiden«, antwortete er nach einem unauffälligen Blick über seine Schulter mit einem Achselzucken. »Uns kann das doch egal sein, oder? Riechen Sie Wildbret? Ich habe seit einem Jahr kein Wild mehr gegessen.«
Gleichermaßen angewidert und beleidigt wandte Laurence sein Gesicht zum offenen Fenster. Eine solche Deutung wäre ihm nie eingefallen. Der Kaiser hatte ihn nur pro forma adoptiert. Auf diese Weise hatten die Chinesen ihr Gesicht wahren können, denn sie hatten darauf bestanden, dass kein Himmelsdrache der Gefährte eines Mannes sein konnte, der nicht wenigstens entfernt mit der kaiserlichen Familie verwandt war. Auf englischer Seite hatte man diese Lösung vor allem als schmerzlosen Weg gesehen, den Streit über die Eroberung von Temeraires Ei beizulegen. Schmerzlos für jeden, außer Laurence, der bereits einen stolzen und gebieterischen Vater besaß, dessen zorniger Reaktion auf die Adoption seines Sohnes er mit nicht geringem Unbehagen entgegensah. Natürlich hatte ihn diese Überlegung nicht aufgehalten: Bis auf Hochverrat hätte er sich leichten Herzens allem unterworfen, um nicht von Temeraire getrennt zu werden. Aber nachweislich hatte er sich eine derart seltsame Ehre weder gewünscht, noch hatte er danach gestrebt. Dass ihn diese Männer jetzt für einen albernen Emporkömmling hielten, der orientalische Titel mehr als seine eigene Abstammung schätzte, demütigte ihn zutiefst.
Die Scham ließ ihn in Schweigen verfallen. Gern hätte er die Hintergründe seines ungewöhnlichen Aufzugs in Form einer Anekdote preisgegeben, dafür entschuldigen würde er sich aber auf keinen Fall. Die wenigen Gesprächsangebote in seine Richtung erwiderte er nur knapp. Ohne es zu wissen, hatte ihn der Zorn erbleichen lassen, was seinem Gesicht einen kalten und abweisenden, ja fast gefährlichen Ausdruck verlieh, der die Gespräche in seiner Nähe ersterben ließ. Obwohl von Natur aus mit keinem dunklen Teint ausgestattet, hatten die vielen Jahre der Arbeit in der Sonne seinem Gesicht einen warmen, bronzefarbenen Ton verliehen. Die meisten Falten in seinem Gesicht stammten vom Lachen, und normalerweise hatte er eine freundliche Ausstrahlung, was den Kontrast zu seiner momentanen Wirkung nur noch vergrößerte. Diese Männer schuldeten zumindest ihren Reichtum, wenn nicht gar ihr Leben, dem Erfolg der diplomatischen Mission in Peking. Ein Fehlschlag hätte offenen Krieg bedeutet und ein Ende des Handels mit China. Laurence hatte sein eigenes Blut und das Leben eines seiner Männer dafür gelassen. Er hatte nicht erwartet, mit Dank überschüttet zu werden, hätte ihn sogar zurückgewiesen, wenn die Sprache darauf gekommen wäre. Doch ihm mit Ablehnung und Unhöflichkeit zu begegnen, das war etwas ganz anderes.
»Sollen wir hineingehen?«, fragte Sir George früher als gewöhnlich und ließ dann am Tisch nichts unversucht, um die unangenehme Stimmung zu lockern, die sich über die Gesellschaft gelegt hatte. Gleich ein halbes Dutzend Mal wurde der Diener in den Keller geschickt, und mit jedem Gang wurden die Weine exquisiter. Trotz der begrenzten Möglichkeiten, die Stauntons Koch zur Verfügung standen, waren die Speisen ausgezeichnet. Zu den Gerichten gehörte ein schöner gebratener Karpfen, auf einem Ragout jener kleinen Krabben angerichtet, die nun ihrerseits zu Opfern geworden waren. Als Hauptgang gab es einige saftige Keulen Wildbret, begleitet von einer Schale Johannisbeergelee, glänzend rot wie ein Edelstein.
Langsam begann die Konversation wieder in Gang zu kommen. Stauntons ernsthaften Wunsch, ihm und dem Rest der Gesellschaft einen angenehmen Abend zu ermöglichen, konnte Laurence nicht missachten. Er war noch nie nachtragend gewesen, noch viel weniger, wenn er mit einem wundervollen Burgunder, der gerade seine volle Reife erreicht hatte, versöhnt wurde. Niemand hatte weitere Bemerkungen über Jacken oder kaiserliche Verwandtschaften fallen lassen, und nach einigen Gängen taute Laurence genügend auf, um sich begeistert auf eine bezaubernde Kleinigkeit aus neapolitanischen Keksen und Biskuitkuchen mit Vanillesoße, die nach reichlich Brandy und einem Hauch Orange schmeckte, zu stürzen. Plötzlich war draußen vor dem Speisesaal ein Aufruhr zu hören, der schließlich in einem einzelnen, durchdringenden Schrei wie von einer Frau gipfelte, wodurch die lauter und angeregter gewordenen Gespräche unterbrochen wurden.
Schnell wurde es ruhig am Tisch. Gläser verharrten mitten in der Luft. Einige Stühle wurden zurückgeschoben. Nervös erhob sich Staunton und entschuldigte sich. Noch bevor er herausfinden konnte, was draußen vor sich ging, wurde die Tür mit einem Ruck aufgestoßen. Stauntons besorgter Diener stolperte rückwärts in den Raum und protestierte heftig auf Chinesisch. Vorsichtig, aber mit entschlossener Kraft schob ihn ein anderer chinesischer Mann zur Seite. Er trug eine Steppjacke und einen runden, gewölbten Hut, der sich über einer dicken Lage dunkler Wolle erhob. Die staubige und mit gelben Schmutzflecken übersäte Kleidung des Fremden unterschied sich von den üblichen Gewändern der Einheimischen. Auf seiner behandschuhten Hand saß ein bösartig wirkender Adler. Der Vogel sträubte sein braungoldenes Gefieder, während er mit dem Schnabel klackerte und übellaunig sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen verlagerte. Seine großen Krallen drangen durch den schweren, gesteppten Stoff des Handschuhs.
Nachdem man sich einen Moment gegenseitig angestarrt hatte, überraschte der Fremde die Männer an der Tafel noch mehr, als er in gepflegtem Englisch sagte: »Meine Herren, ich bitte um Verzeihung, dass ich Ihr Abendessen unterbreche, aber mein Auftrag kann nicht warten. Ist Kapitän William Laurence zugegen?«
Zuerst war Laurence zu benebelt vom Wein und von der Überraschung, um zu antworten, dann aber stand er auf und trat vor den Tisch, um unter dem unfreundlichen Blick des Adlers ein versiegeltes, wasserdicht verpacktes Paket entgegenzunehmen. »Ich danke Ihnen, Sir«, sagte er. Auf den zweiten Blick entsprach das schmale und kantige Gesicht nicht ganz dem eines Chinesen: Die Augen, obwohl dunkel und leicht schräg gestellt, waren eher westlich in ihrer Form, und die Hautfarbe des Mannes erinnerte an poliertes Teakholz, wofür weniger die Natur als vielmehr die Sonne verantwortlich war.
Der Fremde verneigte sich höflich. »Ich bin froh, zu Diensten sein zu können.« Er lächelte nicht, doch das Funkeln der Belustigung in seinen Augen deutete an, dass er es wohl gewohnt war, eine derartige Reaktion wie die im Saal auszulösen. Er warf der versammelten Gesellschaft einen letzten Blick zu, verbeugte sich knapp vor Staunton und verschwand so plötzlich, wie er gekommen war, vorbei an weiteren Dienern, die der Ursache des Lärms hatten nachgehen wollen.
»Bitte bieten Sie Mr. Tharkay eine Erfrischung an«, bedeutete Staunton in gedämpfter Tonlage den Dienern und schickte sie ihm hinterher, während Laurence sich dem Paket zuwandte. Das Siegelwachs war durch die Sommerhitze aufgeweicht worden, sodass die Prägung kaum noch zu erkennen war. Weil sich das Siegel weder einfach ablösen noch aufbrechen lassen wollte, musste er es herunterziehen. Wie weiches Naschwerk blieb es in klebrigen Fäden an seinen Fingern hängen. In dem Umschlag fand sich nur ein einziges Blatt. Der Brief war aus Dover gesandt worden. Admiral Lenton hatte ihn im knappen Stil eines förmlichen Befehls persönlich verfasst. Ein kurzer Blick genügte, um den Inhalt aufzunehmen.
… und hiermit sind Sie aufgefordert, unverzüglich nach Istanbul aufzubrechen. Dort werden Sie im Kontor von Avraam Maden, in Diensten Seiner Majestät Selim III., drei Dracheneier erhalten, die laut Vereinbarung nun Eigentum des Korps Ihrer Majestät sind. Sie werden sie, geschützt vor den Elementen, mit aller nötigen Umsicht, was den Fortschritt ihres Brutvorgangs angeht, direkt in die Obhut der Ihnen zugeteilten Offiziere bringen, die auf dem Stützpunkt in Dunbar warten …
Die üblichen strengen Schlussworte folgten, sollten Sie oder einer der Ihren versagen oder diesen Befehlen zuwiderhandeln, werden Sie sich auf eigenes Risiko verantworten.
Laurence übergab den Brief an Granby, der ihn auf ein Nicken hin an Riley und Staunton weiterreichte, die sich in der Abgeschiedenheit der Bibliothek zu ihnen gesellt hatten.
»Laurence«, sagte Granby, nachdem er ihn weitergegeben hatte, »wir können hier nicht herumsitzen und die Reparaturen abwarten, wenn wir danach noch eine monatelange Seereise vor uns haben. Wir müssen sofort aufbrechen.«
»Aber auf welche Weise wollen Sie sonst reisen?«, fragte Riley und sah von dem Brief auf, den er über Stauntons Schulter hinweg gelesen hatte. »Es gibt kein anderes Schiff im Hafen, das Temeraires Gewicht auch nur einige Stunden lang tragen könnte, und ohne Rastplatz können Sie nicht über den Ozean fliegen.«
»Es ist ja nicht so, als müssten wir bis Nova Scotia reisen und uns bliebe dafür nur der Seeweg«, entgegnete Granby. »Wir könnten stattdessen auch die Landroute nehmen.«
»Ach, kommen Sie«, entgegnete Riley ungeduldig.
»Warum denn nicht?«, fragte Granby. »Auch unabhängig von den Reparaturen scheidet der Seeweg aus. Wir verlieren unendlich viel Zeit, wenn wir Indien umfahren. Stattdessen können wir das Tatarenland überfliegen …«
»Aber ja doch, Sie könnten auch direkt ins Wasser springen und bis nach England schwimmen«, höhnte Riley. »Früher ist besser als später, aber später ist besser als niemals, und schneller als niemals wird die Allegiance Sie auf jeden Fall nach Hause bringen.«
Laurence lauschte ihrer Unterhaltung nur mit halbem Ohr und las den Brief mit erneuter Aufmerksamkeit noch einmal. Es war schwer, den echten Grad der Dringlichkeit vom allgemeinen Tenor des Befehlstons zu unterscheiden. Zwar brauchten Dracheneier in der Tat eine lange Zeit, bevor sie ausgebrütet waren, doch waren sie auch schwer einzuschätzen und durften nicht unbegrenzt liegen gelassen werden. »Wir müssen berücksichtigen, Tom«, sagte er zu Riley, »dass es leicht bis zu fünf Monaten dauern kann, nach Basra zu segeln, wenn wir mit dem Wetter Pech haben; und von dort müssten wir in jedem Fall über Land bis Istanbul fliegen.«
»Am Ende wäre es genauso wahrscheinlich, dass wir statt der drei Eier drei Drachenjunge vorfinden, die uns überhaupt nichts nützen«, erklärte Granby. Als Laurence ihn nach seiner Einschätzung fragte, vertrat er die feste Überzeugung, die Eier seien keineswegs so weit von ihrem Schlupftermin entfernt, dass es keinen Grund zur Eile gäbe. »Es gibt nicht viele Rassen, die länger als einige Jahre in der Schale bleiben«, erklärte Granby, »und die Admiralität hätte die Eier nicht gekauft, wenn sie nicht mindestens halb ausgebrütet wären. Vorher lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, dass überhaupt etwas aus ihnen wird. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich verstehe jedoch nicht, warum sie uns schicken, um sie zu holen, und nicht eine Mannschaft aus Gibraltar.«
Laurence, der mit den verschiedenen Außenposten des Korps weniger vertraut war, hatte diese Möglichkeit noch gar nicht bedacht. Auf einmal kam es auch ihm seltsam vor, dass man ihnen die Aufgabe übertragen wollte, wo sie doch so viel weiter entfernt waren. »Wie lange bräuchte man denn von dort bis nach Istanbul?«, fragte er beunruhigt. Auch wenn große Teile der Küste unter französischer Kontrolle standen, konnten die Patrouillen nicht überall sein, und ein einzeln fliegender Drache wäre sicherlich in der Lage, auch Stellen zu finden, an denen er rasten konnte.
»Zwei Wochen, vielleicht etwas weniger, wenn sie sich die ganze Strecke über beeilen«, antwortete Granby. »Während ich annehme, dass wir es nicht unter einigen Monaten schaffen, selbst wenn wir über Land fliegen.«
Staunton, der ihren Überlegungen neugierig gelauscht hatte, mischte sich nun ein: »Würde dann nicht allein die Existenz dieser Befehle einen gewissen Mangel an Dringlichkeit bedeuten? Ich wage zu sagen, dass es drei Monate gebraucht hat, bis der Brief hierhergelangte. Einige weitere Monate können dann keinen Unterschied mehr machen, sonst hätte das Korps bestimmt jemanden geschickt, der weniger weit entfernt wäre.«
»Wenn es überhaupt so jemanden gäbe, der hätte entsandt werden können«, sagte Laurence düster. England war derartig knapp an Drachen, dass während einer Krise selbst einer oder zwei nicht leicht entbehrt werden konnten, schon gar nicht für eine Reise, die hin und zurück einen Monat oder gar noch mehr dauerte. Dies galt besonders für einen Drachen mit schwerem Kampfgewicht wie Temeraire einer war. Vielleicht drohte Bonaparte gerade erneut mit einer Invasion über den Kanal oder startete Angriffe gegen die Mittelmeerflotte, sodass nur Temeraire und eine Handvoll Drachen, die in Bombay und Madras stationiert waren, überhaupt zur Verfügung standen.
»Nein«, beschloss Laurence, nachdem er diese unerfreulichen Möglichkeiten überdacht hatte. »Ich denke nicht, dass wir von einer solchen Annahme ausgehen dürfen. Ohnehin gibt es keine zwei Möglichkeiten, die Aussage »unverzüglich« zu interpretieren. Jedenfalls nicht, solange Temeraire eindeutig in der Lage ist, sich auf den Weg zu machen. Ich weiß, was ich über einen Kapitän denken würde, der sich mit solch einem Befehl bei günstigem Wasserstand und gutem Wind im Hafen herumdrücken würde.«
Als er erkannte, dass Laurence nahe daran war, eine Entscheidung zu treffen, ergriff Staunton das Wort: »Kapitän, ich bitte Sie, nicht ernsthaft ein solches Risiko einzugehen.« Riley, der immerhin auf eine neunjährige Bekanntschaft bauen konnte, wurde deutlicher: »Um Gottes willen, Laurence! Sie können nicht vorhaben, etwas derart Verrücktes zu tun.«
Einen Augenblick später fügte er hinzu: »Und ich würde es auch nicht im Hafen herumdrücken nennen, wenn Sie darauf warten, dass die Allegiance bereit gemacht wird. Die Überlandroute zu nehmen, das wäre, als würden Sie direkt in einen Sturm segeln, während eine Woche Geduld für einen klaren Himmel sorgen könnte.«
»Sir, bei Ihnen klingt das, als ob wir uns genauso gut gleich die Kehlen durchschneiden könnten«, rief Granby. »Ich gebe zu, es wäre mühsam und gefährlich, mit einer Karawane die nötigen Vorräte quer durch die Weltgeschichte zu schleppen. Aber mit Temeraire an unserer Seite wird uns niemand Ärger machen, und wir brauchen nur einen Ort, an dem wir über Nacht ruhen können.«
»Und genügend Nahrung für einen Drachen erster Klasse«, schoss Riley zurück.
Staunton nickte und sprang auf den Zug auf: »Ich glaube, Sie können sich weder vorstellen, wie extrem karg noch wie weitläufig die Regionen sind, die Sie durchqueren wollen.« Eilig durchforstete er seine Bücher und Papiere, um Laurence einige Karten der Gegend herauszusuchen. Selbst auf Pergament handelte es sich um einen unwirtlichen Ort. Nur wenige einsame, kleine Siedlungen unterbrachen lange Etappen namenloser Steppe und großer Wüstengebiete, die sich hinter Bergen auftaten. Auf der staubigen und halb zerfallenen Karte hatte jemand in altertümlicher, spinnengleicher Handschrift »hiero ist kein Wasser für drei mal sieben Tage« in den leeren, gelben Wüstenfleck geschrieben. »Verzeihen Sie mir, wenn ich es so deutlich sage, aber es ist ein leichtsinniges Vorhaben und, da bin ich mir sicher, nicht das, was die Admiralität von Ihnen erwartet haben kann.«
»Und ich bin überzeugt, dass Lenton es niemals für möglich gehalten hätte, dass wir sechs Monate in einer Windstille liegen«, sagte Granby. »Es sind schon Leute über Land gereist. Was war mit diesem Burschen namens Marco Polo? War das nicht schon vor ein paar Jahrhunderten?«
»Allerdings. Aber was ist mit der Expedition von Fitch und Newberry, die nach ihm kam?«, fragte Riley. »Drei Drachen, alle in einem fünftägigen Schneesturm in den Bergen verloren durch genau solch ein leichtsinniges Verhalten …«
»Dieser Mann, Tharkay, der den Brief brachte«, begann Laurence, an Staunton gewandt, und unterbrach das Wortgefecht, das immer hitziger zu werden drohte. Rileys Tonfall war bereits ziemlich scharf, und Granbys blasse Haut begann, sich in verräterischer Weise zu verfärben. »Er kam ebenfalls über Land, oder?«
»Ich hoffe, Sie nehmen ihn nicht als Vorbild«, entgegnete Staunton. »Ein einzelner Mann kann hingehen, wo keine Gruppe durchkommt. Außerdem kann ein abgehärteter Abenteurer wie er mit sehr wenig auskommen. Und das Wichtigste ist: Wenn er geht, riskiert er sein eigenes Leben. Sie müssen berücksichtigen, dass Sie für einen unbeschreiblich wertvollen Drachen verantwortlich sind, dessen Verlust schwerer wiegt als sogar diese Mission.«
»Oh, bitte lass uns sofort aufbrechen«, drängelte dieser unbeschreiblich wertvolle Drache, als Laurence ihn in die immer noch ungelöste Frage einweihte. »Für mich klingt das sehr aufregend.« Der Abend war vergleichsweise kühl und Temeraire hellwach. Sein Schwanz zuckte voller Begeisterung hin und her und schob dabei auf beiden Seiten mehr als mannshohe Sandwälle auf dem Strand zusammen. »Von welcher Drachenrasse stammen die Eier? Werden sie Feuer spucken?«
»Gott, wenn sie uns nur einen Kazilik schicken würden«, seufzte Granby. »Aber ich vermute, dass es gewöhnliche Mittelgewichte sein werden. Diese Sorte von Gelegenheitskäufen tätigt man meist, um ein wenig frisches Blut in die Zuchtlinien zu bringen.«
»Wie viel schneller werden wir nach Hause kommen?«, fragte Temeraire und legte seinen Kopf schräg, damit er einen neugierigen Blick auf die Karten werfen konnte, die Laurence auf dem Sand ausgebreitet hatte. »Sieh nur, Laurence, wie weit der Umweg ist, den wir segeln würden. Und schließlich brauche ich nicht die ganze Zeit Wind, so wie das Schiff. Wir werden noch vor dem Ende des Sommers zu Hause sein.« Das war eine ebenso optimistische wie unwahrscheinliche Schätzung, da Temeraire den Maßstab der Karte nicht besonders gut umrechnen konnte. Trotzdem dürften sie wahrscheinlich gegen Ende September wieder in England sein. Das allein war beinahe reizvoll genug, um alle Vorsicht fahren zu lassen.
»Aber dennoch kann ich mich nicht darüber hinwegsetzen«, sagte Laurence, »dass wir der Allegiance zugeteilt wurden. Lenton muss davon ausgegangen sein, dass wir mit ihr nach Hause kommen würden. Einfach entlang der alten Seidenstraße loszustürzen, hat für mich einen Beigeschmack von Übereilung. Und du musst mir gar nicht erst erzählen«, fügte er hinzu, um Temeraires Einwände im Keim zu ersticken, »dass es nichts gäbe, worüber man sich Sorgen machen müsste.«
»Aber es kann einfach nicht so gefährlich sein«, sagte Temeraire unbeirrt. »Es ist ja nicht so, als ob ich dich allein gehen lassen würde, sodass du womöglich verletzt werden könntest.«
»Dass du dich einer Armee entgegenwerfen würdest, um uns zu beschützen, daran habe ich keinen Zweifel«, sagte
cbt – C. Bertelsmann Taschenbuch Der Taschenbuchverlag für Jugendliche Verlagsgruppe Random House
1. Auflage Deutsche Erstausgabe Oktober 2007 Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform
© 2006 der Originalausgabe
by Naomi Novik Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Black Powder War« bei Del Rey Books, an imprint of the Random House Publishing Group, a division of Random House, Inc., New York. © 2007 der deutschsprachigen Ausgabe cbt/cbj Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten Übersetzung: Marianne Schmidt Innenillustrationen: © Gayle Marquez Umschlagillustration: Dominic Harman Umschlaggestaltung: HildenDesign, München he ∙ Herstellung: CZ Satz: Uhl + Massopust, Aalen
eISBN 978-3-641-09181-1
www.cbj-verlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: