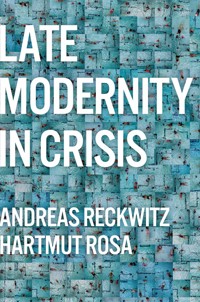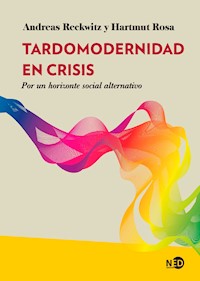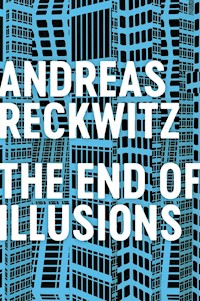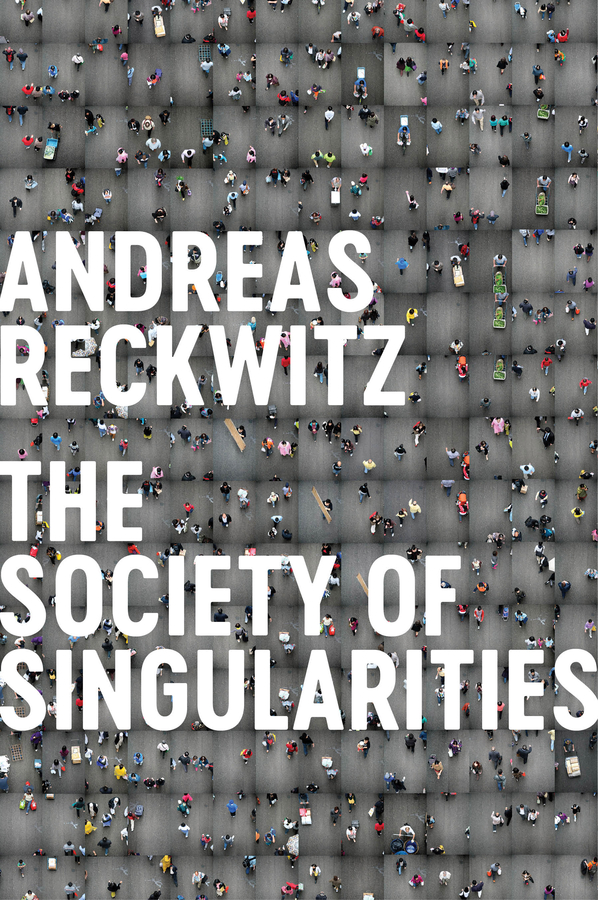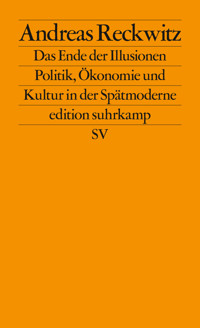
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Noch vor wenigen Jahren richtete sich die westliche Öffentlichkeit in der scheinbaren Gewissheit des gesellschaftlichen Fortschritts ein: Der weltweite Siegeszug von Demokratie und Marktwirtschaft schien unaufhaltsam, Liberalisierung und Emanzipation, Wissensgesellschaft und Pluralisierung der Lebensstile schienen die Leitbegriffe der Zukunft. Spätestens mit dem Brexit und der Wahl Donald Trumps folgte die schmerzhafte Einsicht, dass es sich dabei um Illusionen gehandelt hatte.
Tatsächlich wird erst jetzt das Ausmaß des Strukturwandels der Gesellschaft sichtbar: Die alte industrielle Moderne ist von einer Spätmoderne abgelöst worden, die von neuen Polarisierungen und Paradoxien geprägt ist – Fortschritt und Unbehagen liegen dicht beieinander. In einer Reihe von Essays arbeitet Andreas Reckwitz die zentralen Strukturmerkmale der Gegenwart pointiert heraus: die neue Klassengesellschaft, die Eigenschaften einer postindustriellen Ökonomie, den Konflikt um Kultur und Identität, die aus dem Imperativ der Selbstverwirklichung resultierende Erschöpfung und die Krise der Liberalismus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Andreas Reckwitz
Das Ende der Illusionen
Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne
Suhrkamp
Ausführliches Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Die desillusionierte Gegenwart
Fortschritt, Dystopie, Nostalgie
Desillusionierung als Chance
Von der industriellen Moderne zur Gesellschaft der Singularitäten
1 Kulturkonflikte als Kampf um die Kultur: Hyperkultur und Kulturessenzialismus
Die Kulturalisierung des Sozialen
Kulturalisierung I: Hyperkultur
Kulturalisierung II: Kulturessenzialismus
Hyperkultur und Kulturessenzialismus: Zwischen Koexistenz und Konflikt
Doing universality– die Kultur des Allgemeinen als Alternative?
2 Von der nivellierten Mittelstandsgesellschaft zur Drei-Klassen-Gesellschaft: Neue Mittelklasse, alte Mittelklasse, prekäre Klasse
Der globale und historische Kontext
Die Rahmenbedingungen: Postindustrialisierung, Bildungsexpansion, Wertewandel
Im Paternoster der Drei-Klassen-Gesellschaft
Die neue Mittelklasse: Erfolgreiche Selbstverwirklichung und urbaner Kosmopolitismus
Die alte Mittelklasse: Sesshaftigkeit, Ordnung und kulturelle Defensive
Die prekäre Klasse: Sichdurchbeißen und Deklassierung
Die Oberklasse: Distanz qua Vermögen
Querschnittseigenschaften: Geschlecht, Migration, Region, Milieus
Politische Polarisierungstendenzen und gesellschaftliche Zukunftsszenarien
3 Jenseits der Industriegesellschaft: Polarisierter Postindustrialismus und kognitiv-kultureller Kapitalismus
Aufstieg und Niedergang des industriellen Fordismus
Sättigungskrise
Produktionskrise und polarisierter Postindustrialismus
Globalisierung, Neoliberalismus, Finanzialisierung
Kognitiver Kapitalismus und immaterielles Kapital
Kulturelle Güter und kultureller Kapitalismus
Winner-take-all-Märkte: Die Skalierbarkeit und Attraktivität kognitiver und kultureller Güter
Extremer Kapitalismus: Die Ökonomisierung des Sozialen
4 Erschöpfte Selbstverwirklichung: Das spätmoderne Individuum und die Paradoxien seiner Emotionskultur
Von der Selbstdisziplin zur Selbstverwirklichung
Erfolgreiche Selbstverwirklichung: Eine ambitionierte Doppelstruktur
Die Selbstverwirklichungskultur als Generator negativer Emotionen
Wege aus der Enttäuschungsspirale?
5 Die Krise des Liberalismus und die Suche nach dem neuen politischen Paradigma: Vom apertistischen zum einbettenden Liberalismus
Politische Paradigmen und politische Paradoxien
Problemlagen und Problemlösungen: Zwischen Regulierungs- und Dynamisierungsparadigma
Der Aufstieg des sozial-korporatistischen Paradigmas
Die Überregulierungskrise
Der Aufstieg des Paradigmas des apertistischen Liberalismus
Die dreifache Krise des apertistischen Liberalismus
Populismus als Symptom
Ein »einbettender Liberalismus« als das Paradigma der Zukunft?
Herausforderungen für den einbettenden Liberalismus
Einleitung: Die desillusionierte Gegenwart
Es ist merkwürdig. Manche im Nachhinein als historisch apostrophierten Begebenheiten des Weltgeschehens nimmt man als Zeitgenosse nur am Rande wahr, bei anderen hingegen kann man sich noch Jahre später genau an den Moment erinnern, als »es passierte«, an die eigene Verblüffung oder Ratlosigkeit, an den Schrecken oder die ungläubige Freude, als etwas geschah, was man so nicht für möglich gehalten hätte.
So wie ich mich noch genau an »meinen« 9. November 1989, den Tag, an dem die Berliner Mauer fiel, erinnern kann und an den 11. September 2001, den Terrorangriff auf das New Yorker World Trade Center, so präsent ist mir nach wie vor der Morgen des 9. November 2016. Wie viele andere Menschen weltweit hatte auch ich in den Monaten zuvor den Präsidentschaftswahlkampf in den USA mit wachsendem Unbehagen verfolgt: die überraschende Kandidatur Donald Trumps für die Republikanische Partei, seine hässliche, brutale Wahlkampagne gegen Hillary Clinton, die Kandidatin der Demokraten. Bis ich an jenem Morgen auf dem Bildschirm meines Tablets tatsächlich lesen musste, dass passiert war, was ich mir bis zum letzten Moment als Möglichkeit nicht eingestehen wollte: die Wahl des populistischen Kandidaten, der vor allem mit frauen- und fremdenfeindlicher Demagogie, mit tiefem Misstrauen gegenüber internationaler Kooperation sowie demokratischen Institutionen aufgefallen war und völlig unberechenbar erschien, zum 45. Präsidenten der USA, also an die Spitze der westlichen Führungsnation.[1] Die Reaktion bei mir an diesem Morgen und noch Wochen danach war Entsetzen und das Gefühl, dass etwas zusammenbrechen könnte, ohne genau zu wissen, wohin dies führen wird: Wie war das möglich, und wie wird es nun weitergehen? Ich empfand einen historischen Bruch.
Die Trump-Wahl war allerdings nicht das einzige politische Erdbeben, das wir in den letzten Jahren erlebt haben. Auch andernorts haben Wahlen und Abstimmungen scheinbar stabile Ordnungen ins Wanken gebracht: Im Juni 2016 stimmte die britische Bevölkerung mehrheitlich für den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union, und bei der französischen Präsidentschaftswahl 2017 erreichte keiner der Kandidaten der etablierten Parteien, sondern die rechtspopulistische Marine Le Pen die Stichwahl. Sie verlor gegen den liberalen Parteineugründer – En Marche! – Emmanuel Macron, der sich wiederum 2018 und 2019 der heftigen Proteste durch die »Gelbwesten« erwehren musste. In Italien kam 2018 eine (rechts-)populistische Regierung an die Macht, in Ungarn und Polen, den einstigen Musterdemokratien im postkommunistischen Teil Europas, stehen demokratische Institutionen unter Beschuss. Die Europäische Union, die manchen als alternativloser Endpunkt der Entwicklung auf einem Kontinent galt, der aus den Kriegen der Vergangenheit gelernt hat, und das gewohnte Links-rechts-Schema des Parteiensystems erwiesen sich plötzlich als brüchig. Weitere Verunsicherungen haben wir erlebt: Die globale Finanzkrise 2007 hat ein System, das viele Ökonomen als verlässliche Geldmaschine gepriesen hatten, an den Rand des Zusammenbruchs geführt. Terroristische Anschläge wie jener in Paris 2015 (durch den »Islamischen Staat«) und im neuseeländischen Christchurch 2018 haben die Fragilität des Alltags der westlichen Gesellschaften demonstriert. Die Einschläge kommen offensichtlich näher – so eine verbreitete Wahrnehmung.
Warum verunsichern sie derart? Die Antwort mag schmerzhaft sein: Wir nehmen die Ereignisse nicht mehr als Einzelfälle wahr, nach denen wir rasch zur Tagesordnung übergehen können. Vielmehr wird ein Muster deutlich: Die hoffnungsvollen Erwartungen hinsichtlich der gesellschaftlichen Entwicklung, wie viele sie seit dem Ende des Kalten Krieges 1989/90 in den westlichen Ländern gehegt haben, werden so ganz grundsätzlich enttäuscht oder zumindest relativiert. Die Erwartungen erweisen sich heute als Illusionen, das Ergebnis ist Desillusionierung. Dies gilt nicht nur für Deutschland, sondern für die westlichen Gesellschaften insgesamt – und in mancher Hinsicht sogar darüber hinaus für die Weltgesellschaft. Ob in den Medien, der Politik, der Wirtschaft und auch in großen Teilen der intellektuellen Debatte – nach 1990 hatte man sich nämlich darin eingerichtet, an einer großen Erzählung gesellschaftlichen Fortschritts zu weben, des wirtschaftlichen, des politischen, des sozialen, des kulturellen und des technischen Fortschritts. Der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama brachte dieses Narrativ in einer von Hegel und dessen Interpreten Alexandre Kojève entlehnten Wendung auf den Begriff des »Endes der Geschichte«: Es mochte scheinen, als ob wir in die Zielgerade der Weltgeschichte eingebogen sind und einen Zustand erreichen, in dem die institutionellen Ordnungen von Politik und Wirtschaft eine nicht mehr veränderungsbedürftige oder auch nur veränderbare Gestalt angenommen haben.[2] Aus heutiger Sicht mutet diese Erzählung reichlich blauäugig an.
Die im Kern liberale Fortschrittserzählung der letzten dreißig Jahre kann durchaus auf eine Fülle von empirischen Evidenzen verweisen. Man sollte sie sich noch einmal in Erinnerung rufen. Für den politischen Fortschritt sprechen Demokratisierungsbewegungen in Osteuropa, Lateinamerika und Afrika, die dazu führten, dass autoritäre Regime in beträchtlichem Umfang durch liberal-demokratische Systeme verdrängt wurden. Hinzu kommt die intensivierte globale Kooperation zwischen den Staaten, für die die Europäische Union nur ein Beispiel ist. Auch wirtschaftlicher Fortschritt ist zweifellos zu verzeichnen: Die Globalisierung und die Integration großer Teile des globalen Südens in den Weltmarkt haben vor allem in den Schwellenländern wie China und Indien für einen Industrialisierungsschub gesorgt, der zu einem deutlichen Rückgang der Armut und zum Aufstieg einer starken Mittelklasse führte. In Nordamerika und Europa hat sich eine postindustrielle Wissensökonomie etablieren können, die insbesondere von der digitalen Revolution profitiert.
Der Prozess der Digitalisierung – die prägende technologische Entwicklung der letzten beiden Jahrzehnte – schien sich zunächst nahtlos in die Fortschrittsgeschichte einzufügen: Die Vernetzung der Individuen und der Organisationen, das Internet als experimenteller Raum für neue Identitäten und Kooperationen, schließlich eine grenzüberschreitende, die Demokratie vitalisierende Kommunikation – dies alles waren die Hoffnungen der Tech-Euphorie. Schließlich hat das Fortschrittsnarrativ auch eine gesellschaftspolitische Komponente. Man kann auf die erheblichen Liberalisierungs- und Emanzipationsgewinne der letzten Jahrzehnte hinweisen: auf den Schub zur Gleichstellung der Geschlechter, auf die Gleichberechtigung von sexuellen Minderheiten (zum Beispiel schwulen Männern, lesbischen Frauen und Transgender-Personen), auf eine Transformation der westlichen Lebensweise, die insgesamt im besten Sinne hedonistischer und kosmopolitischer geworden ist und so manche Rigidität der Nachkriegsgesellschaft hinter sich gelassen hat. Insbesondere die neue, junge Mittelklasse bewegt sich dabei in der globalisierten Welt wie ein Fisch im Wasser: Dass die Welt grundsätzlich offen steht, hat sich in den letzten Jahrzehnten so bei manchen als scheinbar unverrückbares Lebensgefühl verbreitet.
Natürlich – es gibt alle diese Entwicklungen, und sie sind bedeutsam. Die liberale Fortschrittserzählung ist nicht falsch. Aber trotzdem kann es sich nicht um die ganze Wahrheit handeln. Wer glaubt, Fortschrittsidee und gesellschaftliche Realität würden einander eins zu eins entsprechen, erliegt einer Illusion. Und eine Illusion ist es auch, dass einmal in Gang gesetzte Prozesse sich quasi naturwüchsig verstetigen würden. Die Finanzkrise, der Brexit, die Terroranschläge, die Trump-Wahl und andere Ereignisse der jüngsten Vergangenheit verdeutlichen, dass die gesellschaftliche Realität widersprüchlicher und fragiler ist, als es uns das Fortschrittsnarrativ glauben machen will. Und: Es ist davon auszugehen, dass diese Ereignisse letztlich Ausdruck von beziehungsweise Reaktionen auf Widersprüche, Konflikte und Krisenmomente sind, die sich auf der Ebene der Strukturen der spätmodernen Gesellschaft bereits seit längerem herausbilden.
Fortschritt, Dystopie, Nostalgie
Dass das liberale Fortschrittsnarrativ bis vor wenigen Jahren derart allgegenwärtig scheinen konnte, ist so ungewöhnlich nicht, wenn wir den Blick weiten und die Kulturgeschichte der Moderne insgesamt betrachten. Die moderne Gesellschaft, die sich seit dem 18. Jahrhundert im Zuge von Industrialisierung, Demokratisierung, Urbanisierung, Vermarktlichung, Emanzipation und Verwissenschaftlichung zunächst in den westlichen Ländern langsam, aber stetig entwickelt hat, ist von Anfang an untrennbar mit der Vision einer Arbeit am Fortschritt verknüpft gewesen – mit dem »Projekt der Moderne«. Reinhart Koselleck hat darauf hingewiesen: Die Entstehung der Fortschrittssemantik fällt mit der Realität der – politischen, wirtschaftlichen und technischen – Revolutionen am Ende des 18. Jahrhunderts zusammen, sie hat sie begleitet und teilweise auch aktiv angetrieben.[3] Das religiöse Erbe der Heilsgewissheit hat die Moderne damit gewissermaßen in Gestalt des Fortschrittsglaubens in ihrem kulturellen Code abgespeichert.
Natürlich ist in der Geschichte der Moderne im 19. und 20. Jahrhundert häufig strittig gewesen, worin genau der realisierte oder erhoffte Fortschritt bestehen soll: Technik, Freiheit, Gleichheit, Wohlstand und Komfort, Mündigkeit oder Emanzipation? Zudem haben sich Wellen von Fortschrittsoptimismus und kulturkritischem Selbstzweifel immer wieder abgewechselt. Nach den Napoleonischen Kriegen begann im Europa des 19. Jahrhunderts zunächst eine lange Phase des bürgerlichen Selbstbewusstseins und der unbeirrbaren Hoffnung auf zivilisatorischen Fortschritt (nicht zufällig von Imperialismus und Kolonialismus begleitet). An der Wende zum 20. Jahrhundert wurde der Staffelstab des progressiven Optimismus an die sozialistischen Bewegungen weitergereicht. Nach dem Ersten Weltkrieg setzte dann eine Phase nagender intellektueller Verunsicherung ein, und eine skeptische Haltung machte sich breit, die unter einigen Intellektuellen in eine regelrechte Katastrophenstimmung angesichts des befürchteten Niedergangs der europäischen Moderne umschlug – man lese nur Oswald Spenglers Der Untergang des Abendlandes oder José Ortega y Gassets Der Aufstand der Massen.[4] Nach dem Zivilisationsbruch von Faschismus und Holocaust fing sich nach dem Zweiten Weltkrieg der liberale Fortschrittsoptimismus in Westeuropa und Nordamerika überraschend schnell wieder. Es folgten die Trente Glorieuses (Jean Fourastié) mit ihrem Aufstieg der westlichen Wohlstandsgesellschaften und den Visionen einer perfekten industriell-technischen Modernität. In den 1970er Jahren wurden diese Gesellschaften zunächst mit der ökonomischen und ökologischen Debatte um die »Grenzen des Wachstums« und der unbequemen Gesellschaftskritik nach 1968 konfrontiert. Dann brach das kommunistische System zusammen, der bisher letzte und radikalste Schub der Globalisierung setzte ein, die digitale Revolution begann – ebenjene Phase eines erneuerten liberalen Fortschrittsnarrativs in einer Ära vermeintlicher Grenzenlosigkeit, das heute massiv in Zweifel gezogen wird.
Es ist aufschlussreich, sich diese Konjunkturen gesellschaftlicher Fortschrittsdiskurse der Vergangenheit vor Augen zu führen. Der historische Blick relativiert manches – sowohl das blinde Vertrauen in eine widerspruchsfreie Progressivität der Entwicklung als auch die defätistische Katastrophenstimmung, die immer wieder darauf folgte. Aktuell prägt jedenfalls das Genre der Dystopie das Feld.[5] Die Enttäuschung über den begrenzten Realitätsgehalt des liberalen Fortschrittsideals ist offenbar bei manchen so groß, dass man nun, angetrieben von heftigen Emotionen wie Wut oder Trauer, dazu tendiert, ins andere Extrem zu fallen. Wenn der öffentliche Diskurs ein Patient in der psychologischen Therapie wäre, dann müsste man bei ihm Züge des Manisch-Depressiven diagnostizieren: Auf die grenzenlose Euphorie folgt offenbar umstandslos eine Stimmung der tief empfundenen Ausweglosigkeit (die bei manchen mit einer klammheimlichen Freude angesichts des vorgeblich bevorstehenden Desasters einherzugehen scheint).
Die aktuellen Dystopien deuten in unterschiedliche Richtungen. Medial enorm präsent – insbesondere in der digitalen Welt, aber auch auf dem Markt populärer Bücher – sind die Niedergangsdiagnosen aus dem Umfeld der Neuen Rechten. Sie reaktivieren letztlich Spenglers zyklische Geschichtsphilosophie des »Untergangs des Abendlandes«. In ganz anderer Weise findet man unter dem Eindruck der Finanzkrise im Lager der linken Kapitalismuskritik manche Stimmen, die Belege für die nun definitiv bevorstehende Implosion des Kapitalismus sammeln – ein Untergang, den sich viele dieser Autoren, mangels sozialistischer Alternative, selbst nur als ausweglose Dauerkrise vorstellen können. Hinzu kommt, dass der öffentliche Diskurs über die Digitalisierung mittlerweile fast vollständig von der Tech-Euphorie in eine recht pauschale Technikkritik umgeschlagen ist. Diese assoziiert die digitale Revolution nun bevorzugt mit einer allumfassenden Kontrolle der Nutzerinnen durch ökonomische oder staatliche Datensammler, mit Filterbubbles und verrohter Kommunikation, schließlich mit Automatisierung und drohender Massenarbeitslosigkeit.
Angesichts dieser Katastrophenszenarien klammert sich der öffentliche und politische Diskurs der Gegenwart nicht selten an den Strohhalm der Nostalgie. Insbesondere die industrielle Moderne während der drei Wohlstandsjahrzehnte von 1945 bis 1975, die vor wenigen Jahren noch komplett »von gestern« erschien, verwandelt sich mittlerweile in eine Projektionsfläche nostalgischer Sehnsüchte ganz unterschiedlicher Färbung – in eine Nostalgie von rechts, von links und aus der Mitte. Die rechte Nostalgie in den USA, in Frankreich oder in Deutschland verherrlicht das damals noch gültige traditionelle Familien- und Geschlechtermodell, die konservative Moral und die vermeintliche kulturelle Homogenität. Die linke Nostalgie sehnt sich nach der größeren sozialen Gleichheit, der starken Industriearbeiterschaft und dem Wohlfahrtsstaat der alten Industriegesellschaft. Die Nostalgie aus der Mitte schließlich blickt wehmütig zurück auf eine Ära der Volksparteien und integrierenden Verbände, des breiten Mittelstandes und des vermeintlich gemächlicheren Lebenstempos. Beim Griff in den Nostalgiefundus kann es sich um eine politisch folgenlose, eher ästhetische Retrotendenz handeln, aber auch diverse politischen Populismen bedienen sich daraus in effektiver Weise.
Desillusionierung als Chance
Der Umschlag der öffentlichen Debatte vom unbeirrbaren Fortschrittsoptimismus in Dystopie und Nostalgie, von einem selektiven Blick zum nächsten macht es uns nicht gerade leichter, die Strukturen der Gegenwartsgesellschaft zu begreifen und mit ihnen umzugehen. Das Ende der Illusionen muss jedoch nicht zwangsläufig in allumfassenden Pessimismus münden. Illusionslosigkeit kann eine Tugend sein, die einen nüchternen Realismus ermöglicht und den Raum für die Analyse öffnet. Jenseits dystopischer und nostalgischer Stimmungen gilt es, eine undogmatische und differenzierte Perspektive zu entwickeln, die kritisch ist, ohne in eine haltlose Generalabrechnung mit der Gegenwart abzudriften. Hier kommt nun die Soziologie ins Spiel, weil sie genau eine solche nüchterne Gegenwartsanalyse leisten kann. Die Soziologie, wie ich sie verstehe, übertüncht in ihrer Untersuchung gesellschaftlicher Strukturen und Wandlungsprozesse nicht in fortschrittsgläubiger Manier die Widersprüche und Ambivalenzen, welche die Spätmoderne prägen, sie kleistert sie nicht moralistisch zu oder flüchtet sich in Szenarien des Niedergangs. Eine realistische »Sozioanalyse« enthält in mancher Hinsicht vielmehr Parallelen zur Psychoanalyse, so wie Sigmund Freud sie in Bezug auf Individuen und Kultur entwickelte: Auch diese stellt schließlich keine vollständige Auflösung der Widersprüche in einer versöhnten, harmonischen Existenz in Aussicht. Der Aufklärungsgewinn – der analytische Fortschritt – besteht vielmehr gerade darin, die Paradoxien und Ambivalenzen sichtbar zu machen, dadurch auf sie reflektieren zu können und über diesen veränderten Blick auf die Lage der Dinge realistische Schritte zu ihrer Veränderung zu ermutigen.
In diesem Sinne möchten die in diesem Band versammelten Texte die widersprüchlichen Strukturen der Gegenwartsgesellschaft unter die Lupe nehmen, die sich sowohl gegen allzu schlichte Fortschrittsnarrative als auch gegen alarmistische Verfallsdiagnosen sperren. Eindeutige Bewertungen und einfache Lösungen sind daher nicht zu erwarten, im Gegenteil: Wer Ambivalenzen aushalten und produktiv mit ihnen umgehen kann, ist in der Spätmoderne klar im Vorteil. Allerdings hat die elementare psychologische Fähigkeit der Ambiguitätstoleranz im gegenwärtigen Debattenklima mit seinen klaren Freund-Feind-Unterscheidungen einen schweren Stand.[6] In meinem Buch Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne habe ich eine solche Theorie der spätmodernen Gesellschaft in ihren Ambivalenzen systematisch zu entfalten versucht. In den Aufsätzen des vorliegenden Bandes will ich einzelne Aspekte dieser Theorie der Spätmoderne zuspitzen. Dabei geht es um die politische, die ökonomische und die kulturelle Dimension gleichermaßen. Mit der Gegenwartsgesellschaft ist im Übrigen nicht allein Deutschland gemeint, sondern die westliche Welt insgesamt, die – trotz nationaler Unterschiede – in Nordamerika und Europa gegenwärtig überall ähnlichen Transformationen und Problemen ausgesetzt ist. Der Wandel des Westens wiederum ist nur innerhalb eines globalen Rahmens nachvollziehbar.
Von der industriellen Moderne zur Gesellschaft der Singularitäten
Der Ausgangspunkt für meine Perspektive auf die Gegenwartsgesellschaft lautet, dass wir einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Strukturwandel erleben, in dessen Verlauf sich in den letzten dreißig Jahren die klassische, die industrielle Moderne, in eine neue Form der Moderne verwandelt, die ich Spätmoderne nenne. Das Verständnis der Strukturen dieser Spätmoderne aber ist noch unterentwickelt.
Die industrielle Moderne formierte sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts und erreichte ihren Höhepunkt in den Wohlstandsgesellschaften der oben erwähnten glorreichen drei Nachkriegsjahrzehnte bis in die 1970er Jahre hinein. Sie war eine Gesellschaftsform, die auf allseitige Rationalisierung, Technisierung und Planung setzte. Die industrielle Massenproduktion in den Großbetrieben war für sie ebenso kennzeichnend wie der Massenwohnungsbau, die keynesianische Globalplanung der Wirtschaft, der Ausbau des Wohlfahrtsstaates und der feste Glaube an den technischen Fortschritt. Für die Individuen bedeutete die industrielle Moderne, in einer affluent society (John Kenneth Galbraith) mit verhältnismäßig egalitärem Lebensstandard zu leben. Die soziale Kontrolle und die kulturelle Homogenität wie auch der kulturelle Konformismus waren hoch, eine eindeutige Rollenverteilung der Geschlechter sowie die Diskriminierung sexueller und ethnischer Minderheiten bildeten nicht die Ausnahme, sondern waren die Regel. Mit dem französischen Historiker Pierre Rosanvallon gesprochen, war diese eine »Gesellschaft der Gleichen« mit all ihren Licht- und Schattenseiten: eine Gesellschaft, in der Regeln des Allgemeinen und des Kollektivs herrschten.[7]
Diese klassische Industriegesellschaft gibt es so nicht mehr, auch wenn sie als Leitmaßstab immer noch in einigen Köpfen herumspukt. Natürlich existieren einzelne ihrer Bestandteile in manchen Bereichen weiter, es gibt immer eine Gleichzeitigkeit des historisch Ungleichzeitigen. Aber als dominante Gesellschaftsformation ist sie von einer anderen verdrängt worden, die von manchen Soziologen als Postmoderne bezeichnet worden ist, von anderen als Hochmoderne, Zweite Moderne oder Hypermoderne. Ich verwende den Begriff der Spätmoderne. Dieser Strukturwandel hat sich bereits in den 1970er und 80er Jahren angebahnt – emblematische Ereignisse sind die Studentenrevolte von 1968, die Ölkrise und der Zusammenbruch des zentral gesteuerten globalen Finanzsystems von Bretton Woods 1973 sowie die Entwicklung des Apple I, des ersten bezahlbaren Personal Computer 1976. Ihre ausgereifte Form erhält die Spätmoderne seit den 1990er Jahren. Sie ist unter anderem durch eine radikale Globalisierung gekennzeichnet, in deren Verlauf die für die industrielle Moderne so typische und klare Trennung zwischen »Erster«, »Zweiter« und »Dritter Welt« sich aufhebt und die Grenzen zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden immer stärker verschwimmen. In Teilen des Südens findet nun eine rasante Modernisierung statt, während Teile des Nordens ihren überlegenen Status einbüßen.
Die Strukturmerkmale dieser Spätmoderne zusammenhängend auf den Begriff zu bringen, bleibt eine Herausforderung. Das liberale Fortschrittsnarrativ würde hier – ich hatte es zu Anfang angedeutet – im Wesentlichen Globalisierung (positiv verstanden), Demokratisierung, Expansion der Märkte, Liberalisierung und Vernetzung wahrnehmen. Auf diese Weise würde der Strukturwandel einseitig als eine lineare Entwicklung begriffen. Wir müssen jedoch lernen, die Spätmoderne als eine widersprüchliche, konflikthafte Gesellschaftsformation zu begreifen, die durch eine Gleichzeitigkeit von sozialem Aufstieg und Abstieg, eine Gleichzeitigkeit von kultureller Aufwertung und Entwertung charakterisiert ist – am Ende durch Prozesse der Polarisierung. Genau dies macht sie explosiv. Diese Asymmetrien und strukturellen Disparitäten sind als solche ganz überwiegend weder geplant noch bewusst herbeigeführt worden, sondern das, was Soziologen nichtintendierte Handlungsfolgen nennen. Gerade deswegen irritieren sie.
Im Gegensatz zur Gesellschaft der Gleichen der industriellen Moderne nimmt die Spätmoderne mehr und mehr die Form einer Gesellschaft der Singularitäten an.[8] Zugespitzt formuliert heißt dies: Während die industrielle Moderne in verschiedensten Bereichen auf der Reproduktion von Standards, von Normalität und Gleichförmigkeit basierte und man von einer »Herrschaft des Allgemeinen« sprechen konnte, ist die spätmoderne Gesellschaft an der Verfertigung von Besonderheiten und Einzigartigkeiten, sie ist an der Prämierung von qualitativen Differenzen, Individualität, Partikularität und dem Außergewöhnlichen orientiert. Wenn man eine in der Soziologie und der politischen Debatte vertraute Begrifflichkeit verwenden will, könnte man die Spätmoderne in einem ersten Zugriff als eine Gesellschaft des radikalisierten Individualismus umschreiben. Sie treibt gewissermaßen jenen Individualismus, welcher der Moderne von Anfang an eigen war, auf die Spitze. Allein: Der traditionsreiche Begriff des »Individualismus« scheint mir ebenso wie jener der »Individualisierung« zu mehrdeutig und zugleich zu eng, um präzise jene gesellschaftlichen und kulturellen Prozesse beschreiben zu können, welche die Spätmoderne charakterisieren.[9]
Ich ziehe daher die Begrifflichkeit der Singularisierung vor. Sie bezeichnet schärfer die sozialen Prozesse, in denen Besonderheiten und Einzigartigkeiten, in denen Nichtaustauschbarkeit, Unvergleichlichkeit und Superlative erwartet, fabriziert, positiv bewertet und erlebt werden.[10] In der Spätmoderne etabliert sich großflächig eine soziale Logik der Singularisierung, wie sie in früheren Phasen der Moderne lediglich in schmalen Segmenten der Gesellschaft existieren konnte. Sie hat eine unweigerlich paradoxe Struktur: Es bilden sich in gesellschaftlichen Kernbereichen allgemeine Strukturen und Praktiken aus, deren Interesse systematisch am Besonderen ausgerichtet ist. Singularitäten bewegen sich also nicht außerhalb der Sozialwelt oder sind gegen sie gerichtet, sondern befinden sich mitten in ihrem Zentrum. Sie werden nicht »in die Freiheit entlassen«, sondern in der gesellschaftlichen Praxis verfertigt.
Anders als die Individualisierung sind die so verstandenen Prozesse der Singularisierung nicht mehr auf menschliche Individuen beschränkt. Natürlich prämiert die spätmoderne Gesellschaft auch die Besonderheit einzelner Menschen – etwa eine exzellente berufliche Performance, einen Spitzensportler, eine prominente Klimaaktivistin oder eine außergewöhnliche Bloggerin –, aber sie zeichnet auch die Singularität von Dingen und Objekten aus, etwa die vorgebliche Authentizität und Nichtaustauschbarkeit begehrter Waren, Güter und Marken, welche teilweise wie Kunstwerke verehrt werden. Sie unterzieht auch räumliche Einheiten einer Singularisierung – etwa Städte oder Landschaften als wiedererkennbare, »wertvolle« Orte – ebenso wie zeitliche Einheiten, die als singuläre Events oder erinnerbare Momente interessieren. Schließlich singularisiert die spätmoderne Gesellschaft sogar ihre Kollektive: vom Projekt und Netzwerk bis zur selbst gewählten »Neogemeinschaft«, etwa religiöser oder regionaler Art, die jeweils Unvergleichlichkeit beanspruchen. Die Bewertungssysteme der Spätmoderne gehen so regelmäßig auf Distanz zum lediglich Standardisierten und Funktionalen – zu den »mittelmäßigen« Individuen als bloßen Rollenträgern, den Dingen als schnöder Industrieware »von der Stange«, den »gesichtslosen« Räumen und den spannungsarmen, schnell vergessenen zeitlichen Routinen, schließlich den nüchtern-versachlichten Kollektiven etwa in Form zweckrationaler Organisationen – und richten das gesellschaftliche Interesse stattdessen an dem aus, was als singulär empfunden und valorisiert wird. Nur diesem wird Wert im eigentlichen Sinne beigemessen.
Plakativ gesagt, erweist sich die Spätmoderne damit als eine äußerst ambitionierte Gesellschaftsform, in der nicht mehr der Durchschnitt genügt, sondern von den Individuen, Dingen, Ereignissen, Orten und Kollektiven erwartet wird, dass sie diesen Durchschnitt hinter sich lassen. Erst die Singularisierung des Sozialen verspricht Befriedigung, Prestige und Identifikationskraft, erst sie macht die Menschen und die Welt aus Sicht der spätmodernen Kultur wertvoll. Die Transformation von der Gesellschaft der Gleichen zur Gesellschaft der Singularitäten hat dabei mehrere Ursachen: Der ökonomische Strukturwandel vom industriellen zum kognitiv-kulturellen Kapitalismus, die technologische Revolution der Digitalisierung, schließlich der soziokulturelle Prozess, in dem eine neue, urbane Mittelklasse von hochqualifizierten, an Selbstentfaltung und individuellem Prestige orientierten Akademikern zum neuen Leitmilieu der Gesellschaft avanciert, stellen sich als die wichtigsten heraus.
Die »singularistische« Struktur der spätmodernen Gesellschaft trägt jedoch ihre Kehrseite notwendigerweise mit sich: das, was nicht singulär sein kann, will oder darf. Es wird abgewertet, bleibt unsichtbar im Hintergrund und erhält – wenn überhaupt – nur minimale Anerkennung. Es scheint wertlos. Den Gewinnern stehen so unweigerlich Verlierer gegenüber, der Aufwertung die Abwertung, die Entwertung. Diese Einsicht ist zentral: Die Singularisierung des Sozialen ist kein linearer Prozess, in dem gewissermaßen jeder, jede und jedes in ihrer Besonderheit Anerkennung erhält. Durch die Singularisierungsprozesse hindurch betreten wir mitnichten ein postmodernes »Reich der Freiheit«, welches das industrielle »Reich der Notwendigkeit« hinter sich gelassen hätte. Vielmehr bedeutet die gesellschaftliche Prämierung des Singulären die Abwertung von jenem, was nunmehr als standardisiert oder massenhaft im Hintergrund verschwindet. Die allseitige Singularisierung des Sozialen erzeugt also unter gegenwärtigen Bedingungen unweigerlich und systematisch strukturelle Asymmetrien und Disparitäten.
Diese Doppelstruktur von Singularisierung und Polarisierung gilt für alle Dimensionen der tektonischen Verschiebung, welche die spätmodernen Gesellschaften erleben. Einige von ihnen verfolge ich in den Aufsätzen dieses Bandes:
Im Bereich der Ökonomie findet der ehrgeizige, global vernetzte kognitiv-kulturelle Kapitalismus, der auf die Entwicklung komplexer Güter – Dinge, Dienste, Ereignisse, mediale Formate – mit hoher Innovationsdynamik, Kreativität und Anziehungskraft ausgerichtet ist, seine Kehrseite im Bedeutungsgewinn der sogenannten einfachen Dienstleistungen, der Routinejobs und repetitiven Arbeiten von Niedrigqualifizierten, deren Prestige und soziale Sicherheit gering sind. Im kognitiv-kulturellen Kapitalismus herrschen umgekehrt Marktstrukturen, die einer Winner-take-all-Logik folgen, so dass die extrem lukrativen Güter – vom Hightech-Medikament über den Spitzenfußballer und das weltweit anerkannte Kunstwerk bis zur Immobilie in ausgesuchter Lage – Reichtumsproduktion im Übermaß ermöglichen.
Im spätmodernen Bildungssystem sind der rapide gewachsene Anteil von Hochschulabsolventen und der eifrige Profilierungswettbewerb zwischen den Schulen und Universitäten sowie zwischen den Absolventen um Exzellenz und Alleinstellung nur die eine Seite. Die Kehrseite der Akademisierung ist die indirekte Abwertung der niedrigen oder mittleren Bildungsabschlüsse: was früher Normalmaß war, gilt heute noch nicht einmal mehr als Durchschnitt.
Hohe Ambition und Entwertung gehen auch im Bereich der Lebensformen Hand in Hand. Das Lebensmodell der »erfolgreichen Selbstverwirklichung«, das nach der Einzigartigkeit des eigenen Lebens trachtet und Singularitätskapital anhäuft, macht die Gestaltung des Alltags und der Biografie, von Beruf, Freizeit und Familienleben zu einer ambitionierten Herausforderung. Es wird von der neuen Mittelklasse getragen. Die Kehrseite dieses Prozesses findet sich in der subtilen kulturellen Abwertung oder auch massiven sozialen Deklassierung, welche die traditionelle Mittelklasse und die prekäre Klasse erfahren. Hinzu kommt, dass jedoch auch in der neuen Mittelklasse die Frustration bei jenen groß ist, die den eigenen ambitionierten Maßstäben nicht zu genügen vermögen: Der singularistische Lebensstil enthält ein systematisch begründetes hohes Enttäuschungspotenzial.
Auch die digitale Welt basiert auf einer fundamentalen Asymmetrie: zwischen jenen Individuen (und auch: Gütern, Orten, Institutionen), die Aufmerksamkeit und Wertschätzung – teilweise im Übermaß – auf sich versammeln, und jenen, die weitgehend unsichtbar bleiben, die schlecht vernetzt und isoliert sind, denen es an Anerkennung mangelt – oder die gar ins Zentrum negativer Aufmerksamkeit wie Verachtung oder Hass geraten.
Auf der Ebene der räumlichen Strukturen ist für die Spätmoderne der Boom der Metropolregionen kennzeichnend. Attraktiv scheinende Städte ziehen neue Wirtschaftsbranchen und Arbeitskräfte sowie Besucher an, und es findet ein überregionaler Wettbewerb um urbane Lebensqualität statt. Auf diese Weise entstehen auf der anderen Seite »abgehängte« Regionen, die in eine Abwärtsspirale von Abwanderung und Attraktivitätsverlust geraten.
Dass der Singularismus der spätmodernen Gesellschaft am Ende auch zu Polarisierungen im Feld des Politischen führt, ist nur folgerichtig. Seit den 1980er Jahren wird ein neuer Liberalismus dominant, der radikal auf Wettbewerb und Differenz, auf eine Dynamisierung und globale Entgrenzung des Sozialen, Ökonomischen und Kulturellen setzt. Als Reaktion auf diesen Liberalismus ist mittlerweile der Aufstieg eines aggressiven Populismus zu beobachten, der eine soziale Schließung der Nationalstaaten propagiert. Er wird vor allem von jenen Bevölkerungsgruppen gestützt, die unter die Räder des liberalen Modernisierungsprogramms geraten sind oder zu geraten drohen. Im Populismus artikuliert sich so die verdrängte Kehrseite der Gesellschaft der Singularitäten.
***
Im ersten Aufsatz – »Kulturkonflikte als Kampf um die Kultur: Hyperkultur und Kulturessenzialismus« – behandele ich die Frage, in welcher Weise die spätmodernen Gesellschaften von einem Konflikt um Kultur und Identität geprägt sind. Gegen Samuel Huntingtons prominente These, wir hätten es mit einem Kampf zwischen den Kulturkreisen zu tun, zeige ich, dass sich weltweit zwei grundsätzlich konträre Umgangsweisen mit der Kultur gegenüberstehen. In der einen, der Hyperkultur, gibt die Kultur der Selbstentfaltung von Individuen eine Form und der Diversität auf globalen Märkten einen Raum, in der zweiten Umgangsweise, dem Kulturessenzialismus, wird Kultur als fester Ort beziehungsweise als Medium der kollektiven Identität von Gemeinschaften begriffen. Es stellt sich die Frage nach dem Verhältnis zwischen diesen beiden Formen der »Kulturalisierung« und ob es eine Alternative zu beiden gibt.
Der zweite Text – »Von der nivellierten Mittelstandsgesellschaft zur Drei-Klassen-Gesellschaft: Neue Mittelklasse, alte Mittelklasse, prekäre Klasse« – untersucht die neue Differenzierung, welche die Sozialstruktur in den westlichen Ländern kennzeichnet, und fragt nach ihren Ursachen. Aus der Erbmasse der allumfassenden Mittelschicht der industriellen Moderne hat sich im Zuge der Postindustrialisierung und der Bildungsexpansion eine neue Dreier-Struktur der Klassen herausgebildet. Auf der einen Seite ist eine hochgebildete, urbane neue Mittelklasse emporgestiegen – das neue Leitmilieu der Spätmoderne –, auf der anderen eine neue prekäre Unterklasse vor allem von Mitgliedern eines Dienstleistungsproletariats nach unten abgerutscht. Zwischen beiden verharrt die traditionelle, an Ordnung und Sesshaftigkeit orientierte Mittelklasse. Es zeigt sich, dass das Verhältnis der Klassen zueinander nicht auf materielle Ungleichheiten zu reduzieren ist, sondern der kulturelle Faktor der symbolischen Auf- und Abwertung grundlegend wirkt.
»Jenseits der Industriegesellschaft: Polarisierter Postindustrialismus und kognitiv-kultureller Kapitalismus« widmet sich dem Strukturwandel des westlichen Kapitalismus. Die Industrieökonomie hat im Westen ihre strukturbildende Bedeutung verloren. Aber was bedeutet es, dass wir in einer postindustriellen Ökonomie leben? Der Aufsatz erklärt die Transformation von der industriellen zur postindustriellen Ökonomie als Antwort auf eine doppelte Sättigungs- und Produktivitätskrise. Er arbeitet die Merkmale heraus, welche die Güter in einem kognitiven Kapitalismus erhalten, der auf intangible assets, Wissensarbeit und Skalierbarkeit beruht. Und er untersucht die Mechanismen eines kulturellen Kapitalismus, dessen Märkte von der variablen Reputation abhängen, welche die symbolischen Güter aus Sicht der Konsumenten erlangen. Der kognitiv-kulturelle Kapitalismus erweist sich als ein Kapitalismus der Extreme, der auch einer tiefgreifenden Ökonomisierung des Sozialen den Weg bereitet.
In »Erschöpfte Selbstverwirklichung. Das spätmoderne Individuum und die Paradoxien seiner Emotionskultur« betrachte ich die kulturell dominante Lebensform des spätmodernen Selbst in ihrer alltagspraktischen und psychischen Dynamik. Was bedeutet es, ein Leben zu führen, das die »romantische« Aspiration der Entfaltung des Selbst und das »bürgerliche« Ziel des sozialen Erfolgs miteinander zu verknüpfen versucht? Der Aufsatz weist auf die Dilemmata einer spätmodernen Lebensform hin, in der subjektives Erleben und psychische Befriedigung zu fragilen Maßstäben des gelungenen Lebens geworden sind. Sie wird geprägt von einer paradoxen Emotionskultur, die einerseits im Extrem auf positive Gefühle als Lebensziel setzt, die aber zugleich keinen Umgang mit negativen Gefühlen, mit jenen Enttäuschungen und Frustrationen vermittelt, die sie systematisch hervorbringt.
Der abschließende Text – »Die Krise des Liberalismus und die Suche nach dem neuen politischen Paradigma: Vom apertistischen zum einbettenden Liberalismus« – wendet sich der aktuellen politischen Krise zu, in der Liberalismus und Populismus einander gegenüberstehen. Ich entwickele eine alternative Lesart der politischen Entwicklung seit 1945, die dort weniger einen Wechsel zwischen links und rechts, sondern vielmehr eine Transformation von übergreifenden politischen Paradigmen der gesellschaftlichen Regulierung und der Dynamisierung am Werk sieht. Die aktuelle Krise jenes Liberalismus, der seit den 1980er Jahren als Synthese von Neoliberalismus und Linksliberalismus dominiert, lässt sich so als eine »Überdynamisierungskrise« interpretieren. Es stellt sich die Frage, welche Anforderungen an einen »einbettenden Liberalismus« zu stellen sind, der dieses Paradigma ablösen und zugleich eine Alternative zur Welle des Populismus bieten kann.
Mit Ausnahme des ersten Aufsatzes, der in zwei früheren Fassungen bereits publiziert wurde,[11] sind die vorliegenden Texte eigens für diesen Band verfasst worden. Ich habe sie so geschrieben, dass sie sich unabhängig voneinander lesen und verstehen lassen. Auch wird keine Reihenfolge der Lektüre nahegelegt: Die Leserin und der Leser sollen einfach ihrer Neugier und ihrem Interesse folgen!
Ich bedanke mich bei meiner Lektorin Eva Gilmer für ihre sorgfältige Lektüre sowie bei Moritz Plewa und Julius Voigt für ihre redaktionelle Hilfe.
1 Kulturkonflikte als Kampf um die Kultur: Hyperkultur und Kulturessenzialismus
Vor etwa einem Vierteljahrhundert, kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs formulierte der amerikanische Politikwissenschaftler Samuel Huntington in seinem viel zitierten Buch The Clash of Civilizations eine irritierende These.[12] Huntington nahm an, dass das Ende des Ost-West-Konflikts nicht zu immerwährendem Frieden führen werde. Vielmehr formiere sich eine neue, unübersichtlichere und bedrohliche Konfliktlage: ein globaler Kampf der Kulturen, zwischen dem Westen, Russland, China, Indien, der arabischen Welt und anderen Teilen der Erde. Huntingtons These stieß zunächst auf Ablehnung. In den 1990er Jahren wehte der Wind eines grenzenlosen liberalen Optimismus der Globalisierung, und die meisten Beobachter gingen von einem weltweiten Siegeszug der Modernisierung westlicher Prägung aus. Es ist anders gekommen – was wir gegenwärtig beobachten, ist ganz offensichtlich eine Potenzierung neuer kultureller Konflikte: die Terroranschläge des islamistischen Fundamentalismus, die nationalistischen Tendenzen in Ost- und Südosteuropa, die selbstbewusste Verteidigung der eigenen Kultur in China oder Indien und schließlich die rechtspopulistischen Zentrifugalkräfte im Westen selbst, überraschenderweise auch in dessen Kernstaaten Frankreich und den USA.
Angesichts der komplizierten Gemengelage fällt es zunächst leicht, auf Samuel Huntingtons These vom Kampf der Kulturen zurückzugreifen. Huntingtons These ist verführerisch, aber letztlich deutlich zu einfach. Zweifellos: In den Konflikten geht es sowohl innerhalb der Nationalgesellschaften als auch auf globaler Ebene häufig um Kultur, und die Frage nach der Kultur ist eng mit jener nach der Identität verknüpft. Hinzu kommt, dass in den spätmodernen Gesellschaften der Gegenwart der Kultur ein Stellenwert zukommt, der sich kaum überschätzen lässt. Es ist geradezu verblüffend, wie häufig und intensiv Fragen der Kultur – von den »Parallelkulturen« bis zur »Leitkultur« – heute in den öffentlichen Debatten zum Streitthema werden. Aber im Unterschied zu Huntington sollte man in diesen Auseinandersetzungen keinen simplen Kampf der Kulturen, sondern etwas anderes sehen: einen Konflikt um die Kultur, das heißt eine Auseinandersetzung darüber, was unter Kultur verstanden wird und wie man mit ihr umgeht. Statt einen antagonistischen Kampf zwischen diversen Kulturen und ihren kulturellen Mustern zu behaupten, beobachten wir – dies ist meine Ausgangsthese – in der Spätmoderne einen sehr viel grundsätzlicheren Widerstreit zwischen dem, was ich zwei konträr aufgebaute Regime der Kulturalisierung nennen will. Nicht unterschiedliche kulturelle Muster stehen einander gegenüber, sondern – noch elementarer – zwei gegensätzliche Auffassungen darüber, was Kultur überhaupt bedeutet, und dementsprechend zwei konträre Formate, in denen Kultur organisiert ist.
In der Spätmoderne findet eine Kulturalisierung des Sozialen auf breiter Front statt, die zwei unterschiedliche Formen annimmt: Auf der einen Seite – ich spreche hier von Kulturalisierung I – beobachten wir eine Kulturalisierung der Lebensformen, in der nach Selbstentfaltung strebende Individuen sich Versatzstücke der Kultur aus einem mobilen globalen Markt kultureller Güter zusammenstellen. Hierbei handelt es sich um ein kosmopolitisches Kulturverständnis, das man als Hyperkultur bezeichnen kann. Auf der anderen Seite ist eine Kulturalisierung zu beobachten, die sich auf Kollektive richtet und sie als moralische Identitätsgemeinschaften aufbaut. Diese Kulturalisierung II arbeitet mit einem Innen-Außen-Dualismus und gehorcht dem Modell homogener Gemeinschaften, die als imagined communities in die Welt gesetzt werden. Das entsprechende Modell der Kultur ist das eines Kulturessenzialismus, den man in mannigfachen Ausformungen findet. Die Spätmoderne ist durch einen elementaren Konflikt zwischen diesen beiden Kulturalisierungsregimen gekennzeichnet.
Die Kulturalisierung des Sozialen
»Kulturalisierung« mag zunächst als Begriff merkwürdig klingen. Wir kennen in der Soziologie eine Reihe von Begriffen, welche die Endung »-ierung« enthalten und damit eine Steigerung und Intensivierung bezeichnen: Modernisierung, Rationalisierung, Individualisierung, Differenzierung etc. In vergleichbarer Weise müsste der Begriff der Kulturalisierung dann eine Ausdehnung von Kultur in Bereiche bedeuten, wo bisher keine Kultur war. Aber was kann das bedeuten, wenn mittlerweile doch Konsens darüber zu bestehen scheint, dass gewissermaßen alles Kultur »ist«, insofern als jedes menschliche Handeln erst vor dem Hintergrund von Sinnzusammenhängen und Bedeutungswelten zu dem wird, was es ist? Um dem Begriff der Kulturalisierung trotz dieser ersten Bedenken eine sozial- und gesellschaftstheoretische Bedeutung zu geben, sind zwei Unterscheidungen wichtig: erstens die zwischen Kultur in einem weiten, aber schwachen und Kultur in einem engen, aber starken Sinne; zweitens die Unterscheidung zwischen Rationalisierung und Kulturalisierung.
Was ist ganz generell unter Kultur zu verstehen? Und was ist ihr Ort in der modernen Gesellschaft? Kultur ist sicher einer der umstrittensten und schillerndsten Begriffe der Geistes- und Sozialwissenschaften. Der britische Soziologe Raymond Williams hat ihn zugleich als einen der Schlüsselbegriffe der Moderne bezeichnet, der sich nicht zufällig seit Ende des 18. Jahrhunderts, also mit dem Aufstieg der Moderne selbst, verbreitet hat.[13] Es gab und gibt ganz unterschiedliche Definitionen von Kultur.[14] In der frühen Moderne hat man Kultur als ausgezeichnete, besonders hervorzuhebende Lebensweise von Individuen verstanden: Kultur haben dann wenige – der Adel, das Bürgertum, die Geistesaristokratie –, während es dem Rest, also den meisten Menschen, angeblich daran mangelt. Alternativ hat Herder in der deutschen Romantik Kultur als die ganze Lebensweise eines Volkes bezeichnet: Die »deutsche Kultur« ist dann eine andere als die der Chinesen. Dieses Kulturverständnis von Kultur als Eigenschaft einer Gruppe scheint auch Huntington zu teilen. Kultur kann man dagegen auch sehr eng verstehen; dies ist etwa in den Kultusministerien der Fall, wo häufig von »Kunst und Kultur« die Rede ist und Kultur mit der Hochkultur der Bildung, der Künste, vielleicht noch der Religion identifiziert wird. Die Kulturwissenschaften des 20. Jahrhunderts haben demgegenüber den Kulturbegriff radikal ausgeweitet. Für Ernst Cassirer beispielsweise ist Kultur die jeweilige Weise, wie die Welt wahrgenommen wird, wie sie in Weltbildern und alltäglichen Vorstellungen interpretiert und welche Bedeutung ihr zugeschrieben wird.[15]
Dieses letzte, weite kulturwissenschaftliche Verständnis von Kultur ist in vielerlei Hinsicht sinnvoll und nützlich. Jede Handlungspraxis kann so als kulturell verstanden werden, indem man herausarbeitet, welche Definitionen und Begriffe, welche Unterscheidungen und interpretativen Vorannahmen in ihr enthalten sind. Nicht nur Religion oder Kunst sind dann kulturell, auch die Natur, die Geschlechter oder die Technik haben insofern eine kulturelle Dimension, als sie von sozialen Bedeutungswelten abhängen, die Natur, Geschlecht oder Technik auf bestimmte Weise definieren und interpretieren. Trotzdem benötigen wir für ein Verständnis der Rolle der Kultur in der Moderne neben diesem zugleich weiten und schwachen Begriff des Kulturellen noch einen engen und zugleich starken Begriff von Kultur. Im weiten kulturwissenschaftlichen Verständnis ist gewissermaßen alles Kultur, weil überall Bedeutungen am Werk sind. Das enge Verständnis sieht Kultur hingegen nur dort, wo es um Wert geht.[16] Das ist mein Ausgangspunkt: Kultur und Wert hängen untrennbar miteinander zusammen. Im Feld der Kultur wird bestimmten Dingen Wert zugeschrieben, sie werden mit Wert aufgeladen und anderen wird Wert abgesprochen. Das Feld der Kultur ist somit der dynamische gesellschaftliche Bereich, in dem man einerseits »valorisiert«, also Wert zuschreibt, andererseits devalorisiert, also Wert abspricht, entwertet. Dem Wertvollen auf der einen steht das Wertlose auf der anderen Seite gegenüber. Wohlgemerkt: Hier geht es nicht bloß darum, dass Individuen Werte »haben«, die etwa anlässlich von Meinungsumfragen abgefragt werden. Es geht vielmehr darum, dass in gesellschaftlichen Prozessen Elementen der Welt Wert zugeschrieben oder abgesprochen wird, das heißt, um den hochgradig dynamischen und häufig auch konfliktbeladenen Prozess des doing value. Auf diese Weise wertvoll werden können Kunstwerke oder bestimmte Individuen, Götter oder ein ethischer Kodex, Popmusik oder Altbauwohnungen, Mode, YouTube-Videos oder das Grundgesetz.
Jede menschliche Gesellschaft hat nun ihre eigene Sphäre der Kultur, das heißt ihre Verfahren, um bestimmten Dingen, Räumen, Ereignissen, Gruppen oder Subjekten Wert zuzuschreiben und anderen abzusprechen. Dies gilt auch für die moderne Gesellschaft, die seit der Aufklärung, der Industrialisierung und den demokratischen Revolutionen Ende des 18. Jahrhunderts entstanden ist. Allerdings schien es lange so, als ob in der Moderne die Sphäre der Kultur nur eine marginale Rolle spielte und gegenüber der Sphäre des Nützlichen, Funktionalen und Effizienten ins Hintertreffen gerät. Denn die Kultur hat einen mächtigen Gegenspieler: die (formale) Rationalität. Wenn die Kultur die Sphäre der Wertaufladung und Entwertung ist, dann ist die Rationalität die Sphäre der Zweck-Mittel-Verfahren, der neutralen Prozeduren, Gesetze und kognitiven Prozesse. Vom französischen Soziologen Émile Durkheim kann man hier die klassische Unterscheidung zwischen dem Sakralen und dem Profanen entlehnen.[17] Die Sphäre der Kultur verhandelt dann die großen und kleinen Formen des Sakralen, von Gott bis zum Konsumobjekt, wohingegen in der Sphäre der Rationalität das Profane, das Sachliche und Leidenschaftslose zu Hause ist, das Entzauberte. Die positiven und negativen Valorisierungen der Kultur sind mit starken Emotionen und Affekten verknüpft, während das Profane der Rationalität vergleichsweise emotionsarm bleibt.
Die moderne Gesellschaft hat nun von Anfang an im Extrem Systeme der Rationalität entwickelt. Wie Max Weber es einleuchtend auf den Begriff brachte, setzt die Moderne mit Macht auf formale Rationalisierung und Effizienzsteigerung in der Technik, in der Wirtschaft, im Staat und in der Wissenschaft.[18]Die klassische Moderne (also die bürgerliche Moderne des 19. Jahrhunderts und die industrielle Moderne der ersten zwei Drittel des 20. Jahrhunderts) war so weitgehend versachlicht und säkularisiert. Kultur fristete hier nur ein Schattendasein am Rande, bestenfalls in der Kunst und den Resten der Religion angesiedelt. Die traditionell am Bildungsbürgertum orientierten Kulturinstitutionen wie Theater, Konzerthäuser und Museen bildeten in dieser Phase gewissermaßen Inseln der Kultur, die einem relativ begrenzten Publikum eine temporäre Flucht aus beziehungsweise eine Alternative zu der ansonsten dominanten Logik der industriellen Zweckrationalität boten. Mit diesem insularen Dasein der Kultur ist es jedoch spätestens seit den 1970er Jahren vorbei, denn von da ab – und dies markiert aus meiner Sicht den Übergang von der klassischen Moderne zur Spätmoderne (oder Postmoderne) – haben die Gesellschaften westlicher Prägung damit begonnen, sich zu kulturalisieren.[19] Sukzessive hat sich die Sphäre der Kultur gegenüber der Sphäre der Rationalität ausgedehnt. Natürlich: Es gab (und gibt) nach wie vor mächtige Prozesse der Rationalisierung, aber die Kultur als Sphäre der Valorisierungsdynamik dehnt sich in der Spätmoderne aus, weil immer mehr Dinge – jenseits der Frage nach Nutzen, Interessen und Funktion – in das kulturelle Spiel von Aufwertung und Abwertung hineingesogen werden. Das Soziale nimmt in der Spätmoderne immer mehr an einer Logik der Wertzuschreibung, der Identität und der Affektivität teil, welche die profane Sphäre der Funktionalität hinter sich lässt. Allerdings wird diese Kulturalisierung in zwei Formen realisiert, die gegensätzlich zueinander aufgebaut sind: als Hyperkultur oder als Kulturessenzialismus.
Kulturalisierung I: Hyperkultur
Die Kulturalisierungsform der Hyperkultur hat sich seit den 1980er Jahren zur Taktgeberin der Spätmoderne entwickelt, getragen von einer neuen kosmopolitischen Mittelklasse, die sich bevorzugt in den urbanen Zentren der westlichen Gesellschaften ballt, aber zunehmend auch die aufstrebenden Städte des globalen Südens erobert. Mit »Kultur« ist im Zusammenhang der Hyperkultur nicht mehr die Hochkultur des Bildungsbürgertums gemeint, aber auch nicht die konforme und homogene Massenkultur der Nachkriegszeit. Vielmehr bezieht sich Kultur nun auf die Pluralität kultureller Güter, die auf globalen Märkten zirkulieren und den Individuen Ressourcen für ihre Selbstentfaltung zur Verfügung stellen. Anders gesagt: Die Hyperkultur begreift die globale Kultur als ein einziges, riesiges Reservoir vielfältiger Ressourcen der Selbstverwirklichung, aus dem man schöpfen kann – die japanische Kampfkunst Aikido oder das indische Yoga, das skandinavische Design, die französischen Kinofilme oder die amerikanischen Computerspiele, die kreolische oder süddeutsche Küche, den Städtetrip, den Aktivurlaub oder die Themenreise, die Weltmusik oder das Kunstmuseum usw. usf.[20]
Die Hyperkultur ist tatsächlich Überkultur, das heißt eine Art übergreifendes, dynamisches Prinzip, das eine Sphäre kreiert, in der potenziell alles in höchst variabler Weise zum Gegenstand von Wert werden kann, aber natürlich nicht alles gleichermaßen von Wert ist. Entscheidend für die Kulturalisierung der Hyperkultur sind zwei Instanzen: einerseits Güter, die sich auf kulturellen Märkten bewegen, andererseits Subjekte, die den Gütern mit einem Wunsch nach Selbstentfaltung begegnen. Kultur findet in dieser globalen Hyperkultur immer auf kulturellen Märkten statt, auf denen kulturelle Güter miteinander im Wettbewerb stehen.[21] Im Hintergrund der kommerziellen Konkurrenz befindet sich hier ein grundlegender Wettbewerb zwischen den Gütern um die knappen Größen der Aufmerksamkeit und der positiven Valorisierung. Die Kultursphäre der Hyperkultur bildet gewissermaßen einen Markt, auf dem um Sichtbarkeit, Attraktivität und die Nobilitierung als wertvoll konkurriert wird. Dieser Markt ist hochgradig dynamisch und unberechenbar. Er ist häufig am Neuen, am Innovativen und Kreativen ausgerichtet, das Überraschungen verspricht, er wertschätzt jedoch auch jene kulturellen Güter, die langfristig den Status von Klassikern erreicht haben.
Die zentrale Stütze der Märkte der Hyperkultur ist der globale kulturelle Kapitalismus, die stetig wachsende creative economy von der Computer- und Internetbranche über Design und Architektur bis zum Tourismus.[22] Diese Ökonomie liefert die Basis der postindustriellen Gesellschaft, in deren Metropolen kulturelle Objekte und Räume wie Stile, Moden oder Szenen unmittelbar aufeinandertreffen und so als das genannte Reservoir der Hyperkultur zur Verfügung stehen. Interessanterweise transformiert sich das überregionale System der Städte dabei seinerseits mehr und mehr in einen kulturellen Markt, auf dem national oder auch global ein Wettbewerb um Bewohner, Investoren und Besucher stattfindet. Die einzelne Stadt ist zum kulturellen Gut geworden, das Aufmerksamkeit und Wert beansprucht. Dies ist in der Tat neu: In der Industriegesellschaft sollten Städte im Wesentlichen Funktionen des Arbeitens und Wohnens erfüllen, in der Spätmoderne hingegen werden Berlin und Seattle, Amsterdam und Singapur, São Paulo und Melbourne, Kapstadt und Freiburg kulturell gedacht, das heißt entlang von Eigenschaften wie Attraktivität und Authentizität, Interessantheit und Lebensqualität bewertet. Sie befinden sich untereinander im Wettbewerb um eine Anerkennung nicht nur ihrer Funktion, sondern auch ihres Wertes.[23]