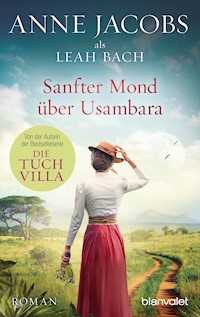10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Tuchvilla-Saga
- Sprache: Deutsch
Das Schicksal einer Familie in einer bewegten Zeit. Und eine Liebe, die alles überwindet.
Augsburg, 1920. In der Tuchvilla blickt man voller Optimismus in die Zukunft. Paul Melzer ist aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück und übernimmt die Leitung der Tuchfabrik, um der Firma wieder zu altem Glanz zu verhelfen. Seine Schwester Elisabeth zieht mit einer neuen Liebe wieder im Herrenhaus der Familie ein. Und Pauls junge Frau Marie will sich einen lang gehegten Traum erfüllen: ihr eigenes Modeatelier. Ihre Modelle haben großen Erfolg, doch es kommt immer wieder zu Streitigkeiten mit Paul – bis Marie schließlich die Tuchvilla mit den Kindern verlässt …
SPIEGEL-Bestsellerautorin Anne Jacobs bei Blanvalet:
Die Tuchvilla-Saga:
1. Die Tuchvilla
2. Die Töchter der Tuchvilla
3. Das Erbe der Tuchvilla
4. Rückkehr in die Tuchvilla
Die Gutshaus-Saga:
1. Das Gutshaus. Glanzvolle Zeiten
2. Das Gutshaus. Stürmische Zeiten
3. Das Gutshaus. Zeit des Aufbruchs
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 826
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Augsburg, 1920.
Der Krieg ist vorbei, und nach einer entbehrungsreichen Zeit zieht das Glück wieder in die Tuchvilla ein. Auch Paul Melzer ist zurück und kann nun endlich die Verantwortung für den Familienbetrieb übernehmen. Gemeinsam mit Ernst von Klippstein bringt er die Fabrik auf Vordermann und verwirklicht seine Visionen. So kann sich auch Pauls junge Frau Marie ihrer eigentlichen Berufung widmen und ein kleines Modeatelier eröffnen. Bereits nach kurzer Zeit werden ihre traumhaften Modelle zum Erfolg, und schon bald kann Marie das junge Unternehmen vergrößern. Doch während das Atelier wächst und gedeiht, leidet ihre Ehe unter Pauls Eifersucht und den unaufhörlichen Streitereien. Die Fronten verhärten sich, und Paul stellt seiner Frau ein folgenreiches Ultimatum. Als Marie daraufhin mit den beiden Kindern aus der Tuchvilla auszieht, nimmt das Schicksal seinen Lauf …
Autorin
Anne Jacobs veröffentlichte unter anderem Namen bereits historische Romane und exotische Sagas. Mit Die Tuchvilla gestaltete sie ein Familienschicksal vor dem Hintergrund der jüngeren deutschen Geschichte und eroberte damit die Bestsellerliste. Nach der erfolgreichen Fortsetzung Die Töchter der Tuchvilla legt sie nun mit Das Erbe der Tuchvilla den Abschluss ihrer erfolgreichen Familiensaga vor.
Von Anne Jacobs außerdem bei Blanvalet lieferbar:
Die Tuchvilla
Die Töchter der Tuchvilla
Das Gutshaus - Glanzvolle Zeiten
Das Gutshaus - Stürmische Zeiten
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und
www.twitter.com/BlanvaletVerlag.
ANNE JACOBS
DAS
ERBE
Der
TUCHVILLA
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2016 by Blanvalet
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: René Stein
Covergestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesignCovermotiv: Richard Jenkins Photography und Shutterstock.com
NG · Herstellung: sam
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-18326-4V010
www.blanvalet.de
1
September 1923
Leo hatte es eilig. Auf der Treppe drängte er die Erstklässler zur Seite und schob sich an einer Gruppe schwatzender Mädchen vorbei – dann musste er stehenbleiben, weil hinter ihm jemand seinen Tornister festhielt.
»Immer schön der Reihe nach«, sagte Willi Abele hämisch. »Raffkes und Judenfreunde nach hinten.«
Das ging gegen seinen Papa. Und auf Walter, seinen besten und einzigen Freund. Der war heute krank und konnte sich nicht verteidigen.
»Lass los, sonst setzt es was!«, warnte er.
»Komm schon, Schlappohr … Trau dich …«
Leo versuchte sich zu befreien, aber der andere hielt eisern fest. Rechts und links brandete der Strom der Volksschüler an ihnen vorbei die Treppe hinunter auf den Schulhof und ergoss sich von dort in die Straße am Roten Torwall. Leo gelang es, seinen Widersacher mit sich bis in den Hof zu zerren, bevor ein Riemen des Tornisters riss. Er musste sich rasch umdrehen und zupacken, sonst würde sich Willi Schulranzen samt Büchern und Heften unter den Nagel reißen.
»Melzer – Stelzer – Hundekackewälzer …«, höhnte Willi und versuchte, die Schnalle an Leos Tornister zu öffnen.
Leo sah jetzt rot. Er kannte diesen Spruch, vor allem die Kinder aus den Arbeitervierteln riefen ihm gern solche Gemeinheiten hinterher. Weil er besser angezogen war und Julius ihn manchmal mit dem Automobil von der Schule abholte. Der Abele Willi war gut einen Kopf größer als Leo und zwei Jahre älter. Aber das zählte jetzt nicht. Ein fester Tritt gegen Willis Knie, Willi heulte auf und gab die Beute frei. Leo konnte seinen zurückeroberten Ranzen noch auf den Boden stellen, da hatte sich der andere schon auf ihn gestürzt. Beide gingen zu Boden. Schläge prasselten auf Leo ein, sein Jackenstoff riss, er hörte seinen Gegner keuchen und kämpfte verbissen gegen den Stärkeren an.
»Was ist hier los? Abele! Melzer! Auseinander!«
Es bewahrheitete sich der Spruch, dass die Ersten die Letzten sein werden, denn Willi, der als überlegener Kämpfer oben lag, bekam die strafende Hand von Lehrer Urban als Erster zu spüren. Leo hingegen wurde nur am Kragen gepackt und auf die Füße gestellt – seine blutende Nase bewahrte ihn vor der fälligen Maulschelle. Schweigend und mit verkniffenen Gesichtern hörten sich die beiden Knaben die Strafrede des Lehrers an, viel schlimmer war das hämische Grinsen und Flüstern der Mitschüler, die einen dichten Zuschauerkreis um die Streithähne gebildet hatten. Vor allem die Mädchen.
»Der hat’s ihm feste gegeben …«
»Wer die Kleinen haut, ist ein Feigling …«
»Geschieht dem Leo recht – eingebildet ist der …«
»Der Abele Willi ist doch ein Hundsfott …«
Lehrer Urbans Predigt rauschte indessen ungehört an ihnen vorbei. Er sagte sowieso immer das Gleiche. Jetzt musste Leo sein Taschentuch herausnehmen und sich die Nase putzen, dabei stellte er fest, dass der Saum des Jackenärmels ein Stück herausgerissen war. Während er sich das Gesicht abwischte, erntete er mitleidige und bewundernde Mädchenblicke, was ihm ausgesprochen peinlich war. Willi hingegen behauptete, der Melzer würde sich »anstellen« und wurde dafür von Lehrer Urban mit einer zweiten Maulschelle bedacht. Gut so.
»Und jetzt reicht euch die Hände …«
Sie kannten das Ritual, das nach jeder Prügelei fällig war und nicht das Mindeste bewirkte. Trotzdem nickten sie zu den Ermahnungen und versprachen, sich ab sofort zu vertragen. Das so arg gebeutelte deutsche Heimatland brauchte besonnene, fleißige junge Menschen und keine Raufbolde.
»Ab nach Hause!«
Das war die Erlösung. Leo hängte sich den lädierten Tornister über die Schulter und wäre gern losgerannt, doch er durfte auf keinen Fall den Eindruck erwecken, vor seinem Widersacher zu flüchten, daher ging er gemessenen Schrittes bis zum Schultor. Erst dann begann er zu laufen. In der Remboldstraße blieb er kurz stehen und blickte hasserfüllt auf das große Backsteingebäude zurück. Warum musste er auf die blöde Volksschule am Roten Torwall gehen? Papa hatte erzählt, dass er damals gleich ins Gymnasium Sankt Stephan gekommen sei. In eine Vorklasse. Da hatte es nur Knaben aus guten Familien gegeben, die bunte Mützen tragen durften. Es gab dort auch keine Mädchen. Aber die Republik wollte, dass alle Kinder zuerst in eine Volksschule gingen. Die Republik war ganz großer Mist. Alle schimpften darauf, besonders die Großmama. Die sagte immer, unter dem Kaiser sei alles viel besser gewesen.
Er schnäuzte sich noch einmal in sein Taschentuch und stellte fest, dass die Nase zum Glück nicht mehr blutete. Jetzt aber los, die warteten bestimmt schon. An Sankt Ulrich und Afra vorbei bergauf, durch ein paar Gässchen zum Milchberg und dann auf die Maximilianstra…
Wie angewurzelt blieb er stehen. Klaviermusik. Da spielte einer ein Stück, das er kannte. Leos Augen wanderten an den grau verputzten Wänden des Miethauses hinauf. Die Melodie erklang aus dem zweiten Stock, da stand ein Fensterflügel offen. Sehen konnte er nichts, eine weiße Tüllgardine war vorgezogen, aber wer immer da Klavier spielte, es klang famos. Wo hatte er diese Musik schon einmal gehört? Vielleicht bei einem Konzert des Kunstvereins, zu dem Mama ihn oft mitgenommen hatte? Es war so großartig und zugleich auch traurig. Und dann wieder durchzuckte es einen förmlich, wenn die Akkorde loshämmerten. Er hätte stundenlang dort stehen und zuhören können, aber jetzt unterbrach der Pianist sein Spiel, um sich eine Passage genauer vorzunehmen. Die wiederholte er immer wieder, es wurde einem ganz fad dabei.
»Da ist er ja!«
Leo fuhr zusammen. Das war unverkennbar Hennys helles, durchdringendes Organ. Aha, sie waren ihm entgegengekommen. Da hatten sie aber Glück gehabt, er hätte genauso gut eine andere Gasse nehmen können. Hand in Hand rannten die Mädels jetzt das Trottoir entlang auf ihn zu, Dodo mit fliegenden blonden Zöpfen, Henny im rosafarbigen Hängekleid, das Mama für sie genäht hatte. An ihrem Tornister baumelte noch ein Schwämmchen, denn Henny war erst in diesem Jahr in die Schule gekommen und lernte das Schreiben noch auf der Schiefertafel.
»Wieso starrst du in die Luft?«, wollte Dodo wissen, als sie keuchend vor ihm standen.
»Wir haben hundert Jahre auf dich gewartet!«, rief Henny vorwurfsvoll.
»Hundert Jahre? Dann wärst du ja schon längst tot!«
Henny ließ den Einwand nicht gelten. Sie hörte sowieso nur das, was ihr passte.
»Das nächste Mal gehen wir ohne dich …«
Leo zuckte die Schultern und schielte vorsichtig zu Dodo hinüber, doch die war nicht bereit, ihn zu verteidigen. Dabei wussten sie alle drei, dass er sie nur abholte, weil die Großmama es so wollte. Ihrer Ansicht nach gingen zwei siebenjährige Mädel nicht ohne Begleitung durch die Stadt, schon gar nicht in diesen unruhigen Zeiten. Daher hatte Leo den Auftrag, gleich nach Schulschluss hinüber zu St. Anna zu laufen, um Schwester und Cousine sicher zurück in die Tuchvilla zu bringen.
»Wie siehst du denn aus?« Dodo hatte jetzt den abgerissenen Ärmel entdeckt. Und auch das Blut, das auf seinen Kragen getröpfelt war.
»Ich? Wieso?«
»Du hast dich wieder geprügelt, Leo!«
»Ihhh! Ist das Blut?« Henny berührte mit ausgestrecktem Zeigefinger seinen Hemdkragen. Ob sie die roten Punkte eklig oder aufregend fand, war nicht so recht auszumachen. Leo schob ihre Hand weg.
»Lass das. Wir müssen jetzt los.«
Dodo musterte ihn immer noch eingehend, dabei machte sie schmale Augen und schob die Lippen vor. »Wieder der Abele Willi, was?«
Er nickte verdrossen.
»Wär ich doch nur dabei gewesen. Erst feste an den Haaren ziehen und dann … anspucken!«
Sie sagte das mit großem Ernst und nickte zweimal. Leo war gerührt, zugleich war es ihm aber auch peinlich. Dodo war seine Schwester, sie war mutig und stand immer zu ihm. Aber trotzdem war sie nur ein Mädchen.
»Jetzt kommt endlich«, rief Henny, für die die Prügelei längst abgehakt war. »Ich muss noch zu Merkle.«
Das war ein Umweg, den konnten sie sich jetzt schon gar nicht mehr leisten.
»Nicht heute. Wir sind spät dran …«
»Mama hat mir extra Geld gegeben, weil ich Kaffee kaufen soll.«
Immer wollte Henny herumkommandieren. Leo hatte sich vorgenommen, ganz genau aufzupassen, damit er ihr nicht mehr in die Falle ging. Aber es war nicht einfach, denn Henny fand immer einen vernünftig klingenden Grund. Wie heute: Kaffee kaufen!
»Ohne Kaffee kann Mama nicht leben, hat sie gesagt!«
»Willst du, dass wir zu spät zum Mittagessen kommen?«
»Willst du, dass meine Mama totgeht?«, fragte Henny empört zurück.
Sie hatte es wieder geschafft. Man steuerte die Karolinenstraße an, in der Frau Merkle ›Kaffee, Konfitüren und Tee‹ in einem kleinen Laden anbot. Solche Leckereien konnte sich nicht jeder leisten, Leo wusste, dass viele seiner Klassenkameraden nur einen Teller Graupensuppe zu Mittag bekamen; ein Schulfrühstück brachten sie schon gar nicht mit. Es tat ihm oft leid, ein paarmal hatte er sein Leberwurstbrot mit anderen geteilt. Meist mit Walter Ginsberg, seinem besten Freund. Seine Mutter hatte auch einen Laden, hinten in der Karlstraße, sie verkaufte Notenblätter und Musikinstrumente. Aber die Geschäfte gingen schlecht. Walters Papa war in Russland gefallen, zudem die Inflation. Weil alles immer teurer wurde und – wie Mama sagte – das Geld nichts mehr wert war. Gestern hatte die Köchin Frau Brunnenmayer gejammert, sie habe für ein Pfund Brot 30.000,– Mark zahlen müssen. Leo konnte schon bis tausend zählen. Das war dreißig mal Tausend. Gut, dass es seit dem Krieg kaum noch Münzen, sondern fast nur noch Scheine gab, sonst hätte die Brunnenmayer wohl einen Pferdewagen mieten müssen.
»Da schau mal – das Porzellanhaus Müller hat zugemacht«, sagte Dodo und wies auf die mit Zeitungspapier verklebten Schaufenster. »Da wird die Großmama traurig sein. Sie kauft doch hier immer die Kaffeetassen nach, wenn mal eine kaputtgeht.«
Das war mittlerweile nichts Ungewöhnliches mehr. Viele Läden in Augsburg waren geschlossen, und diejenigen, die noch geöffnet hatten, stellten nur uralte Ladenhüter in die Schaufenster. Papa hatte neulich beim Mittagessen gesagt, diese Betrüger hielten die guten Waren zurück, um auf bessere Zeiten zu warten.
»Guck mal, Dodo. Da gibt es Tanzbären …«
Leo sah verächtlich zu, wie sich die Mädels die Nasen an dem Schaufenster der Bäckerei plattdrückten. Klebrige Tanzbären aus rotem und grünem Fruchtgummi waren nichts für ihn.
»Kauf endlich den Kaffee, Henny«, schimpfte er. »Merkle ist gleich da drüben.«
Er stockte, weil ihm jetzt erst klar wurde, dass neben dem kleinen Laden von Frau Merkle das Sanitärgeschäft von Hugo Abele lag. Das gehörte den Eltern von Wilhelm Abele. Willi, dem Mistkerl. Ob der schon zu Hause war? Leo ging ein paar Schritte weiter und spähte über die Straße hinweg in das Schaufenster des Sanitärgeschäfts. Viel war nicht ausgestellt, nur ein paar Schläuche und Wasserhähne lagen dicht vor der Ladenscheibe. Weiter hinten thronte eine mattweiße Kloschüssel aus Porzellan. Er beschattete die Augen gegen die schräge Septembersonne und stellte fest, dass das edle Teil erstens ein blaues Firmenzeichen trug und zweitens schon ziemlich verstaubt war.
»Willst du vielleicht ’n Klo kaufen?«, fragte Dodo, die ihm gefolgt war.
»Nee.«
Dodo spähte nun auch hinüber und verzog das Gesicht. »Das ist das Geschäft von Willi Abeles Eltern – stimmt’s?«
»Hm …«
»Ist der Willi da drin?«
»Kann sein. Der muss immer helfen.«
Die Geschwister schauten sich an. Etwas blitzte in Dodos graublauen Augen.
»Ich geh mal rein.«
»Wozu?«, fragte er besorgt.
»Ich frag, was das Klo kostet.«
Leo schüttelte den Kopf. »Wir brauchen kein Klo.«
Aber Dodo war schon über die Straße gelaufen, gleich darauf war die Ladenklingel des Sanitärgeschäfts zu vernehmen. Dodo verschwand hinter der Eingangstür.
»Was macht sie da?«, wollte Henny wissen und hielt Leo eine Papiertüte voller Lakritztaler und Tanzbären vor die Nase.
Oha – da würde für den Kaffee wohl nicht viel Geld übrig geblieben sein. Er nahm sich einen Lakritztaler und ließ dabei das Sanitärgeschäft nicht aus den Augen. »Sie fragt nach dem Klo …«
Henny starrte ihn empört an, dann nahm sie sich einen grünen Tanzbären aus der Tüte und stopfte ihn in den Mund. »Du denkst wohl, ich bin dumm.«, knautschte sie beleidigt.
»Frag sie doch selber …«
Drüben öffnete sich die Ladentür, man sah Dodo, die einen höflichen Knicks machte und dann auf die Straße hinaustrat. Sie musste einen Moment lang warten, weil ein Pferdefuhrwerk vorüberrasselte, dann lief sie zu ihnen hinüber.
»Der Papa vom Willi ist im Laden. So ein großer mit einem grauen Schnurrbart. Der guckt so komisch, als wollte er einen fressen.«
»Und der Willi?«
Dodo grinste. Der Willi säße hinten und müsse Schrauben in kleine Schachteln sortieren. Sie hätte sich kurz zu ihm herumgedreht und ihm ganz weit die Zunge herausgestreckt.
»Der war vielleicht wütend. Aber weil sein Papa dabei war, durfte er nichts sagen.«
Und das Klo sollte zweihundert Millionen Mark kosten. Vorzugspreis.
»Zweihundert Mark?«, fragte Henny. »Das ist sehr teuer für ein so hässliches Klo.«
»Zweihundert Millionen«, verbesserte Dodo.
Keiner von ihnen konnte so weit zählen.
Henny senkte die Augenbrauen und blinzelte nachdenklich zu dem Schaufenster hinüber, in dessen Glasscheibe sich jetzt gleißend die Mittagssonne spiegelte. »Ich frag auch mal …«
»Nein! Bleibst du wohl hier … Henny!« Leo wollte sie am Arm fassen, doch sie schlüpfte geschickt an zwei älteren Frauen vorbei und Leo hatte das Nachsehen. Kopfschüttelnd blieb er zurück und sah zu, wie die blondgelockte Henny im rosa Hängekleidchen hinter der Ladentür verschwand. »Ja, spinnt ihr denn alle zwei?«, knurrte er Dodo an.
Sie liefen Hand in Hand über die Straße und schauten durch das Schaufenster in den Laden hinein. Tatsächlich – Willis Papa hatte einen grauen Schnurrbart, und er schaute wirklich so komisch. Vielleicht waren seine Augen entzündet? Willi saß ganz hinten an einem Tisch, der ganz mit kleinen und großen Pappschachteln bedeckt war. Man sah nur seinen Kopf und die Schultern.
»Meine Mama schickt mich«, piepste Henny drinnen, und sie schenkte Herrn Abele ihr schönstes Lächeln.
»Und wie heißt deine Mama?«
Henny lächelte noch mehr. Die Frage überhörte sie einfach.
»Meine Mama möchte gern wissen, was das Klo kostet …«
»Das im Schaufenster? Dreihundertfünfzig Millionen. Soll ich dir die Zahl aufschreiben?«
»Das wäre sehr nett von Ihnen.«
Während Herr Abele einen Zettel suchte, drehte sich Henny rasch zu Willi um. Was sie tat, konnte man nicht sehen, aber Willis Augen quollen hervor wie bei einem Fisch. Mit einem Papierfetzen in der Hand kam Henny stolz aus dem Laden und fand es unerhört, dass Dodo und Leo sie durch das Schaufenster beobachtet hatten.
»Zeig mal!« Dodo nahm Henny den Zettel aus der Hand. Da stand 350 in Ziffern und dahinter das Wort »Millionen«.
»So ein Gauner! Eben gerade waren es noch zweihundert Millionen!«, sagte Leo empört.
Henny konnte nicht einmal bis hundert zählen, aber dass dieser Mann ein Betrüger war, hatte sie verstanden. Solch ein Lump!
»Ich geh noch mal rein!«, rief Dodo entschlossen.
»Lass es besser«, warnte Leo.
»Jetzt erst recht!«
Leo und Henny blieben vor dem Laden zurück und spähten durch die Scheibe. Sie mussten ganz dicht herangehen und das Glas mit beiden Händen beschatten, weil das Sonnenlicht so spiegelte. Von drinnen war Dodos energische Stimme zu vernehmen, dann der tiefe Bass von Herrn Abele.
»Was willst du schon wieder?«, grummelte der Bass.
»Sie haben gesagt, das Klo kostet zweihundert Millionen.«
Er glotzte sie an, und Leo stellte sich vor, wie sich das Räderwerk im Gehirn von Herrn Abele mühsam in Bewegung setzte.
»Was hab ich gesagt?«
»Sie haben gesagt: zweihundert Millionen. Das stimmt doch, oder?«
Er schaute auf Dodo, dann zur Tür, schließlich hinüber zum Schaufenster, wo die weiße Porzellanschüssel stand. Dabei entdeckte er die beiden Kinder, die draußen an der Scheibe klebten.
»Lausegören!«, brüllte er wütend. »Jetzt aber raus hier. Ich lass mich auch noch foppen … Raus – oder ich mach euch Beine!«
»Und ich hab doch recht!«, beharrte Dodo furchtlos.
Dann machte sie eilig kehrt, weil Herr Abele sich bedrohlich genähert hatte und sogar den Arm ausstreckte, um sie bei den Zöpfen zu packen. Dicht vor der Ladentür hätte er sie fast erwischt, wenn nicht Leo die Tür von außen aufgerissen hätte, um sich schützend vor seine Schwester zu stellen.
»Rasselbande, verflixte«, brüllte Herr Abele. »Wollt mich zum Narren halten, wie? Da hast du dein Fett, Bürschlein.«
Leo duckte sich, aber Herr Abele hatte ihn beim Kragen seiner Jacke gefasst und die Ohrfeige traf seinen Hinterkopf.
»Schlagen Sie ja nicht meinen Bruder«, kreischte Dodo. »Sonst spuck ich Sie an.«
Sie spuckte tatsächlich, Herrn Abeles Jacke bekam etwas davon ab, leider traf sie auch Leos Hinterkopf. Im Laden war inzwischen Willis Mutter erschienen, eine kleine schmale Frau mit schwarzem Haar, hinter ihr kam Willi gelaufen.
»Die haben mir die Zunge rausgestreckt, Papa! Das ist der Melzer Leo. Wegen dem hat mich der Lehrer heut geohrfeigt!«
Beim Klang des Namens »Melzer« hielt Herr Abele inne, Leo zappelte heftig, weil er seinen Kragen nicht freigab.
»Melzer? Die Melzer aus der Tuchvilla etwa?«, fragte Herr Abele und drehte sich zu Willi um.
»Oh Gott!«, rief seine Frau und hielt sich die Hände vor den Mund. »Mach dich nicht unglücklich, Hugo. Lass das Kind los. Ich bitte dich!«
»Ob du ein Melzer aus der Tuchvilla bist?«, brüllte der Ladenbesitzer Leo an. Der nickte. Darauf gab Herr Abele seinen Jackenkragen frei.
»Dann nix für ungut«, brummte er. »Hab mich geirrt. Das Klo kostet dreihundert Millionen. Kannst es deinem Vater ausrichten.«
Leo rieb sich den Hinterkopf und rückte seine Jacke zurecht. Dodo sah den großen Mann missgünstig an.
»Bei Ihnen«, sagte sie hoheitsvoll. »bei Ihnen kaufen wir ganz bestimmt kein Klo. Nicht einmal, wenn es aus Gold wäre. Komm, Leo!«
Leo war noch ganz benommen. Ohne Widerspruch ließ er sich von Dodo bei der Hand nehmen und die Straße entlang in Richtung Jakobertor führen.
»Wenn der das dem Papa erzählt …«, stotterte er.
»Ach was!«, beruhigte ihn Dodo. »Der hat doch selber Schiss.«
»Wo ist überhaupt Henny?«, sagte Leo und blieb stehen.
Sie fanden Henny im Laden von Frau Merkle. Für das restliche Geld hatte sie doch tatsächlich noch ein ganzes Viertelpfund Kaffee bekommen.
»Weil wir so gute Kunden sind!«, strahlte sie.
2
Marie fuhr von ihrer Zeichnung auf, als die Tür geöffnet wurde.
»Paul! Oh Himmel – ist es schon Mittag? Ich habe vollkommen die Zeit vergessen!«
Er trat hinter sie, hauchte einen Kuss auf ihr Haar und warf dabei einen neugierigen Blick auf ihren Zeichenblock. Abendkleider entwarf sie. Sehr romantisch. Träume in Seide und Tüll. Und das in diesen Zeiten …
»Du sollst mir nicht über die Schulter schauen«, beschwerte sie sich und legte beide Hände auf ihr Zeichenblatt.
»Aber warum denn nicht, Schatz? Es ist wunderschön, was du zeichnest. Ein wenig … verspielt vielleicht.«
Sie hob den Kopf in den Nacken, und er berührte mit den Lippen zart ihre Stirn. Auch nach drei Jahren empfanden sie es als ein großes glückliches Geschenk, wieder beieinander sein zu dürfen. Manchmal wachte sie in der Nacht auf, geplagt von der schrecklichen Vorstellung, Paul sei noch im Krieg, dann schmiegte sie sich an seinen ruhenden Körper, spürte seinen Atem, seine Wärme und schlief beruhigt wieder ein. Sie wusste, dass es ihm ähnlich ging, denn oft fasste er ihre Hand, bevor sie einschliefen, als wolle er sie auch in seinen Träumen bei sich wissen.
»Das sind Ballkleider. Die dürfen verspielt sein. Willst du die Kostüme und die Röcke sehen, die ich entworfen habe? Schau …« Sie zog eine Mappe aus dem Stapel heraus. Seit Elisabeths Umzug nach Pommern stand ihr ehemaliges Zimmer Marie als Arbeitsraum zur Verfügung, in dem sie ihre Entwürfe zeichnete und auch dieses oder jenes Kleidungsstück nähte. Meist waren es jedoch Flick- und Ausbesserungsarbeiten, für die sie die Nähmaschine in Gang setzte.
Paul bewunderte die Entwürfe und behauptete, sie seien ungemein einfallsreich und sehr frech. Nur wunderte er sich, dass alles so lang und schmal ausfalle. Ob sie ihre Kostüme nur für Damen mit Bohnenstangenfigur konzipiere?
Marie kicherte. Sie war Pauls Witzeleien über ihre Arbeit gewohnt, wusste sie doch, dass er im Grunde stolz auf sie war. »Die neue Frau, mein Liebster, ist überschlank, sie trägt das Haar kurz, den Busen flach und die Hüften schmal. Sie schminkt sich auffällig, und sie raucht mit Zigarettenspitze.«
»Grauenhaft!«, stöhnte er. »Ich hoffe, dass du dir diese Mode nie zum Vorbild nehmen wirst, Marie. Es reicht, dass Kitty mit einem Bubikopf herumläuft.«
»Oh, kurzes Haar würde mir gewiss gut stehen.«
»Bitte nicht …«
Er sagte es so flehentlich, dass sie fast gelacht hätte. Nein – sie trug ihr Haar lang und steckte es tagsüber auf. Am Abend aber, wenn sie miteinander zu Bett gingen, setzte Marie sich vor den Spiegel, um die Frisur zu lösen, während Paul ihr dabei zusah. Tatsächlich war ihr Liebster in manchen Dingen ziemlich altmodisch.
»Sind die Kinder noch nicht da?«, fragte Marie jetzt. Sie sah auf die Pendeluhr an der Wand. Eine der wenigen Hinterlassenschaften von Elisabeth – die übrigen Möbel hatte sie bis auf das Sofa und zwei kleine Teppiche mitgenommen.
»Weder die Kinder noch Kitty«, meinte Paul vorwurfsvoll. »Unten im Esszimmer sitzt Mama einsam und verlassen am Mittagstisch.«
»Oh weh!«
Marie schlug die Mappe zu und erhob sich hastig. Alicia, Pauls Mutter, war in letzter Zeit oft kränklich und beklagte sich häufig, niemand habe Zeit für sie. Nicht einmal die Kinder, die tollten lieber im Park mit Augustes Gören herum, niemand kümmere sich um ihre Erziehung. Besonders die Mädchen seien schon ganz und gar »verwildert«. Zu ihrer Zeit habe man ein Fräulein engagiert, die habe die Mädchen im Haus gehalten, sie nützliche Dinge gelehrt und auf ihre charakterliche Entwicklung geachtet.
»Warte einen Moment, Marie!«
Paul verstellte ihr den Weg zur Tür und grinste dabei verschmitzt, als habe er einen Bubenstreich vor. Sie musste lachen. Oh, wie sie dieses Mienenspiel an ihm liebte!
»Ich wollte dir etwas mitteilen, mein Schatz«, sagte er. »So ganz unter uns, ohne Zuschauer.«
»Ach ja? Ganz unter uns? Ein Geheimnis?«
»Kein Geheimnis, Marie. Aber eine Überraschung. Etwas, das du dir schon lange gewünscht hast …«
Du liebe Güte, dachte sie. Was habe ich mir wohl gewünscht? Eigentlich bin ich vollkommen glücklich. Habe alles, was ich brauche. Vor allem ihn. Paul. Und die Kinder. Gut – wir haben auf ein drittes Kind gehofft, aber das wird sich gewiss irgendwann noch einstellen …
Er sah sie gespannt an und war ein wenig enttäuscht, als sie nur mit den Schultern zuckte.
»Du kommst nicht darauf? Pass auf. Stichwort: Nadel.«
»Nadel. Nähen. Faden. Fingerhut …«
»Kalt«, rief er. »Ganz kalt. Schaufenster.«
Das Spiel erschien ihr zwar lustig, gleichzeitig war sie voller Unruhe, weil Mama unten auf sie wartete. Außerdem waren jetzt die Stimmen der Kinder zu hören.
»Schaufenster. Ladenpreise. Brötchen. Würste …«
»Meine Güte!«, rief er lachend. »Jetzt bist du ganz auf dem Holzweg. Ich gebe dir noch eine Hilfe: Atelier.«
Atelier! Jetzt begriff sie. Oh Himmel – konnte das möglich sein?
»Ein Atelier?«, flüsterte sie. »Ein … Modeatelier?«
Er nickte und zog sie an sich. »Jawohl, mein Schatz. Ein richtiges kleines Modeatelier für dich ganz allein. ›Maries Damenmoden‹ wird über der Tür stehen. Ich weiß doch, wie lange du schon davon geträumt hast.«
Er hatte recht, es war ihr großer Traum gewesen. Aber über all den Veränderungen, die Pauls Rückkehr aus dem Krieg mit sich gebracht hatte, hatte sie ihn fast vergessen. Sie war froh und erleichtert gewesen, die Verantwortung für die Fabrik abgeben zu dürfen, um sich ganz der Familie und Paul zu widmen. Gut – zu Anfang hatte sie weiterhin an den geschäftlichen Gesprächen teilgenommen, das war unumgänglich gewesen, um Paul auf den neuesten Stand zu bringen. Dann aber hatte Paul ihr liebevoll, aber doch eindringlich klargemacht, dass die Geschicke der Melzer’schen Tuchfabrik von nun an wieder in seinen Händen und in denen seines Partners Ernst von Klippstein liegen würden. Das war gut und richtig so, zumal die Zeit drängte und wichtige Entscheidungen gefällt werden mussten. Paul hatte dies mit kluger Voraussicht getan – sein Vater wäre stolz auf ihn gewesen. Man hatte die Maschinen erneuert, alle Selfaktoren durch Ringspinnmaschinen ersetzt, die nach den Plänen ihres Vaters konstruiert worden waren. Von dem restlichen Kapital, das von Klippstein in die Fabrik einbrachte, hatte Paul einige Grundstücke sowie zwei Häuser in der Karolinenstraße erworben.
»Aber wie ist das auf einmal möglich?«
»Das Porzellanhaus Müller hat zugemacht.« Paul seufzte, die beiden alten Leute taten ihm leid.
Andererseits wusste Marie, dass die Schließung nicht unerwartet kam. Das Geschäft hatte schon seit Jahren kaum noch Umsatz gemacht, nun hatte die galoppierende Inflation ihm den Rest gegeben.
»Und was wird nun aus den beiden?«
Paul hob die Arme und ließ sie resigniert wieder fallen. Er würde das Ehepaar oben im Haus wohnen lassen. Dennoch würden sie Not leiden, denn auch die Kaufsumme für das Haus würde rasch von der Inflation gefressen werden.
»Wir werden ihnen hie und da unter die Arme greifen, Marie. Die Geschäftsräume und die Zimmer im ersten Stock aber werden dir gehören. Dort wirst du alle deine Träume verwirklichen.«
Sie war so gerührt, dass sie kaum sprechen konnte. Ach, es war ein solcher Beweis seiner Liebe zu ihr. Und zugleich hatte sie doch ein schlechtes Gewissen, ihre berufliche Zukunft auf dem Unglück des alten Ehepaares aufzubauen. Und dann dachte sie wieder, dass sie sich ja um die beiden kümmern würde, dass dies vielleicht sogar für die alten Leute ein Glück war, das vielen anderen, die in ähnlicher Lage waren, nicht widerfuhr.
»Freust du dich denn gar nicht?« Er nahm sie bei den Schultern und musterte ihre Züge mit leichter Enttäuschung.
Ach, er musste sie doch kennen. Sie war keine, die ihre Gefühle so rasch nach außen dringen ließ.
»Doch«, sagte sie lächelnd und lehnte sich an ihn. »Ich brauche nur ein wenig Zeit … Ich kann es noch kaum glauben. Ist es tatsächlich wahr?«
»So wahr ich hier stehe.«
Er wollte sie küssen, doch in diesem Augenblick wurde die Tür aufgerissen, und sie fuhren auseinander, als wären sie bei einer Sünde ertappt worden.
»Mama!«, rief Dodo vorwurfsvoll. »Was macht ihr denn hier? Großmama ist sehr ärgerlich, und Julius hat gesagt, länger kann er die Suppe nicht warmhalten!«
Leo warf nur einen kurzen Blick auf die Eltern und verschwand im Badezimmer. Henny dagegen zupfte an einem von Dodos Zöpfen.
»Dummkopf«, flüsterte sie. »Die wollten sich doch küssen.«
»Das geht dich überhaupt nichts an«, fuhr Dodo sie an. »Weil – das sind nämlich meine Eltern!«
Marie fasste Tochter und Nichte bei den Schultern und schob sie geradewegs durch den Flur in Richtung Bad. Man hörte den Essensgong, den Julius mit Ausdauer betätigte.
Kitty kam aus ihrem Zimmer und stöhnte laut, man könne in diesem Haus keine fünf Minuten kreativ arbeiten, ohne durch dieses alberne »Bim, bam, bum« gestört zu werden. »Hennylein – zeig mal deine Hände! Die kleben ja. Was ist das für ein Zeug? Tanzbären? Lauf schnell ins Bad und wasch dir die Finger … Wo ist denn nur Else? Wieso kümmert sie sich nicht um die Kinder? Ach Paulemann, du strahlst ja wie ein Honigkuchenpferd. Lass dich umarmen, Brüderlein.«
Marie ließ Paul und Kitty vorausgehen und lief rasch mit Henny und Dodo ins Bad, wo Leo mit kritischer Miene vor dem Spiegel stand und mit einem Lappen in seinem Gesicht herumwischte. Sofort fiel ihrem geübten Mutterblick ins Auge, dass er den Hemdkragen nach innen gesteckt hatte.
»Lass mal sehen, Leo. Aha. Lauf und zieh ein anderes Hemd an. Schnell. Henny – du musst nicht das ganze Bad vollspritzen. Dodo – das ist mein Handtuch, deines hängt dort drüben.«
Hatte sie gerade eben noch über die raffinierte Schleppe eines schwarzseidenen Abendkleides nachgedacht, so war sie jetzt wieder ganz in ihrer Mutterrolle. Leo hatte sich schon wieder geprügelt! Sie wollte vor Dodo und Henny nicht darauf eingehen, auch bei Tisch sollte nicht die Rede davon sein. Aber sie würde ein Gespräch unter vier Augen mit ihm führen. Sie wusste aus ihrer eigenen Kindheit im Waisenhaus, wie brutal und boshaft Kinder miteinander umgehen konnten. Sie selbst war damals mutterseelenallein gewesen. Das sollte ihren Kindern niemals passieren.
Als sie ins Esszimmer traten, saßen Paul und Kitty bereits auf ihren Plätzen. Paul war es gelungen, den Ärger seiner Mutter zu zerstreuen. Es brauchte nicht viel, ein kleiner Scherz, eine liebevolle Bemerkung – Alicia schmolz dahin, sobald ihr Sohn sich ihr zuwendete. Kitty hatte früher die gleiche Wirkung bei ihrem Vater erzielt, sie war sein Lieblingskind gewesen, sein Augenstern, sein kleines Prinzesschen, doch Johann Melzer weilte nun schon seit vier Jahren nicht mehr unter ihnen. Marie hatte hin und wieder das Gefühl, dass diese übergroße väterliche Liebe und Nachgiebigkeit Kitty nicht gut auf das Leben vorbereitet hatte. Sie liebte Kitty sehr, aber ihre Schwägerin würde wohl immer die verzogene, launenhafte Prinzessin bleiben.
»Lasst uns denn beten«, sagte Alicia feierlich, und alle falteten pflichtschuldigst die Hände auf dem Schoß. Nur Kitty drehte dabei die Augen zur stuckgeschmückten Zimmerdecke, was Marie angesichts der Kinder für nicht besonders klug befand.
»Herr, wir danken für die Gaben, die wir heut empfangen haben, lass uns froh zu Mittag essen und auch die Armen nicht vergessen. Amen.«
»Amen!«, wiederholte der Familienchor, wobei Pauls Stimme laut herausklang.
»Guten Appetit, meine Lieben …«
»Das wünschen wir dir auch, Mama …«
Früher, als Johann Melzer noch lebte, hatte es dieses tägliche Ritual bei Tisch noch nicht gegeben, jetzt aber bestand Alicia auf dem Tischgebet. Angeblich der Kinder wegen, die eine feste Ordnung brauchten, doch Marie wusste ebenso wie Kitty und Paul, dass es vielmehr Alicia war, die es so aus ihrer Kindheit kannte und nun als Witwe Trost darin fand. Seit dem Tod ihres Ehemannes trug sie Schwarz, die Freude an schönen Kleidern, Schmuck und bunten Farben war ihr vollkommen vergangen. Zum Glück schien sie – außer den üblichen Migräneanfällen – bei guter Gesundheit zu sein, aber Marie hatte sich vorgenommen, auf ihre Schwiegermutter zu achten.
Julius erschien mit der Suppenterrine, platzierte das gute Stück auf dem Tisch und begann, die Suppe zu verteilen. Er war seit drei Jahren als Hausdiener in der Tuchvilla beschäftigt, hatte jedoch Humberts Beliebtheit bei Herrschaft und Personal niemals erreichen können. Er war zuvor in einem adeligen Haushalt in München angestellt gewesen und schaute auf die Angestellten der Tuchvilla mit einer gewissen Hochnäsigkeit herab, was ihm wenig Sympathien eintrug.
»Schon wieder Graupen? Und dann auch noch mit Rübchen …«, nörgelte Henny.
Den strafenden Blicken von Seiten der Großmama und Onkel Paul begegnete sie mit einem harmlosen Lächeln, als jedoch Kitty die Stirn runzelte, tauchte sie den Löffel in die Suppe und begann zu essen.
»Ich meine ja nur«, murmelte sie. »Weil die Rübchen immer so … so … weich schmecken.«
Marie sah ihr an, dass sie eigentlich »matschig« hatte sagen wollen, doch sie hielt sich vorsichtshalber zurück. So großzügig und unbedacht Kitty als Mutter oft war – wenn sie energisch würde, dann wusste Hennylein, dass es besser war zu gehorchen. Leo löffelte die Graupen in sich hinein und schien tief in Gedanken, Dodo sah immer wieder zu ihm hinüber, als wolle sie ihm etwas sagen, schwieg jedoch und kaute bedächtig ein kleines Stückchen Räucherspeck, das in ihrer Suppe geschwommen hatte.
»Warum kommt denn Klippi nicht mehr zum Essen, Paulemann?«, erkundigte sich Kitty, als Julius die Teller abräumte. »Schmeckt es ihm nicht bei uns?«
Ernst von Klippstein war seit einigen Jahren Pauls Geschäftspartner. Die beiden Männer, die sich schon lange kannten, kamen gut miteinander aus. Paul kümmerte sich um das Geschäftliche, während Ernst von Klippstein die Verwaltung und die Personalangelegenheiten übernommen hatte. Marie hatte Paul niemals erzählt, dass von Klippstein ihr damals, als er schwer verwundet im Lazarett der Tuchvilla lag, recht eindeutige Liebeserklärungen gemacht hatte. Es war inzwischen bedeutungslos geworden und hätte das schöne Einvernehmen der beiden Männer nur gestört.
»Ernst und ich sind übereingekommen, dass er in der Fabrik bleibt, solange ich Mittag mache. Dafür geht er später, am Nachmittag, kurz zum Essen. So ist es für den Arbeitsablauf besser.«
Marie schwieg dazu, Kitty schüttelte den Kopf und bemerkte, der arme Klippi würde immer dünner, Paulemann solle aufpassen, dass sein Partner nicht eines Tages vom Wind davongeweht wurde. Alicia jedoch empfand es als persönlichen Affront, dass der Herr von Klippstein nicht wenigstens am Nachmittag zu einem Imbiss in die Tuchvilla kam.
»Nun – er ist ein erwachsener Mann und geht seiner Wege, Mama«, sagte Paul lächelnd. »Wir reden zwar nicht darüber – aber ich denke, dass Ernst daran denkt, wieder eine Familie zu gründen.«
»Ach nee!«, rief Kitty aufgeregt. Es fiel ihr sichtlich schwer, ihre Zunge im Zaum zu halten, solange Julius die Hauptmahlzeit auftrug. Schupfnudeln mit Sauerkraut – das erklärte Lieblingsgericht aller Kinder. Auch Paul schaute mit großer Zufriedenheit auf seinen Teller und bemerkte, dass die Brunnenmayerin eine Meisterin der Sauerkrautbereitung sei.
»Wenn ich etwas bemerken dürfte, Herr Melzer«, bemerkte Julius und zog die Luft scharf durch die Nase ein, wie es seine Gewohnheit war. »Das Kraut habe ich ganz allein gehobelt. Frau Brunnenmayer hat es dann in die Töpfe eingelegt …«
»Wir wissen das zu schätzen, Julius«, sagte Marie lächelnd.
»Vielen Dank, Frau Melzer!«
Julius hatte zu Marie eine besondere Zuneigung gefasst, vielleicht weil sie sich immer wieder erfolgreich bemühte, die aufflammenden Streitigkeiten unter den Angestellten zu schlichten. Alicia überließ ihr diese Position nur allzu gern, sie fand es anstrengend, sich mit diesen Dingen zu befassen. Früher hatte ihre liebe Eleonore Schmalzler, die ehemalige Hausdame, für eine reibungslose Zusammenarbeit unter den Angestellten gesorgt, doch Frau Schmalzler war in den wohlverdienten Ruhestand gegangen und lebte nunmehr in ihrer Heimat in Pommern. Es gab einen regelmäßigen Briefwechsel zwischen Alicia und ihrer langjährigen Angestellten, von dem sie der Familie jedoch nur wenig berichtete.
»Ich platze gleich«, sagte Dodo und stopfte sich die letzte Schupfnudel in den Mund.
»Und ich bin schon geplatzt«, übertrumpfte sie Henny. »Aber das macht nichts. Mama, darf ich noch Schupfnudeln?«
Kitty war dagegen. Henny sollte bitte erst einmal das Häuflein Sauerkraut aufessen, das auf ihrem Teller zurückgeblieben sei.
»Aber das mag ich nicht. Nur die Schupfnudeln mag ich.«
Kitty schüttelte den Kopf und seufzte, woher das Kind nur diesen Hang zur Mäkelei hatte. Sie sei doch wirklich äußerst streng mit Henny.
»Gewiss«, bestätigte Marie sanft. »Zumindest … oft.«
»Meine Güte, Marie! Ich bin keine Rabenmutter. Sie hat schon diese oder jene Freiheit. Vor allem abends, wenn sie nicht schlafen kann, da lasse ich sie einfach herumlaufen, bis sie müde wird. Oder Süßigkeiten, da zeige ich mich auch großzügig. Aber beim Essen bin ich doch sehr streng mit ihr.«
»Das ist wahr«, bestätigte Alicia. »Es ist allerdings der einzige Bereich, in dem du dich wie eine vernünftige Mutter aufführst, Kitty.«
»Mama«, sagte Paul beschwichtigend und fasste rasch Kittys Hand, da diese schon aufbegehren wollte. »Lass uns nicht schon wieder über dieses Thema streiten. Gerade heute nicht. Bitte!«
»Heute nicht?«, staunte Kitty. »Und wieso gerade heute nicht, Paulemann? Ist heute etwa ein besonderer Tag? Habe ich etwas verpasst? Habt ihr beide am Ende Hochzeitstag, Marie und du? Ach nein, der ist ja im Mai.«
»Es ist der Beginn einer neuen geschäftlichen Ära, meine Lieben …«, sagte Paul feierlich und lächelte Marie zu.
Marie war nicht froh darüber, dass Paul ihr gemeinsames Vorhaben derart vor der ganzen Familie verkünden wollte, doch sie begriff, dass er es ihr zuliebe tat, daher erwiderte sie sein Lächeln.
»Wir stehen vor der Gründung eines Modeateliers, meine Lieben«, sagte Paul und blickte vergnügt in die erstaunten Gesichter.
»Nein!«, kreischte Kitty. »Marie bekommt ein Atelier. Ich werde verrückt vor Begeisterung. Ach Marie, meine Herzensmarie – das hast du schon längst verdient. Du wirst wundervolle Kreationen aus Stoff entwerfen, und alle Leute in Augsburg werden deine Modelle tragen …«
Sie war von ihrem Stuhl aufgesprungen und Marie um den Hals gefallen. Ach, das war Kitty! So spontan, so überschwänglich in ihrer Freude, niemals nahm sie ein Blatt vor den Mund, alles, was sie dachte und fühlte, sprudelte nur so aus ihr heraus. Marie ließ sich ihre Umarmung gefallen, lächelte über ihre Aufregung und war ganz gerührt, als Kitty sogar Tränen der Freude vergoss.
»Oh, ich werde alle Wände in deinem Atelier gestalten, Marie. Es wird aussehen wie im alten Rom. Oder möchtest du lieber griechische Jünglinge? Bei den Olympischen Spielen, weißt du, da traten sie ganz ohne Gewänder gegeneinander an …«
»Ich glaube nicht, dass das passend wäre, Kitty«, bemerkte Paul stirnrunzelnd. »Ansonsten finde ich deine Idee sehr gut, Schwesterlein. Zumindest einige der Wände sollten wir mit Malereien versehen, nicht wahr, Marie?«
Marie nickte. Du liebe Zeit, sie hatte die Räume ja bisher kaum gesehen, nur den mit Regalen vollgestopften Laden der Müllers im Parterre, die Zimmer im ersten Stock kannte sie gar nicht. Das ging ihr alles viel zu schnell. Fast bekam sie jetzt Angst vor dieser großen Aufgabe, die Paul ihr so unbefangen zuschob. Was, wenn ihre Entwürfe nicht gefielen? Wenn sie tagein tagaus ganz allein in ihrem Atelier saß und kein einziger Kunde sich blicken ließ?
Inzwischen meldeten sich auch die Kinder zu Wort.
»Was ist ein Atelier, Mama?«, wollte Leo wissen.
»Verdienst du dann richtig Geld, Mama?«, fragte Dodo.
»Magst du vielleicht mein Sauerkraut, Onkel Paul?«, nutzte Henny die Lage.
»Meinetwegen, kleiner Quälgeist. Her damit!«
Während Paul erklärte, dass er bereits Leute engagiert habe, um die Räume zu entrümpeln und demnächst mit Marie bei Finkbeiner wegen der Wandfarben und Tapeten vorbeischauen wollte, mampfte Henny zufrieden die restlichen Schupfnudeln aus der Schüssel. Ganze fünf Stück. Mit dem Nachtisch, der aus einer kleinen Portion Vanillecreme mit einem Klecks eingemachter Kirschmarmelade bestand, hatte sie allerdings große Mühe.
»Jetzt ist mir schlecht«, stöhnte sie, als die Großmama das Zeichen gab, dass man vom Tisch aufstehen durfte.
»So was«, knurrte Leo. »Du frisst dich voll, dass dir schlecht wird, und andere Kinder haben nicht einmal ein Mittagessen.«
»Na und?«, gab Henny schulterzuckend zurück.
»Wir haben doch gebetet, dass wir die Armen nicht vergessen dürfen, oder?«, stand Dodo ihrem Bruder zur Seite.
Henny schaute sie mit großen Augen an. Es sah naiv und ein wenig hilflos aus, in Wirklichkeit prüfte sie nur die Lage, um ihren Vorteil zu wahren. Sie hatte frühzeitig gelernt, dass die Zwillinge immer zusammenhielten, auch gegen sie.
»Ich hab ja auch die ganze Zeit über an die armen Kinder gedacht und für sie ein paar Schupfnudeln mitgegessen.«
Paul fand diese Antwort lustig, auch Kitty lächelte, nur Alicia runzelte die Stirn.
»Ich finde, dass Leo nicht ganz unrecht hat«, sagte Marie leise, aber mit Überzeugung. »Wir könnten beim Essen ganz gut an Ausgaben einsparen. Auch müssen wir nicht jeden Tag Nachtisch servieren.«
»Ach Marie!«, rief Kitty und hakte sich übermütig bei ihr unter. »Du bist ein solch liebes Wesen – vermutlich würdest du gern hungern und deinen Nachtisch den Armen geben. Ich fürchte nur, dass nicht einmal ein Einziger davon satt wird. Komm jetzt, meine Liebe, ich will dir zeigen, wie ich mir die Wandbilder vorstelle. Paulemann? Wann können wir eine erste Ortsbesichtigung machen? Schon heute? Nein? Ja, wann denn?«
»In den kommenden Tagen, Kitty … Wie ungeduldig du bist, Schwesterlein!«
Marie folgte Kitty in den Flur hinaus, wo Else schon bereitstand. Elses Aufgabe war es, sich nach dem Essen um die Kinder zu kümmern, die ihre Schularbeiten erledigen mussten. Danach hatten sie einige Stunden Zeit zum Spielen, Besuche von Klassenkameraden mussten zuvor angekündigt und von den Müttern abgesegnet werden.
»Ich würde gerne Walter besuchen, Mama«, bat Leo. »Er ist krank und war nicht in der Schule.«
Marie blieb stehen und sah zum Speisezimmer hinüber, dessen Tür noch offen stand. Paul würde gleich wieder hinüber in die Fabrik gehen, einstweilen befand er sich jedoch im Gespräch mit Alicia. Sie würde allein entscheiden müssen.
»Aber nur kurz, Leo. Nach den Hausaufgaben soll Hanna dich begleiten.«
»Kann ich nicht allein gehen?«
Marie schüttelte den Kopf. Sie wusste, dass Paul und Alicia diese Entscheidung nicht billigen würden, beide waren über Leos Freundschaft zu Walter Ginsberg wenig erfreut. Nicht etwa, weil die Ginsbergs Juden waren, da war zumindest Paul recht unbefangen. Aber beide Knaben verband eine übergroße Leidenschaft für die Musik, und Paul fürchtete – ein alberner Gedanke in Maries Augen –, sein Sohn könne auf die Idee kommen, Musiker zu werden.
»Jetzt komm doch endlich, Marie. Nur ein paar Minütchen … Ich muss doch gleich hinüber zu der lieben Ertmute, wegen meiner Ausstellung im Kunstverein. Julius? Ist der Wagen fahrbereit? Ich brauche ihn gleich.«
»Sehr wohl, gnädige Frau. Darf ich Sie chauffieren?«
»Danke, Julius. Ich fahre selbst.«
Marie folgte Kitty die Treppe hinauf in ihr Zimmer, das sie zu einem Maleratelier umgewandelt hatte. Außerdem hatte sie den ehemaligen Schlafraum ihres Vaters annektiert, was Alicia erst nach langem Zögern gestattet hatte. Aber natürlich konnte die arme Kitty nicht zwischen all den halbfertigen Bildern schlafen und in der Nacht die giftigen Farbgerüche einatmen.
»Schau einmal, ich könnte dir auch eine englische Landschaft malen. Oder hier: Moskau im Schnee. Nein? Nun ja. Aber Paris, das ist es. Notre-Dame und die Seinebrücken, der Eiffelturm … Ach nein, das Ding ist wirklich zu hässlich.«
Marie hörte sich die Ausgeburten von Kittys überbordender Fantasie ein Weilchen an, dann meinte sie, dies seien alles wunderbare Ideen, man müsse jedoch daran denken, dass sie ja ihre Kleider präsentieren wolle, da dürfte der Hintergrund nicht allzu dominant wirken.
»Da hast du sicher recht … Wie wäre es denn, wenn ich dir einen Sternenhimmel male? Und an den Wänden eine Landschaft im Nebel, so ganz geheimnisvoll in Pastelltönen.«
»Lass uns erst einmal die Räume anschauen, Kitty.«
»Na schön … Ich muss jetzt sowieso gehen. Hast du mir den blauen Rock kürzer gemacht? Ja? Ach Marie – du bist ein Schatz. Meine Goldmarie.«
Küsschen, Umarmung, dann war Marie von der liebevollen Aufmerksamkeit ihrer Schwägerin erlöst und stand wieder im Flur. Sie lauschte nach unten – Paul war noch im Speisezimmer, sie konnte ihn reden hören. Wie schön, sie würde ihn durch die Halle zur Haustür begleiten und ihm dort noch einmal sagen, welche Freude er ihr gemacht hatte. Er war vorhin ein wenig enttäuscht gewesen, weil sie nicht gleich in Jubel ausgebrochen war, diesen Eindruck sollte er nicht mit zurück zur Arbeit nehmen.
Sie nickte Julius freundlich zu, der zur Personaltreppe eilte, um den Wagen für die gnädige Frau aus der Garage zu fahren, dann, als sie schon die angelehnte Tür zum Speisezimmer aufschieben wollte, hielt sie inne.
»Nein Mama, ich kann deine Bedenken nicht teilen«, hörte sie Pauls Stimme. »Marie hat mein volles Vertrauen.«
»Mein lieber Paul. Du weißt, dass auch ich Marie schätze, aber leider – und das ist nicht ihre Schuld – wurde sie nicht wie eine junge Dame unseres Gesellschaftsstandes erzogen.«
»Ich finde diese Bemerkung nicht sehr geschmackvoll, Mama!«
»Bitte, Paul. Ich sage dies nur, weil ich um dein Glück besorgt bin. Marie hat, während du im Feld warst, Großes für uns alle geleistet. Das soll erwähnt sein. Aber gerade deshalb fürchte ich, dass dieses Modeatelier sie in die falsche Richtung ziehen wird. Marie ist ehrgeizig, sie ist begabt und … Vergiss bitte nicht, wer ihre Mutter war.«
»Jetzt ist es aber genug! Entschuldige Mama, ich habe deine Vorbehalte angehört, ich teile sie nicht und möchte auch nicht weiter darüber diskutieren. Im Übrigen werde ich drüben in der Fabrik gebraucht.«
Marie hörte seine Schritte und tat etwas, dessen sie sich sehr schämte, das aber in diesem Moment die beste Lösung war. Sie öffnete lautlos die Bürotür und verschwand dahinter. Weder Paul noch Alicia sollten wissen, dass sie ihr Gespräch mitgehört hatte.
3
Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben, drei – mal – hoch!«
Der Jubelchor klang recht uneinheitlich, besonders Gustavs Brummelbass und Elses altjüngferlicher Sopran fielen heraus, dennoch war Fanny Brunnenmayer gerührt. Schließlich kam der Gesang ihrer Freunde von Herzen.
»Danke, danke …«
»Kinder soll sie kriegen, Kinder soll sie krieg…«, sang Gustav unbeirrt weiter, bis ein Rippenstoß seiner Auguste ihn zum Schweigen brachte. Er sah sich grinsend um und freute sich, dass er zumindest Else und Julius zum Lachen gebracht hatte.
»Das mit den Kindern überlass ich besser euch beiden, Gustav!«, meinte Fanny, die Köchin, mit Blick auf Auguste, die schon wieder einmal in den Wochen war. Das vierte Kind sollte nun aber endgültig das letzte sein. Wo es schon schwer genug war, die anderen drei hungrigen Mäuler zu stopfen.
»Ja mei – ich häng nur meine Hose übers Bett, da ist meine Auguste schon schwanger.«
»Wer will denn das so genau wissen?«, beschwerte sich Else und errötete dabei.
Fanny Brunnenmayer ignorierte die losen Reden und gab Hanna das Zeichen, den Kaffee einzugießen. Der lange Küchentisch war heute Abend mit bunten Astern und orangefarbiger Tagetes festlich geschmückt, Hanna hatte ihr Bestes gegeben und das Gedeck der Brunnenmayer sogar mit einem Kranz aus Eichenlaub umwunden. Sechzig Jahre wurde die Jubilarin am heutigen Tag, ein stolzes Alter, das man der Köchin keineswegs ansah. Nur das straff zu einem Knoten gebundene Haar, das früher dunkelgrau gewesen war, hatte sich in den letzten Jahren weiß gefärbt, ihr Gesicht aber war rosig, rundlich und glatt wie eh und je.
Platten mit belegten Broten standen auf dem Tisch verteilt, später würde es eine echte Sahnetorte mit eingemachten Kirschen geben, eine Spezialität der Brunnenmayer. All diese Köstlichkeiten waren von der Herrschaft gespendet, damit Fanny Brunnenmayer ihren Ehrentag gebührend feiern konnte. Es hatte schon am Morgen einen kleinen Umtrunk oben im roten Salon gegeben, zu dem alle Angestellten eingeladen waren. Da hatte die Frau Alicia Melzer eine Rede auf Fanny Brunnenmayer gehalten, ihr für 34 Jahre treue Dienste gedankt und sie als eine »bewundernswerte Meisterin« ihrer Kunst bezeichnet. Die Köchin hatte zu diesem Anlass ihr schwarzes Festtagskleid angelegt und eine Brosche angesteckt, die sie vor zehn Jahren von der Herrschaft geschenkt bekommen hatte. Sie hatte sich in dieser ungewohnten Bekleidung und bei all den Ehrungen und Geschenken sehr unbehaglich gefühlt und war froh gewesen, als sie wieder in Alltagskleid und Kochschürze in ihrer Küche stand. Nein, die Räume der Herrschaft waren nichts für sie, dort hatte sie stets Sorge, sie könnte eine Vase umstoßen oder – was noch schlimmer wäre – über einen der Teppiche stolpern und der Länge nach hinschlagen. Hier unten aber in den Wirtschaftsräumen war sie zu Hause, hier herrschte sie unangefochten über Speisekammer, Keller und Küche und gedachte, es noch etliche Jahre weiterhin zu tun.
»Greift zu, meine Lieben. Solange der Vorrat reicht!«, rief sie schmunzelnd und nahm sich eines der leckeren Leberwurstbrote, die Hanna und Else mit geschnittenen Essiggürkchen verziert hatten.
Niemand ließ sich das zweimal sagen. Während der folgenden Minuten war in der Küche außer dem Zischen des Wasserkessels auf dem Herd nur hie und da ein leises Schlürfen zu vernehmen, wenn einer der Anwesenden kleine Schlückchen vom heißen Kaffee zu sich nahm.
»Diese pommersche Leberwurst – ein Gedicht«, meinte Hausdiener Julius und wischte sich den Mund mit der Serviette ab, bevor er sich ein zweites Schnittchen nahm.
»Die Räucherwurst ist auch nicht übel …«, seufzte Hanna. »Was wir für ein Glück haben, dass die Frau von Hagemann uns immer mit dicken Fresspaketen versorgt.«
Else nickte bedächtig, sie kaute nur auf der linken Seite, weil sie rechts seit Tagen Zahnschmerzen hatte. Zum Zahnarzt wollte sie jedoch vorerst nicht gehen, sie hatte höllische Angst davor, dass ihr ein Zahn gezogen wurde, und hoffte, die Schmerzen würden schon irgendwann von selbst verschwinden.
»Ob sie wohl glücklich ist, dort oben in Pommern zwischen Kühen und Schweinen«, meinte Else zweifelnd. »Die Elisabeth von Hagemann ist schließlich eine geborene Melzer und hier in Augsburg aufgewachsen.«
»Warum soll die Lisa denn nicht glücklich sein?«, fragte Hanna schulterzuckend. »Sie hat doch alles, was sie braucht.«
»Freilich«, meinte Auguste boshaft. »Den Ehemann und auch den Liebhaber. Da wird sie sich wohl die Zeit vertreiben …«
Auf einen zornigen Blick der Köchin hin senkte Auguste den Kopf und langte nach dem letzten Leberwurstschnittchen. Der Hausdiener Julius, der für anzügliche Geschichten gern zu haben war, blinzelte zu Hanna hinüber, die jedoch so tat, als bemerkte sie es nicht. Julius hatte schon mehrfach versucht, sie mit zweideutigen Bemerkungen aus der Fassung zu bringen, sie war jedoch wohlweislich nicht darauf eingegangen.
»Und wie geht’s mit der Gärtnerei, Gustav?«, lenkte die Brunnenmayer auf ein anderes Thema. »Habt’s viel zu tun?«
Gustav Bliefert hatte sich vor zwei Jahren mit einer kleinen Gärtnerei selbstständig gemacht. Gerade noch rechtzeitig, bevor die Inflation Augustes Ersparnisse ganz und gar auffressen konnte, hatte sich das Ehepaar eine Wiese nicht weit von der Tuchvilla gekauft, eine Remise errichtet und Frühbeete angelegt. Paul Melzer hatte der kleinen Familie gestattet, weiterhin im Gartenhaus zu wohnen, denn für eine Mietwohnung reichte das Einkommen vorerst nicht. Im Frühjahr hatte Gustav mit jungen Gemüsepflanzen recht gute Geschäfte gemacht, denn auch jetzt noch lebte ein Großteil der Bevölkerung in Augsburg von den Erzeugnissen des eigenen Gartens. Sogar drüben in der Stadt nutzten die Leute jedes Fleckchen Erde, um Karotten, Sellerie oder ein paar Krautköpfe zu ernten.
»Ist eher ruhig«, meinte Gustav wortkarg. »Nur die Totengestecke und die Girlanden zur Kirchweih …«
Julius bemerkte mit gespitzten Lippen, dass eine Gärtnerei eine gute Buchführung benötige, und handelte sich damit einen zornigen Blick von Gustavs Seite ein. Gewiss, alle wussten das, der Gustav war kein Büromensch. Und auch die Auguste, die früher in der Tuchvilla Stubenmädchen gewesen war, hatte nie gelernt, Ausgaben und Einnahmen genau und lückenlos aufzulisten. Wobei Auguste jedoch diejenige war, die dafür sorgte, dass immer noch Geld im Haus war, denn sie arbeitete dreimal in der Woche für einen halben Tag in der Tuchvilla. Es fiel ihr nicht leicht, denn sie musste nun alle anfallenden Arbeiten erledigen, die übrigblieben, also auch solche, die nicht in den Arbeitsbereich eines Stubenmädchens fielen, wie Holz für den Ofen holen oder Böden wischen. Da ihr Kind wohl im Dezember zur Welt kommen würde, konnte sie sich jetzt schon ausrechnen, dass der Verdienst um die Weihnachtszeit schmal werden würde.
»Es ist halt ein Elend«, sagte sie verdrossen. »Heut kostet das Brot 30 000 Mark, morgen schon 100 000, und der Himmel weiß, was es nächste Wochen kosten wird. Wer mag da Blumen kaufen? Und dann brauchten wir Glasscheiben für neue Frühbeete. Am besten wär ein richtiges, großes Gewächshaus. Aber woher nehmen? Sparen kannst nix in diesen Zeiten. Was du heut verdienst, ist morgen schon nichts mehr wert.«
Fanny Brunnenmayer nickte verständnisvoll und schob Gustav die Platte mit den Schnittchen zu. Hunger hatte der arme Kerl. Die Auguste konnte wenigstens in der Tuchvilla zulangen, manchmal durfte sie auch einen Krug Milch mitnehmen, oder die Köchin steckte ihr ein Glas Eingemachtes zu. Für die Liesl und die beiden Buben. Aber der Gustav, der hielt sich zurück, der gab alles den Kindern und blieb selber hungrig.
Auguste hatte die gute Absicht der Brunnenmayer durchschaut, es war ihr jedoch nicht recht, dass ihr Mann wie ein Hungerleider gefüttert wurde. Noch vor ein paar Jahren hatte Auguste lauthals verkündet, die Zeit der Stubenmädchen und Kammerdiener sei vorbei, bald würde es keine Hausangestellten mehr geben, darum würde der Gustav jetzt in der Tuchvilla kündigen und einen Betrieb eröffnen. Leider hatte sich inzwischen erwiesen, dass es immer noch eine gute Sache war, in der Tuchvilla angestellt zu sein. Dort hatte man sein Auskommen und lebte ohne quälende Sorgen um die Zukunft.
»Mei, da hat so mancher jetzt alles verloren«, sagte Auguste, bemüht, über fremdem Leid die eigenen Sorgen zu vergessen. »Ein Laden nach dem anderen macht in Augsburg zu. Bei MAN haben sie auch Arbeiter entlassen, das Militär braucht halt keine Geschütze mehr. Und erst die Stiftungen, sogar die ganz frommen. Denen ist das Geld auf der Bank dahingeschmolzen … Habt ihr net gehört, dass auch das Waisenhaus pleite ist?«
Nein, diese Nachricht war neu und schlug kräftige Wellen.
»Das Waisenhaus ›Zu den Sieben Märtyrerinnen‹?«, erkundigte sich Fanny Brunnenmayer beklommen. »Die müssen zumachen? Ja, wo sollen denn die armen Würmer hin?«
Auguste goss sich den Rest aus der Kaffeekanne ein und verlängerte das Getränk mit einem guten Schuss Sahne. »Ganz so schlimm ist es net, Brunnenmayerin. Die Nonnen von St. Anna werden das Waisenhaus weiterführen. Um Gottes Lohn tun die frommen Schwestern das. Aber die Jordan, die wird bald auf der Straße stehen, weil das Geld für ihren Lohn nicht mehr da ist.«
Maria Jordan war vor Jahren in der Tuchvilla als Kammerzofe angestellt gewesen, sie hatte diese Stellung jedoch gekündigt und hatte durch glückliche Umstände die Leitung des Waisenhauses ›Zu den sieben Märtyrerinnen‹ übernommen. Damit war es nun wohl vorbei. Fanny Brunnenmayer war nicht immer eine gute Freundin der Jordan gewesen, vor allem ihre Kartenlegerei und das falsche Theater mit den angeblichen Träumen hatte sie an der ehemaligen Kammerzofe oft geärgert. Dennoch tat sie ihr leid. Maria Jordan war keine, die es leicht im Leben hatte, was zum einen Teil an ihrem eigenen, schwierigen Charakter lag, zum anderen aber auch an verschiedenen Unglücksfällen, an denen sie keine Schuld trug. Aber sie war eine Kämpferin und würde sich auch dieses Mal wieder herauswinden.
»Da werden wir wohl bald lieben Besuch haben«, lästerte Else, die die Jordan noch nie hatte leiden können. »Und einen Blick in unsere Zukunft werden wir auch tun können, ihre Karten wird sie gewiss dabeihaben …«
Julius lachte verächtlich. Von diesem Hokuspokus, wie er es nannte, hielt er gar nichts. Das sei nur eine schlaue Methode, gutgläubige Dummköpfe um ihr Geld zu bringen.
»Die Wahrheit sagt sie schon«, ließ sich Hanna leise vernehmen. »Das steht einmal fest. Aber es ist die Frage, ob man sie überhaupt wissen sollte, die Wahrheit. Ob es nicht besser ist, wenn man sie nicht kennt …«
»Die Wahrheit?« Julius wandte sich ihr mit herablassender Miene zu. »Du willst doch nicht behaupten, diese Schwindlerin hätte auch nur im Entferntesten eine Ahnung, wie unsere Zukunft aussieht? Die erzählt den Leuten doch nur, was sie hören wollen, und kassiert ihr Geld.«
Hanna schüttelte den Kopf, erwiderte jedoch nichts. Die Köchin wusste sehr gut, wovon sie sprach. Damals hatte die Jordan Hanna den schwarzhaarigen jungen Liebhaber vorausgesagt und auch, dass es Kummer mit ihm geben würde. Beides war eingetroffen, aber was besagte das schon?
»Die reine Wahrheit sagt die Jordan«, rief Auguste und lachte. »Das wissen doch alle hier. Net wahr, Else?«
Else biss sich vor Ärger auf den schmerzenden Backenzahn und zuckte zusammen. »Bist immer nur glücklich, wenn du über andere lästern kannst, wie?«, fuhr sie Auguste an.
Alle am Tisch wussten, dass die Jordan Else schon dreimal die große Liebe vorausgesagt hatte. Bisher hatte sich jedoch kein passender Prinz blicken lassen, und die Chancen hatten sich durch den unglückseligen Krieg nicht gerade verbessert. Junge und gesunde Männer waren rar im Land.
»Die große Liebe!«, meinte Julius und hob abschätzig die Augenbrauen. »Was ist das schon? Erst wollen sie füreinander sterben, und dann können sie nicht miteinander leben.«
»Jessus, Herr Kronberger!«, rief Auguste, und sie grinste spöttisch in die Runde. »Das haben Sie aber schön gesagt.«
»Der Baron von Schnitzler, mein ehemaliger Herr, pflegte sich so auszudrücken«, gab Julius zurück, bemüht, sich seine Verärgerung nicht ansehen zu lassen. »Im Übrigen, liebe Auguste, gebe ich dir die Erlaubnis, mich der Einfachheit halber mit »Julius« anzureden.«
»Da schau an …«, ließ sich Gustav mit leiser Eifersucht vernehmen. Der Hausdiener hatte sich bereits den Ruf eines beharrlichen, wenn auch wenig glückhaften Schürzenjägers erworben.
»Für Sie gilt das natürlich nicht, Herr Bliefert. Sie sind ja nicht mehr Angestellter der Tuchvilla!«
Gustav lief rot an, denn Julius hatte gleich einen weiteren wunden Punkt getroffen. Natürlich bedauerte er, seine Stelle so leichtfertig gekündigt zu haben. Sein Großvater, der vor einem Jahr gestorben war, der hatte ihn noch gewarnt. »Mein Lebtag haben die Melzer gut für uns gesorgt, Gustav«, hatte der alte Mann gesagt. »Sei nicht hoffärtig und bleib, was du bist.« Aber er hatte auf Auguste gehört, und jetzt hatte er den Schlamassel.
»Ich red eh nur meine Freunde mit Vornamen an«, knurrte er feindselig. »Und dazu gehören Sie nicht, Herr von Kronberger!«
»Jetzt ist es aber genug!«, rief Fanny Brunnenmayer und schlug mit der Faust auf den Küchentisch. »Heut ist mein Geburtstag – da wird net gestritten. Sonst ess ich meine Sahnetorte allein!«
Auch Hanna bemerkte, dass das eine Schande sei, gerade am Ehrentag von Frau Brunnenmayer könne man keine Streithansln brauchen. Dabei schaute sie aber nicht Gustav, sondern nur den Hausdiener Julius an.
»Recht hast du, Hanna«, sagte Else mit weinerlichem Ausdruck. Sie hielt sich die rechte Backe, denn der Schmerz ließ einfach nicht nach. »Wenn unsere gute Frau Schmalzler noch bei uns wär, die hätt solche Reden unter den Angestellten gar net erst aufkommen lassen.«
Gustav knurrte etwas Unverständliches vor sich hin, beruhigte sich dann aber schnell, weil Auguste ihm sanft über den Rücken strich.
Julius zog die Nase hoch und schnüffelte ein paarmal. Er habe es nicht so gemeint und könne nichts dafür, dass einige Leute überempfindlich seien. »Wenn man euch so zuhört, dann muss diese Frau Schmalzler geradezu Wunderkräfte gehabt haben, wie?« Julius hatte einen ironischen Ton angeschlagen, denn es ärgerte ihn, ständig diese legendäre Hausdame vorgehalten zu bekommen.
»Die Frau Schmalzler hat jeden von uns auf seine Art zu nehmen gewusst«, sagte Fanny Brunnenmayer mit der ihr eigenen Bestimmtheit. »Eine Respektsperson ist sie gewesen. Aber im Guten, verstehst du?«
Julius langte nach seiner Kaffeetasse und führte sie zum Mund, dann bemerkte er, dass sie leer war und stellte sie zurück auf den Tisch.
»Natürlich …«, sagte er mit bemühter Freundlichkeit. »Eine große, alte Dame. Ich verstehe. Möge sie ihren wohlverdienten Ruhestand noch viele Jahre lang genießen.«
»Das wünschen wir ihr alle«, sagte Hanna. »Die gnädige Frau bekommt immer wieder Post von ihr. Ich glaube, die Frau Schmalzler denkt viel an uns hier in der Tuchvilla. Die gnädige Frau hat ihr neulich auch Fotografien in den Umschlag gesteckt. Von den Enkeln.«
Auguste, die niemals eine große Freundin der Hausdame gewesen war, bemerkte, dass Frau Schmalzler ja schließlich auf eigenen Wunsch gegangen sei. Wenn sie jetzt Heimweh nach der Tuchvilla verspürte, dann hätte sie sich das selbst zuzuschreiben. »Und wenn wir schon dabei sind – Sie haben doch neulich auch Post bekommen, Frau Brunnenmayer. Aus Berlin. Und wenn ich mich net täusch, dann waren da auch Fotografien dabei.«
Die Köchin wusste recht gut, worauf Auguste hinauswolle. Es passte ihr jedoch nicht, Humberts Fotografien in der Küche herumzuzeigen, weil vor allem Julius das nicht verstanden hätte. Humbert trat in einem Berliner Kabarett als Frau auf. Und das – wie es schien – mit großem Erfolg.
Fanny Brunnenmayer wusste um ein hervorragendes Mittel, dieses unliebsame Thema vom Tisch zu bekommen.
»Hanna, bring das große Messer und die Tortenschaufel. Else! Frische Teller. Und Kuchengabeln. Heut essen wir wie die feinen Leut. Julius – stellen Sie mal den Topf mit Wasser auf den Tisch, damit ich das Messer eintauchen kann, wenn ich die Torte anschneide.«