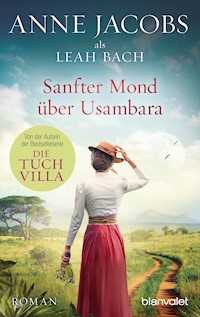Die Tuchvilla-Saga Band 1-3: - Die Tuchvilla / Die Töchter der Tuchvilla / Das Erbe der Tuchvilla (3in1-Bundle) E-Book
Anne Jacobs
24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Anne Jacobs’ Roman vermittelt ein detailliertes Gesellschaftsbild vor 100 Jahren, mit Ängsten und Sorgen, aber auch der Liebe.« Fränkische Nachrichten
Das Schicksal einer Familie in einer bewegten Zeit. Und eine Liebe, die alles überwindet. Kraftvoll, prächtig und mitreißend: Bei Anne Jacobs wird Geschichte lebendig! Teil 1-3 der großen Saga nun in einem E-Book.
Band 1: Die Tuchvilla
Augsburg, 1913. Die junge Marie tritt eine Anstellung als Küchenmagd in der imposanten Tuchvilla an, dem Wohnsitz der Industriellenfamilie Melzer. Während das Mädchen aus dem Waisenhaus seinen Platz unter den Dienstboten sucht, sehnt die Herrschaft die winterliche Ballsaison herbei, in der Katharina, die hübsche, jüngste Tochter der Melzers, in die Gesellschaft eingeführt wird. Nur Paul, der Erbe der Familie, hält sich dem Trubel fern und zieht sein Münchner Studentenleben vor – bis er Marie begegnet …
Band 2: Die Töchter der Tuchvilla
Augsburg, 1916. Die Tuchvilla, der Wohnsitz der Industriellenfamilie Melzer, ist in ein Lazarett verwandelt worden. Die Töchter des Hauses pflegen gemeinsam mit dem Personal die Verwundeten, während Marie, Paul Melzers junge Frau, die Leitung der Tuchfabrik übernommen hat. Da erreichen sie traurige Nachrichten: Ihr Schwager ist an der Front gefallen, ihr Ehemann in Kriegsgefangenschaft geraten. Während Marie darum kämpft, das Erbe der Familie zu erhalten und die Hoffnung an ein Wiedersehen mit Paul nicht aufzugeben, kommt der elegante Ernst von Klippstein in die Tuchvilla. Und wirft ein Auge auf Marie …
Band 3: Das Erbe der Tuchvilla
Augsburg, 1920. In der Tuchvilla blickt man voller Optimismus in die Zukunft. Paul Melzer ist aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück und übernimmt die Leitung der Tuchfabrik, um der Firma wieder zu altem Glanz zu verhelfen. Seine Schwester Elisabeth zieht mit einer neuen Liebe wieder im Herrenhaus der Familie ein. Und Pauls junge Frau Marie will sich einen lang gehegten Traum erfüllen: ihr eigenes Modeatelier. Ihre Modelle haben großen Erfolg, doch es kommt immer wieder zu Streitigkeiten mit Paul – bis Marie schließlich die Tuchvilla mit den Kindern verlässt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2544
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Autorin:
Anne Jacobs lebt und arbeitet in einem kleinen Ort im Taunus, wo ihr die besten Ideen für ihre Bücher kommen. Unter anderem Namen veröffentlichte sie bereits historische Romane und exotische Sagas, bis ihr mit »Die Tuchvilla« der große Durchbruch und der Sprung auf die Bestsellerliste gelang.
Die Tuchvilla
Augsburg, 1913. Die junge Marie tritt eine Anstellung als Küchenmagd in der imposanten Tuchvilla an, dem Wohnsitz der Industriellenfamilie Melzer. Während das Mädchen aus dem Waisenhaus seinen Platz unter den Dienstboten sucht, sehnt die Herrschaft die winterliche Ballsaison herbei, in der Katharina, die hübsche, jüngste Tochter der Melzers, in die Gesellschaft eingeführt wird. Nur Paul, der Erbe der Familie, hält sich dem Trubel fern und zieht sein Münchner Studentenleben vor – bis er Marie begegnet …
Die Töchter der Tuchvilla
Augsburg, 1916. Die Tuchvilla, der Wohnsitz der Industriellenfamilie Melzer, ist in ein Lazarett verwandelt worden. Die Töchter des Hauses pflegen gemeinsam mit dem Personal die Verwundeten, während Marie, Paul Melzers junge Frau, die Leitung der Tuchfabrik übernommen hat. Da erreichen sie traurige Nachrichten: Ihr Schwager ist an der Front gefallen, ihr Ehemann in Kriegsgefangenschaft geraten. Während Marie darum kämpft, das Erbe der Familie zu erhalten und die Hoffnung an ein Wiedersehen mit Paul nicht aufzugeben, kommt der elegante Ernst von Klippstein in die Tuchvilla. Und wirft ein Auge auf Marie …
Das Erbe der Tuchvilla
Augsburg, 1920. In der Tuchvilla blickt man voller Optimismus in die Zukunft. Paul Melzer ist aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück und übernimmt die Leitung der Tuchfabrik, um der Firma wieder zu altem Glanz zu verhelfen. Seine Schwester Elisabeth zieht mit einer neuen Liebe wieder im Herrenhaus der Familie ein. Und Pauls junge Frau Marie will sich einen lang gehegten Traum erfüllen: ihr eigenes Modeatelier. Ihre Modelle haben großen Erfolg, doch es kommt immer wieder zu Streitigkeiten mit Paul – bis Marie schließlich die Tuchvilla mit den Kindern verlässt …
Anne Jacobs
Die Tuchvilla-SagaBand 1-3
Die TuchvillaDie Töchter der TuchvillaDas Erbe der Tuchvilla
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgaben © 2014, 2015, 2016 by Blanvalet Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion »Die Tuchvilla«: Miriam Vollrath
Redaktion »Die Töchter der Tuchvilla«: Angela Kuepper
Redaktion »Das Erbe der Tuchvilla«: René Stein
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign
»Die Tuchvilla« (l.o.): nach einer Originalvorlage von © Johannes Frick Umschlagmotive: Arcangel Images (Susan Fox; Yolande de Kort)
»Die Töchter der Tuchvilla« (l.u.): nach einer Originalvorlage von © Johannes Frick Umschlagmotive: © Yolande de Kort/Trevillion Images; Arcangel Images (Margie Hurwich; Jill Battaglia); Shutterstock.com (June Marie Sobrito; satit_srihin; suns07butterfly)
»Das Erbe der Tuchvilla« (r.u.): Umschlagmotive: Richard Jenkins Photography und Shutterstock.com (CCat82; Potapov Alexander; Botond Horvath; Ysbrand Cosijn)
ISBN 978-3-641-28661-3V002
www.blanvalet.de
ANNE JACOBS
DIE TUCHVILLA
Roman
I.
AUGSBURG, HERBST 1913
1
Nachdem sie das Jakobertor hinter sich gelassen hatte, waren ihre Schritte immer langsamer geworden. Eine andere Welt tat sich hier am östlichen Stadtrand auf. Nicht beschaulich und eng wie die Gässchen in der Unterstadt, sondern lärmend und gewaltsam. Wie mittelalterliche Festungen lagen die Fabrikanlagen in den Wiesen zwischen den Bachläufen, jede von einer Mauer umgeben, damit kein Unbefugter das Gelände betrat und kein Arbeiter der Aufsicht entging. Innerhalb dieser Festungen vibrierte und lärmte es ohne Pause, Schornsteine schickten schwarzen Rauch in den Himmel, in den Hallen ratterten die Maschinen Tag und Nacht. Marie wusste aus Erfahrung: Wer hier arbeitete, der wurde zu einem grauen Kieselstein. Taub vom Dröhnen der Maschinen, blind vom aufwirbelnden Staub, stumm von der Leere im Hirn.
Es ist deine letzte Chance!
Marie blieb stehen und blinzelte gegen die Sonne zu Melzers Tuchfabrik hinüber. Einige Fenster blitzten im Morgenlicht, als brenne dahinter ein Feuer, die Mauern waren jedoch grau, und in ihrem Schatten erschienen die Hallen fast schwarz. Die Villa auf der anderen Seite aber leuchtete in rotem Backstein, ein traumschönes Dornröschenschloss inmitten eines herbstbunten Parks.
Es ist deine letzte Chance! Warum hatte Fräulein Pappert das gestern Abend dreimal wiederholt? So, als bliebe für Marie nur Gefängnis oder Tod, falls sie auch jetzt wieder fortgeschickt würde? Sie fasste das schöne Gebäude genauer ins Auge, aber es verschwamm vor ihrem Blick, vermischte sich mit Wiesen und Bäumen des Parkgeländes. Kein Wunder, sie war noch schwach von dem Blutsturz vor drei Wochen, und dann hatte sie heute früh vor Aufregung kaum etwas gegessen.
Also gut, dachte sie. Es ist wenigstens ein hübsches Haus, und ich werde nicht nähen müssen, sondern andere Dinge tun. Und wenn sie mich hinüber in die Fabrik schicken, dann laufe ich einfach fort. Niemals wieder plage ich mich zwölf Stunden am Tag mit einer verölten schwarzen Nähmaschine herum, bei der ständig der Faden reißt.
Sie rückte das Bündel auf ihrer Schulter zurecht und ging langsam zum Eingang des Parkgeländes. Das altmodische Eisentor aus ineinander verschlungenen Blütenranken stand einladend offen. Der Fahrweg wand sich durch den Park und endete in einem gepflasterten Platz, in dessen Mitte sich eine kreisrunde Blumenrabatte befand. Niemand war zu sehen, aber aus der Nähe wirkte die Villa noch einschüchternder, besonders der Säulenvorbau, der sich über zwei Etagen erhob. Die Säulen stützten einen Balkon mit steinerner Einfassung – vermutlich hielt der Fabrikherr von hier oben am Silvesterabend eine Rede an seine Arbeiter. Die starrten ehrfürchtig zu ihm und seiner in Pelze gehüllten Gattin hinauf. Vielleicht bekamen sie ja Schnaps oder Freibier an den Feiertagen. Sekt ganz bestimmt nicht, den Champagner trank der Fabrikherr mit seiner Familie.
Ach, eigentlich wollte sie nicht hier arbeiten. Wenn sie hinauf in die davonziehenden Wolken schaute, schien es, als bewegte sich das hohe Backsteingebäude auf sie zu, um sie unter sich zu zermalmen. Aber es war ihre letzte Chance. Also hatte sie wohl keine Wahl. Marie musterte die Front der Villa. Rechts und links des Säulenvorbaus gab es je eine Pforte, das waren die Eingänge für die Angestellten und die Lieferanten.
Während sie noch überlegte, welche der beiden Türen sie ansteuern sollte, vernahm sie hinter sich das knatternde Geräusch eines Automobils. Eine dunkle Limousine tuckerte dicht an ihr vorüber. Als sie erschrocken zur Seite sprang, konnte sie das Gesicht des Chauffeurs erkennen. Er war noch jung und trug eine blaue Schirmmütze mit einer goldfarbigen Kokarde darauf.
Aha, dachte sie. Jetzt holt er den Fabrikherrn ab und fährt ihn in sein Büro. Dabei ist die Fabrik doch nur ein paar Schritte entfernt. Höchstens zehn Minuten zu laufen. Aber so ein reicher Herr geht nicht zu Fuß, da könnten ja seine teuren Schuhe und der gute Mantel dreckig werden.
Neugierig und ein wenig missgünstig starrte sie auf das Portal unter den Säulen, das sich jetzt öffnete. Ein Hausmädchen war zu sehen, in dunklem Kleid und heller Schürze, auf dem glatt zurückgekämmten Haar ein weißes Häubchen. Dann zwei Damen, in lange Mäntel mit weichen Pelzkrägen gehüllt, die eine in Dunkelrot, die andere in Hellgrün. Hüte wie Traumgebilde aus Blüten und Schleierstoff, beim Einsteigen in die Limousine sah man die zierlichen Stiefeletten aus braunem Leder. Ein Herr folgte den beiden Frauen – nein, das konnte nicht der Fabrikdirektor sein, dazu war er viel zu jung. Vielleicht war es der Ehemann einer der Damen? Oder der Sohn des Hauses? Er trug einen kurzen braunen Reisemantel und eine Tasche, die er mit leichtem Schwung auf das Dach des Wagens beförderte, bevor er im Wagen Platz nahm. Wie albern der Chauffeur herumhüpfte, die Wagentüren aufriss, den Damen die Hand bot, als könnten sie sich nicht ohne seine Hilfe auf den gepolsterten Sitzen niederlassen. Ja gewiss, diese Frauen waren aus Zuckerwerk gebacken. Ein Platzregen hätte sie aufgelöst und davonfließen lassen. Wie schade, dass es heute nicht regnete.
Als die Herrschaften im Wagen verstaut waren, fuhr der Chauffeur mit ihnen um die Blumenrabatte, in der rote Astern, rosafarbige Dahlien und lila Heidekraut blühten. Nach diesem gemächlichen Wendemanöver knatterte das Gefährt wieder in Richtung Tor. Es fuhr so dicht an Marie vorüber, dass das vorstehende Trittbrett ihren im Wind flatternden Rock berührte. Graue Männeraugen streiften Marie mit unverhohlener Neugier. Der junge Herr hatte den Hut abgesetzt, das nachlässig geschnittene lockige Haar und der blonde Oberlippenbart gaben ihm das Aussehen eines unbesorgten Studenten. Er lächelte Marie zu, dann beugte er sich vor und sagte etwas zu der Dame in Rot, worauf alle zu lachen begannen. Machten sie sich über das schlecht gekleidete Mädel mit dem Bündel über der Schulter lustig? Marie verspürte einen Schmerz in der Brust, sie musste wieder gegen den Impuls ankämpfen, auf der Stelle kehrtzumachen und zurück ins Waisenhaus zu laufen. Aber sie hatte keine Wahl.
Der Qualm, den das Automobil hinterließ, stank nach Benzin und heißem Gummi, sodass sie husten musste. Entschlossen ging sie um die Blumenrabatte herum zum linken Nebeneingang und betätigte den Türklopfer aus schwarzem Eisen. Es tat sich nichts – vermutlich waren alle an der Arbeit, es war schon gegen zehn. Als sie zweimal erfolglos geklopft hatte und schon entschlossen war, die Tür einfach aufzuklinken, hörte sie endlich Schritte.
»Jesses Maria – das ist die Neue. Warum macht ihr denn keiner auf? Traut sich nicht herein, das Mädel …«
Die Stimme war jung und hell. Marie erkannte das Hausmädchen wieder, das vorhin das Portal für die Damen geöffnet hatte. Sie war ein rosiges, blondes Wesen, kräftig und gesund, ein harmloses Lächeln lag auf ihrem breiten Gesicht. Vermutlich stammte sie aus einem der umliegenden Dörfer, ein Stadtkind war die auf keinen Fall.
»Komm herein. Brauchst dich nicht zu schämen. Bist die Marie, ja? Ich bin die Auguste. Zweites Stubenmädchen. Schon seit einem guten Jahr.«
Darauf schien sie mächtig stolz zu sein. Was für ein Haus! Sie beschäftigten zwei Stubenmädchen! Da, wo Marie vorher angestellt gewesen war, hatte sie alle Arbeit, auch das Kochen und Waschen, allein machen müssen.
»Grüß Gott Auguste. Dankschön für dein Willkommen.«
Marie stieg die drei Stufen hinunter in den engen Flur. Wie seltsam. Die rote Backsteinvilla hatte zahllose hohe und niedrige Fenster, hier im Gesindetrakt aber war es so finster, dass man kaum wusste, wohin man die Füße setzte. Aber das lag wohl daran, dass ihre Augen noch blind von der hellen Morgensonne waren.
»Hier ist die Küche. Die Köchin wird dir bestimmt einen Kaffee und eine Semmel geben. Schaust ja ganz verhungert aus …«
In der Tat. Gegen die dralle, vor Gesundheit strotzende Auguste musste sie, Marie, wie ein Gespenst erscheinen. Sie war immer dünn gewesen, aber nach der Krankheit waren auch ihre Wangen hohl geworden, und an den Schultern stachen die Knochen hervor. Dafür erschienen ihre Augen jetzt doppelt so groß wie vorher, und das dunkelbraune Haar war widerspenstig wie ein Besen. Das hatte zumindest Fräulein Pappert noch gestern Abend behauptet. Fräulein Pappert war die Leiterin des Waisenhauses der Sieben Märtyrerinnen, und sie sah aus, als habe sie jedes einzelne Martyrium selbst durchlebt. Geholfen hatte es nichts, die Pappert war boshaft wie eine Hexe und würde gewiss einst in der Hölle braten. Marie hasste sie abgrundtief.
Die Küche war ein Ort der Zuflucht. Warm, hell und voller köstlicher Düfte. Ein Raum, der von saftigem Schinken, frischem Brot und Kuchen erzählte, von köstlichen Pasteten, Hühnersüppchen und Rindsbouillon. Der nach Thymian, Rosmarin und Salbei duftete, nach Dill und Koriander, nach Nelkenblüten und Muskat. Marie stand bei der Tür und starrte auf den langen Tisch, an dem die Köchin allerlei Vorbereitungen betrieb. Erst jetzt spürte sie, wie kalt es draußen gewesen war, und sie begann zu zittern. Wie schön war die Aussicht, mit einer Tasse Milchkaffee neben dem Ofen zu sitzen, die Wärme zu spüren, den Geruch des Wohllebens einzuatmen und dabei in langsamen Schlucken den heißen Kaffee zu schlürfen.
Ein lauter Schrei ließ sie zusammenfahren. Ausgestoßen hatte ihn eine ältlich aussehende zierliche Frau, die soeben die Küche von der anderen Seite betrat und bei Maries Anblick erschrocken zurückprallte.
»Heilige Jungfrau!«, stöhnte sie und presste beide Hände auf die Brust. »Da ist sie! Der Herr steh mir bei. Genau wie der Traum. Herr Jesus Christus, beschütze uns vor allem Unheil …«
Die Frau musste sich gegen die Wand lehnen und riss dabei einen kupfernen Topf vom Haken, der scheppernd auf den gekachelten Küchenboden fiel. Marie erstarrte vor Schreck.
»Sind Sie jetzt ganz und gar verrückt geworden, Jordan?«, keifte die Köchin erbost. »Hauen mir meinen besten Gemüsetopf herunter. Gnade Ihnen Gott, wenn der jetzt eine Delle oder gar einen Sprung hat.«
Die zierliche Frau, die gerade mit »Jordan« angeredet worden war, nahm das Geschrei der Köchin kaum wahr. Schwer atmend löste sie sich von der Wand, griff sich mit den Händen in die Frisur, die mit einer schwarzen Schleife geschmückt war. Schwarz waren auch ihre Bluse und der Rock, dazu trug sie eine kleine Brosche, eine in Silber gefasste Gemme mit dem Abbild eines zarten Mädchenkopfes.
»Es … es ist nichts«, flüsterte sie und legte beide Handrücken auf ihre Schläfen, als habe sie Kopfschmerzen. Migräne bekam nur die »Gnädige«, eine Angestellte hatte ganz ordinäres Kopfweh, und das kam vom Suff und vom Nichtstun.
»Wieder geträumt, wie?«, knurrte die Köchin und angelte den Topf unter dem Tisch hervor. »Eines Tages werden Sie noch berühmt mit Ihren Träumen. Dann wird der Kaiser Sie zu sich bestellen, um sich von Ihnen die Zukunft voraussagen zu lassen.«
Sie lachte laut, es klang ein wenig wie das Meckern einer Ziege. Spöttisch, aber nicht boshaft.
»Ach lassen Sie doch diese stupiden Scherze«, wehrte Jordan ab.
»Aber wenn Sie immer nur von Unheil träumen«, fuhr die Köchin unbeirrt fort, »dann wird der Kaiser Sie wohl nicht haben wollen!«
Marie stand gegen die Tür gelehnt, ihr Herz klopfte wild, es wurde ihr plötzlich schlecht. Keine der beiden Frauen nahm Notiz von ihr, stattdessen erklärte die Jordan jetzt, das gnädige Fräulein wünsche Tee und Gebäck, die Köchin solle sich sputen.
»Das gnädige Fräulein wird sich gedulden müssen, ich muss erst Wasser aufsetzen.«
»Es ist immer das Gleiche. Hier in der Küche wird herumgetrödelt, und ich werde dafür vom gnädigen Fräulein getadelt.«
Es erschien Marie merkwürdig, dass die Stimmen zwar aufgeregter, aber dennoch immer leiser wurden. Vielleicht lag es an dem Pfeifen, das alle anderen Geräusche überlagerte. Hatte die Köchin nicht gerade gesagt, sie müsse erst Wasser aufsetzen? Wieso pfiff dann der Kessel schon?
»Herumgetrödelt?«, vernahm sie die Stimme der Köchin. »Ich habe ein Mittagessen vorzubereiten, dazu Kuchen und für heute Abend ein Diner mit zwölf Personen. Und das alles ohne Hilfe, weil Gertie, das dumme Ding, davongelaufen ist. Wenn mir nicht Auguste hin und wieder zur Hand … Ach du gütiger Himmel!«
»Heilige Jungfrau – jetzt haben wir die Bescherung!«
Marie hatte sich noch rasch hinsetzen wollen, aber es war zu spät. Die grauen und hellbraunen Fliesen des Küchenbodens näherten sich ihr in rasendem Tempo, dann war alles schwarz. Still und angenehm leicht. Ein Schweben in sanfter, zärtlicher Dunkelheit. Nur ihr dummes Herz klopfte und hämmerte, erschütterte ihren ganzen Körper und machte, dass sie zitterte. Sie konnte gar nicht mehr damit aufhören, ihre Zähne schlugen aufeinander, die Hände verkrampften sich.
»Na, das hat uns hier noch gefehlt. Eine Fallsüchtige. Da war mir ja Gertie mit ihren Männergeschichten noch lieber …«
Marie wagte nicht, die Augen aufzuschlagen. Sie musste in Ohnmacht gefallen sein. Das war ihr seit dem Blutsturz nicht mehr passiert. Hatte sie etwa wieder Blut gespuckt? O Gott – nur das nicht. Sie hatte sich damals fürchterlich erschrocken. Helles Blut war aus ihrem Mund gelaufen. Schrecklich viel. So viel, dass sie hinterher nicht mehr stehen konnte.
»Halten Sie Ihr dummes Maul«, knurrte die Köchin. »Das Mädel ist vollkommen ausgehungert, kein Wunder, wenn sie umfällt. Da – nehmen Sie mal die Tasse.«
Jemand griff ihr mit rauer Hand unter die Schultern, hob ihren Oberkörper ein wenig an. An den Lippen spürte sie den warmen Rand eines Bechers, es roch nach Kaffee.
»Trink, Mädel. Das bringt dich wieder auf die Beine. Nun trink schon. Einen kleinen Schluck.«
Marie blinzelte. Dicht vor ihr war das breite rote Gesicht der Köchin, unschön, schweißbedeckt, aber gutartig. Dahinter erkannte sie die dünne schwarze Gestalt der Jordan. Die Silberbrosche blitzte an ihrer schwarzen Bluse, und in ihrem Gesicht spiegelte sich Abscheu.
»Was päppeln Sie die noch auf? Wenn die krank ist, wird Fräulein Schmalzler sie sowieso wieder fortschicken. Ist gut so. Sehr gut so. Sie bringt Unheil, wenn sie bleibt. Großes Unglück trägt sie ins Haus, ich weiß es …«
»Gießen Sie mal den Tee über, das Wasser kocht.«
»Das ist nicht meine Aufgabe!«
Marie entschloss sich, nun doch einige Schlucke Kaffee zu trinken. Auch wenn sie damit kundtat, dass sie wieder unter den Lebenden war, was sie gern noch verborgen hätte. Sie konnte die nette Köchin nicht so hängen lassen. Und zum Glück schien sie kein Blut gespuckt zu haben.
»Na also«, murmelte die Köchin zufrieden. »Geht’s wieder?«
Marie wurde übel von dem starken, bitteren Getränk. Sie ließ den Kopf zurückfallen und lächelte mühsam.
»Geht schon … Danke für den Kaffee …«
»Bleib noch ein Weilchen liegen. Wenn’s dir wieder besser geht, bekommst du was Anständiges zu essen.«
Marie nickte gehorsam, obgleich die Vorstellung von einer Buttersemmel oder gar einer Hühnersuppe ihren Magen anhob. Die beiden Frauen hatten sie auf eine der hölzernen Bänke gelegt, auf denen die Angestellten saßen, wenn sie ihre Mahlzeit einnahmen. Marie schämte sich unendlich für diese dumme Ohnmacht. Zu zweit hatten sie sie anheben und auf die Bank legen müssen. Und dann das Gerede der Jordan. Die war wohl nicht ganz dicht im Kopf. Sie, Marie, sei fallsüchtig und würde Unheil in die Villa bringen. Umgekehrt war es richtig. Die Villa war ein Unglückshaus, das hatte sie gleich am ersten Tag erfahren, und es sollte ihr zu denken geben. Letzte Chance oder nicht – sie würde auf keinen Fall hierbleiben. Nicht für Geld und gute Worte. Und schon gar nicht wegen des dummen Geschwätzes von der Pappert.
»Was treiben Sie denn da?«, kreischte die Köchin. »Die Teekanne gießt man niemals bis oben hin voll. Gott steh mir bei – jetzt läuft alles über, und das gnädige Fräulein wird mich dafür verantwortlich machen!«
»Hätten Sie Ihre Arbeit getan, wie es sich gehört, wäre das nicht geschehen. Ich bin schließlich nicht fürs Teekochen zuständig. Ich bin Kammerzofe und keine Küchenwanze!«
»Küchenwanze? Ihnen schaut der Hochmut aus allen Knopflöchern. Der Hochmut und die Dummheit.«
»Was ist denn hier unten los?«, vernahm man Augustes helle Stimme. »Das gnädige Fräulein hat schon dreimal nach ihrem Tee geläutet und ist ziemlich in Rage. Und die Jordan soll sofort hinaufkommen …«
Marie sah, wie das ohnehin schon farblose Gesicht der Kammerzofe noch eine Nuance bleicher wurde. Sie selbst konnte jetzt schon den Kopf heben, die Übelkeit war verschwunden.
»Ich habe es doch geahnt«, murmelte die Jordan düster.
Während sie mit rauschendem Rock aus der Küche eilte, spürte Marie ihren Blick. Sie starrte Marie an wie ein gefährliches Insekt.
2
Eleonore Schmalzler war eine stattliche Frau. Die siebenundvierzig Jahre im Dienst der Familie hatten ihre Schläfen ergrauen lassen, Schultern und Rücken waren jedoch gerade wie in den besten Tagen ihrer Jugend. In Pommern war sie Kammerzofe des gnädigen Fräuleins Alicia von Maydorn gewesen, und nach deren Heirat folgte Eleonore ihrer Herrin in das Augsburger Domizil. Eigentlich eine Mesalliance – Johann Melzer war ein Fabrikant, der Sohn eines Lehrers aus der Provinz. Ein Aufsteiger, der es zu etwas gebracht hatte. Die adeligen von Maydorns hingegen hatten abgewirtschaftet, zwei Söhne waren Offiziere und kosteten nur, das Gut in Pommern war hoch verschuldet. Dazu war Alicia bei ihrer Verlobung schon Ende zwanzig, ein spätes Mädchen. Sie hatte ein steifes Fußgelenk seit ihrer Kindheit – ein unglückseliger Treppensturz, der ihren Wert auf dem Heiratsmarkt zusätzlich geschmälert hatte.
Mit der Position der Hausdame wurde Eleonore Schmalzler anfangs nur aushilfsweise betraut. Alicia Melzer misstraute dem Personal aus der Stadt, die Leute waren ihrer Ansicht nach nur auf ihren eigenen Vorteil und nicht auf das Wohl des Hauses bedacht. Es hatte zwei Butler und eine Hausdame gegeben, die Alicia nach kurzer Zeit wieder fortschickte. Eleonore Schmalzler aber bewährte sich vom ersten Tag an glänzend. Sie verband die Anhänglichkeit an ihre Herrin mit einer natürlichen Begabung, Menschen zu führen. Wer in der Tuchvilla arbeitete, der hatte seinen Dienst als Privileg zu sehen, das man sich durch Tugenden wie Ehrlichkeit, Fleiß, Verschwiegenheit und Treue verdienen musste.
Es war schon gegen elf – die gnädige Frau und das Fräulein Katharina wurden jeden Augenblick zurückerwartet. Man hatte den jungen Herrn zum Bahnhof gefahren – er studierte seit einigen Jahren Jura an der Münchner Universität. Anschließend war die Gnädige mit ihrer Tochter bei Dr. Schleicher zu einer Sitzung gewesen. Diese Arztbesuche dauerten meist nur eine halbe Stunde. Eleonore Schmalzler hielt gar nichts davon, aber die gnädige Frau setzte große Hoffnungen in den Doktor. Die knapp achtzehn Jahre alte Katharina Melzer litt unter Schlaflosigkeit, Nervosität und heftigen Kopfschmerzen.
»Auguste!«
Die Hausdame hatte die Schritte der Kammerzofe im Flur richtig erkannt. Auguste schob die Tür vorsichtig auf, sie balancierte in der rechten Hand ein kleines Silbertablett, auf dem eine benutzte Teetasse, Sahnekännchen und Zuckerdose standen.
»Ja, Fräulein Schmalzler?«
»Geht es ihr jetzt besser? Dann schickt sie zu mir herein.«
»Gern, Fräulein Schmalzler. Sie ist schon wieder munter. Ein nettes, kleines Mädel, aber schrecklich dünn, und dann hat sie auch keine …«
»Ich warte, Auguste.«
»Jawohl, Fräulein Schmalzler.«
Man musste jeden auf seine Weise behandeln. Auguste war willig, aber ihr Verstand reichte nicht allzu weit. Außerdem neigte sie zur Schwatzhaftigkeit. Dass sie es dennoch zum Stubenmädchen gebracht hatte, lag an Eleonore Schmalzlers Empfehlung. Auguste war ehrlich und der Familie treu ergeben. Es gab Mädchen, die mit einer Arbeit in der Fabrik liebäugelten und nach ein paar Monaten davonliefen. Auguste würde das nicht tun, sie hing an der Villa und an ihrer Position, auf die sie sehr stolz war.
Die Tür knarrte, als die Neue sie langsam öffnete. Die Hausdame erblickte ein dünnes, blasses Geschöpf mit riesenhaften Augen. Das dunkle Haar hatte sie zu einem Zopf geflochten, aus dem überall feine Strähnen hervorstachen. Das also war sie. Marie Hofgartner, achtzehn Jahre alt. Eine Waise. Vermutlich unehelich geboren, bis zu ihrem zweiten Lebensjahr bei der Mutter aufgewachsen, nach deren Tod im Waisenhaus der Sieben Märtyrerinnen verblieben. Mit dreizehn in einen Haushalt in der Augsburger Unterstadt gegeben, dort war sie nach vier Wochen davongelaufen. Zwei weitere Versuche als Hausmädchen waren ebenfalls gescheitert, als Näherin bei einer Modeschneiderin hatte sie es ein Jahr ausgehalten, dann ein halbes Jahr in der Textilfabrik Steyermann. Ein Blutsturz vor drei Wochen …
»Grüß Gott, Marie«, sagte sie bemüht freundlich zu der kleinen Jammergestalt. »Geht es dir gut?«
Die braunen Augen blickten ungewöhnlich intensiv, die Hausdame fühlte sich unwohl unter diesem forschenden Blick. Entweder war dieses Mädchen besonders einfältig, oder das Gegenteil war der Fall.
»Danke. Es geht mir gut, Fräulein Schmalzler.«
Haltung hatte die Kleine. Sie war keine, die herumjammerte. Eben noch hatte sie bewusstlos auf dem Küchenboden gelegen – so hatte die Jordan ihr berichtet –, und jetzt stand sie hier und tat, als sei nichts gewesen. Fallsüchtig sei sie, hatte die Jordan behauptet. Aber die schwatzte häufig dummes Zeug. Eleonore Schmalzler verließ sich niemals auf das Urteil einer Angestellten. Sie gestattete sich sogar – allerdings nur insgeheim –, auch das Urteil ihrer Herrschaft mit dem eigenen scharfen Verstand zu überprüfen.
»Schön«, meinte sie. »Wir benötigen ein Mädchen für die Küchenarbeit, und du wurdest uns von Fräulein Pappert empfohlen. Hast du schon einmal in der Küche gearbeitet?«
Die Frage war eigentlich überflüssig, denn sie hatte das Arbeitsbuch und die Zeugnisse des Mädchens gelesen, man hatte ihr die Sachen gestern durch einen Boten bringen lassen.
Die Augen des Mädchens wanderten über die kleine Sitzgruppe mit den hohen geschnitzten Stühlen und das mit Büchern und Akten gefüllte Wandregal. Einen Augenblick lang blieben sie an den üppig drapierten grünen Fenstergardinen hängen. Der Raum, in dem die Hausdame residierte, war reich ausgestattet und schien die Kleine zu beeindrucken. Gleich darauf aber bewies ein winziges Zusammenzucken ihrer Lider, dass Marie ihre Papiere auf dem Schreibtisch entdeckt hatte. Was fragt sie eigentlich, sagte ihr Blick. Sie hat doch alles gelesen.
»Ich war dreimal in einem Haushalt angestellt, da musste ich kochen, waschen, das Essen auftragen und die Kinder beaufsichtigen. Außerdem haben wir im Waisenhaus immer Gemüse putzen, Wasser holen und den Abwasch machen müssen.«
Sie war keineswegs einfältig, eher ein wenig zu schlau. Eleonore Schmalzler mochte es nicht, wenn eine Angestellte zu intelligent war. Diese Sorte dachte nur an ihren eigenen Vorteil und nicht an das Wohl des Hauses. Auch war sie zu geschickten Betrügereien fähig, die Hausdame erinnerte sich nur ungern an einen Hausdiener, der jahrelang den herrschaftlichen Rotwein beiseitegeschafft und verkauft hatte. Noch heute warf sie sich vor, diesem Gauner so lange aufgesessen zu sein.
»Dann wirst du dich ja schnell in deine Aufgaben einfügen, Marie. Als Küchenmädchen unterstehst du vor allem Frau Brunnenmayer, unserer Köchin. Aber auch alle anderen Angestellten sind dir gegenüber weisungsbefugt, und du hast zu gehorchen, wenn sie dir einen Auftrag geben. Ich sage dir das, weil du – soweit ich sehen kann – noch niemals in einem so großen Haus gearbeitet hast.«
Sie hielt einen Augenblick inne und besah das Mädchen prüfend. Hörte sie überhaupt zu? Sie starrte auf eine gerahmte Kohlezeichnung, die über dem Schreibtisch hing. Ein Geschenk des gnädigen Fräuleins Katharina, die im vergangenen Jahr zu Weihnachten alle Angestellten mit eigenen Zeichnungen beglückt hatte. Diese zeigte die Fabrikhallen, die zackigen Dreiecke der Sheddächer, die nach Norden hin verglast waren.
»Gefällt dir das Bild?«, bemerkte sie spitz.
»Sehr. Nur ein paar Striche, und doch erkennt man sofort, was es sein soll. Das würde ich auch gern können.«
Da war Begeisterung und Sehnsucht in den braunen Augen der Kleinen. Sogar ein kleines Lächeln huschte über ihr Gesicht. Die Hausdame wappnete sich, sie war empfindlich gegenüber unerfüllten Sehnsüchten, ein Laster, das sie mit ihren nunmehr sechzig Jahren immer noch nicht abgelegt hatte. Dabei gab es für die Seelenruhe, die für die Arbeit notwendig war, nichts Schädlicheres als solche Sentimentalitäten.
»Das Zeichnen überlasse besser dem gnädigen Fräulein. Du, Marie, hast hier in diesem Haushalt sehr viel zu lernen. Vor allem in der Küche, wo feine Speisen zubereitet werden. Aber auch in anderen Bereichen, beispielsweise den Umgang mit der Herrschaft betreffend. Wir führen ein großes Haus, es gibt häufig Diners und größere Abendgesellschaften, einmal im Jahr auch einen Ball. Für all diese gesellschaftlichen Ereignisse haben wir feste Regeln.«
Jetzt endlich keimte ein wenig Interesse im Gesicht des Mädchens auf. Bei aller Schlauheit schien sie doch reichlich naiv und verträumt. Vermutlich las sie Groschenromane und glaubte, die Welt sei voller romantischer Liebesstürme.
»Sie meinen einen richtigen Ball? Mit Tanz und Musik und all diesen wunderschönen Kleidern?«
»Genau davon spreche ich, Marie. Du wirst davon allerdings wenig sehen, denn dein Arbeitsplatz ist unten in der Küche.«
»Aber … aber wenn das Essen serviert wird …«
»Bei großen Anlässen servieren nur männliche Angestellte. Auch dies gehört zu den Dingen, die du zu lernen hast. Kommen wir jetzt zu den praktischen Angelegenheiten. Ich stelle dich vorerst für ein Vierteljahr ein mit einem Lohn von fünfundzwanzig Mark. Der wird dir in zwei Raten ausgezahlt. Zehn Mark nach Ablauf eines Monats, der Rest zwei Monate später. Natürlich nur, wenn du dich bewährst.«
Sie machte eine kleine Pause, um die Wirkung ihrer Worte zu überprüfen. Marie blieb gleichgültig. Geldgierig schien sie nicht zu sein. Schön. Als Küchenmädchen hatte sie auch nicht mehr zu erwarten.
»Weiterhin erhältst du von uns zwei einfache Kleider und drei Schürzen. Diese Sachen hast du sauber und ordentlich zu halten und täglich zu tragen. Das Haar bindest du fest in ein Tuch ein, die Hände sind stets rein zu waschen. Socken und Schuhwerk wirst du ja wohl selber besitzen. Wie steht es mit der Wäsche? Zeig mal her.«
Das Mädchen knüpfte sein Bündel auf, und Eleonore Schmalzler stellte fest, dass es auch hier schlecht bestellt war. Wo blieb eigentlich das viele Geld, das zu den Festtagen für das Waisenhaus gesammelt wurde? Das Mädchen besaß zwei durchgescheuerte Hemden, eine Unterhose zum Wechseln, einen löchrigen wollenen Unterrock und mehrere Paar stark gestopfter Socken. Schuhe zum Wechseln gab es nicht.
»Wir werden sehen. Wenn du dich bewährst – Weihnachten ist nicht mehr weit.«
Zu den Festtagen gab es Geschenke an die Angestellten, meist Stoffe für Kleider, Leder für Schuhe oder Socken aus Baumwolle – für die höhergestellten Angestellten auch kleine Familienandenken, wie Uhren, Bilder oder Ähnliches. Man würde bei der Kleinen – vorausgesetzt, sie verdiente es – ein wenig dazulegen, sie brauchte auch einen wollenen Mantel und eine warme Mütze. Der Zorn der Hausdame auf das Waisenhaus blühte aufs Neue. Nicht einmal ein warmes Umhängetuch besaß das Mädel, man hatte sich in allem auf den neuen Arbeitgeber verlassen.
»Schlafen wirst du oben im dritten Stockwerk, wo sich die Kammern der Angestellten befinden. Es schlafen immer zwei Frauen in einer Kammer, du wirst deinen Schlafraum mit Maria Jordan teilen.«
Marie hatte begonnen, ihr Bündel wieder zu verknoten, jetzt hielt sie erschrocken inne.
»Mit Maria Jordan? Der Kammerzofe? Die eine Brosche mit einem geschnitzten Mädchenkopf trägt?«
Eleonore Schmalzler war sich darüber klar, dass die Jordan keine angenehme Schlafgenossin war. Aber es stand dem jungen Ding nicht an, in dieser Beziehung Wünsche zu äußern.
»Du hast sie ja schon kennengelernt. Maria Jordan ist eine angesehene Person in diesem Haus. Du wirst noch lernen, dass eine Kammerzofe das besondere Vertrauen ihrer Herrin besitzt, daher ist ihre Position unter den Angestellten recht hoch.«
Tatsächlich war sogar sie selbst hin und wieder eifersüchtig auf die Jordan, die nicht nur Kammerzofe der gnädigen Frau war, sondern auch die beiden gnädigen Fräulein bediente. Eleonore Schmalzler war selbst einst Kammerzofe gewesen, sie wusste um die Intimität einer solchen Stellung.
Die schmale Gestalt vor der Hausdame versteifte sich, sie wurde ein wenig größer, weil sie den Rücken geradebog.
»Verzeihung, aber ich möchte auf keinen Fall mit Maria Jordan in einer Kammer wohnen. Lieber schlafe ich irgendwo unterm Dach bei den Mäusen. Oder in der Küche. Schlimmstenfalls auch im Zwischenstock.«
Eleonore Schmalzler musste sich zusammennehmen, um ihre Fassung zu wahren. Solch eine Frechheit war ihr noch niemals begegnet. Da kam dieses abgerissene, halb verhungerte Wesen aus dem Waisenhaus, konnte nichts vorweisen als eine Menge schlechter Zeugnisse und erdreistete sich, Forderungen zu stellen. Gerade eben hatte die Hausdame noch Mitleid mit der Kleinen verspürt, jetzt war sie über deren Hochmut zutiefst entsetzt. Aber natürlich, es war ja in fast allen Zeugnissen zu lesen. Hochmütig, frech, aufsässig, faul, ungehorsam … Nur hinterhältig war sie wohl nicht. Aber das andere reichte schon aus. Eleonore Schmalzler hätte dieses Mädchen nur allzu gern zurück ins Waisenhaus geschickt. Leider gab es da ein kleines Problem. Warum auch immer – die gnädige Frau wünschte, dass das Mädel eingestellt wurde.
»Das wird sich finden«, gab sie kurz angebunden zurück. »Dann ist da noch etwas, Marie. Du hast ja schon gemerkt, dass Fräulein Jordan den Vornamen »Maria« trägt. Daher wirst du hier im Haus einen anderen Namen erhalten, es könnte sonst zu Verwechslungen kommen.«
Marie zerrte den zweiten Knoten ihres Bündels fest, sie strengte sich dabei so an, dass ihre Fingerknöchel weiß hervortraten.
»Wir werden dich Rosa nennen«, bestimmte die Hausdame leichthin. Unter anderen Umständen hätte sie dem Mädel zwei oder drei Namen zur Auswahl vorgeschlagen. Aber diese da hatte solch ein Entgegenkommen nicht verdient.
»Das wäre vorerst alles, Rosa. Geh jetzt in die Küche, denn du wirst für die Arbeit gebraucht. Später wird Else dir die Kammer zeigen und dir Kleider und Schürzen aushändigen.«
Sie wandte sich ab und trat zum Fenster, um den Vorhang ein wenig beiseitezuschieben. Da waren sie ja. Robert half dem gnädigen Fräulein beim Aussteigen, die gnädige Frau war bereits auf den Stufen zum Portal. Es schien etwas wärmer geworden zu sein, das gnädige Fräulein hatte den Mantel sogar abgelegt. Sie überließ es Robert, ihr das Kleidungsstück nachzutragen, eine Aufgabe, der er sich mit großer Hingabe widmete. Die Schmalzler tat einen Seufzer, sie würde ein paar Worte mit dem jungen Mann reden müssen. Er war ein anstelliger Bursche und konnte es weit bringen, vielleicht sogar bis zum Butler. Sie konnte nur hoffen, dass an den Gerüchten, die unter dem Personal umgingen, nichts dran war.
»Else? Sag der Köchin, dass die Herrschaften zurück sind. Kaffee und den üblichen kleinen Imbiss.«
»Ja, Fräulein Schmalzler.«
»Warte. Danach holst du die Sachen für das neue Küchenmädchen aus der Wäschekammer und trägst sie hinauf in ihr Zimmer. Sie schläft bei Maria Jordan.«
»Ja, Fräulein Schmalzler.«
Die Hausdame war in den Flur hinausgetreten, um ihre Anweisungen zu geben. In der Küche herrschte das übliche Durcheinander vor einem festlichen Diner. Die Köchin war eine hervorragende Kraft, doch wenn sie zu tun hatte, war mit ihr nicht gut Kirschen essen. Auch jetzt wurde Elses Meldung mit einer unwirschen Antwort quittiert – die Hausdame wusste jedoch, dass Kaffee und Imbiss pünktlich bereit sein würden. Sie wandte sich wieder ihrem Zimmer zu, dort fand sie zu ihrer allergrößten Überraschung – Marie. Vielmehr Rosa, wie sie ab jetzt gerufen werden sollte.
»Was willst du noch hier?«
Das Mädchen hatte ihr Bündel wieder über die Schulter gelegt, ihre Augen hatten einen seltsamen Ausdruck. Wund und zugleich ungemein hart.
»Es tut mir sehr leid, Fräulein Schmalzler.«
Die Hausdame starrte sie irritiert an. Dieses Mädchen war ihr vollkommen unbegreiflich.
»Was tut dir leid, Rosa?«
Die Kleine zog die Luft tief ein, als müsse sie einen schweren Gegenstand stemmen. Sie hob den Kopf ein wenig an und machte die Augen schmal.
»Ich möchte mit meinem eigenen Namen gerufen werden. Ich heiße Marie und nicht Maria wie Fräulein Jordan. Außerdem arbeite ich in der Küche, ich glaube nicht, dass die gnädige Frau jemals nach mir rufen wird. Sie wird nach ihrer Kammerzofe rufen, aber gewiss nicht nach dem Küchenmädchen. Wir können also gar nicht verwechselt werden.«
Sie trug diese Gründe mit leiser Stimme vor und nickte dabei immer wieder. Auch wenn sie leise sprach, so redete sie doch flüssig und ohne Scheu. Die Hausdame dachte insgeheim sogar, dass sie nicht ganz Unrecht hatte. Allerdings würde sie das angesichts dieser Dreistigkeit auf keinen Fall zugeben.
»Dies zu entscheiden ist nicht deine Sache!«
Das Maß war voll. Diese Person war einfach nur arbeitsscheu, suchte einen Vorwand, um sich weiterhin im Waisenhaus durchfüttern zu lassen, anstatt ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
»Verstehen Sie denn nicht?«, fuhr das Mädchen aufgeregt fort. »Meine Eltern haben diesen Namen für mich ausgewählt. Sie haben lange und gründlich darüber nachgedacht und genau diesen Namen für mich gefunden. Marie. Es ist ihr Vermächtnis an mich. Deshalb will ich keinen anderen Namen tragen.«
Es hörte sich nach verzweifelter Entschlossenheit an, und Eleonore Schmalzler besaß genügend Menschenkenntnis, um zu begreifen, dass das Mädchen weder arbeitsscheu noch grundlos bockig war. Sie fand es eher rührend. Auch wenn die Kleine sich da ganz sicher etwas zusammenfantasierte. Ihre Eltern! Sie war unehelich und hatte ihren Vater vermutlich nie zu Gesicht bekommen.
Dieses sture Wesen würde nur schwer zu lenken sein, so viel war der Hausdame klar. Sie hätte die Kleine nur allzu gern gehen lassen. Aber da war der Wunsch ihrer Herrschaft.
»Na schön«, sagte sie und zwang sich ein Lächeln ab. »Wir versuchen es erst einmal mit deinem richtigen Namen.«
»Ja bitte, Fräulein Schmalzler.«
Triumphierte sie? Nein, sie schien nur grenzenlos erleichtert.
Nach ein paar Sekunden fügte sie hinzu:
»Vielen Dank.«
Sie machte so etwas wie einen angedeuteten Knicks, drehte sich dann um und trollte sich endlich in die Küche. Die Hausdame ließ einen kaum unterdrückten Seufzer hören.
Dieser Widerspruchsgeist muss gebrochen werden, dachte sie. Das wird auch die gnädige Frau einsehen.
3
Bitte, Elisabeth. Ich bin todmüde, und außerdem habe ich Kopfschmerzen.«
Katharina hatte sich auf ihr Bett gelegt, sie trug immer noch das hellgrüne Kostüm, nur das aufgesteckte Haar hatte sie gelöst und die Stiefeletten ausgezogen. Elisabeth kannte die Zustände ihrer Schwester seit Jahren. Ihrer Ansicht nach war sie eine perfekte Simulantin, die sich nur die Aufmerksamkeit ihrer Umgebung sichern wollte.
»Kopfschmerzen?«, meinte sie in sachlichem Tonfall. »Nun, dann solltest du ein Pulver einnehmen, Kitty.«
»Ich bekomme Magenkrämpfe davon.«
Elisabeth zuckte mitleidslos die Schultern und ließ sich auf dem hellblau bezogenen Sesselchen vor dem Spiegel nieder. Auf dem Toilettentisch ihrer Schwester herrschte ein heilloses Durcheinander von Glasfläschchen, Haarspangen, Kämmen aus Schildpatt, Puderquasten und anderem Zeug. So oft Auguste auch aufräumte, Katharina brachte stets wieder Unordnung hinein. So war sie nun einmal, ihre verrückte kleine Schwester.
»Ich wollte dir ja nur erzählen, was mir Dorothea vorhin berichtet hat. Sie traf dich und Paul vorgestern Abend in der Oper – erinnerst du dich?«
Elisabeth neigte sich dem Spiegel zu und tat, als müsse sie eine blonde Haarsträhne zurück in die Frisur stecken. In Wirklichkeit beobachtete sie genau die Reaktion ihrer Schwester. Sie war leider wenig aufschlussreich – Katharina hatte die Hand auf die Stirn gelegt und die Augen geschlossen. Sie schien nicht geneigt, eine Antwort zu geben.
»Es muss eine sehr schöne Aufführung gewesen sein …«
Jetzt regte sich Schwesterlein, sie nahm die Hand von der Stirn und blinzelte zu Elisabeth hinüber. Solch alberne Dinge wie Musik oder Malerei brachten sie stets dazu, ihre Kopfschmerzen zu vergessen.
»Es war tatsächlich eine großartige Aufführung. Besonders die Sängerin der Leonore war wundervoll. Fidelio ist überhaupt solch eine bewegende Geschichte, und dazu diese Musik …«
Elisabeth schürte Katharinas Begeisterung noch ein wenig, um dann desto sicherer auf ihr Ziel hinzusteuern.
»Ja, ich bedaure jetzt auch, nicht mitgegangen zu sein.«
»Ich verstehe nicht, Lisa, dass du dir solch einen Kunstgenuss entgehen ließest. Wo wir doch eine Loge im großen Haus unterhalten. Überhaupt, deine Abneigung gegen Konzerte und die Oper …«
Elisabeth lächelte zufrieden. Katharina hatte sich jetzt sogar im Bett aufgesetzt, keine Spur mehr von Kopfschmerzen. Sie schwafelte von Kostümen und Bühnenbildern – ihre närrische kleine Schwester hatte sogar Zeichnungen angefertigt.
»In der Pause kam Besuch in unsere Loge, sagte Dorothea …«
Katharina runzelte die Stirn, als müsse sie sich erst besinnen. Was Elisabeth für Verstellung hielt – Kitty wusste doch ganz genau, wer sie aufgesucht hatte.
»Ja richtig. Leutnant von Hagemann kam, um uns zu begrüßen. Er hatte erfahren, dass Paul das Wochenende in Augsburg verbracht hat, und ließ Sekt bringen. Es war sehr nett von ihm.«
Da war es heraus. Elisabeth sah plötzlich nur noch ihr eigenes Bild im Spiegel, ihr Gesicht war unschön, wenn sie aufgeregt war. Die Wangen wirkten feist, die Lippen wurden schmal.
»Leutnant von Hagemann kam, um Paul zu begrüßen? Wie nett von ihm.«
Sie hörte selbst, wie gekünstelt die Sätze klangen. Aber sie war zu zornig, um sich gut zu verstellen.
»Na hör mal, Lisa«, meinte Kitty und ließ sich wieder zurück in die Kissen fallen. »Die beiden sind schließlich Schulkameraden.«
Das war zwar richtig, aber da Paul zwei Jahre älter als Klaus von Hagemann war, hatten sie niemals gemeinsam die Schulbank gedrückt. Sie hatten nur das gleiche Gymnasium besucht. Und überhaupt – Paul hatte an diesem Wochenende viel Zeit mit seinen Freunden verbracht, aber zu diesem Kreis gehörte Klaus von Hagemann nicht.
»Dorothea hat auch erzählt, dass du dich so hervorragend mit dem Leutnant unterhalten hättest, Kitty. Ist es wahr, dass er während des zweiten Aktes in unserer Loge blieb und neben dir saß?«
Katharina hatte schon wieder die Hand auf die Stirn gelegt, nun aber hob sie den Kopf, um Elisabeth empört zu fixieren. Aha – jetzt endlich hatte sie begriffen.
»Wenn du darauf anspielst, dass ich und Klaus von Hagemann …«
»Allerdings tue ich das!«
»Das ist doch lächerlich!«
Katharinas Augen drückten Unwillen aus, eine Falte erschien auf ihrer Stirn, die Lippen zogen sich zusammen. Verärgert stellte Elisabeth fest, dass Katharina auch jetzt hübsch aussah. Die ein wenig schräg stehenden Augen, die kleine Nase und der runde Kussmund gaben ihrem dreieckigen Gesicht eine ungemein anziehende Note. Dazu verfügte sie über eine Fülle dunkelbrauner Haare, die einen zarten Stich ins Kupferrot bekamen, wenn das Licht darauf lag. Sie selbst war blond, einfach nur blond ohne jegliche Besonderheit. Aschblond, mattblond, strohblond – es war zum Verzweifeln.
»Lächerlich?«, rief Elisabeth, außer sich vor Zorn. »Die ganze Stadt redet von nichts anderem. Die bezaubernde Katharina, die zarte braunlockige Fee, die Königin der kommenden Ballsaison. Nun hat sie auch Leutnant von Hagemann bezirzt, den klugen und besonnenen jungen Mann, der ein ganzes Jahr lang ihrer Schwester den Hof gemacht hat …«
»Hör bitte auf, Lisa! Das ist doch alles gar nicht wahr!«
»Gar nicht wahr? Willst du behaupten, es sei nicht wahr, dass Klaus von Hagemann kurz davor war, mir einen Antrag zu machen?«
»Aber das habe ich doch nicht gesagt. Oh, mein Kopf!«
Katharina hatte beide Hände gegen die Schläfen gepresst, doch Elisabeth war viel zu aufgebracht, um Rücksicht zu nehmen. Fragte vielleicht irgendjemand danach, wie es ihr selbst ging? Vielleicht hatte sie ja auch schlaflose Nächte und Kopfschmerzen, doch das kümmerte in diesem Haus niemanden.
»Ich werde dir das niemals verzeihen, Kitty! Nie, nie im ganzen Leben!«
»Aber … aber ich habe doch gar nichts getan, Lisa. Er setzte sich zwischen Paul und mich, das war alles. Und dann haben wir über Musik geredet, er versteht so viel von Musik, Lisa … Ich habe ihm einfach nur zugehört. Nichts weiter. Das schwöre ich dir.«
»Du falsche Schlange! Dorothea hat doch gesehen, wie du mit ihm gelacht und geflirtet hast.«
»Das ist eine infame Lüge!«
»Alle Leute im Theater haben es gesehen, und da willst du behaupten, ich lüge?«
»Oh Lisa. Wir haben uns ganz normal unterhalten. Vergiss bitte nicht, dass Paul die ganze Zeit anwesend war!«
Elisabeth sah ein, dass sie zu weit gegangen war. Doro musste wohl übertrieben haben, diese boshafte Person. Wie hatte sie nur so dumm sein können, diesem Geschwätz aufzusitzen. Verbissen starrte sie in den Spiegel. Er war mit einem schmalen Goldrahmen versehen und dreiteilig, sodass sie ihr zornverquollenes Gesicht einmal von vorn und zweimal im Profil sehen konnte. O Gott – wie abstoßend hässlich sie jetzt aussah. Wieso war das Schicksal so ungerecht? Wieso bescherte es ihrer kleinen Schwester dieses feenhafte, verführerische Gesicht, sogar dann, wenn sie Kopfschmerzen hatte oder sich aufregte?
»Es ist gelogen, Lisa«, schwatzte Kitty in hilfloser Verzweiflung. »Dorothea ist solch eine Klatschbase, wie kannst du ihr nur Glauben schenken? Jeder weiß doch, dass sie …«
Sie hielt inne, denn es klopfte an der Tür, und ihre Mutter trat ein. Katharina beruhigte sich zwar sofort, aber Mama hatte ihre aufgeregte Stimme schon im Flur vernommen.
»Kitty! Was ist geschehen? Dr. Schleicher hat dir doch angeraten, dich nicht aufzuregen.«
»Es ist nichts, Mama. Ich bin ganz ruhig.«
Alicia Melzer kannte ihre Töchter. Ihr Blick wanderte zu Elisabeth, die rasch eine Puderquaste gegriffen hatte und sich damit im Gesicht herumfuhr.
»Du weißt, dass du deine Schwester nicht provozieren sollst, Lisa. Kitty hat in der Nacht kaum schlafen können.«
»Das tut mir sehr leid«, sagte Elisabeth mit sanfter Stimme. »Ich habe sie aufgesucht, um sie ein wenig aufzuheitern. Das ist alles.«
Katharina bestätigte diese Version. Sie war keine Petze, das konnte man ihr wirklich nicht vorwerfen, auch damals schon hatte sie die ältere Schwester niemals verraten. Alicia Melzer seufzte.
»Wieso seid ihr noch nicht umgekleidet?«, tadelte sie. »Das Mittagessen wird gleich aufgetragen.«
Mama trug ein dunkelblaues, bodenlanges Kleid aus Seide und dazu eine Perlenkette, in die sie in Brusthöhe einen Knoten geschlungen hatte. Obgleich schon über fünfzig, war sie immer noch eine anmutige Erscheinung, nur der ein wenig wiegende Gang, der von ihrem steifen Fußgelenk herrührte, rief hie und da Erstaunen hervor. Elisabeth hätte viel darum gegeben, so schlank wie ihre Mutter zu sein, doch das Schicksal wollte es so, dass sie den väterlichen Vorfahren nachschlug, die eher rundlich und breithüftig waren. Selbst in dem weiten Morgenkleid, einem zart wallenden Spitzengebilde, das mit Schleppe genäht war, hatte ihre Figur nichts Ätherisches. Kitty, das Biest, hatte einmal gescherzt, sie sähe darin aus wie ein wandelnder Kaffeewärmer. Wenigstens handelte sich ihre kleine Schwester einen Tadel ein, denn das grüne Kostüm war nun, da sie damit im Bett gelegen hatte, vollkommen zerknittert. Es war schade darum. Der schmale Rock und die lange Jacke mit Schößchen waren aus glänzendem Seidenbrokat genäht, den Papa aus Indien bezog.
»Mittagessen?«, rief Katharina und stöhnte auf. »Wir haben doch heute Abend ein Diner. Wie soll man da noch etwas hinunterbringen, wenn wir jetzt ein ganzes Mittagessen zu uns nehmen müssen?«
»Es muss eben sein, Kitty. Wir können Papas Bruder und seine Frau nicht allein speisen lassen. Das wäre allzu unhöflich. Sie haben bereits angekündigt, dass sie nach dem Mittagessen wieder abreisen werden.«
»Zum Glück«, entfuhr es Elisabeth.
Sie handelte sich einen strafenden Blick ihrer Mutter ein, aber sie wusste, dass Mama über diese Abreise ebenso froh war wie sie selbst. Papa hatte drei Brüder und vier Schwestern, alle hatten Familien gegründet und Nachkommen in die Welt gesetzt. Keiner von ihnen hatte sich jedoch nennenswerte irdische Güter erworben. Daher waren ihre Besuche stets mit der Bitte um diese oder jene Summe oder um eine Fürsprache verbunden. Johann Melzer war eine geachtete Persönlichkeit in Augsburg. Geschäftsleute, Bankiers, Künstler und Stadtväter verkehrten in seinem Haus, und seine adelig geborene Ehefrau sorgte dafür, dass man sich in zwanglos angenehmer Atmosphäre begegnete. Sie selbst kümmerte sich hingebungsvoll um die Damen, während im »Herrenzimmer« Rotwein, Madeira und französischer Cognac konsumiert wurden, der Rauch dicker Zigarren die Luft schwängerte und zwischen den Männern allerlei Geschäftliches gemischt mit Privatem zur Sprache kam. Solch ein Diner würde auch heute Abend stattfinden, und es wäre selbstverständlich mehr als peinlich gewesen, wenn der Kontorschreiber Gabriel Melzer und seine verhärmt aussehende grauhaarige Ehefrau mit am Tisch gesessen hätten. Schon allein der unpassenden Kleidung wegen.
»Also zieht euch um, Mädchen. Nichts allzu Auffälliges. Ihr wisst ja, Tante Helene besitzt nur ein einziges Kleid.«
»Ja«, kicherte Elisabeth. »Aber sie knöpft jeden Morgen einen anderen Kragen hinein und bildet sich ein, uns damit täuschen zu können.«
Über Alicia Melzers Züge zuckte ein Lächeln, das sie jedoch gleich wieder unterdrückte. Elisabeths Bemerkungen waren oft respektlos, das Mädchen musste lernen, sich zusammenzunehmen.
»Nun, sie haben ein krankes Kind, das viel Geld kostet.«
Elisabeth legte den Kopf schräg, doch dieses Mal behielt sie ihre Meinung für sich. Heute war es ein krankes Kind, vor Monaten war es eine unglückselige Bürgschaft für einen Freund gewesen, dann wieder war in der Küche ein Feuer ausgebrochen und hatte einen schlimmen Schaden angerichtet. Papas Verwandtschaft erfand immer wieder neue Gründe, um dem reichen Johann Melzer das Geld aus der Tasche zu ziehen. Allerdings waren Mamas Verwandte nicht viel anders, sie hatten nur bessere Manieren. Zumindest solange sie nüchtern waren. Und sie benötigten höhere Summen, weil sie auf größerem Fuß lebten und entsprechende Schulden hatten. Insgesamt waren Verwandte ausgesprochen peinliche Leute, Elisabeth kannte keinen einzigen, den sie nicht lieber von hinten als von vorn sah.
»Muss ich unbedingt zum Mittagessen gehen, Mama?«, seufzte Katharina. »Ich bin schrecklich müde und hätte mich gern ein wenig schlafen gelegt. Du weißt doch, Dr. Schleicher hat mir diese Pillen gegeben. Damit ich einschlafen kann.«
Alicia war bereits an der Tür, sie zögerte einen Augenblick, unsicher, ob das Wohl ihres kranken Kindes nicht mehr zählte als Höflichkeit und Konvention. Noch dazu der armen Verwandtschaft ihres Ehemannes gegenüber. Dann aber siegte ihre Erziehung zu Haltung und Disziplin über die mütterlichen Anwandlungen. Auch Katharina musste lernen, sich zusammenzunehmen. Vor allem sie.
»Wir werden das Mittagessen nicht allzu lange ausdehnen, Kitty. Danach kannst du dich gern hinlegen. Ich schicke dir Maria, dann geht es mit dem Umkleiden rascher. Elisabeth – du wirst das braune Kleid mit den gebauschten Ärmeln tragen. Dich, Kitty, möchte ich in dem hellgrauen Kleid sehen, du weißt doch, das mit dem kleinen Bolero und den Perlmuttknöpfen.«
»Ja, Mama!«
Elisabeth erhob sich widerwillig vom Sessel und begab sich in ihr eigenes Zimmer. Natürlich sollte Maria ihrer Schwester beim Umkleiden helfen, während sie selbst allein fertig werden musste. Maria würde höchstens noch rasch zu ihr hereinkommen, um ihr Haar aufzustecken. Es war doch ganz offensichtlich, dass eine einzige Kammerzofe für drei Frauen nicht ausreichte. Zumal die gute Jordan schon über vierzig war und ihre Ansichten über Mode so altmodisch wie die von Mama. Aber was regte sie sich auf – wenn sie einmal heiratete, würde sie eine eigene Kammerzofe haben.
Das braune Kleid war schon drei Jahre alt, Mama hatte es für sie anfertigen lassen, als sie siebzehn wurde. Sie war der Meinung gewesen, dass die braune Farbe gut mit Elisabeths blondem Haar harmonierte. Elisabeth fand das überhaupt nicht. Braun war langweilig, öde wie ein Erdhügel, in diesem Kleid wurde sie von allen Leuten übersehen, und die altmodischen, überdimensionalen Ärmel machten die Sache nicht besser. Aber für den Kontorschreiber Gabriel Melzer und seine fade Gattin würde dieser Aufzug genügen.
Maria hatte das Kleid schon aus der Kammer geholt und in ihr Zimmer gehängt, sie brauchte nur noch das Morgenkleid abzustreifen und sich in das braune Ungetüm zu zwängen. Ein weiteres Ärgernis tat sich auf: Die braune Scheußlichkeit war zu eng geworden, sie musste sich förmlich hineinquetschen. Eigentlich hätte sie sich enger schnüren müssen, aber ohne Maria war das nicht möglich. Und dann würde sie heute Abend zum Diner das dunkelgrüne Samtkleid tragen, dazu musste sie das Korsett so eng ziehen, dass ihr jetzt schon schlecht wurde.
»Gnädiges Fräulein? Darf ich rasch Ihr Haar richten? Nein, wie gut Ihnen dieses Kleid steht!«
Maria Jordan lächelte sie an. Die perfekte Kammerzofe. Immer höflich, zurückhaltend, die absurdesten Schmeicheleien klangen glaubhaft aus ihrem Mund. Elisabeth musste nur in den Spiegel schauen, um zu sehen, dass sie in diesem Stoffkokon wie eine gestopfte Leberwurst aussah. Aber trotzdem tat es gut, Marias Kompliment zu hören, sich auf dem Polsterschemel vor dem Spiegel in malerischer Pose niederzusetzen und das Haar Marias kundigen Händen zu überlassen.
»Nur ein wenig aufstecken. Für heute Abend brauche ich Sie dann schon gegen fünf.«
»Aber gern, gnädiges Fräulein. Nehmen wir die braune Samtschleife?«
»Nein. Keine Schleife. So ist es schon gut. Danke, Maria.«
»Wie Sie wünschen, gnädiges Fräulein.«
War es nicht ungerecht, dass ausgerechnet sie zur Molligkeit neigte? Mama war niemals dick gewesen, sie hatte heute noch die Figur eines jungen Mädchens. Einmal hatte sie den staunenden Töchtern ein Kleid aus Jugendtagen gezeigt, ein schrecklich altmodisches Gewand aus dunkelrotem Barchent mit weit gebauschtem Rock und Spitzenbesatz. Sie hatte es aufgehoben, weil sie es trug, als sie Papa zum ersten Mal begegnete. Nun – Elisabeth fand das Kleid abscheulich, aber es passte Mama noch genau wie damals. Ihre Figur hatte sich trotz der drei Geburten kaum verändert.
Im Flur sah sie Kitty, die gerade die Treppe hinunterging. Leichtfüßig und immer ein wenig schwebend, so als liefe sie auf Wolken. Meist träumte dieses merkwürdige Wesen auch vor sich hin. Aber schlank war sie, traumhaft schmal, eine Silhouette wie aus einem Modemagazin ausgeschnitten. Und dabei war es Kitty so vollkommen unwichtig, was sie trug und wie man ihr Haar aufsteckte. Stattdessen hatte sie den Wunsch geäußert, in Paris das Malen zu lernen. Mit der Staffelei auf der Straße, wie es die jungen Künstler dort taten. Mama hatte die Fassung bewahrt, wie sie es immer tat, aber Papa war zornig geworden und hatte Kitty eine »undankbare dumme Gans« genannt.
Elisabeth folgte ihrer Schwester in den ersten Stock, die dicken Teppiche im Flur und auf der Treppe schluckten ihre Schritte, sodass Katharina sie nicht hörte. Sie war ohnehin mit sich selbst beschäftigt. Elisabeth dachte daran, dass ihre hübsche Schwester auch heute Abend beim Diner mit am Tisch sitzen würde. Die von Hagemanns, gute Bekannte ihrer Mutter, waren eingeladen, außerdem Geschäftsfreunde ihres Vaters. Sie verspürte heftiges Herzklopfen. Es konnte daher rühren, dass dieses Kleid ihr über der Brust viel zu eng war. Es konnte aber auch daran liegen, dass Leutnant Klaus von Hagemann, der seine Eltern heute Abend begleitete, sich endlich erklären musste.
Else öffnete ihr die Tür zum Speisezimmer – vermutlich würde das ältliche Stubenmädchen auch servieren. Wegen der armen Verwandtschaft bemühte man schließlich nicht Robert, der heute Abend in Livree und weißen Handschuhen agieren würde. Elisabeth begrüßte die Gäste mit anerzogener Höflichkeit und entschuldigte sich für ihr spätes Kommen. Sie war die Letzte, jetzt erst setzte man sich zu Tisch, und Else erschien mit der Suppe. Rinderbouillon mit Eierstich – Elisabeth schielte hämisch zu Katharina hinüber. Sie wusste, dass ihre Schwester Bouillon hasste und auch sonst kaum Fleisch zu sich nahm.
»Wie geht es dir denn, liebe Kitty?«, fragte Tante Helene. »Du schaust müde aus.«
Katharina rührte gedankenverloren in ihrer Suppe, Elisabeth konnte sehen, dass ihre Augenlider schon halb herabgesunken waren.
»Kitty?«
Sie zuckte zusammen und öffnete die Augen.
»Verzeihung, Tante. Was hattest du gefragt?«
Mama runzelte die Stirn, und unter ihrem durchdringenden Blick riss sich Katharina zusammen. Sie lächelte verlegen.
»Ich sagte, dass du müde ausschaust, mein Kind«, wiederholte Tante Helene geduldig.
»Entschuldige bitte, Tante, ich habe nicht zugehört. Ich bin heute ungewöhnlich müde.«
»Das sagte ich ja«, beharrte Tante Helene, leicht irritiert.
Elisabeth verbiss sich tapfer einen Lachanfall, Mama sprang in die Bresche und erklärte, die arme Katharina habe in der Nacht kaum schlafen können. Tante Helene heuchelte Verständnis und konnte mit eigener Schlaflosigkeit aufwarten, die sie geschickt mit den Sorgen um die Familie begründete. Damit war sie wieder bei der Geschichte von der kranken Tochter und den teuren Medikamenten. Überhaupt die Ärzte, man wisse gar nicht, was man von ihnen halten solle. Sie verschrieben allerlei Tinkturen und Pillen – aber ob man davon wieder gesund würde, das wisse nur Gott allein.
»Wir müssen uns alle dem Willen Gottes beugen«, bestätigte Alicia freundlich. Elisabeth wusste, dass ihre Mutter das ehrlich meinte, man war christlich gesinnt, besuchte jeden Sonntag die Messe in St. Ulrich und Afra.
»Es ist so schade, dass der liebe Johann nicht die Zeit findet, mit uns zu essen«, sagte Tante Helene mit höflichem Bedauern. »Es kann doch nicht gesund sein, dass er den ganzen Tag drüben in seinem Büro verbringt, ohne ein Mittagessen zu sich zu nehmen.«
Elisabeth wusste sehr genau, dass auch ihre Mutter über Papas Abwesenheit verärgert war. Es sah ihm ähnlich, sich drüben in seine Arbeit zu vergraben und die lästige Verwandtschaft Frau und Töchtern zu überlassen. Doch natürlich ließ Alicia Melzer diesen Ärger nicht nach außen dringen. Stattdessen stimmte sie Tante Helene mit einem gut gespielten Seufzer bei und beklagte die Hingabe ihres Ehemannes an seine Arbeit. Er sei ja mit seiner Fabrik so gut wie verheiratet, gehe in aller Frühe hinüber und kehre nicht selten erst in der Dunkelheit wieder in die Villa zurück. Die Verantwortung liege so schwer auf seinen Schultern, jede geschäftliche Entscheidung wolle genau bedacht werden, jeder Fehler in den Werkshallen könne einen wichtigen Auftrag zunichtemachen.
»Wohlstand bedeutet nun einmal rastlose Tätigkeit«, sagte sie mit bedeutsamem Lächeln und blickte dabei Onkel Gabriel an. Der wurde rot, denn es war Samstag, und er hätte eigentlich im Büro sein müssen. Vermutlich hatte er seinem Arbeitgeber irgendeine Lügengeschichte erzählt, Papa hatte einmal gesagt, Onkel Gabriel sei ein unzuverlässiger Angestellter.
Elisabeth hatte es kommen sehen. Der Suppenlöffel fiel Katharina aus der Hand, klatschte in die Rinderbouillon und berührte zugleich mit dem monogrammgeschmückten Ende das gefüllte Weinglas. Das Glas kippte, zerschellte, und der Wein floss auf das Tischtuch. Onkel Gabriel machte eine hastige Bewegung, um das Glas zu halten, dabei blieb er mit der gestärkten Manschette an seinem gefüllten Suppenteller hängen, dessen Inhalt sich auf den Schoß seiner Ehefrau ergoss. Selten hatte man eine derart unglückselige Verkettung von Peinlichkeiten erlebt.
»Else! Bring frische Tücher. Auguste – begleite Frau Melzer ins Gästezimmer hinauf, sie muss sich umkleiden …«
Elisabeth rührte keine Hand, es war gar zu komisch, wie Tante Helene verzweifelt ihren Rock schüttelte und Katharina sich immer wieder bei ihr entschuldigte.
»Es … es tut mir so schrecklich leid, Tante Helene. Ich bin so furchtbar ungeschickt. Ich gebe dir eines von meinen Kleidern.«
Als Auguste die Tür des Speisezimmers für die bekleckerte Tante aufhielt, vernahm man aus der Küche die Stimme der Köchin. Fanny Brunnenmayer war so in Rage, dass man jedes Wort verstand.
»Du bist wirklich das Dümmste, was mir je über den Weg gelaufen ist. Zu nichts bist du zu gebrauchen. Heilige Jungfrau – kann es so viel Blödheit auf einmal geben!«
Alicia Melzer gab Auguste einen Wink, die Tür so rasch wie möglich wieder zu schließen.
»Das neue Küchenmädchen«, sagte sie entschuldigend zu Gabriel Melzer. »Sie muss sich in ihre Arbeit erst hineinfinden.«
4
Es war Hexenwerk. Eine wirre Anordnung von Töpfen und Schüsseln, ein Chaos aus dunkelrotem Wildrücken, gerupften und ausgenommenen Täubchen, Speckseiten, rosigem Filet und eingelegten Hühnerbrüstchen. Dazwischen allerlei Gemüse: Mangold, Zwiebeln, Schalotten, Karotten, Sellerie und auch Äpfel, ein Büschel Petersilie, Dill, Koriander …
»Stehst schon wieder im Weg herum! Ran an den Herd. Das Feuer schüren. Aber nicht zu gach. Was hab ich gerade gesagt? Weg vom Ofen, du verdirbst ja alles!«
Marie rannte hierhin und dorthin. Nahm diesen oder jenen Topf, holte Teller und Löffel herbei, brachte Holz für den Herd, wusch Schüsseln und Messer ab. Was sie auch anfasste – immer war es falsch.
»Nicht den Sahnetopf, du dumme Person. Den Topf mit der Brühe. Da drüben. Mach doch die Augen auf. Rasch, die Soße verkocht mir ja …«
Sie war zu langsam. Wenn sie etwas suchte, griff sie mehrfach daneben, brachte sie das Gesuchte endlich der Köchin, dann hatte die sich schon anderweitig beholfen. Die Küche erschien ihr wie eine gewaltige aufgewühlt wogende See, der Tisch, auf dem die Töpfe und Schüsseln aufgereiht waren, wie ein Schiffsdeck, das im Sturm schlingerte.
»Sei mit den Täubchen vorsichtig. Ganz sanft, dass du ihnen ja keinen Flügel abreißt. Und steck die Federn in eine Tüte, sonst fliegen sie überall herum. Heilige Jungfrau – was hab ich gerade gesagt?«
Irgendjemand hatte ein Fenster geöffnet, und die weißen und grauen Taubenfederchen erhoben sich in die Lüfte. Sie tanzten einen Schneeflockenwalzer über dem langen Tisch, und während Marie umherhüpfte, um wenigstens die Schwungfedern einzufangen, sanken die zarten Flaumfederchen in die Töpfe und Teller hinein. Marie sammelte sie von dem gespickten Rehrücken, aus der Himbeercreme, von dem filetierten Fisch und vor allem aus der Schokoladenmousse, auf der sie sich in dichten Scharen niedergelassen hatten.
»Na? Wie macht sich denn unsere kleine Marie?«, hörte sie die hämische Stimme der Jordan an der Küchentür.
»Stecken Sie Ihre spitze Nase in die eigenen Angelegenheiten«, fauchte die Köchin. »Raus aus der Küche, sonst wird die Sahne sauer!«
Es war unmöglich, es der Köchin recht zu machen. Schon deshalb, weil sie gar nicht genau erklären konnte, was sie benötigte. Um eine gute Küchenhilfe zu sein, musste man den Plan kennen, der im Hinterkopf der Köchin steckte und der ablief, ohne dass sie selbst sich dessen bewusst war. Alles, was sie tat, folgte diesem Plan, und Marie spürte, dass er perfekt war. Für jeden Arbeitsgang gab es den einzig richtigen Zeitpunkt, aus dem Chaos der Töpfe und Teller, aus halbfertigen, rohen und bereits gekochten Speisen fügte sich am Ende das großartige Ganze zusammen. Das achtgängige Diner, das pünktlich um sechs Uhr am Abend serviert werden musste.
Lauchsüppchen mit Sahne, Fisch, Täubchen in Honig, Sellerie in Madeirasoße, Rehrücken mit Preiselbeeren, Gefrorenes, Fruchtschaumtorte, Käse. Danach Kaffee und Tee. Mandelgebäck. Liköre.
Es gab einen Speiseaufzug vom Küchenflur zum Flur im ersten Stock, der sich gleich neben dem Speisezimmer befand. Marie hatte Robert nur kurz gesehen, als er in die Küche hereinschaute, um der Köchin ein paar Fragen wegen des Weins zu stellen. Sie wurden unwirsch oder gar nicht beantwortet, und er trollte sich schließlich. Aber Marie hatte doch seine schwarz-blau gestreifte Livree mit den goldenen Knöpfen bewundern können und die makellos weißen Handschuhe.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: