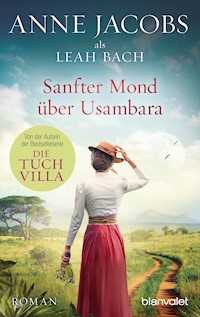14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Dorfladen-Saga
- Sprache: Deutsch
Ganz unterschiedliche Lebenswege warten auf die Schwestern vom Dorfladen – doch ihre Heimat wird ihre Herzen für immer verbinden …
Dingelbach, am Fuße des Taunus, 1925. Der kleine Dorfladen der Familie Haller ist nach wie vor der Dreh- und Angelpunkt, das Herzstück, des ganzen Ortes. Aber Einiges hat sich doch verändert. Frieda besucht weiterhin die Schauspielschule in Frankfurt und steht kurz vor ihrem Abschluss. So ganz loslassen kann sie ihre Heimat allerdings nicht, hängt sie doch sehr vor allem an ihrer kleinen Schwester Ida. Diese ist der schlaue Kopf der Familie und besucht inzwischen ein Gymnasium in Frankfurt. Die älteste und vernünftigste der Schwestern, Herta, ist immer noch die größte Stütze ihrer Mutter im Dorfladen. Aber auch in ihrem Leben wird es einen großen Umbruch geben ... Werden die Schwestern den Weg, den das Leben verspricht gut meistern und ihr Glück finden?
Lesen Sie auch weitere dramatisch-emotionale Bestseller von Anne Jacobs:
Die »Die Tuchvilla«-Saga
Die »Der Dorfladen«-Tetralogie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 789
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Dingelbach, am Fuße des Taunus, 1925. Der kleine Dorfladen der Familie Haller ist nach wie vor der Dreh- und Angelpunkt, das Herzstück des ganzen Ortes. Einiges hat sich aber doch verändert. Frieda besucht weiterhin die Schauspielschule in Frankfurt und steht kurz vor ihrem Abschluss. So ganz loslassen kann sie ihre Heimat allerdings nicht, hängt sie doch sehr vor allem an ihrer kleinen Schwester Ida. Diese ist der schlaue Kopf der Familie und besucht inzwischen ein Gymnasium in Frankfurt. Die älteste und vernünftigste der Schwestern, Herta, ist immer noch die größte Stütze ihrer Mutter im Dorfladen. Aber auch in ihrem Leben wird es einen großen Umbruch geben … Werden die Schwestern den Weg, den das Leben verspricht, gut meistern und ihr Glück finden?
Autorin
Anne Jacobs lebt und arbeitet in einem kleinen Ort im Taunus, wo ihr die besten Ideen für ihre Bücher kommen. Unter anderem Namen veröffentlichte sie bereits historische Romane und exotische Sagas, bis ihr mit der SPIEGEL-Bestseller-Reihe »Die Tuchvilla« der große Durchbruch gelang. Seit Jahren begeistert sie inzwischen auch Leser*innen in einem Dutzend Ländern von Frankreich bis Norwegen. Nach »Der Dorfladen – Wo der Weg beginnt« legt sie nun mit »Der Dorfladen – Was das Leben verspricht« den zweiten Teil ihrer neuen Trilogie vor.
Von Anne Jacobs bei Blanvalet erschienen:
Die Tuchvilla
Die Töchter der Tuchvilla
Das Erbe der Tuchvilla
Rückkehr in die Tuchvilla
Sturm über der Tuchvilla
Wiedersehen in der Tuchvilla
Das Gutshaus – Glanzvolle Zeiten
Das Gutshaus – Stürmische Zeiten
Das Gutshaus – Zeit des Aufbruchs
Der Dorfladen – Wo der Weg beginnt
Der Dorfladen – Was das Leben verspricht
Anne Jacobs
Der Dorfladen
Was das Leben verspricht
Roman
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2024 der Originalausgabe by Blanvalet Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Ulrike Strerath-Bolz
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: Joanna Czogala / Arcangel Images; iStock.com / ivan-96; www.buerosued.de
LH · CS
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-26251-8V002
www.blanvalet.de
Kapitel 1
Juni 1925
Die Hitze lastet schwer auf dem Dorf. Seit Tagen steigt das Thermometer auf über 30 Grad, in den Fachwerkhäusern und Ställen ist die Luft zum Schneiden. Sogar am Sonntag in der Kirche haben die Dingelbacher schwitzen müssen, weil die Wärme inzwischen selbst die dicken Mauern der alten Kirche durchdrungen hat.
Frieda sitzt im Garten hinter dem Haus, auf dem Schoß hat sie eine Blechschüssel, auf dem Tisch steht ein Korb mit Sommerkirschen, daneben ein Topf. Die Kirschen müssen mithilfe einer Haarnadel entsteint werden, danach will Herta daraus Kirschmarmelade kochen. Das Entsteinen ist eine langweilige und eklige Arbeit, weil der rote Saft an den Händen klebt und die Kerne sich nicht gut lösen lassen.
»Du hast richtige Mörderhände«, meint Ida anerkennend, die mit einem Buch neben ihr auf der Wiese sitzt.
»Könntest mir ruhig helfen!«, gibt Frieda brummig zurück.
»Bloß nicht. Ich muss gleich die Wäsche abnehmen!«
Unterwäsche und Büstenhalter hängen schlaff auf der Leine, kein Lüftchen bewegt sie. Friedas neue Hüfthalter schimmern seidig zwischen den ausgebleichten Baumwollsachen. Gestern hat Luise neidisch gefragt, ob sie jetzt »Reizwäsche« tragen würde und ob das zur Schauspielerei dazugehört. Frieda hat sie keiner Antwort gewürdigt. Dingelbach war schon immer ein tristes Kaff voller bornierter Bauern, aber jetzt bei dieser lähmenden Hitze, die nach Kuhmist und Schweinestall stinkt, ist es einfach unerträglich.
Sie wirft die nächste entsteinte Kirsche in den Topf und schaut entmutigt auf den Korb, der einfach nicht leer werden will. Was für ein Aufwand für ein paar Töpfchen Marmelade! Dabei schmecken die Kirschen viel besser, wenn man sie so isst. Sie steckt sich zwei davon in den Mund und spuckt die Steine auf die Wiese. Sie schafft es bis zum Kräuterbeet, Ida kann es besser, die hat vorhin ihren Stein fast bis zum Hühnerhaus gespuckt.
»Heute müssen wir nicht gießen«, meint Ida. »Da gibt’s bald was.«
Sie blinzelt und zeigt nach Westen. Dort sieht man die Wiesen vom Schützhof, wo sie beim Heumachen sind. Der Himmel darüber ist klar und tiefblau, aber ganz hinten, wo es hügelauf geht und die verfallene Hütte steht, kann man ein paar Schleierwölkchen sehen. Wie ein zartes Gespinst schweben sie über dem Hügel, ganz harmlos, aber sie haben es in sich. Die Bauern müssen schauen, dass sie ihr Heu noch von dem Abend in die Scheunen kriegen, sonst ist es hin.
Frieda hätte gegen ein kräftiges Gewitter nichts einzuwenden. Es bringt Abkühlung, und außerdem müssen sie dann am Abend nicht auf den Gemüseacker und das Gießwasser mühsam mit Eimern aus dem Bach herbeischaffen. Sie hadert mit ihrem Schicksal. Warum wurde sie in Dingelbach geboren und hat noch dazu eine überstrenge, pingelige Mutter abbekommen? Es sind Theaterferien, die Schauspielschule hat für einige Wochen den Unterricht eingestellt, was aber nicht heißt, dass in Frankfurt sommerliche Ruhe herrschen würde. Ganz im Gegenteil: Im Zoo, im Palmengarten oder im neuen Waldstadion tummeln sich die Frankfurter auf Großveranstaltungen, da wird zu Jazzmusik getanzt, da gibt es Theateraufführungen, Kabarett, und am Abend wird ein Feuerwerk in den Himmel geschossen. Beim »Sommerfest auf Welle 470« und der »Ersten Presse-Bühnen-Olympiade« auf der Rennbahn sind viele Künstler der städtischen Bühnen dabei, und natürlich gehen auch die Schauspielschülerinnen hin. Alle außer Frieda, die dazu verdonnert ist, klebrige Kirschen zu entsteinen und am Abend zeitig in ihrem Bett zu liegen. Nur mit Ida kann sie darüber reden, höchstens noch mit Lehrer Hohnermann. Aber der wird auch immer spießiger; ständig warnt er sie vor irgendwelchen Gefahren, die in der Stadt auf ein junges Mädchen lauern. Dabei kennt Frieda sich inzwischen aus und glaubt, über solche Dinge besser Bescheid zu wissen als der brave Dorfschullehrer Johannes Hohnermann.
»Frieda! Ida!« ruft die Mutter aus dem Fenster. »Kommt mal helfen!«
»Ach, herrje«, stöhnt Ida missvergnügt und legt den Stiel einer Kirsche als Lesezeichen in ihr Buch. »Jetzt dürfen wir schleppen.«
Frieda steht erleichtert auf und geht zum Regenfass, um ihre Hände zu waschen. Wenigstens etwas Abwechslung.
»War höchste Zeit«, meint sie. »Jetzt kannst du wieder bei uns schlafen, und Mama hat ihre Kammer für sich allein.«
»Meinetwegen hätte Helga ruhig noch bleiben können«, findet Ida.
Es geht darum, dass Helga Schütz, die seit über einem Jahr bei ihnen wohnt, nun endlich eine neue Bleibe gefunden hat. Die Schütz Helga ist damals von ihrem Mann, dem Otto, so schlimm verprügelt worden, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch der Sohn, der damals neunjährige Heinz, musste in die Klinik, weil der Vater ihn gegen den Küchenherd geschleudert hat. Helga hat daraufhin etwas getan, was noch keine Ehefrau im Dorf gewagt hat: Sie hat ihrem Ehemann verkündet, dass sie sich scheiden lassen will, und hat ihn verlassen. Das war ein Skandal in Dingelbach, denn die Ehe ist heilig, Mann und Frau müssen zusammenstehen in guten und in schlechten Zeiten – so ist es schon immer gewesen, und so sehen es die Dingelbacher noch heute. Ehestreitigkeiten kommen vor, auch dass dabei zugeschlagen wird, ist normal, da kann auch ein Ehemann einmal mit einem blauen Auge herumlaufen. Meist ist es jedoch die Frau, die die Prügel einstecken muss. Aber gerade die Frauen im Dorf haben es der Helga verübelt, und als sie aus dem Krankenhaus zurück ins Dorf gekommen ist, hatte nur Marthe Haller, die den Dorfladen führt, den Mut, die Helga bei sich aufzunehmen. Marthe Haller – das ist Friedas und Idas Mutter.
Seitdem hat Helga Schütz bei ihnen gewohnt, und sie sind gut miteinander ausgekommen, obgleich es eng im Haus gewesen ist, sodass Ida sich schließlich eine Schlafgelegenheit unter dem Dach eingerichtet hat. Alles schien sich zum Guten zu wenden, denn weil es dem Otto Schütz nicht gelungen ist, seine Ehefrau mit Gewalt zurück auf den Hof zu holen, hat er erklärt, dass er selbst die Scheidung einreichen wird. Darüber sind sie alle froh gewesen, schon weil der Otto dann die Kosten tragen muss und die Helga demnächst endlich den Mann heiraten kann, der sie liebt und bei dem sie glücklich sein wird. Das ist der Oskar Michalski.
Aber die Dinge haben sich leider nicht so entwickelt wie erhofft.
Daran ist vor allem die Gertrud schuld, die Mutter vom Otto Schütz. Sie hat der Schwiegertochter schon immer das Leben schwer gemacht, und so hat sie ihren Sohn überredet, die Scheidung hinauszuzögern, damit die Helga nicht wieder heiraten kann. So muss Helga als abtrünnige Ehefrau in Schande leben und abwarten, bis der Otto sie freigibt, während Gertrud allerlei böse Gerüchte über ihre Schwiegertochter verbreitet. Und obgleich sich die Leute im Dorf damals über den Otto Schütz aufgeregt haben, weil er Frau und Kind so übel zugerichtet hat, schimpfen jetzt viele auf die Helga, das »untreue Luder«, das nicht zu seinem Ehemann zurückgehen will.
Sogar Marthe Hallers Dorfladen leidet inzwischen unter dieser Geschichte. Das hat die Mutter damals nicht wahrhaben wollen.
»Ach was«, hat sie gesagt. »Die Leute brauchen Waschpulver und Seife, Zucker und Salz, Nähgarn und Knöpfe und vieles mehr – wo sollen sie es denn kaufen, wenn nicht bei mir?«
Doch leider hat Marthe mit der Zeit einsehen müssen, dass sie sich getäuscht hat. Die Umsätze sind immer weiter zurückgegangen, viele kaufen nur noch das Nötigste bei ihr und warten lieber, dass jemand aus dem Dorf hinüber nach Steinbach oder nach Oberursel fährt, um sich von dort etwas mitbringen zu lassen. Und das alles nur, weil Marthe Haller diese »sündige Person«, die Helga, in ihrem Haus wohnen lässt.
Nach Ostern ist der Schütz Gertrud eine neue Schikane eingefallen. Sie schickt den Knecht Hannes einmal in der Woche mit dem Pferdewagen nach Bad Homburg und hat den Dorffrauen verkündet, jede, die etwas zu besorgen hätte, könne unentgeltlich mitfahren. Das hat vielen Bäuerinnen gefallen, schon weil der Hannes ein junger, fröhlicher Bursche ist, und wenn es die Feldarbeit erlaubt hat, war der Wagen voller Frauen, die an dieser neuen Art der Einkaufsfahrt großen Spaß gehabt haben.
Das hat dem Dorfladen schlimmen Schaden zugefügt, weil die Hallers auf den Waren sitzen geblieben sind und sich zusätzlich noch anhören müssen, dass die Sachen in Bad Homburg besser und sogar preiswerter seien als im Dingelbacher Dorfladen. Helga ist darüber ganz verzweifelt gewesen. Sie hat schon überlegt, in die verfallene Hütte auf dem Hügel einzuziehen, weil sie Marthe Haller nicht solche Schwierigkeiten machen will. Das hat Friedas Mutter ihr ausgeredet, aber dennoch war guter Rat teuer. Niemand in Dingelbach war bereit, Helga eine Unterkunft zu geben. Eine weggelaufene Ehefrau, die auf ihre Scheidung wartet – die will keiner haben, zumal man sich mit dem reichen Otto Schütz anlegt, wenn man ihr auch nur eine Dachkammer vermieten würde.
Schließlich aber haben der Killinger Hannes, der immer zur Helga gehalten hat, und der Rudolf Alberti, der Dorfheiler, sich energisch für die Helga eingesetzt und den Rabenwirt Guckes überredet, ihr eines der beständig leer stehenden Zimmer in seinem Gasthof zu vermieten. Der Guckes Jörg ist bald darauf eingegangen, aber seine Karin hat sich zuerst heftig gesträubt und behauptet, wenn »so eine« bei ihnen wohnen täte, würden ihnen die Gäste wegbleiben. Aber das hat der Killinger Hannes ihr ausgeredet, denn wo sollen die Dingelbacher sonst zum Abendschoppen einkehren, wenn nicht im »Raben«?
»Glaubst du vielleicht, die saufen ihr Bier und den Äppler daheim, wo die Ehefrau mitzählt?«, hat er der Karin lachend vorgehalten. »Des wird so schnell net passiere, und wenn sich der Schütz Otto auf den Kopf stellt.«
Dann haben sie verhandelt, denn die Karin Guckes, die Rabenwirtin, hat ihre Bedingungen gestellt: Helga soll im Haus und in der Küche helfen und am Morgen die Gaststube wischen. Bedienen darf sie auf keinen Fall, auch sonst soll sie sich so wenig wie möglich zeigen, und die vier Guckeskinder dürfen nicht zu ihr hinaufgehen.
»Und der Michalski Oskar hat Hausverbot«, hat die Karin weiter verlangt. »Sonst sagen die Leut noch, dass wir da oben ein ›Etablissemang‹ eröffnet hätten.«
Helga hat sich in alles gefügt. Sie ist unendlich froh, den Dorfladenfrauen nicht mehr zu Last fallen zu müssen, aber in Dingelbach bleiben will sie unter allen Umständen. Wegen dem Heinz, ihrem Sohn, der auf dem Schützhof beim Vater lebt. An dem Heini hängt die Helga mit allen Fasern ihres Herzens. Sie glaubt immer noch, dass sie eines Tages als Oskars Ehefrau unbehelligt in Dingelbach leben kann und dass der Heini bei ihnen ein und aus gehen wird. Frieda wundert sich oft, wie stur die Helga sich dieser Hoffnung verschrieben hat, dabei weiß sie doch recht gut, wie die Dingelbacher sind, sie hat ja lange genug im Dorf gelebt.
»Die Zeiten ändern sich«, hat Helga lächelnd gesagt. »Sie werden es halt einsehen müssen.«
Heute Nachmittag soll also endlich der Umzug in das »Gasthaus zum Raben« stattfinden. Es ist ein guter Zeitpunkt, weil das Dorf beinahe leer gefegt ist, denn alles, was Beine hat und arbeiten kann, ist draußen auf den Wiesen. Heute früh haben sie die letzten Stücke gemäht; wenn sie den Tag über fleißig wenden, können sie das Heu gegen Abend auf die Wagen gabeln und einfahren. Der Schütz Otto und zwei oder drei andere, die es sich leisten können, haben Saisonarbeiter eingestellt und kommen gut voran. Die ärmeren Bauern müssen schauen, wie sie die Arbeit schaffen, da müssen auch die Kinder, sogar die Kleinsten, mit ran, und wer ein guter Nachbar ist, der packt auch einmal zu, wenn er sieht, dass der andere nicht zurechtkommt. Allen voran der Dorflehrer Johannes Hohnermann, der selbst nur einen Garten hat und auf dem Acker hilft, wo er nur kann.
Als Frieda und Ida ins Haus gehen, sehen sie, dass die Kammer, die Helga bewohnt hat, schon leer geräumt ist. Die wenigen Dinge, die Helga gehören, hat sie in zwei Bündeln zusammengepackt. Jetzt geht es darum, die Nähmaschine, die Onkel Schorsch ihr großzügig geschenkt hat, die enge Treppe hinunterzutragen. Da müssen sie alle mit anfassen, denn die Maschine ist schwer, und auch der Tisch mit dem gusseisernen Tretbügel hat sein Gewicht. Ida hat Maschine und Tisch auseinandergebaut und erklärt, sie würde beides zusammensetzen, sodass die Maschine nach dem Transport wieder »picobello« laufen würde. Wenn Ida das sagt, dann schafft sie das auch, deshalb tragen sie nun Maschine und Tisch getrennt hinunter und stellen beides auf den Leiterwagen. Sie legen ein Bettlaken darüber, denn Ida hat gesagt, dass der Staub, der von der Dorfstraße aufgewirbelt wird, der Maschine schaden kann. Aber zum Glück geht draußen nicht das leiseste Lüftchen. Die Fachwerkhäuser brüten in der Sommerhitze, man kann das trockene Gebälk knacken hören, nur die Schwalben fliegen eifrig aus den Ställen ein und aus, weil sie ihre Jungen füttern müssen. Herta, die älteste der drei Hallertöchter, bleibt im Laden zurück, falls sich wider Erwarten doch Kundschaft einstellt, die anderen bewegen sich langsam in Richtung Gasthof. Helga und die Mutter tragen die Bündel über der Schulter, Ida und Frieda ziehen den Leiterwagen.
»Wie eine Karawane in der Wüste«, sagt Ida und wischt sich den Schweiß von der Stirn. »Bloß die Kamele fehlen.«
»Das sind wir«, bemerkt Frieda. »Wir sind die Kamele.«
»Kamele sind kluge und ausdauernde Tiere«, belehrt Ida die Schwester. »Man nennt sie auch ›die Wüstenschiffe‹.«
»Weil da in der Wüste so viel Wasser ist, wie?«, knurrt Frieda.
»Nee. Weil man vom Schaukeln seekrank wird, wenn man draufsitzt.«
Ida findet, dass Helga ein Recht darauf hat, in Dingelbach zu bleiben, und wenn die Dingelbacher das nicht einsehen, sind sie selber schuld. Ida ist ein ungewöhnliches Mädchen – sie tut, was sie will, und nimmt sich rücksichtslos, was sie braucht. Mit ihren erst fünfzehn Jahren ist sie schon lange kein Kind mehr.
Am Eingang vom »Gasthof zum Raben« wartet schon die Karin Guckes ungeduldig mit dem Zimmerschlüssel in der Hand.
»Seid ihr endlich da?«, sagt sie mürrisch. »Hab net den ganzen Tag Zeit. Das Heu muss in die Scheune, und ich steh mir hier die Beine in den Bauch.«
Auch der Guckes Jörg und seine Familie sind beim Heumachen, weil sie neben dem Gasthof noch eine kleine Landwirtschaft betreiben und vier Kühe im Stall stehen haben. Karin winkt Marthe und Helga mit ihren Bündeln hinein, dann rollt sie die Augen, weil die beiden Mädchen umständlich beginnen, die Nähmaschine abzuladen.
»Wie lang soll das denn dauern?«, schimpft sie und läuft herbei, um zu helfen. »Dass die da oben eine Nähstubb einrichtet, das war net ausgemacht.«
Frieda ärgert sich über die Guckes Karin, die sonst eigentlich gar nicht so übel ist, aber im Kopf halt dumpf, wie alle Dingelbacherinnen. Einerseits will sie Geld für das Zimmer haben, aber nähen soll Helga dort nicht. Dabei kann Helga sehr gut nähen, und es finden sich trotz allem Leute im Dorf, die ihr kleine Aufträge geben. So sind sie, die Dingelbacher. Nach außen hin heißt es: Pfui, die hat ihren Ehemann verlassen. Aber wenn es darum geht, etwas zu sparen und aus der alten Jacke des Vaters Hose und Weste für den Sohn zu nähen, dann kommen sie heimlich an und tun freundlich mit der Helga. Weil sie solche Arbeiten gut und für wenig Geld erledigt.
Das Zimmer, in dem Helga von jetzt an wohnen wird, verdient seinen Namen kaum, es ist eher eine Kammer. Winzig klein ist es, gerade das Bett und ein Stuhl passen hinein, einen Schrank gibt es nicht, nur ein paar Haken an der Wand. Mit Mühe quetschen sie die Nähmaschine vor das kleine Fensterchen, das nach hinten zum Hof hinausgeht. Nicht einmal ein Ofen ist vorhanden, aber Karin erklärt, der Rauchfang sei gleich hinter der Wand, das würde im Winter genügend Wärme geben.
»Das soll ein Gästezimmer sein?«, fragt Ida, die kein Blatt vor den Mund nimmt. »Da ist ja unser Hühnerstall ein Palast dagegen.«
»Wenn’s der Helga net gefällt – sie braucht’s net nehmen«, gibt Karin Guckes giftig zurück. »Geraucht wird hier net. Und die Gardinen sind neu, da dürfen keine Flecken drankommen.«
Tatsächlich hat sie Vorhänge aus dickem Stoff angebracht, weil sie nicht will, dass jemand die Helga durchs Fenster sehen kann, wenn am Abend das Licht angeschaltet ist.
»Da wisst ihr jetzt Bescheid«, meint die Karin ungeduldig und gibt Marthe den Zimmerschlüssel. »Ich muss hinauf, der Jörg wartet auf mich. Es liegt ein Unwetter in der Luft, wenn wir nur das Heu rechtzeitig in die Scheune kriegen!«
Damit läuft sie die Stiege hinunter und lässt sie allein.
Die Mutter ist zornig, denn sie weiß, dass dieser Raum kein Gästezimmer, sondern die Abstellkammer gewesen ist, in der früher allerlei Gerümpel stand. Das haben sie ausgeräumt und ein altes Bettgestell mit einer Strohmatratze hineingestellt, damit sie ja keines der drei Gästezimmer hergeben müssen.
»Dass die Karin sich so benimmt, das hätt ich nicht gedacht!«, schimpft sie. »Eine Sünd und eine Schand, dafür auch noch Geld zu nehmen!«
»Lass gut sein, Marthe«, sagt Helga. »Es ist ja nicht für immer.«
Die Mutter hilft Helga, das Bett mit dem mitgebrachten Laken zu beziehen. Ida hat sich darangemacht, die Nähmaschine wieder zusammenzubauen. Frieda verabschiedet sich, sie ist froh, aus dieser trostlosen Kammer hinauszukommen. Lieber draußen in der Hitze braten als in diesem engen Loch ersticken. Arme Helga. Das alles hat sie sich eingehandelt, weil sie seinerzeit so dumm war, den Otto Schütz zu heiraten. Jetzt wird sie hier in Dingelbach ganz sicher keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen, da kann sie machen, was sie will. In der Stadt, da ist es anders. Da lassen sich die Frauen scheiden, und niemand stört sich daran. Mindestens zwei Schauspielerinnen am Theater sind geschieden, das weiß Frieda ganz sicher. Und andere haben ein festes Verhältnis, leben ohne Trauschein mit einem Mann zusammen. Die Großmutter hat zwar gesagt, das gäbe es nur unter Künstlern, da seien die Sitten schon immer freier gewesen, aber Frieda glaubt ihr das nicht. In der Stadt denken die Menschen einfach nicht so engstirnig wie auf dem Land. Stadtluft macht frei, heißt es. Ende des Jahres, noch vor der Abschlussprüfung, will sie schon einmal an verschiedenen Theatern vorsprechen, um ein Engagement zu bekommen. Dann ist endgültig Schluss mit Dingelbach.
Draußen ist es immer noch unerträglich heiß, aber das Licht hat sich verändert. Es ist unstet, schwirrend, zugleich liegt eine Spannung in der Luft, die unruhig macht und das Herz beklemmt. Frieda schaut gen Westen, wo sie auf der Schützwiese den Heuwagen beladen. Richtig: Das harmlose Wolkengespinst hat sich zu einer grauen Masse verdichtet und liegt nun wie ein fernes Gebirge am Horizont. Wenn man genau hinschaut, sieht man, wie immer neue, höhere Wolkenspitzen wie drohende Fäuste aus der grauen Formation hinausstoßen und sich zum Dorf herüberrecken.
Vorsichtshalber nimmt sie schon einmal den Leiterwagen mit und zuckelt damit in Richtung Dorfladen. Ein schwacher Wind hat sich erhoben und wirbelt Staubwolken hoch, als beim Dorfbrunnen der erste, hoch beladene Heuwagen auftaucht. Auf dem Kutschbock sitzt der Kappus Dieter, Luises Ehemann, das Hemd klebt ihm am Leib. Er traktiert die Stute mit der Peitsche, weil sie beim Brunnen stehen bleiben will, um zu saufen.
Frieda schiebt den Leiterwagen in die kleine Remise neben dem Laden und steigt die Treppe hinauf. Ihre Schwester Herta sitzt auf dem Hocker und liest in einem Groschenheftchen. Als Frieda eintritt, schaut sie sie mit glasigen Augen an. Aha – sie hat wieder von dem schönen Prinzen geträumt, der das arme Mädchen heiratet.
»Ich hab die Wäsche abgenommen«, sagt Herta vorwurfsvoll, weil das eigentlich Idas Aufgabe gewesen wäre. »Die Kirschen stehen in der Küche.«
»Danke!«
Ein schwaches Donnergrollen ist zu hören. Herta legt das Heftchen weg und läuft zum Schaufenster, weil man von dort auf die Dorfstraße schauen kann. Jetzt ist draußen Bewegung entstanden. Der Grossmann Fritz kommt mit dem Heuwagen, hinter ihm drängelt der Schütz Otto, der zweispännig fährt und in Eile ist, weil er noch eine weitere Fuhre vor sich hat. Man hört ihn laut fluchen und den Grossmann Fritz verwünschen, der sein Heu schief aufgeladen hat, sodass die Ladung zu kippen droht.
»Zu deppert, um anständig aufzugabeln. Gleich liegt’s im Pfarrgarten, du blöder Watz!«
»Endlich tut sich hier mal etwas«, seufzt Herta. »Ich hab schon geglaubt, das Dorf wär ganz und gar ausgestorben, so still ist es gewesen.«
Es rumpelt wieder. Noch ein Stück entfernt, aber nicht minder bedrohlich. Frieda spürt die schwelende Anspannung in allen Fasern, die Luft scheint zu knistern, ihre Hände werden fahrig. In der Küche wirft sie einen Blick auf den Korb, der noch immer randvoll mit roten Kirschen ist – nein, sie hat jetzt keine Ruhe, sich hinzusetzen und das Zeug zu entsteinen. Sie steigt hinauf in die Kammer, um sich in das Drama Der Kaufmann von Venedig zu vergraben. Sie braucht jetzt Theaterluft, eine Rolle, in die sie sich hineindenken kann, das Gefühl, dort zu sein, wo sie hingehört, und nicht in diesem öden Dorf, wo engstirnige Menschen einander sinnlos das Leben schwer machen.
Doch die Flucht gelingt ihr schlecht. Sie kann sich nicht in das Stück hineingeben, sich in die kluge und mutige Portia verwandeln, die als Advokat verkleidet einen Freund vor dem Tod errettet. Vermutlich liegt es an dem Lärm auf der Dorfstraße, vielleicht auch an dem immer lauter heranrollenden Donner und den aufzuckenden Blitzen. Wenn es nur endlich regnen würde – das wäre eine Erlösung.
Die Kammertür fliegt auf, und Ida kommt herein. Ihr Gesicht ist rot und verschwitzt, das Kleid hat dunkle Flecken. Rötliche Locken, die sich aus den Zöpfen gelöst haben, kleben ihr an den Schläfen.
»Jetzt langt’s mir«, stöhnt sie. »Das hält ja keine Sau aus. Schneid sie mir ab, Frieda!«
»Was?«, fragt Frieda irritiert und legt das Textheft zur Seite.
»Was wohl? Die Haare. Ich schwitz mich ja tot mit den langen Zöpfen.«
Ida hat wild entschlossen Mutters Schere aus dem Nähkasten entwendet. Frieda hat Bedenken. Auch sie denkt daran, sich einen Bubikopf schneiden zu lassen, aber die Mutter hat es streng verboten. Keine Frau, kein Mädchen im Dorf trägt das Haar kurz, das tun nur die sittenlosen Frauen in der Stadt, die sich die Lippen anmalen und seidene Unterwäsche mit Spitzen dran anziehen.
»Du kannst die doch nicht einfach abschneiden!«, regt sich Frieda auf. »Das muss ein Frisör machen. Sonst siehst du aus wie ein Wischmopp.«
Ida hat dazu ihre eigene Meinung. Abgeschnitten ist abgeschnitten, ob es der Frisör macht oder Frieda, das ist ihr gleich.
»Ich hab es satt, zehn Pfund Wolle am Kopf hängen zu haben«, schimpft sie und reicht Frieda die Schere. »Los, fang an.«
Ein kräftiger Donnerschlag hindert Frieda an einer Antwort, aber sie nimmt die Schere und schnippelt damit prüfend in der Luft herum.
»Mama kriegt einen Herzschlag, wenn ich das mache«, wendet sie vorsichtig ein.
»Sie wird es überleben.«
Ida schaltet das Deckenlicht ein, weil die Gewitterwolken inzwischen die Sonne verdunkeln, und setzt sich neben die Schwester aufs Bett. Mit einer auffordernden Bewegung hält sie ihr den rechten Zopf hin.
»So geht das nicht. Du musst die Zöpfe aufmachen. Und dann müssen wir das Haar durchkämmen.«
»Was denn noch?«, stöhnt Ida ärgerlich. »Soll ich sie vorher ondulieren und mit Parfüm einsprühen?«
»Nur kämmen. Sonst gibt es lauter Zipfel.«
Widerwillig steht Ida auf und nimmt den Kamm von der Kommode. Dann löst sie die Spangen und entflechtet die langen kupferfarbigen Zöpfe. Das Haar breitet sich wie eine leuchtende, wellige Flut um sie aus, es reicht ihr bis zur Taille und ringelt sich an den Enden in Löckchen. Eigentlich ist es viel zu schön, um es abzuschneiden. Ida kämmt sich jetzt einen Teil des Haars über das Gesicht und fordert: »Schneide mir erst einmal einen Pony.«
Es donnert gewaltig. Das Gewitter ist jetzt direkt über ihnen. Die Schere in Friedas Hand zittert, aber sie setzt sie vorsichtig an und schneidet. Es ist ein seltsames Gefühl, weil Idas Haar sehr dick ist. Fast fühlt es sich an, als würde man Fäden aus Glas zerschneiden.
»Der Pony ist zu lang!«, protestiert die Schwester und pustet sich eine abgeschnittene Strähne aus dem Gesicht. »Ich kann ja gar nichts sehen!«
Frieda bessert nach. Die kurzen Härchen fliegen umher und verteilen sich auf Betten und Fußboden. Ida muss niesen.
»Das kannst du nachher aufkehren«, erklärt Frieda und schnippelt ein paar vorwitzige Spitzen zurecht. Ganz gerade ist es nicht geworden, aber fürs erste Mal nicht übel.
»Jetzt den Rest«, verlangt Ida. »Einen Daumenbreit unter dem Ohr. Und hinten kürzer.«
Frieda nimmt Maß und setzt die Schere an, da kracht über ihnen ein mächtiger Donnerschlag, gerade so, als wäre über dem Haus eine Mörsergranate zerplatzt. Gleich darauf geht das Deckenlicht aus.
Ida schreit wie am Spieß. »Aua! Blöde Kuh! Du hast mich ins Ohrläppchen geschnitten!«
»Entschuldigung«, stottert Frieda. »Tut’s weh?«
»Nein. Es ist ein wunderbares Gefühl. Schneid gleich noch mal ins andere Ohr!«, gibt Ida mit zornigem Spott zurück.
Das Licht flackert auf, geht wieder aus, kommt zurück. Frieda betupft Idas blutendes Ohrläppchen mit einem Taschentuch. Es ist gar nicht so schlimm, wie sie sich anstellt. Das Blut ist rasch gestillt.
»Jetzt mach weiter. Ich kann ja nicht mit einem halben Bubikopf herumlaufen. Und wenn du mich noch mal schneidest, hau ich dich!«
»Dann kannst den Rest selber machen!«
Frieda setzt ihr Werk fort. Lange wellige Haarsträhnen fallen auf das Bett, breiten sich über Decke und Kopfkissen aus, hängen an der Bettkante herab.
»Fertig?«
»Schau mich mal an. Da ist was zu lang. Das muss noch weg.«
Frieda setzt zur Feinarbeit an, schnippelt hier und dort etwas ab, dann ist sie zufrieden. Ida springt auf und läuft zum Waschtisch, an dem oben ein viereckiger, etwas blinder Spiegel befestigt ist.
»Famos!«, schwärmt sie und schüttelt das kurze Haar. »Einfach großartig. Was für ein Gefühl! Die große Freiheit!«
Sie wühlt mit den Händen in ihrem Haar, reibt sich die Kopfhaut, verstrubbelt die ganze schöne Bubikopffrisur, die Frieda so mühevoll zurechtgeschnitten hat.
»Jetzt schaust du aus wie ein Besen. Kämm das wieder glatt!«
»Besen ist auch schön«, behauptet Ida und fährt mit den Fingern durch die Frisur, dass das Haar steil emporsteht. »Die werden staunen, wenn ich so in die Schule komme.«
»Erst mal wird Mama staunen.«
»Und Herta!«
»Die sowieso. Die kriegt einen Ohnmachtsanfall.«
Ein dicker Tropfen klatscht gegen die Fensterscheibe. Es blitzt grell auf, der Donner kracht einige Sekunden später und rollt wie ein Bollerwagen durch die Wolken. Dann kann man hören, wie die Regentropfen auf das Dach fallen. Frieda sammelt die abgeschnittenen Strähnen ein, legt sie ordentlich aufeinander und hält schließlich ein dickes Bündel kupferfarbener Lockenflut in der Hand. Glänzendes rotes Gold.
»Die könnte ich nach Frankfurt mitnehmen und an einen Frisör verkaufen«, überlegt sie.
»Dann krieg ich aber die Hälfte!«, verlangt Ida. »Sind schließlich meine Haare.«
Sie macht das Fenster auf und behauptet, es würde nicht hereinregnen, weil der Wind vom Westen kommt. Die Schwestern stehen nebeneinander, atmen die belebende, warme Feuchte ein und schauen über Wiesen und Äcker, auf die der Regen in dichten grauen Fäden herabstürzt. Was für eine Erlösung! Es ist, als würde die Erde sich ausdehnen und die Nässe durstig einsaugen. Gluckernd rinnt das Wasser durch die Regenrinne, schmatzend plätschert es unten im Regenfass.
»Mitunter ist es doch ganz schön in Dingelbach«, meint Frieda und nimmt einen tiefen Atemzug. Es riecht nach Heu, nach warmer Feuchtigkeit, nach Gartenkräutern und bittersüßem Holunder. Ein heimatlicher Geruch.
»Und wie!«, gibt Ida zurück und schüttelt das kurze Haar. »Dingelbach ist der schönste Ort auf der ganzen Welt!«
Kapitel 2
»Das muss ich mir erst einmal überlegen«, sagt Ilse Küpper gedehnt. »Es kommt etwas überraschend.«
»Natürlich, natürlich«, versichert Oskar Michalski und fährt sich nervös durch das dunkle Haar. »Es muss ja nicht gleich morgen sein, Frau Küpper. Denken Sie in Ruhe darüber nach.«
Nach Arbeitsschluss hat er die Fabrikbesitzerin um ein kurzes Gespräch gebeten, und sie sind in ihr Büro gegangen, das schon halb ausgeräumt ist, weil sie in einigen Tagen drüben im Neubau mehrere Verwaltungsräume beziehen wird. Nur der Schreibtisch und zwei Stühle sind noch übrig, dazu ein Rollwagen mit den wichtigsten Akten. Morgen kommt jemand von der Telefongesellschaft, um den Anschluss zu verlegen.
»Ich lasse es mir durch den Kopf gehen«, verspricht sie.
»Ich danke Ihnen, Frau Küpper«, sagt er und steht auf. »Es wäre für uns alle eine gute Lösung, hab ich mir gedacht.«
»Vielleicht …«
Er lächelt sie rührend hoffnungsvoll an, wünscht ihr einen »angenehmen Feierabend« und geht hinaus. Ilse bleibt mit einem beklommenen Gefühl zurück. Was für eine verrückte Idee! Er hat sie um ein Stück Land gebeten, fünfhundert Quadratmeter von ihrem Park, der zwar momentan zu Ackerland umgewandelt ist, aber demnächst – wenn die Geschäfte weiter so gut laufen – wieder in alter Schönheit auferstehen soll. Oskar hat vor, ein Haus für sich und seine Helga zu bauen, um dort mit ihr zu leben, wenn sie erst verheiratet sind.
Der Vorschlag erscheint Ilse eher wie eine Verzweiflungstat. Ein Stück Land kaufen. Ein Haus bauen. Wovon will er das bezahlen? Er wird sich verschulden müssen. Und wie wird es ausgehen? Was, wenn seine Hoffnung trügt? Oskar Michalski lebt seit über einem Jahr in einer extrem belastenden Situation, schwankt zwischen mühsam gefasster Geduld und übereilten Aktionen, die ihr oft den Schweiß auf die Stirn treiben. Sie kann ihn ja so gut verstehen. Es ist unsagbar schwer für ihn, so lange auf die Frau, die er liebt, warten zu müssen. Ein Wunder, dass er es überhaupt durchgehalten hat, ein anderer wäre längst davongelaufen. Nicht so Oskar Michalski. Er ist gekommen, um seine Helga zu erobern und heimzuführen, und das wird er tun, wie schwer es auch immer für ihn sein wird. Ilse ist gerührt von seiner Treue, und nicht selten steigt in ihr der Zorn auf diese Frau auf, die so hart und unbarmherzig mit ihm ist. Weil Helga ihren Sohn nicht verlassen will, hat sie beschlossen, in Dingelbach zu bleiben. Ehrlich und anständig soll es zugehen, hat sie verlauten lassen. Erst wenn sie geschieden ist, wird sie zu Oskar kommen und die Seine werden. Vorher nicht. Auf keinen Fall will sie mit ihm in »wilder Ehe« leben, denn dann wäre sie in Dingelbach endgültig »unten durch«.
»Die glaubt allen Ernstes, die Dingelbacher würden sie wieder in ihrer Mitte aufnehmen, wenn sie erst mit dem Oskar verheiratet ist«, hat Ilses Haushälterin Carla gesagt und sich an die Stirn getippt. »Die wird sich schön wundern, die Helga. Eine geschiedene Frau bleibt eine geschiedene Frau. Auch wenn sie sich wieder verehelicht hat. Und eine kirchliche Hochzeit gibt das sowieso nicht.«
Carla ist der Meinung, die Helga wäre besser mit dem Oskar von hier fortgegangen – Kind hin oder her. Einem Mann so etwas zuzumuten, das ist nicht anständig. Ilse neigt inzwischen ebenfalls zu dieser Ansicht. Oskar geht es nicht gut, zweimal hat er im Winter mit einer schweren Bronchitis gekämpft, im Frühjahr hat ihn die Grippe aufs Krankenlager geworfen. Dünn ist er geworden. Faltig und hohläugig schaut er aus, findet keine Ruhe und verbringt die Wochenenden drunten beim Killinger Hannes, wo er angeblich in der Schmiede mithilft. Dass er sich dort ein paar mal mit der Helga getroffen hat, will er nicht sagen, aber sie vermuten es. Spät am Abend muss das gewesen sein, weil die Helga tagsüber von hundert neugierigen Augen bewacht wird und weil sie selbst so große Sorge um ihren Ruf hat. Dabei ist der sowieso schon restlos ruiniert.
Ilse schüttelt den Kopf und beschließt, die Angelegenheit mit Richard Goldstein zu besprechen. Er war ein paar Tage in Frankfurt, um irgendwelche wichtigen Bankangelegenheiten zu regeln, doch heute Abend wird er wieder in seine gemietete Wohnung in der Villa zurückkehren, und vermutlich hat er vor, sie zum Essen auszuführen. Seit über einem Jahr wohnt und arbeitet Richard nun schon hier, er hat sich oben ein Atelier eingerichtet und – wie sie schon gehofft hat – wieder zu malen begonnen. Ihr Verhältnis ist freundschaftlich, kollegial, von gegenseitigem Respekt, aber auch von einer gewissen Anziehung geprägt.
Ilse macht sich nichts vor. Richard Goldstein ist ein gut aussehender Mann, er wird in Frankfurt vermutlich die eine oder andere Dame besuchen, allerdings ohne sich binden zu wollen. Sie selbst ist ihm eine gute Freundin, eine geduldige Zuhörerin und Ratgeberin, der er vieles anvertraut, das er weder mit seiner Mutter noch mit irgendwelchen anderen nahestehenden Personen besprechen mag. Vor allem seine lange unterdrückte Neigung für die Kunst ist Thema ihrer abendlichen Gespräche, aber auch Intimeres, Persönliches, wie seine Erlebnisse im Krieg, die er wie so viele Männer nicht vergessen kann und die ihn belasten. Nur über sein seltsam distanziertes und doch anhängliches Verhältnis zu seiner Mutter hat er sich niemals geäußert.
Ilse empfindet seine Gegenwart als eine große Bereicherung. Die Begegnungen mit ihm sind ein anregender Ausgleich zu ihrem harten Tagesgeschäft als Fabrikchefin, ein Einblick in eine für sie neue, bisher fremde Welt, die sie fasziniert und an der sie nun mit Eifer teilnimmt, indem sie das ihr eigene praktische Organisationstalent beisteuert. Richard Goldstein hat sein Atelier schon bald nach seinem Einzug auch für andere Künstler geöffnet, er veranstaltet kleine Ausstellungen, zu denen er Freunde und Bekannte aus der Umgebung einlädt. Auch Vorträge, Musikabende und Lesungen sind geplant. Seine Absicht dabei ist, Geld und Kunst zusammenzubringen, um begabten, noch unbekannten Künstlern zu einem Einkommen zu verhelfen, das ihnen erlaubt, ohne Geldsorgen zu leben und zu arbeiten. Er selbst hält sich nach Ilses Meinung viel zu bescheiden im Hintergrund; sie hat ihn bisher nicht überreden können, seine eigenen Werke der Öffentlichkeit zu zeigen.
»Sie sind zu schlecht«, hat er behauptet. »Ich bin kein Künstler, nur ein begabter und fleißiger Handwerker. Zum Glück bin ich nicht eitel genug, um mir darüber Illusionen zu machen.«
»Mir gefallen Ihre Bilder«, sagt sie und meint es ernst.
»Darüber bin ich sehr glücklich!«
Wenn er sie auf diese warme und herzliche Art anlächelt, ist sie verwirrt und dicht daran, sich falschen Hoffnungen hinzugeben. Er ist ein Freund, ein guter Kamerad – nichts weiter. Dieses anziehende Lächeln gönnt er auch anderen Menschen, vor allem den Künstlern, die er in die Villa einlädt, den Männern ebenso wie den Frauen. Auch Carla, die ihn mit großem Respekt behandelt und sogar einen angedeuteten Knicks macht, wenn er sie begrüßt, ist schon in den Genuss dieses Lächelns gekommen.
Ilse schließt das Büro ab und geht hinüber zur Villa, um sich ein wenig zurechtzumachen, bevor er eintrifft. Nur die verschwitzte Bluse wechseln und mit dem Kamm durch das Haar fahren – sonst nichts. Schließlich kennen sie sich nun schon über ein Jahr, wohnen im gleichen Haus, und sie hat mit Vergnügen festgestellt, dass auch er wenig Wert auf korrektes Aussehen legt, wenn er dort oben an der Arbeit ist. Im Sommer findet sie ihn oft mit einer hellen Hose und einem Sommerhemd bekleidet, barfüßig mit hochgekrempelten Ärmeln vor seiner Staffelei stehen. Er ist schmal, eher sehnig als muskulös, wenn die oberen Hemdknöpfe offen stehen, kann sie seine dunkle Brustbehaarung sehen. Er trägt eine feine Goldkette um den Hals, an der ein Medaillon hängt. Wahrscheinlich ein Familienerbstück.
Carla öffnet ihr die Haustür, sie hat eine frische blütenweiße Schürze umgebunden, weil sie weiß, dass »Herr Goldstein« heute zurückkommt.
»Ich habe Tee vorbereitet«, flüstert sie Ilse zu. »Den Kandiszucker hat mir Marthe Haller extra bestellt.«
»Sehr schön, Carla. Ob wir hier oder auswärts essen, weiß ich leider nicht …«
»Herr Goldstein hat vorhin angerufen. Er will Sie nach Bad Homburg in das Restaurant Ihres Bruders ausführen. Nun ja – er will sicher nachschauen, wie Ihr Bruder das Geld angelegt hat …«
»Was für eine nette Idee«, sagt Ilse und wirft Carla einen vorwurfsvollen Blick zu.
»Genau das habe ich am Telefon auch gesagt, gnädige Frau.«
»Dann muss ich mich umkleiden. Du kannst ihm ja schon einmal Tee servieren, falls er inzwischen ankommt.«
»Sehr gern, Frau Küpper.«
Während Ilse die Treppe hinauf in ihre Räume geht, ärgert sie sich über Carlas Bemerkung. Es hat ihr von Anfang an nicht gefallen, dass Richard ihrem Bruder Josef vor einem halben Jahr einen günstigen Kredit vermittelt hat, den Josef ohne diesen Freundschaftsdienst nirgendwo bekommen hätte. Inzwischen weiß sie, dass ihr Bruder rettungslos verschuldet ist – hätte Richard Goldstein ihm nicht hilfreich unter die Arme gegriffen, dann wären Gasthaus und Landbesitz in Bad Homburg längst versteigert, und ihr Bruder samt Familie fiele ihr zur Last. Trotzdem hat sie Richard abgeraten, da sie fürchtet, dass auch dieses Geld in den hochfliegenden Plänen ihres Bruders versickern wird. Doch Richard hat sich nicht von seinem großmütigen Vorhaben abhalten lassen. Allerdings hat er ein langes und offensichtlich hartes Gespräch mit Josef geführt, sich dessen Finanzen offenlegen lassen und gemeinsam mit ihm einen Plan erstellt, wie und in welche Projekte das Geld zu investieren ist. Ilse war bei dieser Verhandlung nicht anwesend, was sie sehr verunsichert, denn sie kennt ihren Bruder, der nicht gern mit der Wahrheit herausrückt und eine Neigung zu krummen Touren hat. So muss sie einfach auf Richards geschäftliches Geschick vertrauen und hoffen, dass er weiß, was er tut.
Als sie im hellblauen Sommerkleid in den zweiten Stock hinaufsteigt, steht Richard dort an einem der hohen Fenster, um über die Landschaft zu blicken. Es ist immer noch unerträglich heiß, aber der Gewitterguss vor einigen Tagen hat die gemähten Wiesen ergrünen lassen, allerdings auch etliche Dellen und Einbrüche in Korn und Gerste verursacht. Richard sieht diese unregelmäßigen Muster in den ockergelben und mattgrünen Feldern mit dem Blick des Künstlers; vermutlich wird er morgen eine Skizze davon anfertigen. Ilse hingegen weiß, dass es für die Bauern einen empfindlichen Ernteverlust bedeutet, wenn sich die Ähren nicht durch eine günstige Wetterlage wieder aufrichten.
»Seien Sie herzlich gegrüßt, liebe Ilse!«, ruft er ihr gut gelaunt entgegen. »Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, dem staubigen Frankfurter Pflaster zu entkommen und wieder hier bei Ihnen sein zu dürfen.«
Sie reichen einander die Hände. Einmal, ein einziges Mal, hat er den Versuch gemacht, ihr zur Begrüßung den Arm auf die Schulter zu legen. Sie ärgert sich heute noch darüber, dass sie bei dieser Berührung zusammengezuckt ist und am ganzen Körper erstarrte. Warum ist sie ihm nicht entgegengekommen? Es wäre doch nichts dabei gewesen! Seine Künstlerfreunde und etliche der Bekannten grüßt er oft mit einer kurzen, herzlichen Umarmung. Nun ja, sie ist ein gebranntes Kind und außerdem eine alte Jungfer. Das ist leider nicht mehr zu ändern, damit muss sie leben. Immerhin nennen sie einander inzwischen beim Vornamen, bleiben jedoch beim »Sie«.
»Ich freue mich auch, dass Sie wieder hier sind, Richard«, meint sie lächelnd. »Das Haus kam mir recht verlassen vor ohne Ihr geschäftiges Treiben hier oben.«
Vor allem haben ihr die Abende in seiner Gesellschaft gefehlt, aber das will sie nicht so unverblümt sagen. Tagsüber sehen sie sich kaum: Sie ist in der Fabrik zugange, und er arbeitet oben in seinem Atelier. Allerdings hat sie oft von ihrem Bürofenster zum zweiten Stock der Villa hinaufgeschaut, und nicht selten stand er dort oben, den Pinsel zwischen den Zähnen, und winkte ihr zu. Dann hat sie lachend zurückgewinkt und sich hastig wieder in die Arbeit vertieft. Wie schade – von dem neuen Büro aus wird diese nette Kontaktaufnahme nicht mehr möglich sein, die Fenster gehen nach Osten, zum Dorf hin.
Er begibt sich zu dem runden, eingelegten Tisch, der von marokkanischen Sitzen umgeben ist, und schenkt Tee ein. Er bevorzugt eine Mischung, die er direkt aus England bezieht – ein starkes, aromatisches Getränk, das Ilse nur mit Milch und viel Zucker trinken kann.
»Ich hoffe, es ist Ihnen recht, dass ich heute Abend einen Tisch im Restaurant ›Zum König‹ bestellt habe«, meint er und setzt sich bequem in einen Sessel. Sein heller Leinenanzug ist tadellos gebügelt und sitzt wie angegossen. Er hat einen guten Schneider in Frankfurt, über den Preis schweigt er sich aus.
»Natürlich ist es mir recht. Ehrlich gesagt hatte ich schon ein schlechtes Gewissen, weil ich meinen Bruder so lange nicht besucht habe. Aber ich denke, sie waren sehr beschäftigt. Zumindest hat auch Josef nichts von sich hören lassen.«
»Familienbande soll man nicht abreißen lassen«, findet er und schaut sie mit leicht verlegenem Blick an, bevor er fortfährt. »Ich habe mir die Freiheit genommen, auch meine Mutter für diesen Abend einzuladen. Wobei ich kühn Ihr Einverständnis vorausgesetzt habe, liebe Ilse.«
In seinem Lächeln liegt ein kleines bisschen Schuldbewusstsein, zugleich aber Wärme und Überzeugungskraft. Sie weiß inzwischen, dass er seine Wünsche gern auf diese Weise durchsetzt. Höflich, charmant, rücksichtsvoll und doch mit beharrlicher Willenskraft.
»Was für eine nette Überraschung«, gibt sie stirnrunzelnd zurück. »Dann sollte ich mich vielleicht umziehen – Ihre Frau Mutter bevorzugt elegante, damenhafte Kleidung, und dieses Fähnchen ist eher etwas für einen zwanglosen Sommerabend …«
»Aber nein!«, ruft er aus. »Ich liebe dieses Kleid an Ihnen. Das Blau steht Ihnen wundervoll. Bleiben Sie um Himmels willen so, wie Sie sind, Ilse!«
»Also gut. Wenn Sie meinen …«
Sie trinkt den Tee in kleinen Schlucken und überlegt, was ihn wohl dazu bewogen haben mag, die Frau Mama einzuladen. Seit jenem seltsamen Abend vor über einem Jahr, als sie im Gasthof ihres Bruders die Kellnerin spielte, hat es keine Begegnung mehr zwischen ihr und Frau Goldstein gegeben. Sie hat das nicht bedauert, da die Dame ihr nicht gefallen hat und sie kein Bedürfnis verspürte, sie wieder zu treffen. Nun also wird sich ein Wiedersehen nicht umgehen lassen. Sie freut sich nicht gerade darauf. Aber ihm zuliebe wird sie sich höflich und zuvorkommend verhalten und sich alle Mühe geben, einen guten Eindruck zu machen.
»Fahren Sie?«, fragt er, als sie unten vor seinem Wagen stehen.
»Sehr gern.«
Seit er hier eingezogen ist, kommt er ohne Chauffeur. Er hat schnell bemerkt, dass Ilse eine begeisterte Autofahrerin ist, und überlässt ihr, sooft es möglich ist, das Steuer. Es ist eine nette Geste von ihm; überhaupt hat er ein feines Gespür dafür, wie er ihr eine Freude machen kann, und sie hat gelernt, solche Angebote anzunehmen. Was ihr zu Anfang nicht leichtgefallen ist. Die Enttäuschungen und Demütigungen ihrer Jugend haben dazu geführt, dass sie einen Panzer aus Misstrauen um sich gebaut hat. Dass ein Mann ihr ohne jegliche Hintergedanken einen Gefallen tun möchte, konnte sie zuerst nicht glauben.
Sie nimmt die Autoschlüssel aus seiner Hand und startet den Wagen. Richard hat das Verdeck zurückgefahren, sodass der warme Fahrtwind in ihr Haar greift und er vorsichtshalber den Strohhut absetzt, damit das gute Stück nicht davongeweht wird. Behutsam lenkt sie den Wagen über die holprige Dorfstraße, Staub wirbelt auf, Hühner flüchten, aus den Fenstern und Hofeingängen werden sie neugierig beobachtet. Vor dem Grossmannhof stehen Anni Christ und Lenchen Grossmann; beide nicken dem vorüberfahrenden Paar zu. Es ist nicht das Nicken, mit dem sie sich untereinander grüßen, sie senken die Köpfe langsam, auf eine untertänige Weise. Ilse weiß, dass es im Dorf allerlei Gerüchte über Richard und sie gibt, aber sie stört sich nicht daran, denn die Dörfler messen sie mit anderen Maßstäben als ihresgleichen. Sie ist »die Frau Küpper von der Villa«, da gelten andere Regeln, weil sie letztlich eine »Städtische« ist.
Während der Fahrt erzählen sie sich gegenseitig die Ereignisse der vergangenen Woche – er hat in Frankfurt an langwierigen Sitzungen seiner Bank teilgenommen, aber auch zwei Künstlerinnen aufgetan, die er bei passender Gelegenheit in die Villa einladen möchte. Ilse verkneift sich die Frage, ob die Damen jung und hübsch sind; stattdessen berichtet sie über den bevorstehenden Umzug in das neue Fabrikgebäude, das neben einer Produktionshalle auch einen Verwaltungsteil bieten wird. Natürlich hat sie alles genau durchgeplant, damit Arbeitsablauf und Produktion so wenig wie möglich unterbrochen werden.
Dann macht sie Richard den Vorschlag, Frieda Haller zu einer szenischen Lesung einzuladen. »Sie ist eine begabte Schauspielschülerin, und ich denke, sie hat es nicht leicht. Die Mutter ist mit ihrer Berufswahl nicht einverstanden und gibt sich alle Mühe, der Tochter Steine in den Weg zu legen. Das Mädchen darf nur ausnahmsweise bei seiner Großmutter in Frankfurt über Nacht bleiben, ansonsten hat es am Abend zu Hause in Dingelbach zu sein.«
Er lacht und meint, es sei für ein junges Mädchen keineswegs von Übel, am Abend zu Hause zu bleiben. Er hat Frieda bisher nicht zu Gesicht bekommen, da er sich nur in der Villa aufhält und niemals hinunter ins Dorf geht.
»Sie ist die Enkelin von Frau Haller aus Frankfurt, die so eifrig in Ihrem Kunstverein mitwirkt«, ergänzt Ilse.
»Ach so? Ja natürlich. Gut, dass Sie es ansprechen. Dann wäre das wohl in Erwägung zu ziehen.«
In Bad Homburg bietet sich ihnen ein gemischter Anblick. Das »Restaurant zum König« hat durch die Anbauten wenig gewonnen: Die kastenförmigen Erweiterungen rechts und links des alten Gasthofs lassen das Ensemble unharmonisch, geradezu »zusammengestoppelt« erscheinen. Die Bäume, die das Haus früher beschattet haben, sind einem freien Platz mit Parkmöglichkeiten für betuchte Gäste gewichen. Immerhin hat man eine kleine Grünfläche angelegt und mit Blumen bepflanzt, die jetzt bei der sommerlichen Hitze allerdings matt und vertrocknet aussehen. Hinter dem Anwesen, wo nach den Vorstellungen ihres Bruders das Gästehaus des zukünftigen Hotels und ein romantischer Park entstehen sollten, liegt noch alles im Chaos. Das geplante Parkgelände ist teilweise Gemüsegarten, teilweise Wildnis, und von dem künftigen Gästehaus ist nur eine Ausschachtung vorhanden, die von der Schwägerin inzwischen als Müllkippe benutzt wird.
»Ich habe Wert darauf gelegt, dass zuerst einmal das Restaurant fertig wird, damit sie wieder zu Einnahmen kommen«, erklärt Richard, als müsse er sich für diesen hässlichen Anblick bei ihr entschuldigen.
»Vollkommen richtig«, stimmt sie zu.
Drinnen werden sie von ihrem Bruder Josef empfangen, der sie schon mit Ungeduld erwartet hat.
»Das ist aber recht, dass ihr beide endlich einmal vorbeischaut. Die Irma hat schon gemeint, meine Schwester wolle gar nichts mehr von mir wissen. Haha … Ja, da schaut euch nur um bei uns. Da hat sich vieles zum Guten verändert, wir sind recht stolz darauf …«
Er überschlägt sich beinahe vor Höflichkeit und Dienstfertigkeit, öffnet eine Flasche Sekt zum Willkommen und führt sie durch die neu entstandenen Gasträume, die durch Schiebetüren zu einem großen Saal vereinigt werden können. Ilse entgeht nicht, dass er einen funkelnagelneuen Maßanzug trägt und auch seine Schuhe aus teurem Leder gefertigt sind. Er hat das Geld also nicht nur in den Bau gesteckt, sondern auch seinen Kleiderschrank erweitert. Vermutlich hat sich auch die Schwägerin neu ausgestattet.
Aber nun ja – sie wollen ja jetzt die adeligen und wohlhabenden Gäste bedienen, da muss man auf sich halten.
Die schönen alten Möbel aus der Villa, die die Schwägerin unbedingt hat haben wollen, sind bis auf wenige Stücke verschwunden. Auch das Meissener Service und die silbernen Bestecke gibt es nicht mehr.
»Das alte Zeug haben wir verkauft«, erklärt Josef. »Meine Irma hat gemeint, wir brauchen etwas Neues, Zeitgemäßes. Weil wir ja jetzt anspruchsvolle Gäste bedienen.«
Ilse ärgert sich über seine Schwindelei. Sie haben die Sachen aus Geldnot verkaufen müssen, so sieht die Wahrheit aus. Jetzt tut es ihr leid, dass sie all diese Erbstücke damals so großzügig der Schwägerin überlassen hat. Es waren liebe Erinnerungen an die Kindheit im Elternhaus, die nun für immer verloren sind.
Stattdessen hat man neue Tische und gepolsterte Stühle angeschafft und die Fenster mit schweren dunkelroten Portieren verhängt. Die exotischen Gewächse, die in Kübeln im Raum verteilt stehen, sehen traurig aus; bei dem fehlenden Licht werden sie vermutlich bald eingehen. Ilse sieht, dass Richard das Inventar ebenso wenig gefällt wie ihr, doch er lässt sich nichts anmerken und nimmt mit freundlichem Dank an dem für sie reservierten Tisch Platz.
Josef überreicht ihm frisch gedruckte, goldverzierte Menükarten. Man hat auf Richards Empfehlung hin einen französischen Koch eingestellt, der die Herrschaft der Schwägerin über die Küche rasch beendet hat. Die Kinder bekommen sie nicht zu Gesicht, aber Ilse ist klar, dass die drei schon seit dem Nachmittag in der Küche stehen, um nach den Anweisungen des Kochs Gemüse zu putzen. Angestellte sind teuer, schon der Koch kostet vermutlich ein Vermögen.
»Das ist halt was ganz anderes als die Hausmannskost, die wir früher serviert haben«, meint Josef. »Seitdem sich das in Bad Homburg herumgesprochen hat, können wir uns vor illustren Gästen kaum noch retten. Auch zwei französische Offiziere von der Garnison Königstein sind schon hier gewesen …«
Immer noch sitzen französische Besatzungstruppen auf rechtsrheinischem Gebiet bis in den Taunus hinein – man hat sich mit ihnen abgefunden und versucht, sich so gut es geht zu arrangieren. Die wohlhabenden Kurgäste zumindest scheinen nicht wirklich etwas gegen die französische Küche und die Besatzungsoffiziere zu haben.
Einstweilen sind sie die einzigen Gäste, Frau Goldstein ist noch nicht erschienen. Als Josef sie endlich von seiner aufdringlichen Gegenwart befreit hat, sitzen sie beieinander, studieren die Menükarte, und Ilse spürt auf einmal, dass Richard angespannt ist. Wie es scheint, sieht er der anstehenden Begegnung mit seiner Mutter nicht ganz so unbefangen entgegen, wie er vorgegeben hat. Auch sie wird langsam nervös. Wo bleibt die Frau Mama? Eigentlich ist es unhöflich von ihr, sie warten zu lassen.
Frau Goldstein erscheint gute zwanzig Minuten später, sie hat sich von ihrem Chauffeur herfahren lassen und wird von Josef bereits an der Tür mit größter Höflichkeit begrüßt.
»Willkommen, gnädige Frau. Welche Freude, dass Sie uns wieder einmal beehren. Der Herr Sohn und meine Schwester erwarten Sie bereits.«
Frau Goldstein ist deutlich gealtert seit der letzten Begegnung, auch die Schminke und die perfekte Frisur können diese Tatsache nicht verbergen. Während Josef sie übereifrig zu ihrem Tisch geleitet, stützt sie sich auf einen Stock und muss den Kopf heben, um die beiden Personen, die dort sitzen, in Augenschein zu nehmen. Richard springt auf, um seine Mutter mit einer Umarmung zu begrüßen, dann stellt er ihr Ilse vor.
»Frau Ilse Küpper. Eine liebe Bekannte, in deren Villa ich – wie du weißt – eine Wohnung gemietet habe …«
»Angenehm«, sagt die Mama, ohne Ilse anzusehen.
Die alte Dame lässt sich von Richard den Stuhl zurechtrücken und setzt sich. Vermutlich hat sie Schmerzen dabei, aber ihre Züge bleiben unbeweglich. Sie sitzt steif und gerade aufgerichtet, ohne sich anzulehnen, während sie das Lorgnon aus dem Handtäschchen nimmt, um die Menükarte zu studieren.
Da sie schweigsam bleibt und auch Ilse nicht recht weiß, was sie sagen soll, übernimmt Richard das Gespräch. Er berät seine Mama bei der Auswahl des Menüs, bestellt einen Aperitif und erzählt von seiner Absicht, im Herbst verschiedene kleine Veranstaltungen in der Villa zu organisieren.
»Es ist ein Ort, der eine ungemein passende Atmosphäre bietet, Mama. Ländliche Umgebung mit romantischen Ausblicken, helle Räume in einem anmutigen Gebäude und dazu eine wunderbare, kunstsinnige Gastgeberin, die mich in meinen Aktivitäten tatkräftig unterstützt …«
»Frau Küpper, nicht wahr?«, lässt sich jetzt Frau Goldstein vernehmen und schaut Ilse scharf an. »Wir sind uns hier schon einmal begegnet, wenn ich mich recht erinnere.«
»Ganz richtig, gnädige Frau. Damals half ich meinem Bruder aus der Not, da einige seiner Angestellten ausgefallen waren.«
»Sie leiten eine Fabrik, habe ich gehört?«
»Ich habe das Werk Pilz & Küpper in der Nachfolge meines Vaters übernommen.«
»Warum tat das nicht Ihr Ehemann?«
»Ich bin unverheiratet, gnädige Frau.«
Das kurze Verhör wird durch die Schwägerin Irma unterbrochen, die die Gäste aufs Herzlichste begrüßt und nach ihren Wünschen fragt. Sie hat sich ebenfalls neu eingekleidet, das schwarze, kurze Kleid steht ihr nicht einmal schlecht, nur ist sie für Ilses Geschmack zu stark geschminkt. Man wählt die Speisen aus, bestellt die passenden Weine, Irma sammelt die edlen Menükarten wieder ein und begibt sich in die Küche.
»Zu meiner Zeit erzog man ein Mädchen dazu, im Stillen zu wirken, um den Gatten auf diese Weise zu unterstützen«, bemerkt Frau Goldstein mit einem Lächeln. »Für eine Tochter aus gutem Hause wäre es eine Schande gewesen, einen Beruf zu erlernen.«
»Die Zeiten ändern sich, liebe Mama …«, wirft Richard ein.
»Nicht zum Guten …«
Ilse hat das Gefühl, etwas richtigstellen zu müssen.
»Ich habe mich nicht zu dieser Aufgabe gedrängt, Frau Goldstein«, sagt sie in deutlichem Ton. »Erst als mir klar wurde, dass es niemand anderen gab, der das Werk meines Vaters erfolgreich weiterführen konnte, habe ich mich dazu entschlossen. Heute kann ich mit Stolz sagen, dass es die Fabrik Pilz & Küpper ohne mein Eingreifen nicht mehr gäbe.«
»Sehr anerkennenswert«, bemerkt Frau Goldstein gleichmütig. »Und Sie widmen sich inzwischen auch der Kunst?«
Jetzt mischt sich Richard ein, der den Wortwechsel mit wachsender Sorge verfolgt hat. Beredt und mit dem ihm eigenen Charme berichtet er, dass es ihm zu seiner Freude gelungen sei, Frau Küpper neben ihren anstrengenden Obliegenheiten als Fabrikdirektorin auch für die schönen Künste zu begeistern.
»Wie du weißt, Mama, habe ich wieder zu malen begonnen, was mir große Freude und Befriedigung schenkt. Und das ist einzig Frau Küppers Verdienst, wofür ich ihr unendlich dankbar bin …«
»Du warst in der vergangenen Woche wieder einmal in Frankfurt, hat man mir gesagt«, gibt die Mama wenig beeindruckt zurück, ohne auf das Gesagte einzugehen. »Es freut mich sehr, dass du über all diesen Zerstreuungen noch an deine Aufgaben in der Bank denkst.«
»Das versteht sich von selbst, Mama. Niemals würde ich diese wichtigen Verpflichtungen vernachlässigen, da kannst du ganz beruhigt sein.«
Das Horsd’œuvre wird serviert, ein Scheibchen Räucherlachs mit einer Winzigkeit blanchiertem Gemüse und einem Hauch Meerrettichsahne. Frau Goldstein pickt ein wenig Gemüse auf, Fisch isst sie im Sommer niemals. Sie unterhält sich mit Richard über einen geplanten Aufenthalt in Heiligendamm an der Ostsee, beklagt sich über ihren Bruder Jacob, der sich für die Bank halbtot arbeitet und nicht loslassen kann, dann sprechen sie über eine ihrer Villen in Bad Homburg, die sie Richard inzwischen überschrieben hat und die renoviert werden muss. Ilse nippt am Wein und fühlt sich ausgeschlossen. Es ist überdeutlich, dass Frau Goldstein die Ambitionen ihres Sohnes nicht gutheißt. Anstatt in der »Villa Küpper« zu wohnen und zu malen, sollte er sich ihrer Ansicht nach lieber der Familienbank »Blum & Hirschberg« widmen. Auch ihrer Abneigung gegen seine Begleiterin hat Frau Goldstein Ausdruck verliehen, und das sehr viel direkter, als Ilse erwartet hat. Nun – das beruht auf Gegenseitigkeit. Ilse ist keine, die sich einschüchtern lässt. Frau Goldstein ist eine alte, verbitterte Frau, sie klammert sich vehement an ihren Sohn und hat, wie es scheint, große Sorge, er könne ihrem Einfluss entgleiten. Daran kann Ilse nichts ändern, sie wird höflich bleiben und dieses unangenehme Zusammentreffen so rasch wie möglich beenden.
Frau Goldstein ist ihr dabei behilflich, da sie augenscheinlich die gleiche Absicht verfolgt. Nachdem man Suppe und Hauptgericht mit viel diplomatischem Geschick hinter sich gebracht hat und eine weitere Pause bis zum Servieren des Desserts droht, die mit Gesprächen gefüllt werden muss, verkündet die alte Dame, sich nun zurückziehen zu müssen.
»Mein Rücken erlaubt mir das lange Sitzen nicht mehr«, fügt sie erklärend hinzu. »Aber du wirst den Abend ja in der angenehmen Gesellschaft von Frau Küpper beenden, da wird dir deine Mutter ohnehin nicht fehlen.«
»Wie kannst du so etwas sagen? Es ist unendlich schade, dass du uns schon verlassen musst, Mama …«, meint Richard bekümmert.
Ilse lässt verlauten, dass sie vollstes Verständnis hat. »Es ist gewiss kein Vergnügen, wenn man unter Schmerzen steht. Ich wünsche gute Besserung.«
Ein Bedauern über den frühen Aufbruch äußert sie nicht. Sie hat nicht vor zu lügen, und Frau Goldstein weiß ohnehin, was sie denkt. Es stellt sich heraus, dass der Chauffeur bereits draußen wartet, da er auf halb zehn Uhr bestellt worden ist. Die Frau Mama sagt Ilse höflichen Dank für ihr Verständnis, dann lässt sie sich von Richard beim Aufstehen helfen und den Gehstock reichen. Er geleitet sie zur Tür, wo schon der Chauffeur bereitsteht. Josef verpasst den Abschied, auch Schwägerin Irma bekommt ihn nicht mit, weil sie mit anderen Gästen beschäftigt ist, die sich inzwischen eingefunden haben.
»Wie schade«, meint Richard, als er an den Tisch zurückkehrt. »Aber wir wollen uns den schönen Abend nicht verderben lassen, nicht wahr?«
Er lächelt ihr aufmunternd zu; wie es scheint, hat er den frühzeitigen Abgang seiner Frau Mama bereits weggesteckt.
»Auf keinen Fall!«
Sie ist der Ansicht, dass dieser Abend erst jetzt anfängt, schön zu werden, was sich auch bewahrheitet. Richard bestellt neuen Wein und entschuldigt sich für seine Mutter, die nach der Rückenoperation im vergangenen Jahr nun mit neuen Leiden geschlagen ist und sich trotz allem mit großer Energie aufrecht hält.
»Sie ist ein gütiger und liebevoller Mensch. Es sind die Schmerzen, die sie manchmal schroff erscheinen lassen.«
Beim Dessert unterhalten sie sich leise über die neue Einrichtung des Restaurants, machen ihre Scherze über den Geschmack der Schwägerin, und er teilt ihr Bedauern über den Verlust der schönen Möbel. »Trotz allem muss ich Ihnen zum wiederholten Mal gestehen, dass ich mich in Ihrer Villa unendlich wohlfühle«, sagt er schließlich und fügt hinzu: »So frei und glücklich, wie ich bisher noch nie gewesen bin.«
Sie spürt seine Hand, die sich auf ihre Hand legt, und dieses Mal zuckt sie nicht zusammen. Ist es der Wein? Oder sind es seine schönen, dunklen Augen, deren Blick so tief in sie eindringt? Die schützende Mauer, die sie um sich errichtet hat, bröckelt, sie erwidert seinen Blick, lächelt ihm zu.
»Mir geht es ebenso«, gesteht sie. »Seit Sie in meine Villa eingezogen sind, habe ich so viel Schönes erfahren, so viel Neues erlebt. Ja, es hat sich für mich eine ganz andere Welt aufgetan.«
Drüben am Nachbartisch bricht jemand in Gelächter aus, auf der anderen Seite serviert Irma eine Käseplatte, wobei sie mühevoll die französischen Namen der verschiedenen Köstlichkeiten radebrecht. Richard und Ilse sehen einander immer noch an, Heiterkeit mischt sich in ihr Lächeln, er umfasst ihre Hand fester. Es fühlt sich angenehm, beinahe selbstverständlich an.
»Liebe Ilse«, sagt er unbeirrt vom Geschehen um sie herum. »Dies ist ein besonderer Abend, und deshalb wage ich es, Ihnen einen ungewöhnlichen Vorschlag zu machen.«
»Heraus damit. Ich bin zu allen Schandtaten bereit«, meint sie übermütig.
»Könnten Sie sich vorstellen, meine Frau zu werden?«
Mit einem Schlag bricht die weinselige Stimmung zusammen. Hat er sie eben um ihre Hand gebeten? Oder hat sie ihn missverstanden? Berauscht von mehreren Gläsern Wein, kann es passieren, dass sich Traumvorstellungen und Wirklichkeit miteinander vermischen.
»Ich weiß nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe …«
Er zieht ihre Hand an die Lippen und küsst sie. »Ich habe Sie gebeten, mich zu heiraten, Ilse«, sagt er leise und sieht sie dabei erheitert, beinahe schelmisch an. »Ich gebe zu, dass mein Vorschlag überraschend kommt, und ich erwarte nicht, dass Sie mir heute Abend eine Antwort geben. Ich kenne Sie inzwischen besser, als Sie ahnen, liebe Ilse. Ich weiß, dass Sie diesen Überfall erst einmal verkraften müssen …«
Kapitel 3
»Da haben Sie Glück im Unglück gehabt«, meint Rudolf Alberti. »Das hätte auch bös ausgehen können.«