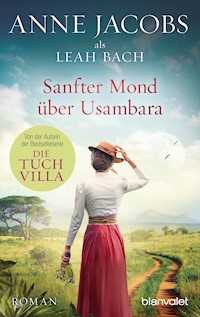10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Tuchvilla-Saga
- Sprache: Deutsch
Eine mächtige Familie. Dramatische Verwicklungen. Ein Haus, das mehr als ein Geheimnis birgt.
Augsburg, 1916. Die Tuchvilla, der Wohnsitz der Industriellenfamilie Melzer, ist in ein Lazarett verwandelt worden. Die Töchter des Hauses pflegen gemeinsam mit dem Personal die Verwundeten, während Marie, Paul Melzers junge Frau, die Leitung der Tuchfabrik übernommen hat. Da erreichen sie traurige Nachrichten: Ihr Schwager ist an der Front gefallen, ihr Ehemann in Kriegsgefangenschaft geraten. Während Marie darum kämpft, das Erbe der Familie zu erhalten und die Hoffnung an ein Wiedersehen mit Paul nicht aufzugeben, kommt der elegante Ernst von Klippstein in die Tuchvilla. Und wirft ein Auge auf Marie …
SPIEGEL-Bestsellerautorin Anne Jacobs bei Blanvalet:
Die Tuchvilla-Saga:
1. Die Tuchvilla
2. Die Töchter der Tuchvilla
3. Das Erbe der Tuchvilla
4. Rückkehr in die Tuchvilla
Die Gutshaus-Saga:
1. Das Gutshaus. Glanzvolle Zeiten
2. Das Gutshaus. Stürmische Zeiten
3. Das Gutshaus. Zeit des Aufbruchs
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 882
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buch
Marie und Paul Melzer sind frisch verheiratet, doch ihnen ist nur eine kurze Zeit der Freude vergönnt. Der Erste Weltkrieg bricht aus, und die Männer werden an die Front gerufen. Paul, der Erbe der Industriellenfamilie Melzer, wird zunächst noch in der Fabrik benötigt, doch auch ihn erreicht der unausweichliche Einberufungsbefehl – ausgerechnet an dem Tag, an dem Marie in den Wehen liegt. Doch seine Frau ist niemand, die vor einer Herausforderung klein beigibt. Sie ahnt bald, wie schlecht es um die Tuchfabrik steht, und dass sie um das Erbe der Melzers kämpfen muss – und auch ihre Schwägerinnen Kitty und Elisabeth benötigen ihren Beistand. Doch dann erreicht sie die schlimme Nachricht, dass Paul in Gefangenschaft geraten ist, und der elegante Ernst von Klippstein sucht immer öfter ihre Nähe…
Autorin
Anne Jacobs veröffentlichte unter anderem Namen bereits historische Romane und exotische Sagas. Mit Die Tuchvilla gestaltete sie ein Familienschicksal vor dem Hintergrund der jüngeren deutschen Geschichte und eroberte damit die Bestsellerliste. Die Töchter der Tuchvilla entführt die Leser erneut in diesen Romankosmos.
Von Anne Jacobs außerdem bei Blanvalet lieferbar:
Die Tuchvilla
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und
www.twitter.com/BlanvaletVerlag.
ANNE JACOBS
DIE
TÖCHTER
DER
TUCHVILLA
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Die Handlung und alle handelnden Personen sind frei erfunden.
Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig.
1. Auflage
Originalausgabe Dezember 2015 bei Blanvalet,
einem Unternehmen der
Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © 2015 by Blanvalet Verlag, in der
Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Johannes Frick, Neusäß
Umschlagmotive: Arcangel Images/Jill Battaglia und Margie Hurwich; Trevillion Images/Yolande de Kort; Shutterstock
Redaktion: Angela Kuepper
ES · Herstellung: sam
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-17382-1
www.blanvalet.de
I.
FEBRUAR 1916 BIS JANUAR 1917
1
Grau senkte sich die frühe Abenddämmerung über das Augsburger Industrieviertel. Hie und da glommen die Lichter der Fabriken auf, in denen trotz der Rohstoffverknappung noch gearbeitet wurde, in anderen Werken hingegen blieb es dunkel. Eine Anzahl Frauen und älterer Männer verließ zum Schichtende die Melzer’sche Tuchfabrik. Man zog den Kragen hoch und schützte sich mit Kopftuch oder Mütze vor dem niederprasselnden Regen. Gurgelnd schoss das Wasser die gepflasterten Straßen hinab. Wer kein gutes Schuhwerk aus Friedenszeiten mehr besaß und auf Holzsohlen unterwegs war, der holte sich jetzt nasse Füße.
In der Backsteinvilla der Fabrikantenfamilie stand Paul Melzer am Fenster des Esszimmers und starrte auf die schwarze Silhouette der Stadt, die sich mehr und mehr mit der Dämmerung vermischte. Schließlich ließ er den zurückgeschobenen Vorhang wieder fallen und tat einen tiefen Seufzer.
»Setz dich endlich zu mir, Paul, und trink einen Schluck!«, ertönte die Stimme seines Vaters.
Schottischer Whisky war wegen der Seeblockade der verdammten Engländer zurzeit eine Kostbarkeit. Johann Melzer nahm zwei Gläser aus der Vitrine und goss die aromatische, honiggelbe Flüssigkeit ein.
Paul warf nur einen kurzen Blick auf Gläser und Flasche und schüttelte den Kopf.
»Später, Vater. Wenn wir einen Grund dafür haben. Gott gebe, dass wir ihn haben werden.«
Im Flur waren hastige Schritte zu vernehmen, und Paul eilte zur Tür. Es war das Stubenmädchen Auguste, fülliger denn je und mit rosigen Wangen, das weiße Spitzenhäubchen saß schief auf ihrer verrutschten Frisur. Sie trug einen Korb, in dem sich zusammengeknüllte weiße Tücher befanden.
»Immer noch nicht?«
»Leider nein, Herr Melzer. Es dauert noch ein wenig.«
Sie knickste und lief zur Dienstbotentreppe, um die Wäsche hinunter in die Waschküche zu tragen.
»Aber es dauert schon über zehn Stunden, Auguste«, rief Paul ihr nach. »Kann das normal sein? Ist auch wirklich alles in Ordnung mit Marie?«
Auguste hielt inne und versicherte ihm lächelnd, dass jede Geburt anders sei, die eine bringe ihr Kind in fünf Minuten auf die Welt, und die andere plage sich tagelang.
Paul nickte gequält. Auguste musste es wissen, sie war selbst schon zweifache Mutter und verdankte es nur der besonderen Großmut der Herrschaft, dass sie in Diensten hatte bleiben dürfen.
Aus dem oberen Stockwerk drangen unterdrückte Schmerzenslaute. Paul machte unwillkürlich einige Schritte in Richtung Treppe, blieb dann jedoch hilflos stehen. Seine Mutter hatte ihn energisch aus dem Schlafzimmer gewiesen, als die Hebamme erschienen war, und auch Marie hatte ihn gebeten, besser nach unten zu gehen. Der Vater, Johann Melzer, sei seit seinem Schlaganfall kränklich, Paul solle sich um ihn kümmern. Es war ein Vorwand, das wussten sie beide, doch Paul hatte nicht mit seiner Frau streiten wollen, schon gar nicht jetzt, in ihrem Zustand. Schweigend hatte er sich gefügt.
»Was stehst du im Flur herum?«, schalt ihn sein Vater. »Eine Geburt ist Weibersache. Wenn es so weit ist, werden sie uns schon Bescheid geben. Trink jetzt!«
Gehorsam ließ sich Paul am Tisch nieder und kippte den Inhalt des Glases herunter. Der Whisky brannte in seinem Magen wie Feuer, und er wurde sich darüber klar, dass er seit dem Frühstück nichts mehr gegessen hatte. Gegen acht am Morgen hatte Marie ein leichtes Ziehen im Rücken verspürt, da hatten sie noch über ihre ständigen Zipperlein, die sich im Laufe der Schwangerschaft einstellten, Scherze gemacht, und er war leichten Herzens hinüber in die Fabrik gelaufen. Kurz vor der Mittagspause rief seine Mutter aus der Villa an, um ihm mitzuteilen, dass Marie Wehen habe und die Hebamme bestellt sei. Er brauche sich jedoch keine Sorgen zu machen, alles gehe seinen gewohnten Gang.
»Als deine Mutter dich vor nunmehr siebenundzwanzig Jahren auf die Welt brachte …«, sagte Johann Melzer und besah gedankenvoll sein Whiskyglas, »… da habe ich drüben in der Fabrik in meinem Büro gesessen und Abrechnungen geschrieben. Weil ein Mann in solch einer Situation eine Beschäftigung braucht, sonst gehen ihm die Nerven durch.«
Paul nickte zustimmend, horchte jedoch gleichzeitig auf jedes Geräusch im Flur, die Schritte des Stubenmädchens, das soeben hinauf in den zweiten Stock lief, das Schlagen der alten Standuhr, die Stimme seiner Mutter, die Else anwies, zwei frische Bettlaken aus der Wäschekammer zu holen.
»Bist damals ein ordentlicher Brocken gewesen«, fuhr sein Vater schmunzelnd fort und schenkte ihm nach. »Die ganze Nacht hat sich Alicia herumgequält. Hast deine Mutter fast das Leben gekostet.«
Die Worte waren nicht dazu angetan, Pauls Ängste zu beschwichtigen, das bemerkte nun auch sein Vater. »Nun sorge dich nicht, die angeblich so schwachen Frauen sind sehr viel zäher und stärker, als man gemeinhin glaubt.« Er nahm einen kräftigen Schluck.
»Was ist überhaupt mit dem Abendessen?«, knurrte er und betätigte die elektrische Gesindeglocke. »Es ist schon nach sechs – gerät denn heute alles aus den Fugen?«
Auf nochmaliges Klingeln erschien Hanna, das Küchenmädchen, ein dunkelhaariges, leicht verhuschtes Wesen, das Maries besonderen Schutz genoss. Alicia Melzer hätte die Kleine ansonsten längst davongeschickt, da sie zur Arbeit wenig taugte und mehr Geschirr zerbrach als irgendeine ihrer Vorgängerinnen.
»Das Abendessen, gnädiger Herr.«
Sie balancierte zwei Teller mit belegten Broten, Graubrot, Leberwurst, Kochkäse mit Kümmel und eingelegten Gürkchen aus dem Küchengarten, den Marie im vergangenen Herbst hatte anlegen lassen. Fleisch, Wurst und Fett waren inzwischen rationiert und nur noch auf Lebensmittelkarte zu haben. Wer sich besondere Leckereien oder gar Schokolade gönnen wollte, musste über gute Beziehungen und die nötigen Mittel verfügen. Im Hause Melzer war man kaisertreu und entschlossen, seine vaterländische Pflicht zu erfüllen. Dazu gehörte auch die Bereitschaft, in diesen harten Zeiten Verzicht zu üben.
»Wieso hat das so lange gedauert, Hanna? Was treibt die Köchin dort unten?«
Hanna stellte hastig die Teller auf dem Esstisch ab, wobei ihr zwei Leberwurstbrote und eine Gurke auf die weiße Tischdecke rutschten. Sie beförderte die Ausreißer mit den Fingern gleich wieder an Ort und Stelle. Paul zog seufzend die Augenbrauen in die Höhe – es war müßig, dieses Mädchen zur Ordnung zu rufen. Alles, was man ihr sagte, ging zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder heraus. Humbert, der Hausdiener der Tuchvilla, der so perfekt und engagiert seine Arbeit getan hatte, war gleich zu Kriegsbeginn eingezogen worden. Armer Kerl – er taugte gewiss wenig zum Soldaten.
»Es ist meine Schuld«, plapperte Hanna ohne schlechtes Gewissen. »Frau Brunnenmayer hatte die Teller schon zurechtgestellt, ich habe sie mit den anderen Speisen hinaufgebracht und dann erst gemerkt, dass sie für Sie bestimmt waren.«
Es stellte sich heraus, dass die Köchin vollauf damit beschäftigt war, die Herrschaften im zweiten Stock zu verköstigen. Vor allem die Hebamme habe einen gesegneten Appetit und trinke schon den dritten Humpen Bier. Außerdem hätten sich Frau Elisabeth von Hagemann und Frau Kitty Bräuer angekündigt, die ebenfalls hier zu Abend essen wollten.
Paul wartete, bis Hanna wieder draußen war, dann schüttelte er ärgerlich den Kopf. Kitty und Elisabeth – seine beiden Schwestern. Als ob nicht schon genug Frauen hier in der Villa herumliefen!
»Köchin!«, brüllte eine fremde Stimme aus dem oberen Stockwerk. »Eine Tasse Bohnenkaffee! Aber aus echten Kaffeebohnen, nicht dieses Erbsenzeug!«
Das musste die Hebamme sein. Paul hatte die Frau noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Der Stimme nach zu urteilen schien sie eine kräftige, sehr entschlossene Person zu sein.
»Hat Haare auf den Zähnen«, sagte denn auch sein Vater abfällig. »Die gleiche Sorte wie diese Krankenschwester, die Alicia vor zwei Jahren engagiert hat. Wie hieß sie doch gleich? Ottilie. Die konnte ein ganzes Dragonerregiment niederstrecken.«
Von unten war die Türglocke vernehmbar. Einmal, zweimal – Sturm. Zugleich hörte man das Donnern des schmiedeeisernen Türklopfers, der unablässig gegen die kleine Metallplatte in der Tür geschlagen wurde.
»Kitty«, sagte Johann Melzer grinsend. »Das kann nur Kitty sein.«
»Ich komm schon, ich komm schon«, rief Hanna, deren glockenhelle Stimme mühelos drei Stockwerke durchdrang. »Das ist ein Tag! Heilige Mutter Gottes. So ein Tag!«
Paul sprang auf, um hinunter in die Eingangshalle zu laufen. Hatte er Kittys Besuch eben noch als lästig empfunden, so war er jetzt auf einmal froh über ihr Kommen. Nichts war zermürbender als dieses untätige Herumsitzen und Warten. Kittys wirbelnde Fröhlichkeit würde ihn ablenken und die Sorgen fernhalten.
Schon auf der Treppe zur Eingangshalle vernahm er ihre aufgeregte Stimme. Kitty – seit einem knappen Jahr mit dem Bankier Alfons Bräuer verheiratet – war selbst guter Hoffnung und würde in einigen Monaten niederkommen, was man ihr jedoch keineswegs ansah. Sie erschien zierlich und schlank wie immer. Nur wenn Paul genau hinsah, fiel ihm die kleine Wölbung unter dem lockeren Kleid auf.
»Du liebe Güte – Hanna! Wie langsam du bist! Lässt uns draußen in der Nässe stehen. Den Tod kann man sich holen bei diesem feuchten Elendswetter. Ach, unsere armen Soldaten draußen in Frankreich und Russland, wie werden sie frieren. Hoffentlich erkälten sie sich nicht. Elisabeth, ich bitte dich, setz endlich diesen Hut ab. Du siehst grauenhaft damit aus, deine Schwiegermutter hat überhaupt keinen Geschmack. Bring mir Hausschuhe, Hanna, die kleinen Pantöffelchen mit der Seidenstickerei. Ist das Kind schon da? Nein? Gott sei Dank, ich fürchtete schon, alles verpasst zu haben …«
Die beiden Schwestern waren ohne Chauffeur gekommen, vermutlich hatte Elisabeth den Wagen gefahren, da Kitty bisher keine Anstalten gemacht hatte, das Autofahren zu erlernen. Es war auch unnötig, da das Bankhaus Bräuer über mehrere Automobile und einen Chauffeur verfügte. Während Kitty bereits Mantel, Hut und Schuhe ausgezogen hatte, stand Elisabeth noch vor dem ovalen Empirespiegel und besah sich mit beleidigter Schmerzensmiene.
Kitty konnte bei all ihrer Unbefangenheit mitunter recht herzlos sein, dachte Paul. Laut rief er: »Ich finde, dass dir der Hut sehr gut steht, Lisa. Er macht dich …«
Weiter kam er nicht, denn Kitty hatte sich ihm an den Hals geworfen, küsste ihn auf beide Wangen und nannte ihn »ihren armen, armen Paulemann«.
»Ich weiß doch, wie schrecklich sich die werdenden Väter anstellen«, kicherte sie. »Nun ja – sie haben ihre Schuldigkeit getan und sind überflüssig. Was nun kommt, ist unsere Sache, nicht wahr, Lisa? Was will ein Mann mit einem Säugling anfangen? Kann er ihn stillen? Füttern? Wiegen? Gar nichts kann er …«
»Jetzt mach mal einen Punkt, Schwesterlein«, rief Paul lachend. »Wer sorgt denn dafür, dass Mutter und Kind ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen haben?«
»Na ja«, meinte sie schulterzuckend und ließ ihn los, um in die zierlichen Pantöffelchen zu steigen, die Hanna vor ihr auf den Boden gestellt hatte. »Aber das ist wenig genug, Paulemann. Weißt du, dass es in Afrika Neger gibt, die schneiden dem werdenden Vater eine tiefe Wunde ins Bein und streuen Salz hinein? Das erscheint mir recht vernünftig, dass die Männer den Geburtsschmerz ein Stück weit mitempfinden …«
»Vernünftig? Barbarisch ist das!«
»Ach, was bist du nur für ein Feigling, Paulemann!«, kicherte sie. »Aber sei unbesorgt – hierzulande ist diese Sitte noch nicht in Mode gekommen. Wo steckt denn Mama? Oben bei Marie? Habt ihr etwa diese scheußliche alte Hebamme geholt? Die Koberin? Die war bei meiner Freundin Dorothea, als sie niederkam. Und stell dir vor, Paulemann, diese Person war stockbetrunken, als sie das Kind hob. Sie hätte es um ein Haar fallen gelassen …«
Paul durchfuhr ein Schreck. Er konnte nur hoffen, dass seine Mutter eine Person ausgewählt hatte, die ihr Handwerk verstand. Während er noch darüber nachsann, war Kittys aufgeregter Geist schon wieder mit anderen Dingen beschäftigt.
»Kommst du endlich, Elisabeth? Meine Güte, mit diesem Hut schaust du aus wie ein Feldgrenadier. So richtig grimmig und zu allem entschlossen. Hanna? Wo steckst du denn? Habt ihr Nachricht von Humbert? Geht es ihm gut? Schreibt er fleißig? Nein? Ach, wie traurig. Komm, Elisabeth. Wir müssen rasch hinauf zu Marie, was wird sie von uns denken, wenn wir im Hause sind und uns nicht um sie kümmern …«
»Ich weiß nicht, ob Marie jetzt Zeit für dich hat …«, wandte Paul ein, doch Kitty eilte trotz ihrer Schwangerschaft leichtfüßig die Treppe hinauf. »Grüß Gott, Papachen«, rief sie durch den Flur, dann war sie schon einen Stock höher gestiegen, wo die Schlafräume lagen. Was sich dort abspielte, konnte Paul beim besten Willen nicht erraten, er vermutete jedoch, dass es Kitty gelungen war, ins Zentrum des Geschehens vorzudringen. Was ihm, dem werdenden Vater, beharrlich verwehrt wurde.
»Wie geht es Papa?«, fragte Elisabeth, die sich jetzt endlich entschloss, Mantel und Hut abzulegen. »Hoffentlich ist diese Aufregung nicht zu viel für ihn.«
»Ich denke, er kommt damit zurecht. Wolltest du die Damenriege dort oben verstärken, oder magst du Papa und mir Gesellschaft leisten?«
»Ich bleibe hier unten. Wollte sowieso etwas mit ihm besprechen.«
Paul war erleichtert, dass wenigstens Elisabeth im Esszimmer bei ihnen ausharren würde, wenn schon Kitty der Hebamme im Weg herumstehen wollte. Oh mein Gott – wenn doch nur alles schon vorbei wäre! Der Gedanke, dass seine Marie solche Schmerzen erleiden musste, war ihm unerträglich. War er selbst nicht die Ursache dafür? Er, der dieses Kind gezeugt hatte?
»Du machst ein Gesicht, als müsstest du Kaulquappen schlucken«, meinte Elisabeth grinsend. »Dabei kannst du dich doch freuen. Du wirst Vater, Paul.«
»Und du wirst Tante, Lisa«, versetzte er ohne Begeisterung.
Im Esszimmer hatte sich Johann Melzer die »Augsburger Neuesten Nachrichten« vorgenommen, um noch einmal die Artikel über den Kriegsverlauf zu studieren. Wenn man den enthusiastischen Berichten glauben wollte, dann war Russland schon so gut wie besiegt, und mit den Franzosen würde man auch bald fertig sein. Aber inzwischen war das dritte Kriegsjahr angebrochen, und Johann Melzer war trotz großer Kaisertreue auch Realist und somit Skeptiker. Die Begeisterung, die sie alle zu Kriegsanfang erfasst hatte, war längst verflogen.
»Papa – du trinkst doch nicht etwa?«, ereiferte sich Elisabeth. »Du weißt genau, dass Dr. Greiner dir den Alkohol verboten hat!«
»Unsinn!«, gab er verärgert zurück. Längst hatten sich alle Bewohner der Tuchvilla damit abgefunden, dass er nun einmal ein eigenwilliger Patient war, sogar Mutter hatte aufgehört, ihn mit Vorschriften und Warnungen zu belästigen. Elisabeth aber konnte es nicht lassen, ihn zu maßregeln. Einer musste schließlich auf seine Gesundheit achten.
»Was schreibt der Herr Leutnant über den Krieg im Westen?«, erkundigte er sich, wohl um weiteren Vorhaltungen auszuweichen. Elisabeth war seit einem guten Jahr mit Major Klaus von Hagemann verheiratet. Sie hatten die Hochzeit nur wenige Tage nach Kriegsausbruch in aller Eile gefeiert, denn Klaus von Hagemann hatte mit seinem Kavallerieregiment am Marnefeldzug teilgenommen. Anfang 1915 hatten dann auch Marie und Paul sowie Kitty und der Bankier Alfons Bräuer den Ehebund geschlossen.
»Gerade heute kam eine Nachricht von Klaus«, berichtete Elisabeth und wühlte die Feldpostkarte aus ihrem Täschchen. »Er steht mit seinem Regiment bei Antwerpen, aber wie es aussieht, wird er wohl bald den Marschbefehl nach Süden erhalten. Wohin, das darf er natürlich nicht schreiben …«
»Nach Süden – aha«, knurrte Johann Melzer. »Und dir geht es weiterhin gut?«
Elisabeth errötete unter dem aufmerksamen Blick ihres Vaters. Ihr Mann hatte im Oktober des vergangenen Jahres für einige Tage Heimaturlaub erhalten und war seinen ehelichen Pflichten durchaus nachgekommen. Wie sehr hatte sie gehofft, dieses Mal endlich schwanger zu werden. Umsonst. Die lästige monatliche Regel hatte sich wieder eingestellt, boshaft und pünktlich, von den üblichen Kopfschmerzen und Bauchkrämpfen begleitet.
»Es geht mir gut, Papa. Danke der Nachfrage …«
Paul schob ihr seinen Teller hinüber und bat sie, sich zu bedienen. Er selbst könne keinen Bissen herunterbekommen.
Elisabeth konnte der fetten Leberwurst nicht widerstehen. Du liebe Güte, wie Paul sich doch anstellte. Natürlich hatte Marie jetzt keine gute Zeit, aber sie brachte ein Kind zur Welt, und auch Kitty war guter Hoffnung. Nur ihr selbst war das Mutterglück verwehrt, aber sie hätte es sich ja von vornherein denken können. Kitty war das Sonnenkind, das vom Schicksal geliebte Wesen, die süße kleine Elfe. Alles, was sie sich wünschte, wurde ihr in den Schoß gelegt. Buchstäblich. Elisabeth musste sich zusammenreißen, um nicht in Selbstmitleid zu versinken. Nun – sie war entschlossen, wenigstens auf andere Art ihre Pflicht gegenüber Kaiser und Vaterland zu erfüllen.
»Weißt du, Papa«, begann sie lächelnd, während Paul schon wieder hinaus in den Flur lief. »Ich denke, dass wir angesichts unserer gesellschaftlichen Stellung und der räumlichen Möglichkeiten in der Villa gar keine andere Wahl haben. Klaus hat mir eindeutig gesagt, er könne dein Zögern nicht begreifen, schließlich sei es unsere vaterländische Pflicht …«
»Wovon redest du eigentlich?«, fragte Johann Melzer misstrauisch. »Doch nicht von dieser verrückten Idee, hier bei uns zu Hause ein Lazarett einzurichten? Das schlag dir besser gleich aus dem Kopf, Elisabeth!«
Sie hatte Ablehnung erwartet und ließ sich keinesfalls entmutigen. Mama hatte ihrem Plan schon halb und halb zugestimmt, schließlich hatte auch Frau von Sontheim ein Lazarett eingerichtet, und die Eltern ihrer besten Freundin Dorothea hatten eines ihrer Häuser für diesen Zweck bereitgestellt. Nur für Offiziere selbstverständlich, man wollte ja nicht irgendwelche verlausten, ungebildeten Proleten beherbergen.
»Unten in der Halle wäre Platz genug für mindestens zehn Betten, und in der Waschküche könnte man einen Operationsraum ein …«
»Nein!«
Zur Bekräftigung griff Johann Melzer zur Whiskyflasche und goss sich noch einen guten Schluck ein. Darauf erklärte er, dass unten in der Halle ständiger Durchzug herrsche, was für kranke Menschen außerordentlich ungesund sei, zudem fehle es an Licht, und nicht zuletzt müsse jeder, der das Haus betrete, an den Betten vorbeilaufen, die Halle sei nun einmal der Eingangsbereich der Villa.
»Du vergisst, dass es einen zweiten Eingang vom Garten her über die Terrasse gibt, Papa. Und dem Durchzug kann man durch Vorhänge aus festem Stoff abhelfen. Nein, ich denke, die Halle ist sehr gut geeignet, sie ist geräumig, durchlüftet und von den Wirtschaftsräumen her leicht zugänglich …«
Johann Melzer trank aus und stellte das leere Glas mit einer heftigen Bewegung zurück auf den Tisch. »Solange ich hier in der Tuchvilla etwas zu sagen habe, wird ein solcher Blödsinn nicht stattfinden. Wir haben auch so schon genügend Mäuler zu stopfen und dazu einen ganzen Sack voller Sorgen um die Fabrik.«
Elisabeth öffnete den Mund zu einer Entgegnung, doch ihr Vater kam ihr zuvor.
»Ich weiß nicht, wie ich meine Arbeiter bezahlen soll und wie lange ich sie überhaupt noch beschäftigen kann«, regte er sich auf. »Baumwolle gibt es schon seit Kriegsbeginn nicht mehr, jetzt ist auch die Wolle knapp, und um aus Hanf Fäden zu spinnen, dazu taugen meine Maschinen nicht. Lass mich also mit dieser verrückten Idee in Ruhe, sonst werde ich …«
Draußen im Flur war eine Bewegung auszumachen. Man hörte Kittys aufgeregte Stimme, oben klappten verschiedene Türen, und Else lief mit einem Korb voller Tücher durch den Flur. Voller Entsetzen sah Elisabeth, dass die weißen Laken mit hellem Blut befleckt waren.
»Du hast eine Tochter, Paulemann«, rief Kitty von oben herunter. »Eine süße, winzige Tochter. Oh mein Gott – sie ist so klein, aber sie hat schon Ärmchen und Händchen, sogar Fingerchen und Fingernägel. Die Hebamme hat sie Auguste gegeben, damit sie sie badet …«
Paul lief die Treppe hinauf, um endlich zu Marie vorgelassen zu werden, doch Kitty warf sich ihm auf halber Höhe in die Arme und weinte an seiner Schulter vor Glück.
»So lass mich doch los, Kitty …«, rief er ungeduldig und versuchte sich zu befreien.
»Ja, ja – gleich«, schluchzte Kitty und hielt ihn fest umklammert. »Warte doch, bis sie gebadet ist. Dann bekommst du deine Tochter fix und fertig verpackt in den Arm gelegt. Ach Paulemann, sie ist so bezaubernd. Und Marie war so tapfer. Ich werde das gewiss nicht zustandebringen, das weiß ich jetzt schon. Ich werde ganz Augsburg zusammenbrüllen, wenn ich solche Qualen aushalten muss …«
Auf der Schwelle vom Esszimmer zum Flur tat Elisabeth einen ärgerlichen Seufzer. Gerade jetzt musste Marie ihr Kind bekommen! Sie hatte noch eine ganze Menge guter Argumente im Hinterhalt, die den Vater ordentlich in die Enge getrieben hätten, aber er war aufgestanden und ebenfalls in den Flur gelaufen.
»Ein Mädchen«, sagte er unzufrieden. »Nun ja – die Hauptsache ist, dass Mutter und Kind wohlauf sind.«
Er musste zur Seite weichen, denn Auguste trug die hölzerne Wiege herbei, in der einst der kleine Paul und auch seine beiden Schwestern gelegen hatten. Sie stammte aus dem Haus derer von Maydorn, dem pommerschen Familienzweig, und hatte wohl schon so manchen adeligen Säugling in den Schlaf geschaukelt.
»Marie!«, rief Paul im oberen Flur. »Marie, mein Schatz. Geht es dir gut? So lasst mich doch endlich zu ihr!«
»Er soll warten!«, vernahm man die herrische Stimme der Hebamme.
»Diese Person ist grauenhaft«, sagte Kitty empört. »Wenn es bei mir so weit ist, will ich diese Megäre auf keinen Fall in meiner Nähe haben. Sie tut ja so, als gehöre ihr die ganze Villa. Stell dir vor, sie hat sogar Mama herumkommandiert …«
Elisabeth entschloss sich widerwillig, nun endlich auch das Esszimmer zu verlassen und an dem Geschehen teilzuhaben. Immerhin war sie schrecklich neugierig auf den Säugling. Ein Mädchen! Das geschah Marie nur recht. Wie enttäuscht Papa diese Nachricht zur Kenntnis genommen hatte. Er hatte auf einen Knaben gehofft, der später einmal die Fabrik weiterführen würde …
Oben war jetzt Getuschel zu vernehmen, Paul stand neben Kitty an der Treppe, beide machten betretene Gesichter. Wie seltsam, dachte Elisabeth. Ob es Marie nicht gut ging? Hatte sie zu viel Blut verloren? Würde sie gar an Entkräftung sterben?
Elisabeth spürte plötzlich ein heftiges Herzklopfen, und sie musste sich am Geländer festhalten, während sie die Treppe hinaufstieg. Oh Himmel. Sie hätte Marie ja durchaus ein kleines Fieber gegönnt – aber sie musste doch nicht gleich von dieser Welt gehen!
Jetzt öffnete sich die Tür des Schlafzimmers, und Mama trat heraus. Sie war vollkommen außer sich, die Ärmste. Ganz rot im Gesicht, die Bluse hatte feuchte Flecken, und ihre Hände zitterten, als sie sich eine losgelöste Haarsträhne hinters Ohr strich.
»Paul, mein lieber Paul …«
»Um Himmels willen – Mama! Was ist geschehen?«
Er stürzte auf sie zu, die Stimme versagte ihm.
»Es ist … es ist unfassbar«, schluchzte Alicia Melzer. »Du hast einen Sohn.«
Niemand begriff den Sinn ihrer Worte, schon gar nicht Elisabeth. Eben war es noch eine Tochter gewesen, jetzt auf einmal ein Sohn. War die Hebamme betrunken? Konnte sie nicht Männlein von Weiblein unterscheiden?
»Einen Sohn?«, stammelte Paul. »Also keine Tochter, sondern einen Sohn? Aber was ist mit Marie?«
Alicia musste sich gegen die Wand lehnen, sie schloss für einen Moment die Augen und legte den Handrücken an die heiße Stirn. Sie lächelte.
»Deine Frau hat Zwillinge geboren, Paul. Ein Mädchen und einen Knaben. Wie es Marie geht? Nun, gerade eben ging es ihr noch ausgezeichnet …«
Elisabeth blieb mitten auf der Treppe stehen. Ihre Angst verwandelte sich auf der Stelle in eine zornige Aufwallung. Zwillinge! Unfassbar, so etwas! Manche Leute konnten ja wohl nicht genug bekommen. Und gesund schien sie auch noch zu sein. Jetzt vernahm man auch das Quäken eines Säuglings, ziemlich schwach und gequetscht, als müsse sich das kleine Wesen schrecklich anstrengen, um diese Laute von sich zu geben. Plötzlich zog sich Elisabeths Herz zusammen, und ein Gefühl großer Zärtlichkeit erfasste sie. Die beiden mussten ja winzig sein, denn sie hatten sich den Platz im Leib ihrer Mutter teilen müssen.
Jetzt endlich erschien die Hebamme, eine stämmige Person mit grau meliertem Haar und feisten, von roten Äderchen durchzogenen Wangen. Sie trug eine frisch gestärkte weiße Schürze, die sie vermutlich gerade eben über das schwarze Kleid gebunden hatte. In ihren angewinkelten kräftigen Armen lagen zwei weiße Pakete. Die Neugeborenen waren in Umschlagtücher eingewickelt, nur die rosigen Köpfchen waren zu sehen. Paul starrte mit gerunzelter Stirn auf seine Kinder, sein Blick war ungläubig, ja verblüfft.
»Sie … sie sind doch gesund, oder?«, fragte er die Hebamme.
»Freilich sind sie gesund!«
»Ich meine ja nur …«, stotterte Paul.
Wie ein stolzer Vater wirkte er nicht gerade, wie er da stand und die gar zu kleinen Babys anstarrte. Ihre Gesichter glichen Grimassen, die Augen schmale Schlitze, die Nasen zwei kleine Löchlein, nur die Münder erschienen groß. Eines der beiden quengelte, stieß seltsam gepresste, hilflose Laute aus.
»Welches ist der Knabe?«, wollte Johann Melzer wissen, der ebenfalls hinaufgestiegen war.
»Der Schreihals. Ist leichter als seine Schwester, aber schon jetzt entschlossen, sich über die Zustände auf dieser Erde zu beschweren.«
Die Hebamme grinste – wenigstens sie schien mit dem Ergebnis ihrer Bemühungen zufrieden. Sie hatte jetzt auch nichts dagegen, dass Paul an ihr vorbei ins Schlafzimmer eilte.
»Marie!«, hörte Elisabeth ihn halblaut rufen. »Meine arme, süße Frau. Was hast du ertragen müssen! Wie geht es dir? Sie sind großartig, unsere Kinder … unsere Kinder …«
»Gefallen sie dir?«, sagte Marie und kicherte leise. »Zwei auf einen Streich – wenn das nicht praktisch ist.«
»Marie …«, flüsterte Paul mit überströmender Zärtlichkeit. Was er weiter sagte, konnte Elisabeth nicht verstehen, es war auch nicht für neugierige Zuhörer bestimmt.
Elisabeth verspürte einen Kloß im Hals, der immer heftiger anschwoll. Oh Himmel, wie rührend das alles war. Und wie sehr sie sich wünschte, dass auch Klaus einmal solch zärtliche, dankbare Worte an sie richten würde. Sie ging zu Mama, um sie zu umarmen, und auf einmal bemerkte sie, dass sie weinte.
»Haben Sie schon Namen für die beiden?«, wollte die Hebamme wissen.
»Gewiss«, sagte Alicia Melzer, und sie streichelte den Rücken ihrer Tochter Elisabeth.
»Das Mädchen wird Dorothea heißen und der Knabe Leopold.«
»Dodo und Leo«, rief Kitty begeistert. »Papachen – du musst die Sektflaschen öffnen, ich werde einschenken. Ach, wenn unser guter Humbert doch hier wäre. Niemand konnte so geschickt eingießen und auftragen wie er. Gehen wir, gehen wir – die beiden da drinnen haben jetzt ganz schrecklich viel miteinander zu flüstern …«
Man begab sich in den roten Salon, schickte nach Else, die Gläser herbeitragen sollte, während Johann Melzer in den Keller hinunterstieg, um den Sekt zu holen. An diesem Freudentag durfte auch das Personal einen kleinen Schluck auf den frisch geborenen Melzer’schen Nachwuchs trinken, Kitty füllte die Gläser, und Alicia rief die Köchin und Hanna aus der Küche herbei, Else trug ein Tablett hinauf ins Schlafzimmer, wo sie zuerst das glückliche Elternpaar, dann aber auch Auguste und die Hebamme mit dem prickelnden Schampus versorgte.
»Ein Hoch auf die neuen Erdenbürger«, rief Johann Melzer aus. »Gottes heilige Engel mögen über ihnen wachen, so wie sie über unserem geliebten Vaterland und unserem Kaiser treue Wacht halten …«
Man trank auf Dodo und Leo, auf Marie, die junge Mutter, auf das frisch gebackene Elternpaar und natürlich auf den Kaiser. Die Köchin Brunnenmayer erklärte, sie habe längst gewusst, dass die gnädige Frau Zwillinge trug, weil sie doch dicke Beine bekommen hatte, und Hanna erkundigte sich, ob sie die Kinder später im Wagen spazieren fahren dürfe. Das wurde ihr in Aussicht gestellt – allerdings nur in Begleitung eines Kinderfräuleins, das noch zu engagieren sei.
»Ich war lange nicht mehr so froh und erleichtert«, sagte Alicia, als die Familie wieder unter sich war. Ihre Augen leuchteten, nach all den Aufregungen hatte das halbe Gläschen Sekt sie schon berauscht. »Es kommt mir vor, als seien die alten Zeiten wieder zurück. Als wir beide noch jung waren, Johann. Und unsere Kinder noch klein. Erinnerst du dich? Ihr fröhliches Lachen in der Halle. Wie sie im Park herumgetobt sind und den Gärtner zur Verzweiflung brachten …«
Johann Melzer hatte von seinem Sekt nur genippt. Er stellte das Glas ab, um seine Frau in seine Arme zu schließen, eine Geste, die schon lange nicht mehr zwischen ihnen üblich gewesen war. Elisabeth sah, wie ihre Mutter lächelnd die Augen schloss und ihre heiße Wange an seine Schulter lehnte.
»Wohl dem, der auf vergangenes Glück zurückschauen kann«, murmelte er. »Das ist ein Schatz, den ihm niemand nehmen kann.«
2
Was treibst denn so lange?«, keifte Else Hanna an. »Ich wart schon eine geschlagene Viertelstunde hier im Regen! Wenn wir heut kein Fleisch und keine Wurst mehr heimbringen, dann werd ich der gnädigen Frau schon sagen, wessen Schuld das ist.« Else war schlechter Laune, und sie hatte keine Hemmungen, Hanna ihren Gemütszustand spüren zu lassen. So war sie nun einmal, die ach so stille und unauffällige Else. Niemals wagte sie, gegen die wehrhafte Auguste oder gar gegen die energische Köchin aufzumucken. Und gegenüber der Herrschaft war sie ganz und gar devot. Aber Hanna, die sowieso ständig getadelt und gestraft wurde, die war dem Stubenmädel Else als Prügelkind gerade recht.
Hanna schleppte einen großen Henkelkorb, in dem ein Sack aus grobem Nesseltuch lag, man hoffte, vielleicht ein paar Kartoffeln zu ergattern.
»Hab noch das Geschirr waschen und einen Eimer Kohlen holen müssen«, sagte sie zu Else, die in Hut und Mantel unter dem Säulendach des Eingangsportals auf sie gewartet hatte. Wo sie eigentlich gar nicht stehen durfte, denn das Personal hatte die beiden Seiteneingänge zu benutzen. Von wegen im Regen gewartet – kein Tröpfchen war auf Elses Mantel zu sehen.
»Ein Wetter ist das«, jammerte Else nun, denn sie musste ihr trockenes Plätzchen aufgeben, um sich gemeinsam mit Hanna auf den Weg zu machen. »Das geht durch und durch. Wenn ich mich nur nicht erkältet habe. Geh doch anständig, Hanna. Du spritzt mir ja den Rock nass. Kannst du überhaupt irgendetwas vernünftig tun? Nicht einmal geradeaus laufen kannst du. Pass auf, dass der Korb nicht …«
Sie schrie auf, breitete auf komische Weise die Arme aus und taumelte nach vorn. Ein trockener Ast, den der Wind von der alten Kastanie abgerissen hatte, war auf den Weg gefallen und hatte sie ins Stolpern gebracht. Zu allem Unglück trat sie nun auch noch in eine Pfütze und durchweichte dabei ihren linken Schuh, der sowieso schon ein Loch hatte.
»Geben Sie Obacht, Else«, sagte Hanna mit ernsthafter Miene, hinter der sie ihre Schadenfreude verbarg. »Da liegt ein trockener Ast im Weg.«
Oh, wie wütend Else nun wurde! Natürlich war Hanna an diesem Missgeschick völlig unschuldig, aber ein Grund, um beschimpft zu werden, ließ sich offenbar immer finden. Ihr lautes Mundwerk. Ihre Ungeschicklichkeit. Beim Abwasch gestern Nacht hatte sie eines der teuren, geschliffenen Sektgläser zerbrochen.
Während sie durch den Park zur Straße gingen, hatte sich Hanna eine Menge Vorhaltungen anzuhören. An diesem Tag störte es sie jedoch wenig, denn sie dachte daran, wie eklig es sein musste, mit einem klatschnassen rechten Schuh herumzulaufen. Und der Saum von Elses Rock hatte auch ordentlich etwas abbekommen.
Als sie auf die Straße einbogen, konnte sie in der Ferne zwischen allerlei Fabrikgebäuden, Remisen und Apfelwiesen das spitze Dach des Jakobertors sehen. Im Nieselregen erschienen Häuser und Türme der Stadt dunkelgrau und wenig einladend. Hanna zog das Tuch zurecht, das sie als Regenschutz über Kopf und Schultern gelegt hatte. Es half nicht allzu viel, der Nieselregen drang mit Leichtigkeit durch den Stoff. In diesem Punkt hatte Else leider recht.
»Unserer jungen Herrin solchen Kummer zu bereiten. Wo sie gestern erst Mutter geworden ist …«
Was Else da für einen Blödsinn schwatzte. Der jungen Frau Melzer war es gewiss völlig gleich, ob es nun elf oder zwölf Sektgläser waren. Und überhaupt war die junge Frau Melzer immer auf Hannas Seite. Auch der junge Herr. Der hatte sie damals, als sie den schlimmen Unfall in der Fabrik gehabt hatte, ins Krankenhaus gebracht. Er war ein guter Mensch, ganz anders als sein Vater. Der war oft mürrisch und konnte die Angestellten zusammenstauchen. Nur bei der Köchin, der Brunnenmayer, da war sogar der Direktor Melzer vorsichtig. Die war was Besonderes, denn sie kannte alle Geheimnisse der Kochkunst. Die Brunnenmayer konnte zwar auch ordentlich schelten, aber sie war offen und ehrlich, und sie schwatzte nie hinter dem Rücken über jemanden. Das tat die Else und auch die Auguste. Die war überhaupt ein Luder, die Auguste. Vor der musste man sich in Acht nehmen. Besonders jetzt, wo ihr Mann, der Gustav, im Feld war. Bevor sie den eingezogen hatten, war die Auguste ganz anders gewesen. Fröhlich, manchmal sogar gutmütig. Jetzt war sie ein Scheusal.
Sie betraten die Stadt durch das Jakobertor und schauten neidisch zu, wie ein junges Ehepaar in eine schwarze Limousine stieg und davonfuhr. Die hatten es gut, brauchten sich nicht nassregnen zu lassen. Es gab nicht mehr viele Privatautos, weil der Treibstoff für das Heer benötigt wurde, aber reiche Leute, wie der Bankier Bräuer, die konnten sich Benzin beschaffen. Trotzdem hatte aller Reichtum dem jungen Herrn Bräuer nicht geholfen – er hatte ins Feld ziehen müssen, genau wie alle anderen.
In der Maximilianstraße war tatsächlich ein Stand, an dem Kartoffeln ausgegeben wurden. Eine lange Schlange hatte sich davor gebildet, vor allem Frauen, aber auch Kinder, alte Männer und Kriegskrüppel. Die kostbaren Knollen lagen in Säcken auf einem Lastwagen, zwei Männer in Uniform hatten eine Waage auf eine Holzkiste gestellt und wogen die Kartoffeln ab.
»Das sind viel zu wenig«, taxierte Else. »Du musst sagen, dass wir zehn Personen sind, darunter eine Wöchnerin, die gestern geboren hat. Hier hast du Geld. Und wehe, du lässt dich übers Ohr hauen!«
Else entriss ihr den Einkaufskorb, drückte ihr den Sack in die Hände und gab ihr einen Schubs in Richtung Warteschlange. Hanna stellte sich brav hinten an und hatte dabei das niederschmetternde Gefühl, völlig umsonst hier im Regen auszuharren. Da waren mehr als dreißig Leute vor ihr, und jetzt drängte sich noch ein altes Mütterchen dazwischen, das so schrecklich zitterte, dass niemand das Herz hatte, es davonzujagen. Neidisch sah Hanna Else hinterher, die mit dem großen Korb in den Bäckerladen ging und dort vermutlich frisches Brot und vielleicht sogar lecker duftende Semmeln kaufte. Danach würde sie Milch und Butter einholen, vermutlich aber wieder einmal nur dieses eklige »Kunstspeisefett« erhalten, über das sich die Brunnenmayer immer schrecklich aufregte.
»Da schau, das faule Pack«, sagte eine Frau im blauen Wollmantel, die ein Stück vor Hanna in der Reihe stand. »Hocken herum und schwatzen, anstatt zu arbeiten.«
Hanna blickte neugierig in die Richtung, in die der Zeigefinger der Frau wies. Dort waren Arbeiter beschäftigt, das Straßenpflaster auszubessern, regennasse Gestalten in abgerissener Kleidung, einige trugen nicht einmal eine Mütze auf dem triefenden Haar. Es waren Kriegsgefangene, die von zwei Uniformierten des Landsturms bewacht wurden.
»Die machen eine Pause«, sagte ein junger Mann. Er war sehr bleich und hielt sich kerzengerade. Wenn er sich bewegte, schwankte er jedoch bei jedem Schritt auf seltsame Weise hin und her, weil er rechts eine Beinprothese hatte. »Arme Schweine sind das. Haben auch nichts anderes getan, als für ihr Vaterland ins Feld zu ziehen.«
»Dreckige Russen«, beharrte die Frau im Wollmantel. »Verlaust und dummdreist. Wie sie nach den Mädchen schauen, diese Kerle. Nimm dich vor denen nur in Acht, Kleine!«
Damit meinte sie Hanna, die mit großen, mitleidigen Augen auf die erschöpften Männer starrte. Sie fand nicht, dass diese Kriegsgefangenen gefährlich aussahen, viel eher schienen sie ihr halb verhungert und ganz sicher krank vor Heimweh. Was für eine verrückte Sache solch ein Krieg doch war. Zuerst waren alle voller Begeisterung gewesen. »Wir hauen den Franzmännern auf die Mütze«, hatte es geheißen, und »an Weihnachten sind wir alle wieder zu Hause«. Die junge Frau Melzer und ihre Schwägerinnen waren zum Bahnhof gefahren, Else, Auguste und sie, Hanna, hatten Körbe mit belegten Broten und Kuchen geschleppt, um all die Köstlichkeiten an die Soldaten zu verteilen, die in langen Eisenbahnzügen nach Westen fuhren. Da wurden Fähnchen geschwenkt und gewinkt, alle waren wie im Rausch gewesen. Für den Kaiser. Für unser deutsches Vaterland. In den Schulen fiel der Unterricht aus, was Hanna gut gefallen hatte. Zwei ihrer Brüder hatten sich freiwillig zum Militärdienst gemeldet, wie stolz waren sie gewesen, als sie nach der Musterung angenommen und eingekleidet wurden. Sie waren noch im ersten Kriegsjahr umgekommen, der ältere war an einem Fieber gestorben und der jüngere irgendwo in Frankreich gefallen, an einem Fluss, der Somme hieß. Paris hatte er nie gesehen. Und dabei hatte er Hanna damals noch versprochen, eine Ansichtskarte zu schicken, wenn er siegreich in die französische Hauptstadt eingezogen war.
Jetzt, im dritten Kriegsjahr, hatte Hanna längst begriffen, dass man sie damals angeschwindelt hatte. Von wegen zu Weihnachten wieder daheim. Der Krieg hatte sich eingenistet, er hockte wie ein böser Geist auf dem Land und fraß, was er kriegen konnte. Brot und Fleisch, Männer und Kinder, Geld, Pferde, Benzin, Seife, Milch und Butter. Es schien, als bekäme er niemals genug. Da sammelten sie alte Kleider, Metall, Gummi, Obstkerne und Papier. Auch Frauenhaar war begehrt. Demnächst würden sie wohl noch ihre Seelen haben wollen – wenn sie die nicht schon längst hatten …
»Träum nicht, Kleine«, sagte der junge Mann mit dem Holzbein. »Du bist gleich dran.«
Sie erschrak und stellte fest, dass sie tatsächlich nicht umsonst gewartet hatte, der Mann wog zwei Pfund Kartoffeln ab und machte eine auffordernde Kopfbewegung in ihre Richtung.
»Macht vierundzwanzig Pfennige.«
»Ich brauche aber mehr Kartoffeln«, sagte Hanna. »Wir sind zehn Personen, darunter eine Wöchnerin, die gestern Zwillinge geboren hat …«
Hinter ihr wurden unmutige Rufe und Gelächter laut. Man habe zu Hause sechs hungrige Kinder und die alten Eltern.
»Zwillinge?«, rief ein kleiner Witzbold. »Ich bin ein Fünfling!«
»Ich ein Hundertling …«
»Ruhe!«, rief der Mann an der Waage ärgerlich. Er war müde, und die Arme taten ihm weh. »Zwei Pfund. Wem’s net gefällt, der kriegt gar nichts. Fertig.«
Die Kartoffeln, die in Hannas Sack kullerten, waren ganz klein. Für jeden im Haus zwei, schätzte sie.
Man schob sie zur Seite, der Nächste empfing seine zwei Pfund Kartoffeln, und ein rascher Blick belehrte sie, dass auf dem Lastwagen nur noch wenige Säcke lagen. Nun würde Else sie wieder schelten, und dabei war es wirklich nicht ihre Schuld, dass sie nicht mehr bekommen hatte. Unschlüssig stand sie auf der Stelle, überlegte, ob sie sich hinten in der Schlange wieder anstellen sollte, vielleicht erkannte sie der Mann ja nicht und gab ihr noch mal zwei Pfund. Da spürte sie, dass jemand sie anstarrte. Es war ein langer Blick aus fremdartig dunklen Augen, er kam von einem der Kriegsgefangenen, die jetzt wieder an die Arbeit gehen mussten. Ein schmaler Bursche war es, ziemlich bleich, der erste dunkle Flaum wuchs auf Kinn und Wangen. Er stand breitbeinig und sah zu ihr hinüber, lächelte für einen winzigen Moment, dann stieß ihn jemand gegen die Schulter, und er packte die Spitzhacke, schwang sie hoch und riss das Pflaster auf. Eine Weile arbeitete er ohne Unterbrechung, hackte mit wütender Kraft auf die Pflastersteine ein, und Hanna wunderte sich, wie einer, der gewiss kaum etwas Vernünftiges zu essen bekam, dennoch solche Kräfte haben konnte.
Ein Russe, dachte sie. Aber ein hübscher Russe. Verlaust war er wohl trotzdem.
»Da schau mal einer an!«, kreischte eine weibliche Stimme, die ihr nur allzu bekannt war. »Schaust den Männern hinterher, wie? Ein feines Früchtchen hab ich da großgezogen. Bist jetzt zu vornehm, deine Mutter zu grüßen?«
Hanna fuhr herum und sah voller Entsetzen, dass ihre Mutter ganz rot im Gesicht war, auch hatte sie den Hut falsch herum aufgesetzt. War sie etwa schon am frühen Morgen betrunken?
»Guten Morgen, Mama. Wolltest du auch Kartoffeln kaufen?«
Eine alkoholgeschwängerte Atemwolke traf sie und bestätigte ihre Vermutung. Grete Weber war im vergangenen Jahr in der Fabrik entlassen worden wie so viele andere auch. Seitdem ging es immer weiter bergab mit ihr.
»Kartoffeln?«, krächzte ihre Mutter und stieß ein heiseres Lachen aus. »Woher sollt’ ich wohl das Geld haben, Kartoffeln zu kaufen? Weißt doch, dass ich nix mehr verdienen kann, Mädel. Dein Dienstherr, der junge Herr Direktor Melzer, der hat mich rausgeworfen. Nachdem ich über zehn Jahr’ treu und fleißig an der Spinnmaschine gestanden bin und meine Arbeit getan hab, hat der mich einfach auf die Straße gesetzt …«
Hanna schwieg dazu, sie wusste aus Erfahrung, dass Widerspruch zwecklos war, auch wenn die Mutter ihr gerade einen Sack voller Lügen aufgetischt hatte. Von wegen »zehn Jahr’ treu und fleißig …«. Wenn sie wenigstens nicht so laut schreien würde, es musste ja nicht jeder wissen, dass sie stockbetrunken war! Woher sie wohl das Geld für den Schnaps hatte? Der Vater war im Feld, und die beiden jüngeren Brüder waren bei einer entfernten Tante in Boblingen untergekommen.
»Bist meine einzige Stütze, Hannakind«, krächzte die Weberin jetzt weinerlich und griff nach Hannas Arm. »Alle sind sie davon. Verdorben. Gestorben. Haben mich allein gelassen. Hungern muss ich und frieren …«
»Das tut mir leid, Mama. Wenn ich meinen Lohn bekomm, dann kann ich dir auch was geben. Aber das ist erst am Monatsende …«
»Was redst du denn? Monatsend’ ist grad erst gewesen. Willst mich anlügen, Hanna? Deine eigene Mutter anlügen? Dass dir einmal die Hand aus dem Grab herauswächst …«
Der mütterliche Griff war jetzt so fest, dass Hanna die Zähne zusammenbeißen musste, um nicht aufzuschreien. Sie machte einen Versuch, sich loszureißen, doch Grete Weber hatte erstaunliche Kräfte, auch wenn sie betrunken war.
»Erst gibst mir das Geld …«, keifte sie und zerrte Hanna hin und her. »Her damit! Willst deine Mutter verhungern lassen, undankbares Balg? Da schau, was für feine Schuhe sie hat. Und ein Tuch aus guter Wolle. Aber die Mutter soll in Lumpen gehen …«
»Du kaufst ja doch nur Schnaps davon …«, entfuhr es Hanna, die verzweifelt versuchte, sich zu befreien.
»Das sagst du mir?«, kreischte die Weberin in heller Wut. »Deiner eigenen Mutter sagst du so was? Da hast du’s!«
Die Ohrfeige traf Hanna unerwartet, sie war kräftig. Die Mutter hatte vier Buben und ein Mädel großgezogen, sie wusste zuzuschlagen. Hanna wich mit einem erschrockenen Aufschrei zurück, wobei ihr der Sack mit den Kartoffeln aus der Hand fiel. Zwar bückte sie sich eilig, um ihn wieder aufzuheben, doch schneller, als sie denken konnte, hatte die Weberin die Beute an sich gerafft.
»Da nehm ich einstweilen das, und morgen komm ich in die Villa, um das Geld zu holen …«
»Nein!«, kreischte Hanna und versuchte, ihrer Mutter den Sack zu entreißen. »Die Kartoffeln gehören mir nicht. Sie gehören der Herrschaft. Gib sie zurück …«
Es war sinnlos, Grete Weber hatte sich bereits auf die andere Straßenseite gerettet, und ausgerechnet jetzt zuckelte ein Pferdefuhrwerk vorbei, das mit Bierfässern beladen war. Um ein Haar wäre Hanna in das alte Pferd hineingelaufen.
»Bist denn blind und taub, Madel?«, fuhr der Bierkutscher sie wütend an. »Allweil sind’s die Weibsleut, die net aufpassen können.«
Natürlich war die Mutter längst zwischen den Häusern verschwunden, als das Fuhrwerk endlich den Weg freigab. Und selbst wenn Hanna sie noch eingeholt hätte – Grete Weber hätte ihr den Sack ganz sicher nicht freiwillig zurückgegeben, sondern es vielmehr auf eine Prügelei ankommen lassen.
Sie wird die Kartoffeln in Schnaps umtauschen, dachte Hanna beklommen. Geht in die nächste Kneipe und feilscht herum.
Wie schrecklich das war, solch eine Mutter zu haben. Hoffentlich hatte wenigstens Else nichts von diesem Auftritt mitbekommen, sonst würde sie nachher in der Küche wieder davon reden, dass die Hanna ja aus »schlimmen Verhältnissen« kam und gut aufpassen musste, nicht dereinst wieder dort hinzukommen. Dabei war die Mutter früher tatsächlich einmal fleißig gewesen. Das war zwar schon lange her, aber Hanna konnte sich noch gut daran erinnern. Damals war es der Vater gewesen, der immer betrunken gewesen war und sie alle geprügelt hatte. Die Mutter hatte sich oft vor die Kinder gestellt, die Schläge mit dem eigenen Körper von ihnen abgehalten. Da hatte die Mutter auch noch mit Näharbeiten Geld verdient, und die Brüder waren in die Schule gegangen. Aber später hatte auch Grete Weber gelegentlich zur Flasche gegriffen, und in der Fabrik hatte sie nie ihr Soll erfüllen können. Am Ende hatte sie der junge Herr Melzer nur aus Mitleid mit Hilfsarbeiten beschäftigt …
Hanna überlegte, wie sie sich aus der Affäre ziehen könnte. Sie schaute zu dem Lastwagen hinüber und stellte fest, dass dort nur noch leere Säcke auf der Ladefläche lagen. Die Männer waren dabei, die große Waage in die Kiste zu packen, dann hoben sie die Kiste auf den Lastwagen und kletterten ins Führerhaus. Der Motor ratterte. Langsam fuhr der Laster an, und die Leute, die gehofft hatten, noch ein paar Kartoffeln zu ergattern, mussten jetzt zur Seite weichen, um nicht überfahren zu werden. So weit, so gut, dachte Hanna. Sie konnte Else ja erzählen, dass sie nichts mehr bekommen hätte und die ganze Zeit umsonst in der Schlange gewartet habe. Der Haken daran war nur, dass auch das Geld weg war. Immerhin vierundzwanzig Pfennige. Dafür konnte man ein Roggenbrot kaufen. Oder zwei Eier. Oder einen ganzen Liter Milch …
Sie drehte sich um, überlegte, ob sie nicht besser hinüber in den Milchladen ging, um nach Else zu schauen. Dabei konnte sie sich auch für ein paar Minuten unterstellen, denn der Regen war heftiger geworden, das Tuch war schon ganz durchweicht, und die Nässe rann ihr den Nacken hinunter. Gerade als sie sich entschlossen hatte, loszumarschieren, begegnete sie – warum auch immer – erneut diesen fremden, dunklen Augen. Der russische Kriegsgefangene stand gebückt, die Hacke in beiden Händen, den Kopf in ihre Richtung gewandt. Er sah sie mit einem Ausdruck von Unverständnis und Mitleid an, folgte ihr mit Blicken, während sie hinüber zum Milchgeschäft lief, und erst als jemand ihm einen zornigen Befehl zubrüllte, setzte er seine Arbeit fort.
Auch das noch, dachte Hanna. Wahrscheinlich denkt er, eine Diebin habe mir die Kartoffeln gestohlen. Wie gut, dass er nicht weiß, dass diese Diebin meine eigene Mutter ist. Wieso kümmert es mich eigentlich, was dieser Russe über mich denkt? Es sollte mir ganz egal sein. Was für ein dreister Kerl, der mir ständig nachschaut! Es wäre besser, man würde ihn zurück nach Russland bringen, soll er dort die Mädchen anglotzen.
Sie wollte gerade die Tür des Milchladens öffnen, da sah sie Else aus der Metzgerei kommen. Das ältliche Stubenmädel – Else war schon über vierzig – blieb auf dem Trottoir vor dem Geschäft stehen und lächelte einfältig, wie sie es tat, wenn sie mit einer höhergestellten Person redete. Tatsächlich trat in diesem Augenblick eine dunkel gekleidete Frau aus dem Geschäft, die einen schrecklich altmodischen Hut trug. Kannte sie diesen Hut nicht? Natürlich – der gehörte Fräulein Schmalzler, die eigentlich den Posten der Hausdame in der Villa innehatte. Vor einem halben Jahr hatte die gnädige Frau sie ihrer Tochter Kitty »ausgeliehen«, dort sollte die Schmalzler das Hauswesen organisieren und das Personal einarbeiten. Auguste hatte erzählt, in der schönen Stadtvilla der Bräuers ginge es »drunter und drüber«. Das Personal nähme sich unglaubliche Freiheiten heraus, während die Gnädige Bilder malte und mit Hammer und Meißel auf Marmorblöcken herumhackte, anstatt sich um ihr Hauswesen zu kümmern.
Die Schmalzler war freilich die Richtige für eine solche Aufgabe. Hanna mochte die Hausdame nicht besonders, musste aber zugeben, dass Eleonore Schmalzler einen scharfen Blick hatte und sich bemühte, gerecht zu sein. Sie hielt nicht viel von Hanna. Aus ihr würde wohl niemals eine verlässliche Kraft werden, hatte sie ihr vor Monaten gesagt, und vielleicht hatte sie ja recht.
Hanna blieb stehen und beobachtete, wie die Schmalzler einen schwarzen Regenschirm aufspannte, unter dem sie nun mit Else zu schwatzen begann. Jetzt fragte die Schmalzler Else wohl nach den neuesten Ereignissen in der Tuchvilla aus. Else würde bestimmt erzählen, dass dieses ungeschickte Ding, das Küchenmädel, eines der geschliffenen Sektgläser zerbrochen habe. Hanna seufzte und wischte sich die Regentropfen aus dem Gesicht. Es war kalt, und die Nässe drang durch die Kleidung. Wie lange wollten die beiden eigentlich noch dort stehen und ratschen? Dachte Else gar nicht mehr an ihren nassen Fuß?
Wenigstens schien sie guter Laune zu sein. Als sie sich mit einem Knicks von der Schmalzler verabschiedete und mit dem gut gefüllten Korb auf Hanna zusteuerte, lag noch der Rest eines befriedigten Lächelns auf ihrem Gesicht. Es hatte ihr wohlgetan, allerlei Klatsch und Tratsch zu verbreiten.
»Da bist du ja«, sagte sie zu Hanna, als habe sie lange nach ihr suchen müssen. »Wo hast du die Kartoffeln?«
Hanna schilderte fantasievoll, wie sie in der Schlange gewartet habe und just in dem Moment, als sie an die Reihe kam, der Mann gesagt habe, sie sei ein Pechvogel, denn nun seien die Kartoffeln leider alle.
Else war immer noch guter Dinge, sie schüttelte nur unwillig den Kopf und meinte, ob Hanna denn nicht versucht habe, sich ein wenig nach vorn zu schieben. Sie sei doch sonst nicht auf den Kopf gefallen.
»Die haben genau aufgepasst. Ein Bub hat sich vordrängeln wollen, da hat ihm eine Frau eine feste Watschen gegeben.«
»Oha!«, sagte Else und fügte hinzu, dass der Hunger manche Leute zu wilden Tieren mache. Sie reichte Hanna den schweren Korb. »Deck den Sack drüber, muss net jeder sehen, dass wir heut Semmeln bekommen haben.«
Da hatte sie den Schlamassel. Der Sack war weg, den hatte ihre Mutter mitgenommen. Jetzt fehlte nur noch, dass Else nach dem Geld fragte.
»Den Sack hab ich … hab ich verschenkt …«
Else blieb stehen vor Verblüffung. Das war ja ungeheuerlich. Dieses Mädchen verschenkte Gegenstände, die der Herrschaft gehörten!
»Verschenkt? Bist narrisch worden?«
Jetzt wurde die Sache schon gefährlich, Hanna musste sich etwas ganz Gescheites einfallen lassen, um da herauszukommen.
»Einem armen Krüppel hab ich den Sack geschenkt«, sagte Hanna mit treuherzigem Augenaufschlag. »Der hockte drüben neben dem Kaufhaus und zitterte vor Kälte. Er hatte keine Beine mehr, Else. Nur zwei Stümpfe. Da hab ich ihm den leeren Sack geschenkt, damit er ihn sich um die Schultern legen konnte …«
Das klang ja fast so rührend wie die Geschichte vom heiligen Martin, der seinen Mantel mit dem Bettler teilte. Else wirkte jedoch skeptisch. Wenn es galt, eine Lügengeschichte aufzutischen, war Hannas Phantasie unerschöpflich. Suchend blickte Else zum Kaufhaus hinüber, dort war kein Bettler zu sehen, nur eine junge Frau mit einem Kind, die den Leuten bunte Feldpostkarten anbot.
»Und wo ist er hin, dein Bettler?«
»Der ist wohl weggegangen …«
»Auf seinen Stümpfen, wie? Dass ich net lach! Verlogene Person. Komm du nur heim, da werden sie dir schon den Marsch blasen! Eine Tracht Prügel hast dir verdient …«
Es war keine großartige Idee gewesen, das musste Hanna vor sich selbst zugeben. Auch wenn es durchaus Krüppel gab, die auf ihren Stümpfen laufen konnten, die Sache war einfach zu weit hergeholt. Verzagt lief sie hinter Else her, die nun mit energischem Schritt in Richtung Jakobertor ging und sich in bedrohliches Schweigen hüllte.
Nun würde sie wieder einmal eine Strafe bekommen, vermutlich zog man ihr etwas vom Lohn ab, dabei musste sie von dem wenigen, das sie erspart hatte, noch die vierundzwanzig Pfennige nehmen, die Else hoffentlich erst in der Villa von ihr fordern würde. Aber Hanna war bereit, alle möglichen Ärgernisse und Strafen auf sich zu laden, wenn nur niemand erfuhr, was tatsächlich geschehen war. Sie schämte sich viel zu sehr für ihre Mutter.
»Denk bloß nicht, dass du eine von den Semmeln bekommst«, nahm Else jetzt das Schelten wieder auf. »Die sind für die Herrschaft, und wenn was übrig bleibt, dann haben da andere einen Anspruch drauf!«
Hanna schwieg. Was sollte sie schon dazu sagen? Sie hatte die leckeren goldbraunen Semmeln trotz der feuchten Papiertüte, in der sie steckten, schon gerochen. Was für ein Duft! Das war weißes Mehl, ein wenig Milch, dazu Salz und Hefe. Locker und köstlich. Ganz was anderes als das steinharte, dunkle Roggenbrot, das – so hatte die Köchin behauptet – mit Sägespänen gestreckt wurde.
»Bekommt halt jede das, was sie verdient«, sagte Else hämisch. Es gefiel ihr sichtlich, nun wieder einen Grund zu haben, Hanna so richtig herunterzuputzen.
Wie gemein das ist, dachte Hanna verbittert. Wie ungerecht! Ich hab nichts Schlimmes getan!
Ihre linke Hand machte sich plötzlich selbstständig. Sie fuhr in die Tüte hinein und zog eine runde Semmel heraus. Was dann geschah, war ein krimineller Akt, ein Verbrechen an Kaiser und Vaterland. Doch Hanna konnte nicht anders. Sie barg die Semmel unter ihrem Tuch, bis sie an der Baustelle vorübergingen. Dort schoss ihre Hand plötzlich unter dem Tuch hervor, und die runde Köstlichkeit wechselte den Besitzer.
Blitzschnell war es geschehen, und nur zwei Menschen hatten davon Kenntnis. Das Küchenmädel Hanna Weber und ein junger Russe, der die Gabe eilig unter seiner Jacke verschwinden ließ.
3
Zweimal hatte die Sekretärin Ottilie Lüders bereits an Pauls Bürotür geklopft und gefragt, ob sie für den jungen Herrn Direktor nicht Holz nachlegen solle. Aber Paul hatte grinsend abgewehrt, er sei schließlich keine Frostbeule. Drüben in den Hallen, wo die Arbeiterinnen an den Selfaktoren stünden, würde auch nicht geheizt. Darauf hatte die Lüders einen tiefen Seufzer unterdrückt und ihm unaufgefordert eine Tasse Ersatzkaffee auf den Schreibtisch gestellt. Weil ein Mensch an solch einem kalten, dunklen Wintermorgen etwas Warmes brauche.
»Lieb von Ihnen, Fräulein Lüders!«
Paul lehnte sich im Stuhl zurück, um seine Zeichnung mit kritischen Augen zu überblicken. »Wenn Maries Vater doch noch am Leben wäre. Jacob Burkard hätte diese Maschine mit Leichtigkeit entworfen.«
Er schüttelte den Kopf und griff zum Radiergummi, um eine Korrektur anzubringen, zeichnete eine Weile mit Dreieck und Lineal und nickte dann zufrieden. Er war kein Genie, wie der arme Burkard es gewesen war, dafür aber ein Praktiker und kein übler Geschäftsmann. Er würde Bernd Gundermann aus der Spinnerei bitten, sich seine Zeichnung einmal anzuschauen. Gundermann war vor Jahren aus Düsseldorf zugezogen; er hatte dort bei Jagenberg gearbeitet, die damals schon Fasern aus Papier herstellten. Man zerschnitt die gewaltigen Papierrollen in zwei bis vier Millimeter breite Streifen, die an den Enden geleimt und zu Fäden gedrillt wurden. Diese Papierfäden ließen sich zu Stoffen verweben. Vorwiegend waren es grobe Stoffe, die für Säcke, Traggurte oder Treibriemen taugten, verfeinert konnte man jedoch auch Kleiderstoffe daraus herstellen. Freilich waren solche Textilien unbequem, sie ließen sich nicht wie gewohnt waschen, und wer längere Zeit damit im Regen herumlief, der hatte das Nachsehen. Aber angesichts des katastrophalen Rohstoffmangels wurde die Herstellung von Papierfasern im Reich massiv gefördert. Die Existenz der Melzer’schen Tuchfabrik stand auf der Kippe, und nur wenn es gelang, in das Geschäft mit diesen Fasern einzusteigen …
Ein leises Klopfen an der Tür zum Büro störte ihn in seinen Gedanken.
»Paul?«
Ein ungutes Gefühl beschlich ihn. Wieso klopfte Vater bei ihm an? Normalerweise stiefelte er unangemeldet in das Büro seines Sohnes, wann immer es ihm passte.
»Ja, Vater. Soll ich zu dir kommen?«
»Nein, nein …«
Die Tür zitterte ein wenig, dann wurde sie gänzlich aufgeschoben, und Johann Melzer trat ein. Seit seinem Schlaganfall vor zwei Jahren war er abgemagert, das Haar schlohweiß, die Hände bewegten sich in nie endender Rastlosigkeit. Der Niedergang seiner Fabrik seit einem guten Jahr machte ihm schwer zu schaffen. Dabei waren sie zu Kriegsanfang richtig gut im Geschäft gewesen, hatten Uniformstoffe aus Baumwolle und Wolle hergestellt, ein kriegswichtiges Unternehmen, dessen junger Direktor Paul Melzer aus diesem Grund von einer Einberufung fürs Erste verschont blieb …
ENDE DER LESEPROBE