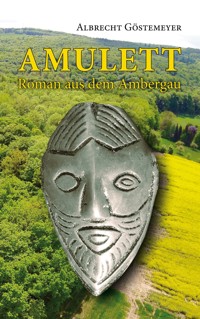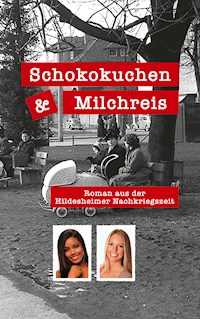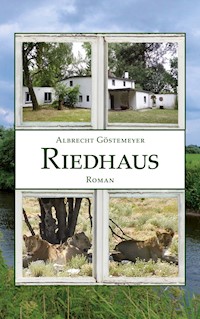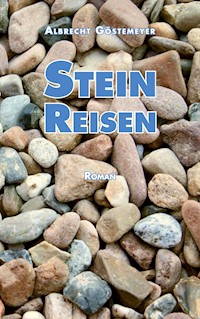Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Berliner Zinnfigurenhändler Paul lebt seit Jahren mit einer jungen, attraktiven Freundin zusammen. Eines Tages erblickt er in einem Fenster eine geheimnisvolle Frau. Durch Zufall trifft er sie auf einer Party wieder. Es ist Leela, die in Indien aufgewachsen ist und in einem Ministerium arbeitet. Zwischen ihnen entwickelt sich eine heftige Leidenschaft. Geprägt aus den Erfahrungen ihrer Jugend führt Leela ihn in eine unbekannte Welt zwischen Raum und Zeit ein. Anfangs erleben sie ihre Beziehung genussvoll, doch später kommt es zu einer Dramatik, die tragisch endet. Daraufhin kehrt Paul zu seiner früheren Freundin Jessica zurück. Trotzdem reist er später auf Leelas Spuren durch Indien. Schließlich wird ihm sein altes Verhältnis zu Leela zum Verhängnis. Und doch entwickelt sich aus dem Geschehen Hoffnung und Zuversicht. Der Roman beschreibt Elemente aus Fantasy, Philosophie und Religion, ohne einem bestimmten Genre anzugehören. Daraus entwickelt sich seine Spannung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
BERLIN, IM JANUAR 2010
BERLIN, IM JANUAR 2011
BERLIN, IM OKTOBER 2011
BERLIN, IM OKTOBER 2012
INDIEN, IM OKTOBER 2012
LONAR, INDIEN, IM NOVEMBER 2012
BERLIN, IM DEZEMBER 2012
BERLIN, SONNABEND, DEN 18. MAI 2013
BERLIN, IM OKTOBER 2013
WYOMING, NORTH LARAMIE RIVER RANCH. IM SOMMER 2098
BERLIN, IM JANUAR 2010
Eine bleigraue, unfreundliche Luftglocke hatte sich über Berlin gesenkt, wie ein Raumschiff, und bedeckte die Straßen, Plätze und Parks. Ihre winterliche Herkunft ließ einen eisigen, mineralischen Hauch spüren, der über Zunge und Gaumen in die Lunge strömte und sich dort ungesund verteilte.
Der Dauerfrost hielt schon über Wochen an und ließ sich durch die magere Morgensonne nur wenig mildern. Ihr kleiner Anflug von Wärme bewirkte, dass die Kälte über die Fassaden der Häuser hinabfiel und sich kriechend über den frosttoten Boden hermachte, der wegen der Salzüberschüttungen bereits resigniert hatte. Das ständige Auftauen und Wiedergefrieren hatte ihn zermürbt und so kam es dazu, dass er neben eisglatten Rutschbahnen, die sich am Mittag glänzend spiegelten, hartgefrorene Placken bildete, die sich so verfestigten, dass sie nur mühsam mit Eishacken zu beseitigen waren. Der Berliner Senat hatte es längst aufgegeben, die öffentlichen Wege und Straßen von den Ausscheidungen dieses Winters freizuhalten und begnügte sich damit, sie mit Asche und Sand zu überdecken, um die Bewegungen der Menschen und Fahrzeuge darauf zu ermöglichen, so folgenlos, wie es eben ging.
Sie stand jetzt vor dem Fenster ihres Schlafzimmers, das sie seit zwei Jahren mit ihrem Freund Paul teilte, unausgeschlafen und halb angezogen, und schaute auf die Zehlendorfer Matterhornstraße, die sich vom Mexikoplatz bis hin zum Südufer des Schlachtensees schlängelt. Sie genoss die heimelige Wärme der gusseisernen Heizkörper, die für die Behaglichkeit in den Räumen dieser alten kleinen Villa sorgten und empfand gleichzeitig die von dem Fenster ausgehende glitzernde Kälte als unangenehm beißend. Offensichtlich hatten die Erbauer des Hauses Geld sparen wollen, indem sie bei dessen Planung nur für die Wohnräume Doppelfenster vorgesehen und bei den Schlafräumen darauf verzichtet hatten.
Auf der Straße war nicht viel los. Ein paar vorsichtige Autos kamen vorbei und eine einzelne, dick eingekleidete Person schob missmutig ein rollendes Gefährt vor sich hin, hoch bestapelt mit Packen von Zeitungen. An jeder Haustür warf sie eine Zeitung in den Briefkasten, wahrscheinlich eines dieser Werbeprodukte, die kaum gelesen, doch meist umgehend entsorgt werden.
Der Nachbar von gegenüber kam fröhlich pfeifend aus der Tür und bemühte sich, mit einem Spaten die Eisplacken vor seiner Haustür zu beseitigen. Wenn es ihm gelang, gab es ein knackendes Geräusch und der Eisplacken flog zur Seite und verschwand unter den winterschlafstarren Sträuchern an seinem Grundstückszaun.
Jessica Andert überlegte, was sie anziehen solle. Sie entschied sich für eine schwarze Wollhose von Bogner und einen pinkfarbenen Kaschmirpullover. Normalerweise ging sie nicht ohne hochhackige Schuhe aus dem Haus, doch Wetter und Eisglätte verlangten eine andere Wahl. Also nahm sie aus ihrem Schuhschrank ein paar neue, schwarzglänzende Halbschuhe heraus, die in ihrem vorderen Anteil mit durchbrochenen, schwarzen Lederapplikationen versehen waren. Sie hatte sie vor einer Woche in einem Geschäft am Kurfürstendamm gekauft.
Es war der dritte Sonnabend im Monat, der Tag, an dem sie sich regelmäßig mit ihrer Freundin Isabell im Café Einstein in der Kurfürstenstraße zum Frühstück traf. Jessica, jetzt wach geworden und munter, lief über die breite Treppe der Villa nach unten, warf sich einen warmen, dunklen Wollmantel über, schloss ab und ging zu ihrem Auto. Der VW Golf eierte etwas beim Start, sprang dann aber an und sandte eine milchige Wolke aus dem Auspuff. Sie überlegte, welchen Weg sie in die Innenstadt nehmen wolle und entschied sich, über den Hohenzollerndamm zu fahren.
Die Kurfürstenstraße war um diese Zeit noch wenig belebt und es gelang ihr, in der Nähe ihres Treffpunktes einen Parkplatz zu finden. Doch das Café Einstein, in den Räumen einer alten repräsentativen Villa angesiedelt, hatte nur wenige Tische frei; lebhaftes Stimmengewirr drang in ihre Ohren.
Sie schaute sich kurz um und erblickte Isabell Wolter, die an einem Zweiertisch saß und ihr zuwinkte. Sie ging zu ihr hin und setzte sich.
„Hab mich etwas verspätet“, entschuldigte Jessica. Isabell machte eine wegwerfende Handbewegung.
„Nicht schlimm, ich bin selbst gerade gekommen. Es ist immer noch elend kalt und ich bin bis hierhin fast gelaufen, nachdem ich das Auto abgestellt hatte.“ Sie zog die Schultern zusammen, um ihr Frösteln anzudeuten.
Isabell war eine schlanke, hübsche Frau, etwas größer als Jessica. Sie hatte ihre Haare dunkelrot gefärbt und zusammengebunden; über ihrer Jeans trug sie einen dicken, weißen Rollkragenpullover. Jessica wirkte etwas gedrungener und verfügte ebenfalls über eine ansprechende Figur, deren Formen sie durch ihre Kleidung mehr betonte als Isabell. Ihre dunkelbraunen Haare, sorgfältig gekämmt, fielen ihr lang über die Schultern.
Eine Serviererin kam. Isabell bestellte ein gemischtes Frühstück und Jessica zwei weichgekochte Eier im Glas und ein Croissant mit Butter und Orangenmarmelade, dazu schwarzen Filterkaffee für beide.
Die Frauen kannten sich seit ihrer Studienzeit an der Hochschule der Künste. Sie hatten beide Medienwissenschaften und Kulturjournalistik studiert. Über Jahre wohnten sie zusammen in einer Wilmersdorfer Altbauwohnung. Es war eine ereignisreiche Zeit gewesen, die sie eng zusammenschweißte. Isabell arbeitete jetzt bei rbb, dem Sender Berlin Brandenburg und Jessica hatte eine Stelle bei einem Kreuzberger Verlag angetreten, der auf Fachzeitschriften und Sachbücher spezialisiert war. Weil sie jetzt weit auseinander wohnten – Isabell lebte in Prenzlauer Berg und Jessica bei ihrem Freund Paul Voigt in Zehlendorf – trafen sie sich im „Einstein“, das ungefähr in der Mitte lag.
Isabell erzählte von ihrer Arbeit beim Sender, die sie zwar fordere, aber auch sehr viel Spaß mache, denn man betraue sie im Moment mit vielen unterschiedlichen Aufgaben; es solle sich wohl herausstellen, für welchen Arbeitsplatz sie auf die Dauer am besten geeignet sei.
„Bei uns geht es etwas weniger aufregend zu“, sagte Jessica. „Ich bin beim Lektorat beschäftigt. Doch wir haben ein super Arbeitsklima in unserem Betrieb und treffen uns auch oft nach der Arbeit privat.“
„Privat, das ist das Stichwort. Wie geht es Paul und eurer Beziehung?“ In diesem Moment kam das Frühstück. Jessica zog die Stirn kraus.
„Erst mal essen, dann kommt der Bericht.“ Sie griff zum Löffel. Die Frauen aßen schweigend. Als Isabell zwischendurch einmal prüfend ihre Freundin anschaute, legte Jessica das Besteck zur Seite und reagierte darauf.
„Es ist kompliziert mit Paul, wie immer. Der Mann führt ein ausgeprägtes Eigenleben und lässt sich ungern durchschauen. Das muss daran liegen, dass er als Einzelkind aufgewachsen ist. Außerdem möchte er oft allein sein, manchmal auch über Nacht. Ich kann ihm daraus keinen Vorwurf machen, denn als ich zu ihm gezogen bin, hat er mir klar gesagt, dass er das brauche.“
„Er geht also fremd?“
„Nein, wahrscheinlich nicht. Ihm gehört immer noch diese Wohnung seines Onkels über dem Laden und er übernachtet dann dort. Ich habe ihn einige Male heimlich kontrolliert. Er war jedes Mal allein.“
„Wozu braucht er das?“
„Keine Ahnung. Ich habe ihn mal gefragt, er sagte, er könne nicht 365 Tage im Jahr über 15 Stunden Menschen um sich haben, schon gar nicht dieselben, also auch mich nicht.“
„Und wie läuft es mit eurem … Sex?“
„Objektiv gibt es nichts zu klagen. Paul ist phantasievoll, zärtlich und ausdauernd. Und doch ist sein Sex von einer eigenartigen Beiläufigkeit. Am Anfang habe ich das seiner Erfahrenheit gutgeschrieben, die wollte ich ja. Du weißt, dass ich ihn schon als Kind kennengelernt habe. Die Voigts und meine Eltern sind befreundet, denn Pauls Vater war Geschäftsführer einer Fabrik, die irgendwas Elektrisches machte und mein Vater ist Industriekaufmann, wie du weißt. Aus den geschäftlichen Bindungen wurden private Bindungen und so kam es, dass Paul in meinem Elternhaus am Stölpchensee ein und aus ging. Als ich so um die sechzehn Jahre alt war, war ich total in Paul verschossen, eine pubertäre Leidenschaft, die wohl bis heute angehalten hat. Paul ist zwar zehn Jahre älter als ich, ich mochte das und es hat mich nie gestört. Er sieht gut aus mit seinem großen und muskulösen Körper, ist gelassen, hat gute Umgangsformen – der perfekte Mann, so schien es mir. Er war eben ganz anders als die Jungs in der Schule, eher etwas konservativ mit seinem kurzen Haarschnitt und seiner dezenten und trotzdem edlen Kleidung, das mag ich. Außerdem hatte er schon Erfahrung mit Frauen, auch das mag ich. Wenn er bei uns zu Hause auftauchte, fing mein Herz an zu klopfen und wenn ich allein in meinem Bett lag, kamen mir wilde Fantasien - na ja, manchmal bin ich sogar ein bisschen feucht geworden. Zu meinem Leidwesen hat er sich damals nie um mich gekümmert. Dabei bin ich überzeugt, dass er gemerkt haben musste, dass ich auf ihn stand. Um so etwas zu übersehen, ist er viel zu erfahren. Die Wende kam erst viel später, kurz vor dem Ende meines Studiums und nachdem ich selbst ein paar Beziehungen hatte, wem sage ich das jetzt? Ich ging mit ihm aus und er sprang an. Den Rest kennst du.“
„Dann sei doch zufrieden!“
„Nein, bin ich nicht. Was mir fehlt, ist die bedingungslose Nähe, die ich mit ihm haben möchte, wir sind weder ineinander verschlungen noch miteinander verzahnt, wenn du verstehst, was ich meine. Wir sind eher zwei einzelne Individuen, die miteinander leben und miteinander schlafen, dies durchaus alles in Harmonie wegen Pauls Erfahrung und Einfühlungsvermögen. Und manchmal denke ich, er hat die Stute erst so spät genommen, weil er wollte, dass sie eingeritten war.“
Jessica stach wütend in die Eier im Glas, ein Eigelbspritzer landete auf ihrem Kaschmirpullover.
„So eine Scheiße! Der Pullover ist im Eimer. Will hoffen, dass die Reinigung ihn wieder hinkriegt.“
In diesem Moment musste Isabell sich bremsen, um das leise Lächeln, mit dem sie Jessicas Ausführungen begleitet hatte, nicht zum Lachanfall werden zu lassen. Jessica merkte es.
„Fang nicht an, zu spotten! Erzähl mir lieber, wie es bei dir aussieht!“
„Na, Jessica, ich hätte jetzt nicht gelacht, um dich auszulachen. Ich finde, eure Beziehung ist mehr als spannend und so eine Beziehung würde ich selbst gern haben. Ich hab mich in der letzten Zeit ein bisschen ausprobiert und musste feststellen, dass nichts Passendes dabei war. Um ein Haar hätte ich mich in einen Kollegen verliebt, schöne Vorstellung, doch getrübt dadurch, dass der Mann verheiratet ist. Dem kurzen Glück wäre ein Rattenschwanz von Problemen gefolgt, ich habe es abgebrochen.“
Die Frauen wechselten das Thema und unterhielten sich über andere Dinge, Mode, Berliner Ereignisse und ihr Vorhaben, demnächst zusammen auszugehen. Eine halbe Stunde später standen sie auf und verließen das Einstein.
Die eisige Winterluft überfiel sie wie ein Schock. Weil ihre Autos nicht weit voneinander entfernt standen, konnten sie noch eine Weile zusammen die Kurfürstenstraße entlang gehen. Auf der anderen Straßenseite erblickten sie mehrere junge Mädchen, die am Straßenrand standen. Die Mädchen trugen kurze Röcke und weiße oder rosafarbene Strumpfhosen und hielten Handtaschen in den Händen. Obwohl sie oben herum dick angezogen waren, bibberten sie vor Kälte.
„Das ist der Babystrich“, sagte Jessica, „die armen Würmer. Die machen das nicht freiwillig, sondern sind drogensüchtig oder wurden von anderen geschickt. Ich verstehe nicht, dass sich keine Behörde um sie kümmert.“
„Kümmern schon“, bemerkte Isabell. „Unser Sender hat mal einen Bericht über sie gedreht. Die Mädchen werden eben von den Behörden verwaltet. Und es ist wie immer bei den Behörden: wenn sie etwas verwalten, glauben sie, das Problem wäre gelöst.“
Sie erreichten das Auto von Jessica. Isabell ging langsam weiter und rief: „Bis in vier Wochen.“ Jessica hielt einen Moment inne.
„Wenn du möchtest, könnten wir uns am nächsten Sonntag bei mir in Zehlendorf treffen. Paul fährt an diesem Tag zu einem Kunden, um ihm die gesamte Zinnfigurensammlung abzukaufen und kommt erst am Montag wieder. Du kannst also auch bei mir übernachten.“ Isabell überlegte.
„Würde gehen, ich habe an dem Tag nichts vor. Also bis nächsten Sonntag. Wir hören vorher noch voneinander.“ Sie verabschiedeten sich.
Paul Voigt bog mit seinem Mercedes bei Hessisch Oldendorf in Richtung Bückeburg nach Steinbergen ab, seinem Ziel. Die morgendliche Glätte hatte bei Bad Eilsen zu einem Verkehrsunfall mit Stau auf der Autobahn geführt, so dass er sie eine Abfahrt vorher verließ. Es folgte ein Anstieg, da die Bundesstraße nun das Wesergebirge überquerte und nach kurzer Zeit kam Steinbergen in Sicht, das sich am bergigen Hang entlang zog. Unübersehbar, wie eine Wächterin, ragte die große neugotische Kirche aus roten Ziegeln am Ortseingang in die graue Winterluft. Der Ort selbst strahlte einen etwas verblichenen Charme aus. Beiderseits der Straße wurden Geschäfte, eine Autowerkstatt und locker verstreut villenartige Gebäude sichtbar, manche nicht bewohnt. Sie stammten offensichtlich aus den zwanziger und dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts. Es schien sich um ehemalige Pensionen und Hotels zu handeln.
Den Gasthof, in dem er sich einquartieren wollte, fand er auf der linken Seite. Er steuerte ihn an und ließ sich vom Wirt den Zimmerschlüssel aushändigen; das wenige Gepäck, das er mitgenommen hatte, trug er eine Treppe hinauf in sein Zimmer. Eiskalte Luft schlug ihm entgegen. Als erstes drehte Paul die Heizkörper voll auf; sie gaben ein knisterndes Geräusch von sich. Dann schaute er sich das Zimmer an. Es war ein Doppelzimmer von normaler Größe. Die Einrichtung, Bett, Schrank, Tisch und zwei Stühle aus einfachen dunklen Möbeln, schien in die Jahre gekommen zu sein und wirkte etwas abgegriffen. Paul hob die Bettdecken an, sie waren schwer von Feuchtigkeit. Gegenüber vom Bett stand auf einem Hocker ein kleiner Fernseher, an der Wand hing das Foto einer Alpenlandschaft, ein billiger Druck. Sonst befand sich außer einem Papierkorb nichts im Zimmer. Das Bad war klein, aber in Ordnung. Paul beschloss, zufrieden zu sein und verließ den Gasthof.
Anlass der Reise war es, einem Kunden, den er nur telefonisch kannte, die Zinnfiguren abzukaufen, die dieser im Laufe seines Lebens gesammelt hatte. Paul besaß einen kleinen Laden für antike Zinnfiguren und Orden in der Charlottenburger Bleibtreustraße. Ursprünglich hatte er vorgehabt, wie sein Vater in die Wirtschaft zu gehen und deswegen Betriebswirtschaft studiert, sehr aufwendig sogar, mit Aufenthalten in London und New York. Doch vor einigen Jahren war sein Onkel gestorben und hatte ihm sein gesamtes Vermögen hinterlassen, welches aus dem Haus in der Bleibtreustraße, in dem sich der Laden befand, der Villa in Zehlendorf und einer beträchtlichen Summe von Bargeld und Wertpapieren bestand. Der Onkel war nicht verheiratet und hinterließ keine Nachkommen; es gab auch keine weitere Verwandtschaft, die als Erben in Frage gekommen wären. Bei der Durchsicht der Bücher fiel ihm auf, dass der Laden einen Gewinn abwarf, den er aus einer Angestelltentätigkeit in der Wirtschaft nur in Ausnahmefällen würde erzielen können, und so übernahm er das Geschäft.
Das Geheimnis des Ladens lag in seiner Spezialisierung. Er lebte weniger von der Laufkundschaft als vielmehr von Handelsgeschäften in alle Welt und war bei Sammlern weit über die Landesgrenzen bekannt, da es weltweit nur wenige gab, die professionell mit alten Zinnfiguren und Orden handelten. Zinnfiguren gab es schon als Spielzeug in der Römerzeit, zwar nur wenige, die in den Museen gehütet wurden, doch dann wieder seit dem Spätmittelalter in ganz Europa, ebenso wie Orden. Darunter befanden sich Exemplare aus den Königs- und Fürstenhäusern von enormem Sammlerwert. Es gehörte zu der Grundvoraussetzung dieses Geschäftes, dass man sich in dem Metier perfekt auskennen musste; dazu hatte ihm der Onkel verholfen, der wusste, dass Paul ihn einmal beerben würde. Vieles hatte ihm auch Richard Wendler beigebracht, Roberts langjähriger Angestellter, den Paul übernommen hatte und der ihn vertrat, auch bei längeren Reisen, denn er konnte Paul in voller Weise ersetzen. Das war noch ein weiterer Vorteil und Grund, den Handel des Onkels zu übernehmen und weiterzuführen.
Der Kunde aus Steinbergen, ein ehemaliger evangelischer Pastor, hatte ihn vor einer Woche angerufen und ihm seine Sammlung angeboten; er wolle sie wegen seines hohen Alters abgeben und weil er befürchte, dass seine Kinder sie einmal in Unkenntnis ihres Wertes zu einem viel zu niedrigen Preis verkaufen würden. Nach der Beschreibung des Kunden vermutete Paul, dass sich darunter Stücke von einigem Wert befinden könnten. Auf diese Weise hatte es ihn in den wenig bekannten Ort Steinbergen verschlagen.
Der Kunde wohnte in einem Einfamilienhaus am nördlichen Ortsrand, kurz vor dem Pass über das Wesergebirge. Er klingelte an der Tür. Der Pastor öffnete und begrüßte ihn.
„Herzlich willkommen! Sie sind fast zu spät gekommen, in einer Viertelstunde gibt es Mittagessen. Sie sollen mit uns essen und bevor wir uns meine Zinnfiguren anschauen, machen wir noch einen kurzen Spaziergang, auf dem ich Ihnen einiges erklären möchte, was mit den Zinnfiguren zusammenhängt.“ Er schaute auf den Himmel. „Es sieht so aus, als wenn wir Glück haben könnten und die Sonne durchkommt.“
„Vielen Dank für die Einladung. Wenn ich ehrlich bin, muss ich gestehen, es ist mir sehr recht, denn langsam werde ich hungrig. Die Fahrt von Berlin durch den Winter hat viel länger gedauert, als ich erwartet habe.“ Sie traten ein.
Paul begrüßte die Frau des Pastors und kurze Zeit später saßen sie am Mittagstisch. Nach dem Essen zogen sie sich warm an und verließen das Haus.
Die Hoffnung des Pastors hatte sich erfüllt, die dichte Bewölkung war gewichen und Sonnenstrahlen blitzten hervor. Sie nahmen einen Weg am Wald entlang nach Norden; der Pastor bemerkte, es sei nur eine kurze Steigung, die sie zu überwinden hätten. Es war seit einer Woche etwas wärmer geworden und so glänzten die von Eis ummantelten Zweige der Buchen und Büsche in der Sonne, manchmal fiel auch ein Tropfen herunter. Zur Rechten lag das Gras der Wiesen noch geknickt am Boden, doch der Raureif löste sich langsam auf. Sie erreichten den Pass.
Weit lag die Landschaft um Bückeburg vor ihnen. Am Bergrand zog sich das Band der Autobahn entlang. Im Hintergrund erhoben sich die Bückeberge. Der Pastor machte Halt.
„Sehen Sie die beiden Bauwerke vor uns? Das rechte Bauwerk heißt Jahrtausendblick und wurde im Jahr 2000 gebaut. Es ist eine Art Rampe, ein Aussichtspunkt. Es soll eine Schnittstelle zwischen Vergangenheit und Zukunft verkörpern. Man hat es anlässlich der Weltausstellung in Hannover errichtet. Der Name passt gut, denn die Arensburg auf der linken Seite ist uralt, sie stammt aus dem frühen vierzehnten Jahrhundert. Auch der Ort Steinbergen ist eine Schnittstelle. Denn hier stoßen zwei kleine alte Länder zusammen: südlich die Grafschaft Schaumburg und nördlich die Grafschaft Schaumburg-Lippe, das spätere Fürstentum. Sie entstammten einer Teilung der ursprünglichen Grafschaft Schaumburg im sechzehnten Jahrhundert.“
„Und wie kam die zustande?“
„Weil das Geschlecht der Grafen von Schaumburg ausgestorben war. Durch Erbschaft fiel der südliche Teil an den Landgraf zu Hessen-Kassel und der nördliche Teil an die Grafen zur Lippe. Was jetzt vor uns liegt, ist das ehemalige Fürstentum Schaumburg-Lippe mit der Residenzstadt Bückeburg. Steinbergen gehörte übrigens dazu, der einzige kleine Zipfel auf der südlichen Seite des Wesergebirges.“
„Und wo liegt die Schaumburg?“
„Ganz in der Nähe von Steinbergen. Doch man kann sie von hier aus nicht sehen. Lassen Sie uns noch ein wenig weiter gehen, wir wollen uns die Arensburg etwas näher anschauen.“ Wenige Minuten später blieb der Pastor wieder stehen.
„Sehen Sie die Teiche vor der Burg?“ Paul nickte.
„Das sind die Hexenteiche mit ihrer finsteren Vergangenheit. Hier wurde mit angeblichen Hexen die Wasserprobe vorgenommen. Man fesselte sie und warf sie hinein. Gingen sie unter, konnten sie freikommen, schwammen sie oben, wurde ihnen der Hexenprozess gemacht.“
„Hexenprozess? Ich denke, hier in der Gegend ist man protestantisch?“ Der Pastor drehte sich zu Paul und lächelte.
„Es ist weitverbreitete Meinung, dass es nur bei den Katholiken Hexenverfolgungen gab. Dabei kamen sie bei den Protestanten genauso häufig vor. Selbst Luther glaubte an Hexen; während er den Reliquienaberglauben ablehnte, legte er den Hexenaberglauben nicht ab. Er war eben ein Kind seiner Zeit. Hier in der Gegend gab es in Rinteln einmal eine Universität mit juristischer Fakultät, die sich unrühmlich dadurch bekannt machte, dass sie Hexenprozesse unterstützte. Es war ausgerechnet ein Katholik, der Jesuitenprofessor Friedrich Spee, der im siebzehnten Jahrhundert ein Buch gegen den Hexenaberglauben geschrieben hat. Dass es in Rinteln gedruckt wurde und erschienen ist, wird seine volle Absicht gewesen sein. Doch es hat seine Gründe, warum ich Ihnen dies alles zeige. Ich habe die Pastorenstelle in Steinbergen lange ausgeübt und mich viel mit der Heimatgeschichte des Ortes beschäftigt. Zu diesem Thema habe ich viele meiner Zinnfiguren gesammelt, die Sie gleich sehen werden. Die Figuren sind für mich wie ein Fenster in die Vergangenheit.“
Sie gingen zurück, nur wenig miteinander sprechend. Paul merkte, dass der Pastor seinen eigenen Gedanken nachging.
Im Haus des Pastors angekommen. machte sich dieser daran, verschiedene Kartons zu holen, um dem Gast seine Zinnfiguren zu präsentieren. Zum Schluss breitete er ein Tuch aus, das er selbst bemalt hatte. Auf dem Tuch war eine blaue Fläche zu sehen, das Steinhuder Meer und eine Insel, die Festung Wilhelmstein.
„Die Festung Wilhelmstein ist ein Kuriosum, Herr Voigt. Graf Wilhelm zu Schaumburg Lippe hatte sie im Jahr 1767 errichtet, weil er Angst um sein kleines Land mit nur 17 000 Einwohnern hatte. Die Angst war berechtigt, war doch die Grafschaft von mächtigen Nachbarn, den Hannoveraner Welfen, Preußen und den hessischen Landgrafen umgeben. Aus diesem Grund hatte er das Land mit einem hervorragend ausgebildeten Militär, fast an die tausend Soldaten, ausgestattet. Dessen berühmtester Fachmann war der General Gerhard von Scharnhorst, der später in preußische Dienste trat. Wilhelmstein sollte ein Rückzugsort sein, ein Refugium wie die Atombunker bei uns aus den siebziger und achtziger Jahren, deren Bau gefördert wurde. Die Kanonenkugeln der Gegner konnten die Festung auch deswegen nicht erreichen, weil es kaum möglich war, die Geschütze am sumpfigen Ufer des Sees aufzubauen. Und diesen Zweck hat sie wirklich einmal erreicht, als der Landgraf von Hessen-Kassel zwanzig Jahre später mit seinen Soldaten das kleine Land nach einem Erbschaftstreit überfiel.“
„Und wie ging das Ganze aus?“
„Die Hessen konnten tatsächlich die Festung nicht einnehmen. Doch letztlich mussten sie weichen, weil die Hannoveraner und Preußen den Schaumburgern zur Hilfe kamen. Doch die Politik des Zwerges aus dem Weserbergland zahlte sich aus. Schaumburg–Lippe wurde später zum Fürstentum erhoben und blieb bis 1946 Freistaat im Deutschen Reich. Die Mitglieder seines Adelsgeschlechtes zählen bis heute zum europäischen Hochadel. Doch jetzt lassen Sie uns zu den Zinnfiguren kommen.“
Der Pastor packte zwei Kartons aus und stellte die Figuren auf das Tuch. Es handelte sich um Soldaten aus dem achtzehnten Jahrhundert. Ein Teil ihrer Uniformen war mit den Farben Dunkelblau und Weiß bemalt, den Farben der Uniform von Schaumburg Lippe. Er stellte sie auf die Fläche des Tuches, das die Festung Wilhelmstein darstellte. Ein paar der Figuren trugen schwarze Uniformen, er stellte sie dazu und bemerkte:
„Die gehören zu den „Schwarzen Teufeln von Bückeburg“, wie sie von den Feinden wegen ihrer Kampfkraft und Tapferkeit genannt wurden, dem sogenannten Karabinierkorps.“
Den Rest der Figuren verteilte er um die blaue Fläche, die das Steinhuder Meer darstellen sollte. Hier handelte es sich um die Soldaten von Hessen-Kassel; sie trugen ähnliche Uniformen wie die Schaumburger, nur dass die Uniformen auch Gelb und manchmal rote Applikationen zeigten.
„Und woher haben Sie die Sammlung?“
„Ich habe sie einem Sammler aus Bückeburg abgekauft. Ich nehme aber an, dass sie ursprünglich aus fürstlichem Besitz stammt. Und jetzt habe ich noch etwas Besonderes für Sie.“
Er holte einen weiteren Karton herbei. Es handelte sich um Szenen aus der Hexenverfolgung: bunt bemalte Hexen, Richter in roten Roben, einen Priester im schwarzen Talar mit Kreuz, einen großen Henker mit Richtschwert, zwei seiner Gehilfen mit Folterinstrumenten und schließlich die größte Figur, eine Hexe auf einem Scheiterhaufen. Dazu stellte er Figuren, die Schaulustige darstellen sollten: Bauern, Handwerker und Marktfrauen in historischen Gewändern.
„Aus welcher Zeit könnten die Figuren stammen, Herr Voigt?“
„Ich nehme an, aus der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, aus der Zeit des Biedermeier und der Romantik. Nachdem die Gebrüder Grimm ihre Märchensammlung herausgegeben hatten, wurden auch viele Märchenfiguren in Zinn gegossen. Aber derartige Figuren habe ich noch nie gesehen.“
Der Pastor packte noch eine weitere Reihe von Kartons aus. Sie enthielten außer soldatischen Motivfiguren Darstellungen von Menschen verschiedener Stände, prächtig bemalte Figuren der Fürsten- und Königshäuser wie perückentragende Damen und Kavaliere, Bürger in ihren Feiertagsanzügen, spielende Kinder, bäuerliche Gestalten wie Mägde, Knechte, Bauersfrauen und schließlich Haus- und Wildtiere.
„Die Figuren habe ich oft hervorgeholt und aufgestellt, wenn mir danach war“, bemerkte der Pastor. „Die ältesten stammen aus dem sechzehnten Jahrhundert. Sie sind wie ein Spiegelbild ihrer Zeit. Ich konnte lange nachsinnen und in die Vergangenheit blicken, wenn ich sie betrachtete.“
Es war eine umfangreiche und anspruchsvolle Sammlung. Nach dem Tee machte Paul ein Angebot von siebentausend Euro. Der Pastor war angenehm überrascht.
„So viel? Ich hatte höchstens mit fünftausend Euro gerechnet!“
Das Geschäft kam zustande. Paul packte die Kartons in das Auto, verabschiedete sich von dem Pastorenehepaar und fuhr zum Gasthof. Mittlerweile überzog Dunkelheit den Ort und brachte kriechende Kälte mit sich.
Die Gaststube war nur mäßig besucht und daher spärlich beleuchtet. In einer Ecke saßen skatspielende Biertrinker, wohl Einwohner, und an zwei weiteren Tischen je zwei Männer in Anzügen, die aßen und dabei lebhaft diskutierten. Paul hielt sie für Vertreter. Es roch nach kaltem Rauch und säuerlichem Bier. Die Serviererin kam, eine verblühte Blondine, jedoch sehr freundlich. Er hatte keinen großen Hunger und bestellte zwei Spiegeleier und einen Salat, dazu eine Flasche Rotwein. Nach dem Essen verschwand er auf sein Zimmer und nahm die angefangene Flasche mit.
Feuchte Wärme schlug ihm entgegen. Die Heizung hatte wohl einen Teil der Feuchtigkeit aus den Betten getrieben und in die Raumluft befördert. Paul öffnete das Fenster einen Spalt, zog sich aus, stellte den Fernseher an und kroch unter eine der Bettdecken. Die Flasche mit dem Rotwein und ein Zahnputzglas hatte er auf den Nachttisch gestellt. Er zog seine Bettdecke noch höher und schaute sich die Nachrichten an. Danach gab es einen Krimi, er interessierte ihn nicht. Stattdessen füllte Paul sein Glas und trank es in einem Zug halb aus. Langsam wurde es unter der Bettdecke warm. Er schaltete den Fernseher aus, legte sich auf die Seite, machte die Augen zu und stützte seinen Kopf in die Hand. Dunkelheit und Wärme beflügelten seine Gedanken. Er dachte an Jessica. Seine Freundin und Geliebte kannte er seit ihrer Geburt, das empfand er als gleichermaßen rührend und verstörend.
Pauls Vater Manfred Voigt stammte aus Baden-Württemberg und war Ende der fünfziger Jahre nach Berlin gezogen. Mit Partnern gründete er eine Fabrik für elektrische und feinmechanische Bauteile, die meistens an Firmen der Unterhaltungselektronik oder des Maschinenbaues geliefert wurden. Es war eine Nische, weil die ursprünglich in Berlin heimische Großindustrie wegen der Abschnürung des Hinterlandes immer mehr schrumpfte. Zudem bekamen derartige Firmen Subventionen vom Bund, sonst wären sie nicht lebensfähig gewesen. Sein Vater war Geschäftsführer der Firma, die sich als außerordentlich erfolgreich erwies. Daran hatte Jessicas Vater Gerhard Andert als Industriekaufmann großen Anteil, weil er ihr die Kunden vermittelte. Beide, Voigt und Andert, kamen schnell zu Wohlstand und erwarben Villen in Berlin Wannsee, Andert sogar in der ersten Reihe am Stölpchensee.
1974 kam Paul zur Welt, als einziges Kind der Familie Voigt. Mit den beiden Söhnen der Familie Andert wuchs er zusammen auf. Die Familien waren befreundet und trafen sich oft privat; Paul brauchte nur vom Elternhaus eine Straße weiterzugehen, um die Söhne der Familie Andert zu treffen. Ihren Vater Gerhard Andert redete er meist mit „Onkel Gerhard“ an.
Jessica wurde im Mai 1984 geboren. Paul erinnerte sich noch gut daran, wie sie in ihrem Babybett lag, lächelnd und mit roten Bäckchen. Sie war ein kräftiges, gesundes Kind und als sie heranwuchs, sah sie Paul ebenso als großen Bruder an wie ihre eigenen Brüder. Als einziges Mädchen beider Familien wurde sie maßlos verwöhnt, auch von Pauls Eltern. Als Jessica acht Jahre alt war, zog Paul aus und begann zu studieren, zunächst in Westdeutschland, dann im Ausland. Nach dem Studium verlängerte er seinen Aufenthalt in London und kam schließlich zurück nach Berlin. Kurz zuvor war seine Mutter verstorben und sein Vater hatte Schwierigkeiten damit, die Firma zu halten. Weil die Subventionen seit der Wiedervereinigung weggefallen waren, wurden ihre Erzeugnisse zu teuer und so hatten die Eigner, zu denen auch er gehörte, die Firma an einen chinesischen Konzern verkauft. Den Chinesen ging es nur um die Patente, die Firma selbst lösten sie langsam auf. Manfred Voigt verlor seine Anstellung als Geschäftsführer. Er verkaufte anschließend das Haus der Familie in Wannsee und erwarb mit dem Verkaufserlös und seinem Gewinn aus dem Firmenverkauf eine Villa am Bodensee, in der er seinen Lebensabend beschließen wollte. In diese Zeit fiel auch Pauls Entschluss, das Geschäft seines Onkels zu übernehmen, in das er etwas später eintrat.
Jessica war inzwischen zu einem bildhübschen jungen Mädchen herangewachsen, mit langen, dunkelbraunen Haaren und ansehnlichen Rundungen, die ein Rest von Teenagerspeck noch betonte. Auch Paul hatte sich verändert, seine ehemalige Jungenhaftigkeit war kerniger Männlichkeit gewichen. Jessica hatte ihn lange nicht gesehen. Als sie ihn zur Begrüßung umarmte und seinen Körper und sein Gesicht spürte, verweilte sie ein wenig. Er nahm es nicht sofort wahr, doch als er sich später einmal daran erinnerte, ahnte er, dass sie sich damals auf der Stelle in ihn verliebt haben musste. In dieser Zeit war er häufig bei den Anderts zu Gast, denn nach dem Verkauf seines Elternhauses bewohnte er nur ein einzelnes Zimmer in der Matterhornstraße im Haus seines Onkels, der meist nicht zuhause war und so gut wie keinen Haushalt führte. Es wurde immer offensichtlicher, dass Jessica ihn begehrte; sie blieb ständig in seiner Nähe und sandte Signale aus, bewusste und unbewusste. So ließ sie die Tür zum Umkleideraum am Pool der Anderts scheinbar nachlässig auf, während sie sich vor und nach dem gemeinsamen Baden umzog. Wenn sie allein im Haus ihrer Eltern zusammen waren und er sie aus den Augenwinkeln beobachtete, fing er manchmal einen sehnsüchtigen Blick auf.
Die Anderts feierten viel und gerne, auch aus Geschäftsgründen. Paul war fast immer eingeladen und erschien mit wechselnden Begleiterinnen. Jessica glühte jedes Mal vor Eifersucht.
Natürlich kamen ihre Signale an. Normalerweise hätten sie ihre Wirkung gezeigt, denn auch er fand sie attraktiv. Doch sie war zum einen die Tochter seines väterlichen Bekannten und zum anderen noch nicht einmal volljährig. Paul stellte sich die Komplikationen vor, die auf ihn zugekommen wären, für den Fall, sie wären miteinander ins Bett gegangen. Gerhard Andert hätte sein Verhalten vielleicht als Vertrauensbruch gewertet und ihm möglicherweise sogar das Haus verboten. Außerdem hatte er keine Lust dazu gehabt, ihr erster Liebhaber zu sein, das kam ihm irgendwie zu kitschig vor, wie eine Art Sissy-Romantik. Somit blieb sein Verhältnis zu Jessica vorerst platonisch, zu ihrem wütenden Bedauern, wie es ihm schien.
Vor etwa drei Jahren kam dann die Wende. Jessica war inzwischen von zuhause ausgezogen und wohnte mit ihrer Freundin Isabell zusammen, mit der sie gemeinsam studierte. Sie hatte ihn eingeladen, zu einer ihrer Geburtstagsfeiern, die sie im Haus ihrer Eltern am Stölpchensee organisiert hatte. Paul kannte solche Feiern und mochte sie nicht, denn sie waren laut und alkoholisiert; die Gäste bestanden meist aus Jessicas Freundinnen und Freunden aus ihrer Teenagerzeit und deren Anhang. Pauls Begleiterin Susanne hatte die Feier vorzeitig verlassen, weil sie am nächsten Tag einen Termin hatte, Paul blieb bis zum Schluss. Als alle Gäste gegangen waren, rückte Jessica an ihn heran und klagte ihm ihr Leid. Ihr derzeitiger Freund Jens verstehe sie nicht, schaue anderen Frauen hinterher und sei auch heute Abend schon früh gegangen, wer weiß, wohin. Natürlich hatte sie für diesen Abend ein besonders kurzes Kleid mit sündigem Ausschnitt ausgesucht, dessen Saum nach oben rutschte, während sie neben ihm saß. Sie hatte wohl damals wirklich geplant, ihn mit einer der ältesten Maschen liebeshungriger Frauen zu verführen, ganz gut eigentlich, denn so wusste er, wo er dran war.
Nachdem damals bei ihr ein paar Krokodilstränen geflossen waren, stand er auf, rief eine Taxe und ließ sich nach Hause fahren. Beim Abschied verabredete er sich mit Jessica zu einem gemeinsamen Besuch der neuen Revue vom Friedrichstadtpalast, denn aus Erfahrung wusste er, dass eine perfekte Inszenierung sich positiv darauf auswirkt, den Liebesgenuss zu steigern.
Es entwickelte sich alles so, wie er es sich gedacht hatte. Nach Theater- und Restaurantbesuch zögerte Jessica keinen Moment, Pauls Auto zu verlassen, als er vor seiner Haustür die obligatorische Frage nach dem letzten Drink stellte. Zum Rotwein kam es dann nicht, weil sich Jessica kurz nach dem Betreten von Pauls Wohnung auf die Zehenspitzen stellte und seinen Mund suchte.
Hinterher, im Bett, waren Paul Dinge zuhauf durch den Kopf gegangen. Jessicas Körper zu spüren, war eine neue Aufregung gewesen, berauschend und sinnlich, obwohl er ihren Körper schon lange kannte, seine ganze Entwicklung, während sie aufwuchs und sich entwickelte. Jessica war unter ihm blitzschnell zum Höhepunkt gekommen, wie er es vorher in dieser Form selten erlebt hatte. Sie hatte sich wahrscheinlich niemals von ihrer Teenagerschwärmerei für ihn gelöst, sodass der Verkehr mit ihm zum Ventil wurde, aus dem es nach allen Seiten strömte.
Eine Zeitlang lebten sie gleichermaßen in einem Glückszustand. Jessica sowieso und Paul, weil er das gute Gefühl hatte, im Anschluss an seine vielen Studienjahre nach Hause gekommen zu sein. Und alles, was Jessica hatte, stimmte: ihr Körper, ihr Temperament, ihre Herkunft. Das fand wahrscheinlich auch ihr Vater. Als sie zusammenzogen, war er hochglücklich, denn er meinte, in Paul einen Schwiegersohn gefunden zu haben, wie er sich ihn besser nicht hätte vorstellen können. Doch so sollte es nicht bleiben.
Eines fehlte Paul. Jessica hatte nichts Geheimnisvolles mehr für ihn, wie soll das auch gehen? Wenn man einen Menschen seit seiner Geburt kennt, kann man das auch nicht erwarten. Und zu seinen früheren Zeiten war das immer spannend gewesen, das ganze Spiel. Man interessiert sich füreinander, wirft sich Blicke zu und achtet auf Signale. Wenn sich zwei Signale treffen, schlägt man zu. Man trifft sich, durchläuft die gängigen Rituale und landet im Bett. Am Morgen wacht man auf und ist ganz gespannt darauf, welcher Mensch in dem Frauenkörper steckt, mit dem man gerade zusammen gewesen ist. Passt er nicht, trennt man sich. Passt er, bleibt man für eine Weile zusammen. Alles das würde mit Jessica nicht funktionieren. Eben die Banalität des Bekannten.
Paul, in seinem Bett in Steinbergen, drehte sich um und schlief ein.
Er schlief schlecht in dem klammen Bett. Um sechs Uhr morgens wachte er auf und zählte die Viertelstunden bis zum Frühstück. Als es an der Zeit war, stand er auf, packte zusammen und verließ später das Hotel. Die Straßen und die Autobahnen nach Berlin waren noch frei. Am Kaiserdamm erreichte er die Innenstadt, bog in Charlottenburg ab und machte einen häufig vorgenommenen Abstecher.
Charlottenburg war ihm immer etwas pariserhaft vorgekommen, mit der geschlossenen Bebauung aus der Gründerzeit und den Straßenlinden, die dem Stadtteil eine spezielle, großbürgerliche Romantik verliehen. Weil er Paris liebte, durchkreuzte er den Stadtteil gern, in dem sich auch sein Laden befand.
Bei seinen Streifzügen war er an einem Herbstabend auf eine Besonderheit gestoßen.
Es war in der Nähe des Sophie-Charlotte-Platzes, einer ruhigen, sanften Wohngegend. Zu beiden Seiten einer Straße mit geschlossener Bebauung standen ansehnliche, selbstbewusst wirkende Häuser aus der Wende zum zwanzigsten Jahrhundert. Meist waren sie mit Balkonen ausgestattet; manche hatten Balustraden und Verzierungen aus Stuck über den Fenstern und Türen. Hier schienen sich die Zerstörungen des Krieges in Grenzen gehalten zu haben und die aufwendige Renovierung der Fassaden mancher Häuser erregte Aufsehen und wies darauf hin, dass man hier wohl Mietwohnungen zu Eigentumswohnungen umgewandelt hatte.